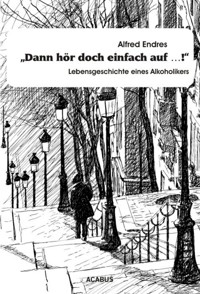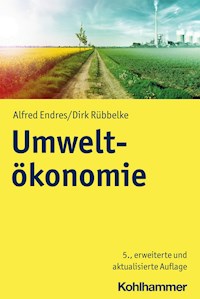
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kohlhammer Verlag
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Dieses Standardlehrbuch analysiert Umweltprobleme und Umweltpolitik aus ökonomischer Sicht: Es bietet damit nicht nur eine verständliche Darstellung der Umweltökonomie von ihren mikroökonomischen Grundlagen bis zu den neuesten Forschungsansätzen, sondern auch eine Orientierung für die aktuelle umweltpolitische Diskussion. Für die Neuauflage wurden umfangreiche Aktualisierungen, insbesondere mit Blick auf das internationale Klimaschutzabkommen von Paris und den EU-Emissionshandel vorgenommen. Die Perspektive der Ökonomie des umweltpolitischen Instrumenteneinsatzes wird durch die Einbeziehung verhaltensökonomischer Aspekte erweitert. Außerdem werden die Auswirkungen des umweltpolitischen Instrumenteneinsatzes auf den umwelttechnischen Fortschritt aus ökonomischer Sicht erörtert.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 747
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Alfred Endres/Dirk Rübbelke
Umweltökonomie
5., erweiterte und aktualisierte Auflage
Verlag W. Kohlhammer
Dieses Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwendung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechts ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und für die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Sämtliche im Buch angegebenen Onlinequellen wurden im Juli 2021 zuletzt aufgerufen.
Um die Verwendung dieses Lehrbuchs als Lehrmittel zu erleichtern, sind PowerPoint-Folien unter https://dl.kohlhammer.de/978-3-17-039458-2 verfügbar.
5., erweiterte und aktualisierte Auflage 2022
Alle Rechte vorbehalten
© W. Kohlhammer GmbH, Stuttgart
Umschlagabbildung: © Philipp Schilli – stock.adobe.com
Gesamtherstellung: W. Kohlhammer GmbH, Stuttgart
Print:
ISBN 978-3-17-039458-2
E-Book-Formate:
pdf: ISBN 978-3-17-039459-9
epub: ISBN 978-3-17-039460-5
Für den Inhalt abgedruckter oder verlinkter Websites ist ausschließlich der jeweilige Betreiber verantwortlich. Die W. Kohlhammer GmbH hat keinen Einfluss auf die verknüpften Seiten und übernimmt hierfür keinerlei Haftung.
Vorwort
In diesem Buch werden Umweltprobleme und Umweltpolitik mit den Methoden der Mikroökonomie untersucht. Dabei soll die ökonomische Struktur herausgearbeitet werden, die den vielfältigen praktischen Problemen und Problemlösungsversuchen zugrunde liegt. Besonderes Augenmerk gilt der Anreizstruktur, der die Träger umweltrelevanter Entscheidungen infolge von Marktmechanismus, staatlichen Regulierungen und internationalen Institutionen ausgesetzt sind. Um die grundsätzliche Ebene der Erörterung nicht vom Boden der Realität abheben zu lassen, werden häufig die Bezüge der wirtschaftstheoretischen Analyse zu praktischen Problemen und Lösungsansätzen hergestellt. Angesichts der großen umweltpolitischen Bedeutung und der großen Ergiebigkeit für die umweltökonomische Analyse geschieht dies besonders ausführlich bei der Behandlung des Klimaschutzabkommens von Paris und des europäischen Emissionshandels.
Das Buch versucht, neueste Entwicklungen in der wissenschaftlichen und politischen Diskussion aufzunehmen. Dennoch soll es auch für Leserinnen und Leser verständlich sein, die »lediglich« über Grundkenntnisse der Volkswirtschaftslehre verfügen, wie sie in den ersten drei Semestern eines wirtschaftswissenschaftlichen Studienganges vermittelt werden. Die Autoren nehmen nicht für sich in Anspruch, diese schwierige Kombination von Zielen erreicht zu haben. Sie ins Auge zu fassen, war jedoch bei der Arbeit stets hilfreich.
Auch »Nebenfachökonomen«, die mit dem Mut zur Lücke die für sie unverständlichen Passagen souverän überblättern, sollten insgesamt vom vorliegenden Text profitieren können. (Mögen die betreffenden Passagen nicht allzu zahl- oder umfangreich sein.) So könnte das Buch einen Beitrag zum Abbau der Sprachbarrieren zwischen den »Kernökonomen« und dem »Rest der Welt« leisten. Gerade im Umweltbereich, wo die Kommunikation zwischen unterschiedlichen Fachrichtungen unverzichtbar ist, wäre eine »Übersetzungshilfe« besonders wichtig.
Wegen der festen Verankerung der Umweltökonomie in der traditionellen Mikroökonomie werden im Ersten Teil die wirtschaftstheoretischen Grundlagen recht ausführlich behandelt. Wir haben bei unserer jahrelangen Teilnahme an der wissenschaftlichen und politischen Umweltdiskussion den Eindruck gewonnen, dass viele Kommunikationsschwierigkeiten auf die mangelnde Vermittlung des wirtschaftstheoretischen Fundaments der Umweltökonomie zurückzuführen sind. Im Zentrum des ersten Teils steht daher eine durch die Notwendigkeiten der folgenden umweltökonomischen Analyse geprägte Darstellung des Wesens und der Optimalität von Marktgleichgewichten.
Die aus ökonomischer Sicht für die Umweltprobleme kennzeichnenden externen Effekte erscheinen dabei als Störungen der Fähigkeit des Marktmechanismus, »sozial optimale« Ergebnisse hervorzubringen. Die umweltpolitische Leitidee der »Internalisierung externer Effekte« stellt den Versuch dar, die verlorene soziale Optimalität des Marktsystems wiederherzustellen. Bei der Darstellung wird besonderes Gewicht darauf gelegt, die dem in der Ökonomie verwendeten Optimalitätskonzept und damit auch dem Konzept der Internalisierung externer Effekte zugrunde liegenden Werturteile herauszuarbeiten. Dieser Teil des Buches richtet sich insbesondere an die »Nebenfachökonomen« unter den Lesern. Er könnte aber auch für »Kernökonomen« nützlich sein, die bei der fortgesetzten Beschäftigung mit modelltechnischen Details die Tatsache aus dem Blick verloren haben, dass die Ökonomie keine Ingenieur- oder Naturwissenschaft ist. Insbesondere ergibt sich, dass das in der Wirtschaftswissenschaft verwendete Optimalitätskonzept keineswegs geeignet ist, umweltpolitische Ziele jenseits des Gestrüpps divergierender Interessen in einer Gesellschaft »objektiv« zu formulieren. Die Lage volkswirtschaftlich optimaler Umweltzustände hängt vielmehr u. a. von den Präferenzen und Einkommen aller (im weitesten Sinne) vom Zustand der Umwelt Betroffenen ab. Ferner wird sie vom Stand der Technik beeinflusst. Auch dieser wird auf vielfältige Weise durch gesellschaftliche Prozesse geprägt. Optimalität ist ein sozialwissenschaftlicher Begriff.
Nach der Klärung der wirtschaftstheoretischen Grundfragen werden im Zweiten Teil die wichtigsten Strategien der Internalisierung externer Effekte dargestellt und diskutiert.
Dabei wird zunächst (in Kapitel A) das von Ronald Coase (1960) vorgeschlagene Modell der Verhandlungen zwischen den an einem externen Effekt beteiligten Parteien erörtert. Die Coase‘schen Überlegungen sind für das Verständnis der Theorie externer Effekte grundlegend. Sie fügen sich nahtlos in die ökonomische Markttheorie ein. Externe Effekte erscheinen als Lücken im Marktsystem, die durch eine entsprechende Ausweitung des marktlichen Geltungsbereiches geschlossen werden. In der Coase‘schen Welt ist es denkbar, dass der Verursacher eines externen Effekts den Geschädigten dafür kompensiert, dass Letzterer die schädigende Aktivität erlaubt. Andererseits ist jedoch auch ein Arrangement denkbar, bei dem der Geschädigte den Verursacher für eine Reduktion der Externalität bezahlt. Mit dieser symmetrischen Behandlung sprengt Coase die traditionelle Rollenverteilung, bei der a priori der Verursacher als Täter und der Geschädigte als Opfer auftritt. Ebenso verhält es sich bei der Verursacherin als Täterin und der Geschädigten als Opfer. Wir erwähnen das im Folgenden nicht mehr gesondert, um den Sprachfluss nicht unangemessen zu behindern. Mit seinem in dieser Hinsicht provokativen Ansatz hat Coase die wohlfahrtsökonomische Diskussion außerordentlich belebt.
Dem Coase‘schen Gedanken verwandt ist die Internalisierung externer Effekte über das Haftungsrecht, die im Kapitel B des Zweiten Teils behandelt wird. Gelingt es, dem Verursacher die von ihm bei Dritten angerichteten Schäden anzulasten, so wird er diese bei der Entscheidung über Ausmaß und Qualität seiner Aktivitäten entsprechend berücksichtigen. Die Bedingungen, unter denen der Verursacher schadensersatzpflichtig ist, werden im Einzelnen durch die geltende »Haftungsregel« festgelegt. In diesem Buch wird wegen ihrer hohen umweltpolitischen Relevanz die Regel der Gefährdungshaftung besonders ausführlich behandelt. Zum Vergleich wird jedoch gelegentlich die Verschuldenshaftung herangezogen.
Neben Verhandlungen und haftungsrechtlichen Regelungen wird auch die Pigou-Steuer als Internalisierungsstrategie behandelt (Kapitel C). Nach dieser Idee wird dem Verursacher die Zahlung einer Abgabe pro Emissionseinheit in Höhe der (im sozialen Optimum veranschlagten) externen Grenzkosten auferlegt. Diese »klassische« Strategie ist bis zur heutigen »Ökosteuer«-Diskussion folgenreich. In zahlreichen Ländern werden Umweltsteuern eingesetzt, die letztlich auf den Pigou’schen Grundgedanken zurückzuführen sind und deren Design sich mehr oder weniger an der Pigou-Steuer orientiert.
Eine Internalisierung externer Effekte in reiner Form ist aus verschiedenen (im Text näher dargelegten) Gründen in der Praxis sehr schwierig. In der wirtschaftswissenschaftlichen Literatur ist daher auch der Einsatz von Instrumenten, die einem aus wirtschaftstheoretischer Sicht etwas weniger anspruchsvollen Ziel als dem der Internalisierung dienen, ausführlich behandelt worden. Es geht in diesem Zusammenhang darum, zu prüfen, inwieweit umweltpolitische Instrumente geeignet sind, einen vorgegebenen (nicht notwendig dem ökonomischen Optimalitätskriterium genügenden) Emissionsstandard zu erreichen. Die betreffenden Instrumente werden daher als »standardorientierte« Instrumente bezeichnet.1
Die hier angesprochene Frage wird im Dritten Teil behandelt. Die außerordentlich zahlreichen »pragmatischen« umweltpolitischen Instrumente, die in Wissenschaft und Politik diskutiert werden, werden dabei in drei »Prototypen«, nämlich Auflagen, Abgaben und Zertifikate zusammengefasst. Sie werden insbesondere auf ihre Effizienz, ihre Anreizwirkung bezüglich des umwelttechnischen Fortschritts und in Bezug auf die Genauigkeit, mit der sie das umweltpolitische Ziel erreichen können, untersucht.
Die Darlegungen in den ersten drei Teilen dieses Buches erklären das wohlfahrtsökonomische Fundament der Umweltökonomie, ihre elementaren Bausteine und den Umriss ihrer Architektur. Damit ist das Grundmodell der Umweltökonomie konstituiert.
Natürlich gibt es eine Unzahl von realen Problemen der Umwelt und der Umweltpolitik, die in diesem Modell nicht oder nicht adäquat abgebildet sind. Diesen wird in der Literatur mit entsprechenden (auf das Erklärungsziel der jeweiligen Erörterung ausgerichteten) Weiterungen des Grundmodells Rechnung getragen. Die Frage, welche Repräsentantinnen der kaum zu übersehenden Schar von Varianten in einem umweltökonomischen Lehrbuch Berücksichtigung finden sollen, ist natürlich schwer zu beantworten. Letztlich wird die Auswahl von der Bewertung ihrer politischen Relevanz und wissenschaftlichen Interessanz (hoppla!) durch die Autoren bestimmt. Im Vierten Teil dieses Buches finden Sie einen bunten Strauß von Erweiterungen des umweltökonomischen Grundmodells. Bei der Abfassung dieses Teils haben wir uns von unserer Überzeugung leiten lassen, dass es möglich sei, die Auswahl von Themen, die in einem grundlegenden Lehrbuch behandelt werden, von der aktuellen Forschung leiten zu lassen. Gegenstand und Methoden dieser Forschung lassen sich in vernünftigen Grenzen durchaus jenseits der In-Crowd der aktiven Forscherinnen und Forscher vermitteln, ohne den weniger spezialisierten Lesern die Unverdaulichkeiten des Forschungsdiskurses zumuten zu müssen.2
Mit den in Kapitel A behandelten Zusatznutzen umweltpolitischer Maßnahmen und den in Kapitel B behandelten Schadstoffinteraktionen geben wir Beispiele für den Umstand, dass zahlreiche ökologische Komplikationen im umweltökonomischen Grundmodell ignoriert werden. Zu Ersterem: Das gleichzeitige Auftreten von verschiedenen Effekten von Umweltschutzmaßnahmen ist eher die Regel als die Ausnahme. So ist eine Verringerung der Verbrennung fossiler Energieträger mit dem Ziel des Klimaschutzes verbunden mit der Reduktion anderer Luftschadstoffe, wie beispielsweise Feinstaub. Zu Letzterem: Unter Schadstoffinteraktionen versteht man das Zusammenwirken verschiedener Emissionsarten bei der Verursachung des Umweltschadens. Exemplarisch wird anhand dieser beiden Phänomene gezeigt, wie man ökologische Spezifika in das ökonomische Modell »einbauen« kann und inwieweit sich damit die Modellergebnisse ändern. Bei einer anderen Klasse von Weiterungen besteht die Abweichung vom Grundmodell darin, dass neben externen Effekten andere Gründe für »Marktversagen« in ein und demselben Modell berücksichtigt werden. Dies ist bei der Umweltpolitik unter den Bedingungen unvollständiger Konkurrenz und bei der Analyse von Umweltpolitik bei asymmetrischer Information gegeben, die in den Kapiteln C und D behandelt werden. Die in den vorgenannten Kapiteln behandelten Probleme von Marktmacht und Unsicherheit wurden in den ersten drei Teilen vollständig ausgeklammert. Anders verhält es sich mit der in Kapitel E behandelten Analyse des induzierten umwelttechnischen Fortschritts. Im ökonomischen Grundmodell wird diese unter der Überschrift »Dynamische Anreizwirkung« schon rudimentär behandelt. Demgegenüber erhält jedoch die dynamische Modellierung der im Vierten Teil des Buches platzierten Passage ein so großes Eigengewicht, dass die entsprechende Modellierung wohl das lehrbuchübliche Grundmodell sprengt und als »Weiterung« bezeichnet werden kann. Diese Einschätzung gilt auch für die in Kapitel E verwendete analytische Methode, die vom Leser mehr technische Kenntnisse verlangt, als die stärker anschaulich gehaltene Darstellung in den ersten drei Teilen.
In dem den Vierten Teil abschließenden Kapitel F werden verhaltensökonomische Aspekte von Umweltproblemen und Umweltpolitik analysiert. Manche Leser/innen werden das wohl eher für eine Alternative zum statt für eine Weiterung des umweltökonomischen Grundmodell(s) halten. Schließlich analysieren wir hier Entscheidungsträger, die über eine völlig andere »DNA in ihren Präferenzen« verfügen als der traditionell (und im Grundmodell ausschließlich) verwendete Homo Oeconomicus. Hier sind z. B. Gerechtigkeitsüberlegungen entscheidungsrelevant, die im Grundmodell der Umweltökonomie keine Rolle spielen. Man kann aber sehr wohl die Auffassung vertreten, dass dies eine Weiterung des Grundmodells sei. Schließlich wird in der Verhaltensökonomie nicht unterstellt, die Entscheidungsträger seien an Gerechtigkeit an der Stelle von Eigennutz interessiert. Vielmehr treten die Gerechtigkeitsüberlegungen ergänzend zu den altbekannten Eigennutzüberlegungen im Kalkül der Entscheidungsträger auf.
Natürlich: Inwieweit eine bestimmte Problematik zum Grundmodell, zu den Weiterungen (oder gar Alternativen) gehört, ist letztlich eine Frage der subjektiven Bewertung. Es sei hier jedem zugestanden, eine andere Einteilung als die hier gewählte für angemessener oder komfortabler zu halten.
Ebenso verhält es sich mit der Antwort auf die Frage, wie die Ökonomie internationaler Umweltprobleme eingeordnet werden soll. Zweifellos könnte sie als Weiterung des Grundmodells gesehen und damit im Vierten Teil platziert werden. Andererseits betritt man jedoch eine »andere Welt«, wenn sich die Betrachtung von der Dichotomie zwischen einer (mehr oder weniger gut informierten) regulierenden Institution und der Schar der Regulierten zur Betrachtung der Interaktion von unabhängigen Akteuren verschiebt. Dies geschieht systematisch bei der Analyse internationaler Umweltpolitik. Hier findet schließlich die Konstruktion des Nationalstaates, der Umweltrecht setzt und durchsetzt, keine Verwendung mehr. Vielmehr wird berücksichtigt, dass internationale Umweltpolitik zwischen souveränen Staaten (mehr oder weniger frei) vereinbart werden muss. Der Verschiebung des Erkenntnisobjekts entspricht ein Wechsel der analytischen Methode. An die Stelle der traditionellen mikroökonomischen Regulierungstheorie tritt die Spieltheorie.
Diese Überlegungen haben den Ausschlag dafür gegeben, die internationalen Umweltprobleme nicht als eine von mehreren Weiterungen des Grundmodells in den Vierten Teil zu allozieren, sondern ihnen den Fünften Teil exklusiv zu widmen. Hinzu kommt die überragende Bedeutung internationaler Umweltprobleme für die aktuelle umwelt- und gesellschaftspolitische Diskussion sowie der (damit korrespondierende) recht große Raum, der der einschlägigen Erörterung in diesem Buch eingeräumt wird. Wegen der hohen Aktualität der Diskussion um die globalen Umweltprobleme haben wir in diesem Teil auch besonders darauf geachtet, dass die wirtschaftstheoretischen Überlegungen nicht für sich stehen, sondern zur Bewertung praktischer internationaler Umweltpolitik herangezogen werden. Dies geschieht insbesondere am Beispiel einer umweltökonomischen Analyse des Klimaschutzabkommens von Paris sowie des EU-Emissionshandelssystems.
Noch leichter als bei den internationalen Umweltproblemen fällt die Entscheidung, natürliche Ressourcen und nachhaltige Entwicklung eigenständig (und damit im Sechsten Teil) zu behandeln, statt sie als Weiterungen des Grundmodells im Vierten Teil zu platzieren. Schließlich ist die hier eingenommene Perspektive sehr deutlich von der vorher in diesem Buch eingenommenen Perspektive zu unterscheiden.
Trotz vielerlei Abweichungen und Differenzierungen besteht die Grundvorstellung in den ersten fünf Teilen des Buches doch darin, dass mit der wirtschaftlichen Aktivität ein unerwünschtes Kuppelprodukt (externer Effekt, Emission) produziert wird, dessen Ausmaß durch ordnungs- oder prozesspolitisches Einwirken des Staates (oder einer Koalition von Staaten) günstig beeinflusst werden soll. Das Leitbild dieser Beeinflussung ist die Internalisierung externer Effekte, – sei es in ihrer reinen Form oder in der »Magerstufe« der standardorientierten Umweltpolitik. Im Sechsten Teil des Buches ergänzen wir dann diese outputbezogene Betrachtung durch eine inputbezogene. Der Umstand, dass jede wirtschaftliche Aktivität Ressourcen aus der Natur entnehmen muss, rückt in den Fokus der Betrachtung. Das Problem besteht in der Erschöpfung des Ressourcenbestandes bzw. in der Beschädigung (wenn nicht sogar der Zerstörung) der ressourcialen Basis der menschlichen Existenz. Die daraus entstehende Frage ist die nach den Bedingungen der Dauerhaftigkeit menschlicher Existenz. Das zugehörige politische Leitbild ist das der nachhaltigen Entwicklung.
Soweit der Überblick über das Programm dieses Buches. Bitte gestatten Sie uns zum Abschluss dieses Anfangs noch einige Bemerkungen zu den Spezifika der vorliegenden Auflage im Vergleich zu ihren Vorgängerinnen. Die ersten vier Auflagen dieses Buches wurden von Alfred Endres in Alleinautorenschaft verfasst und damit auch verantwortet. Nun hat die Lektüre zahlreicher verhaltensökonomischer Artikel den bisherigen Alleinautor davon überzeugt, dass es gut ist, mal einen Schuss Altruismus in seine Entscheidung bezüglich der Autorenschaft der nächsten Auflage einfließen zu lassen. So teilt er denn nun das Vergnügen mit seinem verehrten Kollegen, Herrn Prof. Dr. Dirk Rübbelke von der Technischen Universität Bergakademie Freiberg. Die in dieser Kooperation entstandende Neuauflage unterscheidet sich von der vorangegangenen Auflage insbesondere in folgender Hinsicht:
• Die Literaturhinweise in allen Teilen des Buches sind umfassend aktualisiert worden. Dies ist besonders wichtig für diejenigen Leserinnen und Leser, die das Buch zur Anfertigung von Seminar- und Abschlussarbeiten oder Dissertationen nutzen.
• Das oben bereits angesprochene Kapitel A des Vierten Teils über Umweltschutz als unreines öffentliches Gut wurde neu in das Buch aufgenommen. Dabei wird die Theorie der Kuppelproduktion umweltökonomisch nutzbar gemacht, indem sie zur Analyse von »Zusatznutzen« umweltpolitischer Maßnahmen eingesetzt wird.
• Ebenfalls neu in das Buch aufgenommen wurde das Kapitel F des Vierten Teils, in dem verhaltensökonomische Aspekte des Umweltschutzes berücksichtigt werden.
• Die Analyse der Umweltpolitik bei unvollständiger Konkurrenz war in der Vorauflage auf den Monopolfall beschränkt. Nun findet sich (in Kapitel C des Vierten Teils) auch eine Analyse der Emissionsbesteuerung im Oligopolfall.
• Der Entwicklung der internationalen Umweltpolitik der letzten Jahre folgend wurde die Behandlung des Kyoto-Abkommens stark gekürzt. Spiegelbildlich wird das Klimaschutzabkommen von Paris in der vorliegenden Auflage (in Kapitel B des Fünften Teils) sehr ausführlich behandelt.
• Der europäische Emissionshandel war in den letzten Jahren starken Veränderungen unterworfen und hat erheblich an Bedeutung gewonnen. Dem trägt die Neuauflage des vorliegenden Buches (in Kapitel C des Fünften Teils) Rechnung.
• Natürlich: Das sind allerlei Erweiterungen, die naturgemäß Platz beanspruchen. Damit der Text nicht ausufert, haben wir den für die Erweiterungen notwendigen Platz an anderer Stelle eingespart (leider einsparen müssen). Insbesondere haben wir aus der Vorauflage das Kapitel »Die ›doppelte Dividende‹ der Ökosteuer« gestrichen.
• Bei der Arbeit an der Neuauflage haben die Autoren vielfältige Unterstützung erfahren. Wir möchten uns sehr herzlich bei Frau Annette vom Heede, FernUniversität in Hagen, und Frau Anja Brumme, Frau Dr. Theresa Stahlke und Herrn Dr. Philip Mayer, Technische Universität Bergakademie Freiberg, bedanken, die den Text in mehreren Versionen redaktionell betreut haben.
• Schließlich soll (darf!) hier nicht unerwähnt bleiben, dass sich Herr Professor Dr. Michael Finus (heute: Universität Graz), Frau Professorin Dr. Karin Holm-Müller (heute: Universität Bonn), Frau apl. Professorin Dr. Bianca Rundshagen (FernUniversität in Hagen) und Herr Professor Dr. Reimund Schwarze (heute: Viadrina Universität Frankfurt/Oder) mit zahlreichen nützlichen Hinweisen um frühere Auflagen dieses Buches verdient gemacht haben. Schließlich haben die Ausführungen zur Ökonomie des Umwelthaftungsrechts und des induzierten umwelttechnischen Fortschritts erheblich von der jahrelangen Forschungskooperation zwischen Alfred Endres und Herrn Professor Dr. Tim Friehe (heute: Universität Marburg) profitiert. Die Samariterdienste der genannten Personen wirken wohltuend in den jetzt vorliegenden Text hinein.
Zu guter Letzt noch eine frohe Botschaft für Dozentinnen und Dozenten der Umweltökonomie: Um die Aerodynamik des vorliegenden Textes beim Einsatz in Ihren Lehrveranstaltungen zu verbessern, können Sie die PowerPoint-Folien aller Abbildungen unter https://dl.kohlhammer.de/978-3-17-039458-2 herunterladen.
Alfred Endres und Dirk Rübbelke
Hagen und Freiberg im November 2021
1 Entsprechend könnten die Internalisierungsstrategien als »schadensorientierte« Instrumente bezeichnet werden.
2 Trends in der umweltökonomischen Forschung lassen sich fortlaufend aus den Programmen der Jahrestagungen der einschlägigen wissenschaftlichen Vereinigungen ablesen, z. B. der Association of Environmental and Resource Economists (AERE) oder der European Association of Environmental and Resource Economists (EAERE). Mit einem gewissen Lag gilt das auch für die führenden umweltökonomischen Zeitschriften wie Ecological Economics, Environmental and Resource Economics, Energy Economics, Environmental Economics and Policy Studies, International Review of Environmental and Resource Economics, Journal of Environmental Economics and Management, Resource and Energy Economics, Journal of the Association of Environmental and Resource Economists. Eine thematische Auswertung dieser Zeitschriften präsentieren Kvamsdal et al. (2021). Stärker zukunftsgerichtet (also zu den Herausforderungen, denen sich die Umweltökonomie wird stellen müssen) vgl. Bretschger/Pittel (2020).
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Erster Teil Die Internalisierung externer Effekte als Leitbild der Umweltpolitik
A. Wirtschaftstheoretische Grundlagen
I. Gegenstand und Methoden der mikroökonomischen Theorie
II. Das Gleichgewichtskonzept in der mikroökonomischen Theorie
III. Die »soziale Optimalität« des Marktgleichgewichts im idealtypischen ökonomischen Modell
IV. Abweichungen zwischen Gleichgewicht und Optimum durch externe Effekte: Das Problem des »Marktversagens«
V. Die Internalisierung externer Effekte zur »Wiederherstellung« der »verlorenen« Optimalität des Marktgleichgewichts
B. Implikationen der umweltpolitischen Programmatisierung des Konzepts der Internalisierung
I. Das Prinzip der Konsumentensouveränität
II. Ordinalität und Kardinalität des Nutzenkonzepts: Die Zahlungsbereitschaft als Näherungsgröße
III. Vom individuellen Nutzen zur gesellschaftlichen Wohlfahrt: Das Aggregationsproblem
IV. Konsequenzen
V. Dennoch: Die Internalisierung externer Effekte als unverzichtbarer Bestandteil umweltpolitischer Vision
Zweiter Teil Strategien der Internalisierung externer Effekte
A. Verhandlungen
I. Das Coase-Theorem
II. Kritik und Weiterungen des Coase-Theorems
1. Verteilung und Allokation
2. Das bilaterale Monopol zwischen den Verhandelnden
3. Verursacher und Geschädigte als heterogene Gruppen: Das Problem des Gefangenen-Dilemmas
4. Coase-Theorem und Umweltpolitik: Das Problem der Transaktionskosten
B. Haftungsrecht
I. Einleitung
II. Das ökonomische Grundmodell des Umwelthaftungsrechts
1. Emissionsgleichgewichte bei Verschuldenshaftung
2. Emissionsgleichgewichte bei Gefährdungshaftung
3. Verschuldens- und Gefährdungshaftung im Vergleich
4. Modellvoraussetzungen
III. Probleme einer Internalisierung externer Effekte durch das Haftungsrecht
1. Vollständige Abweichung zwischen Schaden und Schadensersatzzahlung
2. Teilweise Abweichung: Partielle Schadensdiskontierung bei Haftungsbegrenzung
3. Sonstige Probleme
IV. Allokationswirkungen einer Versicherung des Umweltrisikos
1. Vorbemerkung
2. Sorgfaltsgleichgewichte bei Risikoscheu
3. Sorgfaltsgleichgewichte bei Versicherung mit fairer Prämie
4. Sorgfaltsgleichgewichte bei Versicherung mit moralischem Risiko
5. Sorgfaltsgleichgewichte bei Versicherung mit Selbstbeteiligung und vertraglich vereinbartem Sorgfaltsniveau
C. Pigou-Steuer
Dritter Teil Standardorientierte Instrumente der Umweltpolitik
A. Einleitung
B. Typen umweltpolitischer Instrumente
I. Auflagen
II. Abgaben
III. Zertifikate
C. Zur Beurteilung umweltpolitischer Instrumente
I. Effizienz
1. Die einzelne Verursacherfirma
2. Die Gesamtheit der Verursacherfirmen
3. Grafische Veranschaulichung
4. Effizienzprobleme bei der freien Vergabe von Emissionszertifikaten
II. Dynamische Anreizwirkung
III. Ökologische Treffsicherheit
1. Exogener Emissionsstandard
2. Zeitbedarf der Anpassung
3. Ziel-Mittel-Interdependenz
4. Emissionsreduktion ohne festen Zielwert
5. Konservierung »natürlicher« Emissionsrückgänge
6. Schadstoffübergreifende Umweltpolitik
7. Immissionsorientierte Umweltpolitik
8. Emissionszertifikate: Gratifikation umweltpolitischer Abstinenz?
IV. Epilog: Internalisierung oder Standardorientierung? − Ein versöhnlicher Ansatz
Vierter Teil Weiterungen des Umweltökonomischen Grundmodells
A. Umweltschutz als Unreines Öffentliches Gut
I. Kuppelproduktion mit Outputs von verschiedenen Graden an Öffentlichkeit
II. Zusatznutzen aus Luftqualitätsverbesserungen und spieltheoretische Darstellung von Verhandlungen
B. Umweltpolitik mit Schadstoffinteraktion
I. Schadstoffinteraktion und umweltpolitische Zielbestimmung
II. Lineare Interaktion
III. Konkave Interaktion
IV. Nicht-konkave Interaktion
V. Fazit
C. Umweltpolitik bei unvollständiger Konkurrenz
I. Anpassung an eine Emissionssteuer im Monopolfall
II. Anpassung an eine Emissionssteuer im Oligopolfall
III. Anpassung an die Emissionssteuer im Monopolfall bei mehreren Reaktionsoptionen des Unternehmens
D. Internalisierungsverhandlungen bei asymmetrischer Information
E. Zur umweltpolitischen Induktion des umwelttechnischen Fortschritts
I. Vorbemerkung
II. Internalisierung externer Effekte und induzierter umwelttechnischer Fortschritt
III. Standardorientierte Instrumente und induzierter umwelttechnischer Fortschritt
IV. Modellerweiterungen
1. Externe Effekte in Umwelt und Technologie
2. Technologietransfer: Zur Diffusion und Adoption des umwelttechnischen Fortschritts
F. Verhaltensökonomie und immaterielle Effekte des Umweltschutzes
Fünfter Teil Internationale Umweltprobleme
A. Einführung
B. Internationale Umweltvereinbarungen
I. Die spieltheoretische Interpretation
1. Globales Optimum und Nash-Gleichgewicht
2. Das Problem der Anreizkompatibilität: Individuelle Rationalität und Stabilität internationaler Umweltverträge
3. Eine alternative Form der Darstellung: Globale Umweltprobleme als statisches Gefangenendilemma in Normalform
4. Verallgemeinerung der Spielstruktur
5. Instrumente zur Erhöhung der Kooperationsneigung
6. Die Koalitionsbildung bei internationalen Umweltverhandlungen
7. Perspektiven der spieltheoretischen Analyse globaler Umweltprobleme
8. Das Gefangenendilemma – Phantomschmerz der Spieltheoretiker/innen?
9. Epilog: Vermeidung versus Anpassung?
II. Vom Kyoto-Protokoll zum Abkommen von Paris – die ökonomische Sicht
1. Grundzüge des Kyoto-Protokolls
2. Das Abkommen von Paris
C. Instrumente der internationalen Umweltpolitik – Das Beispiel des EU-Emissionshandels
I. Darstellung
II. Umweltökonomische Bewertung
Sechster Teil Natürliche Ressourcen und nachhaltige Entwicklung
A. Ressourcenerschöpfung - Das Ende der Menschheit?
I. Einführung
II. Soziales Optimum und Konkurrenzgleichgewicht beim Abbau erschöpflicher Ressourcen – Die Hotelling-Regel
III. Epilog: Klimapolitik im Lichte der Ökonomie erschöpfbarer Ressourcen
B. Regenerierbare Ressourcen
I. Bio-ökonomische Grundlagen
II. Das Open Access Problem
C. Nachhaltige Entwicklung
I. Einführung
II. Nachhaltigkeit als nicht abnehmende Wohlfahrt
III. Nachhaltigkeit als konstantes Kapital
1. Schwache Nachhaltigkeit
2. Strikte Nachhaltigkeit
3. Kritische Nachhaltigkeit
IV. Nachhaltigkeitspolitik
V. Anreizprobleme der Nachhaltigkeit
Epilog Über drei Arten von externen Effekten und den ansteigenden Schwierigkeitsgrad ihrer Internalisierung
Literatur
Register
Erster TeilDie Internalisierung externer Effekte als Leitbild der Umweltpolitik
So können natürlich die Dinge in Wirklichkeit nicht aneinander passen, wie die Beweise in meinem Brief, … aber mit der Korrektur, die sich durch diesen Einwurf ergibt, … ist meiner Meinung nach doch etwas der Wahrheit Angenähertes erreicht …
Franz Kafka, Brief an den Vater, 1919
A. Wirtschaftstheoretische Grundlagen
I. Gegenstand und Methoden der mikroökonomischen Theorie
Die Mikroökonomie ist die Wissenschaft von der Knappheit und der Bewältigung von Knappheitsfolgen. Knappheit entsteht dadurch, dass die zur Deckung der Bedürfnisse der Menschen vorhandenen Ressourcen nicht ausreichen, um alle vorhandenen Wünsche zu erfüllen. Der Begriff der Knappheit bezieht sich also hier nicht (nur) auf das Fehlen des Notwendigsten, sondern auf jede Divergenz zwischen Wunsch und Wirklichkeit. Die zentralen Begriffe der »Bedürfnisse« und »Ressourcen« sind in der modernen Ökonomie sehr weit gefasst.
Der Begriff des Bedürfnisses transzendiert den umgangssprachlich üblicherweise als »ökonomisch« bezeichneten Bereich von Ernährung, Wohnen, Bekleidung, Transport usw. bei weitem und umfasst häufig als »außerökonomisch« verstandene Bedürfnisse, wie das nach sauberer Umwelt, innerer und äußerer Sicherheit, ja sogar die Sehnsucht nach Harmonie und Geborgenheit in der Partnerschaft.3
Auch der Begriff der Ressourcen ist in der modernen ökonomischen Literatur nicht mehr auf die traditionellen Produktionsfaktoren – (Erwerbs-)Arbeit, Kapital und Boden – beschränkt. Vielmehr werden heute auch die natürlichen (erschöpflichen wie regenerierbaren) Ressourcen oder das menschliche Wissen und die Arbeitsmoral in einer Gesellschaft berücksichtigt.
Eine Welt der Knappheit ist notwendigerweise durch Konflikte um die kostbaren (weil zur Minderung der Knappheit erforderlichen) Ressourcen charakterisiert. Keine Gesellschaft ist ohne Mechanismen und Institutionen zur Regelung dieser Konflikte denkbar. Die Regeln, mit denen knappe Ressourcen auf die allzu zahlreichen Träger der allzu zahlreichen Bedürfnisse aufgeteilt werden können, sind sehr vielfältig. Zu denken ist etwa an die Anwendung des Gesetzes des Dschungels, basisdemokratische Entscheidungsverfahren, den Marktmechanismus oder patriarchalische (matriarchalische) Zuweisungen. Die meisten Gesellschaften praktizieren eine Mischung dieser verschiedenen Allokationsmechanismen mit unterschiedlich starker Ausprägung ihrer Komponenten. Die moderne Wirtschaftstheorie hat sich überwiegend mit dem Markt als Allokationsmechanismus beschäftigt, aber auch die anderen oben erwähnten Mechanismen (und weitere) behandelt.
Für den (sicherlich geringen) Teil der Leserschaft, der an der Relevanz der obigen Ausführungen für die Umweltpolitik zweifelt, sei verdeutlicht: Betrachten wir den Luftraum über einer bestimmten Region als knappe Ressource, um die verschiedene Ansprüche konkurrieren: Firmen möchten die Luft als Aufnahmemedium für ihre Schadstoffe verwenden, Anwohner möchten die Luft einatmen. Die oben genannten Allokationsmechanismen können auch als Institutionen zur Regelung dieses Konflikts eingesetzt werden.
Nach dem Gesetz des Dschungels würde sich die »aggressive« Nutzungsform der Emittenten gegen die »defensive« Nutzungsabsicht der Anwohner uneingeschränkt durchsetzen.4
Der Allokationsmechanismus der autoritären Zuweisung würde im Beispielsfall bedeuten, dass den Firmen Emissionshöchstgrenzen vorgegeben werden. Damit wäre implizit eine Aufteilung der knappen Ressource zwischen Firmen und Anwohnern fixiert.
Mehr oder weniger am marktlichen Allokationsmechanismus orientierte Lösungen bestünden etwa in Verhandlungen zwischen potentiellen Verursachern und potentiellen Geschädigten5 oder in der Vergabe von Emissionszertifikaten6.
Als basisdemokratische Variante wäre eine Volksabstimmung über die Emissionsniveaus (oder Ansiedlung bzw. Schließung) der betreffenden Firmen denkbar.
Im Zusammenhang mit der Analyse von Mechanismen zur Entscheidung über die Verwendung knapper Ressourcen und die Früchte ihres Einsatzes sind für die ökonomische Theorie insbesondere zwei Fragen interessant:
a) Welche Verwendung der knappen Ressourcen wird in einer Volkswirtschaft insgesamt als Resultat der zahlreichen Entscheidungen von zahlreichen einzelnen Entscheidungsträgern vorgenommen?Hier geht es darum zu erfahren, in welcher Weise die Rahmenbedingungen, unter denen die Individuen ihre Entscheidungen treffen, z. B. die Technologie oder die Rechtsordnung, die allokativen Ergebnisse beeinflussen. Wir bezeichnen diesen Teil der mikroökonomischen Theorie als »positive Analyse«.
b) Wie ist das im ersten oben genannten Schritt festgestellte (oder prognostizierte) Allokationsergebnis aus volkswirtschaftlicher Sicht zu bewerten?Dieses weitergehende Programm der mikroökonomischen Theorie bezeichnen wir als »normative Analyse«.
Viele Ökonominnen und Ökonomen sind besonders davon fasziniert, das tatsächlich von einem bestimmten Allokationsmechanismus erreichte Ergebnis mit einem »optimalen« Ergebnis zu vergleichen. Natürlich ist es für dieses Unterfangen nötig, ein gesellschaftliches Optimalitätskriterium zu entwickeln. Wird bei der Analyse des Marktmechanismus festgestellt, dass das Marktergebnis (»Gleichgewicht«) vom Optimum abweicht, so ist dies für den Ökonomen/die Ökonomin Anlass, über Korrekturmechanismen nachzudenken.7
Im Folgenden wird ausführlich dargelegt, dass die Existenz von Umweltproblemen (in der ökonomischen Terminologie: »externen Effekten«) eine Abweichung zwischen Marktgleichgewicht und Optimum begründet. Die im Zweiten Teil des Buches thematisierte »Internalisierung externer Effekte« ist nichts anderes als der Versuch, wirtschaftspolitische Korrekturen am Marktmechanismus mit dem Ziel vorzunehmen, Gleichgewicht und Optimum zur Deckung zu bringen.
Natürlich ist der Anspruch, die Politik solle einen optimalen Zustand herstellen, im Bereich der Umweltpolitik – wie in jedem anderen Bereich – aus mancherlei Gründen zu hoch gegriffen. Dennoch lohnt es sich, den Begriff der Optimalität zu operationalisieren und strukturelle Ursachen für Fehllenkungen des Marktmechanismus durch eine Konfrontation des Marktgleichgewichts mit dem Optimum aufzudecken. Wenn auch das Optimum in der Realität wohl nie erreicht werden wird, so könnte es doch eine Orientierungshilfe für die Umweltpolitik liefern, der der Blick für die einzuschlagende Richtung allzu oft (aber doch auch verständlicherweise) durch das Gestrüpp von Alltagsproblemen verstellt wird.
Allerdings werden der in der Ökonomie verwendete Optimalitätsbegriff und das Konzept der Internalisierung externer Effekte als idealtypisches Instrument zur Herstellung optimaler Zustände nicht kritiklos empfohlen. Vielmehr weisen wir auch auf die Tücken dieser Konzeptionen hin. Freilich sollte diese kritische Darstellung nicht als ablehnende Haltung der Autoren gegenüber den Internalisierungsstrategien missdeutet werden. Die Eignung der Internalisierung externer Effekte als Orientierungshilfe für die praktische Umweltpolitik muss nämlich anhand eines Vergleiches mit den tatsächlich zur Verfügung stehenden Alternativen gemessen werden. Wie unten ausführlicher begründet, sind die Autoren der Auffassung, dass die Internalisierungsstrategien (und andere auf der Grundlage der ökonomischen Theorie entwickelte Instrumente) trotz aller Defekte eher niedrig auf der Skala der Mangelhaftigkeit rivalisierender umweltpolitischer Strategien rangieren.
Vielleicht ist den Vertreterinnen und Vertretern anderer Disziplinen (als der Ökonomie) unter den Lesern noch eine methodologische Vorbemerkung nützlich:
Typisch für die Herangehensweise der Ökonominnen und Ökonomen an die hier angesprochenen (und andere) Fragen ist die modelltheoretische Analyse. Es geht in der ökonomischen Theorie nicht darum, alle in der Welt auftretenden Einzelfälle von Allokationsproblemen in allen ihren historisch zustandegekommenen Einzelheiten zu beschreiben. Dies wäre sicher ein ermüdendes und fruchtloses Unterfangen.8 Vielmehr geht es darum, die gemeinsame Struktur herauszuarbeiten, die verschiedenen Klassen von Einzelfällen zugrunde liegt (insbesondere bezüglich der Anreizwirkungen von Rahmenbedingungen auf die Entscheidungsträger). Hierbei ist es unverzichtbar, von vielerlei Einzelheiten konkreter Anwendungsfälle zu abstrahieren.9 Ein Beispiel: Der Markt für Entsorgungsleistungen im Abfallbereich unterscheidet sich sicherlich in vielem vom Markt für Bananen und dieser wieder vom Markt für Computersoftware. Dennoch sind alle drei Bereiche durch die Kategorie »Markt« vereint. Die Wirtschaftstheorie versucht, die gemeinsame Struktur der unterschiedlichen Märkte, also das »Wesen« des Marktes, herauszuarbeiten. Sie entwickelt dafür Kategorien wie Spezialisierung und Tausch, Angebot und Nachfrage, Effizienz und technischer Fortschritt, Konkurrenz (oder ihre Abwesenheit) und viele mehr. Diese spielen auf allen Märkten eine Rolle und können so zum gemeinsamen Verständnis der vielgestaltigen Einzelmärkte verwendet werden.
Das Ergebnis des hier angesprochenen Abstraktionsprozesses wird in der ökonomischen Theorie mit »Modellen« beschrieben. Hierbei handelt es sich um abstrakte Ursache-Wirkungssysteme. Sie stellen das Zusammenwirken der für das Untersuchungsziel des Modells als wesentlich angesehenen Elemente der Realität stilisiert dar. Betrachten wir als Beispiel ein Modell, mit dem das Verhalten einer Firma erklärt werden soll. Es setzt sich aus den folgenden Bestandteilen zusammen:
Die Konstruktion von Annahmen, auf denen das Modell beruht, ist ein besonders wichtiges und schwieriges Unterfangen: Einerseits sollen die Annahmen geeignet sein, das zu analysierende Problem einfach darzustellen. Eine der wichtigsten Aufgaben des Modells besteht schließlich darin, die den Betrachter häufig zur Resignation treibende hohe Komplexität der Realität zu reduzieren. Andererseits dürfen die Annahmen aber nicht so einfach konzipiert werden, dass sie die »wesentlichen« Aspekte des zu analysierenden Problems aus der Modellbetrachtung ausblenden. Die Konstruktion von Optimierungsmodellen stellt also selbst ein Optimierungsproblem dar.
Diese Optimierung ist ohne Wertung des Analysierenden nicht möglich, denn er muss darüber befinden, welche Aspekte des zu untersuchenden Problems aus seiner Sicht »wesentlich« sind und welche anderen dagegen vernachlässigt werden können. Der hier im Zusammenhang mit der ökonomischen Modellbildung auftretende enge Zusammenhang zwischen Optimierung und Wertung wird uns unten bei der Erörterung optimaler Emissions- oder Sicherheitsniveaus noch weiter beschäftigen. Natürlich kommt die analysierende Ökonomin/der analysierende Ökonom bei der Wertung nicht mit »objektiver Wissenschaftlichkeit« allein aus. Vielmehr muss sie/er auch (ob sie/er dies merkt oder nicht) ihre/seine eigene wissenschaftliche und persönliche Sozialisation in den Prozess ihrer/seiner Modellbildung einbringen.10
Zugegeben: Die obige Erklärung des »Modells« ist einigermaßen abstrakt geraten, ganz ähnlich übrigens wie das Modell selbst. Das ist nicht unbedingt ein Vorteil. Wir versuchen es nun etwas anschaulicher und sichern uns dabei die Unterstützung des englischen Romanciers David Lodge. In seinem Roman »Thinks« (London 2001) lässt er seinen Protagonisten erklären, was ein Roman ist. Wir übersetzen die betreffende Passage und ersetzen dabei das bei der Vorlage verwendete Wort »Roman« durch »ökonomische Modelle«:11
»Ökonomische Modelle sind eigentlich Gedankenexperimente. Der Autor erfindet Leute, setzt sie hypothetischen Situationen aus und zeigt, wie sie reagieren. Das Gedankenexperiment ist geglückt, wenn das Verhalten des Protagonisten interessant und plausibel ist und darüber hinaus etwas über die Natur des Menschen und der menschlichen Gesellschaft enthüllt.«
Verweilen wir doch noch ein wenig bei belletristisch vermittelten Analogien. (Weil’s so schön ist.)
Häufig wird das Verhältnis zwischen ökonomischer Theorie und Realität mit dem Verhältnis zwischen einer Landkarte und dem auf der Landkarte verzeichneten Gebiet verglichen. Die Karte abstrahiert von zahlreichen realen Eigenschaften des Gebiets und bietet stattdessen eine nach geografischen Kriterien vorgenommene Stilisierung. Man sieht auf der Karte viele wichtige Eigenschaften des Gebiets nicht, z. B. ob die Häuser im Wohngebiet schön sind und inwieweit der angrenzende Wald geschädigt ist. Dennoch bietet die Karte wichtige Informationen über die Beschaffenheit des Gebiets und Orientierung für denjenigen, der sich darin bewegen möchte. Dies nimmt die ökonomische Modelltheorie mit Blick auf die von ihr stilisierten Eigenschaften von Wirtschaft, Politik und Gesellschaft ebenfalls für sich in Anspruch.
Dass derartige Stilisierungen auch ihren ästhetischen Wert haben können, wird in dem 2010 unter dem Titel La Carte et le Territoire bei Flammarion in Paris erschienenen Roman von Michel Houellebecq deutlich. Erzählt wird (unter anderem) die Geschichte des berühmten Malers Jed Martin, der in einer bestimmten Phase seines Schaffens Fotografien (hoch künstlerische, versteht sich!) von Michelin-Landkarten herstellt. Über die Ausstellung, die ihm zum Durchbruch verhilft, heißt es auf Seite 77 f. der 2012 bei Dumont erschienenen deutschen Ausgabe Karte und Gebiet:
»Der Eingang zur Ausstellung war halb von einer großen Tafel versperrt, die zu beiden Seiten einen Durchgang von zwei Metern Breite frei ließ und auf der nebeneinander ein Satellitenfoto von der Umgebung des Großen Belchen und die Vergrößerung einer Michelin-Departmentalkarte vom selben Gebiet zu sehen waren. Der Kontrast war frappierend: Während auf dem Satellitenfoto nur eine Suppe aus mit verschwommenen bläulichen Flecken übersäten, mehr oder weniger einheitlichen Grüntönen zu erkennen war, zeigte die Karte ein faszinierendes Netz von Landstraßen, landschaftlich schönen Strecken, Aussichtspunkten, Wäldern, Seen und Pässen. Über den beiden Fotos stand in schwarzen Lettern der Titel der Ausstellung: ›Die Karte ist interessanter als das Gebiet‹«.
II. Das Gleichgewichtskonzept in der mikroökonomischen Theorie
Das Konzept des Gleichgewichts ist für die Umweltökonomie als angewandte Mikrotheorie von erheblicher Bedeutung. Seine Darstellung kann im Folgenden dennoch recht kurz erfolgen, da für die Erörterung des hier gestellten Themas nur die »Essentials« benötigt werden. Nähere Einzelheiten können in jedem mikroökonomischen Lehrbuch nachgelesen werden.12
Besonders eilige Leserinnen und Leser mögen den Wunsch verspüren, die Auseinandersetzung mit der weiter unten diskutierten Abbildung 1 zu vermeiden. Wir tragen diesem Wunsch mit dem folgenden Seitenblick 1 Rechnung. Vielleicht ermöglicht die Betrachtung der Kalligraphie ein intuitives (und damit äußerst zeiteffizientes) Verständnis des Gleichgewichtsbegriffs.
Seitenblick 1:13 Na, – alles im Gleichgewicht?
Für eine etwas ausführlichere Auseinandersetzung mit dem Gleichgewichtskonzept ziehen wir Abbildung 1 zu Rate. Hier ist der Markt für ein beliebiges Produkt x von vorgegebener Qualität stilisiert dargestellt.14
Auf diesem Markt herrsche vollständige Konkurrenz.15 Die Angebotsseite des Marktes werde durch zwei Firmen, die Nachfrageseite durch zwei Haushalte gebildet.16 Die Angebots- bzw. Nachfrageentscheidungen der Akteure bezüglich des Gutes x werden wie folgt über den Markt miteinander koordiniert:
Für die Firmen i bzw. j entstehen bei der Produktion des Produktes x Grenzkosten in Höhe von GKi bzw. GKj.17 Es lässt sich zeigen, dass die Grenzkostenkurve einer jeden Firma der individuellen Angebotskurve dieser Firma entspricht.18 Aus den individuellen Angebotskurven der einzelnen Firmen ergibt sich über die horizontale Aggregation die Angebotskurve, A, für das Produkt x auf dem Markt. Für die beiden Haushalte ist je eine monoton fallende individuelle Nachfragekurve Nk bzw. Nl angenommen. (Nur zur Vereinfachung der Darstellung ist zusätzlich Linearität unterstellt.) Aus ihrer horizontalen Aggregation ergibt sich die Nachfragekurve, N, für den Markt.
Zum Gleichgewichtspreis p* fragt der Haushalt k die Menge nach, der Haushalt l fragt die Menge nach. Die Gleichgewichtssituation eines Haushalts bei gegebenem Preis für ein Produkt ist dadurch charakterisiert, dass die marginale Zahlungsbereitschaft des betreffenden Haushalts für das Produkt dem Preis für das Produkt gleichkommt. Diese Bedingung ist für die auf der Mikroökonomie aufbauende Umweltökonomie sehr folgenreich und soll daher etwas näher erklärt werden:
Wichtig für das Verständnis des Haushaltsgleichgewichts ist es zunächst einmal, dass die Höhe der Bereitschaft des Haushalts, für eine (marginale) zusätzliche Einheit des Produkts zu zahlen, für jede Anfangsausstattung mit dem Produkt x als Ordinatenwert der entsprechenden Nachfragekurve abgelesen werden kann.
Abb. 1
Den Ordinatenwert der Nachfragekurve bezeichnen wir als »Nachfragepreis«, pN. So ist z. B. die Bereitschaft des Haushalts k, wenn er im Besitz der Menge ist, für eine zusätzliche (beliebig kleine) Versorgung mit dem Gut x zu zahlen, gerade als Ordinatenwert der Nachfragekurve über , nämlich , abzulesen.20 Wir behaupten, der Nachfragepreis sei mit der marginalen Zahlungsbereitschaft identisch, d. h. es gelte
Um dies zu verstehen, stellen wir uns einmal vor, es verhielte sich anders:21 Nehmen wir an, die Zahlungsbereitschaft des Haushalts für eine marginale über die Anfangsausstattung hinausgehende Einheit läge unter dem Ordinatenwert der Nachfragekurve beim Abszissenwert , d. h. sie sei kleiner als . Dann würde der Haushalt die letzte Einheit nicht zu einem Preis in Höhe von kaufen. Er würde ja sonst mehr für die Einheit ausgeben (nämlich ) als er auszugeben bereit ist (nämlich MZB). Dieses Ergebnis widerspräche der Annahme eines rationalen nach Nutzenmaximierung strebenden Individuums – und nur das Verhalten solcher Individuen wird mit dem hier vorgestellten Modell erklärt. Die marginale Zahlungsbereitschaft kann daher nicht unter dem Nachfragepreis liegen.
Nehmen wir nun an, die marginale Zahlungsbereitschaft des Haushalts läge über dem Nachfragepreis. Wenn dies so wäre, so wäre es nicht zu erklären, dass der Haushalt schon bei einem geringfügigen Anstieg des Preises von x über den zur Menge gehörenden Nachfragepreis, , reagiert, indem er auf den Kauf der letzten Einheit verzichtet. Dies tut er aber, wie in der Abbildung 1 aus der Bewegung vom Punkt P1 zum Punkt P2 ersichtlich ist. Die marginale Zahlungsbereitschaft kann daher nicht über dem Nachfragepreis liegen.
Da wir festgestellt haben, dass die marginale Zahlungsbereitschaft eines Haushalts weder unter noch über dem Nachfragepreis liegen kann, müssen wir schließen, dass marginale Zahlungsbereitschaft und Nachfragepreis ein und dasselbe sind. Wir können also die marginale Zahlungsbereitschaft eines Haushalts an der Nachfragekurve ablesen.
Aus dieser Erörterung folgt eine wichtige Eigenschaft des in Abbildung 1 skizzierten Konkurrenzgleichgewichts: Im Konkurrenzgleichgewicht wird der Konflikt zwischen den beiden Nachfragern k und l um das Gut x durch die Institution des Marktes so ausgetragen, dass eine Aufteilung der insgesamt produzierten Menge x* auf die Interessenten herbeigeführt wird, bei der die marginalen Zahlungsbereitschaften der beiden Individuen gleich dem Marktpreis sind. Da der Marktpreis (im hier unterstellten Konkurrenzmodell) für alle Konsumenten gleich ist, sind die marginalen Zahlungsbereitschaften der verschiedenen Nachfrager im Gleichgewicht auch untereinander gleich.
Ähnlich wie oben für die Nachfrageseite recht ausführlich geschehen, lässt sich für die Angebotsseite argumentieren. Hier konkurrieren die beiden Firmen i und j um Produktionsfaktoren, die zur Produktion des Gutes x notwendig sind.22 Jede Firma bekommt über den Markt die Menge an Produktionsfaktoren »zugewiesen«, die sie in die Lage versetzt, eine Endproduktmenge herzustellen, für die der Preis gleich den individuellen Grenzkosten ist. Da der Preis im Modell vollständiger Konkurrenz für alle Anbieter identisch ist, sind im Gleichgewicht auch die Grenzkosten der Anbieter einander gleich. Im Konkurrenzgleichgewicht ist also sowohl auf der Nachfrage- als auch auf der Angebotsseite die »Grenzausgleichsbedingung«23 erfüllt.
III. Die »soziale Optimalität« des Marktgleichgewichts im idealtypischen ökonomischen Modell
Wir hatten oben darauf hingewiesen, dass sich die Mikroökonomie (und damit auch die Umweltökonomie als Kind der Mikroökonomie) nicht auf die Beschreibung, Erklärung und Prognose menschlichen Verhaltens beschränkt (»positive Analyse«), sondern auch den Versuch einer Wertung unternimmt (»normative Analyse«).24 Dies ist allerdings nicht so zu verstehen, dass der analysierende Ökonom seine eigenen Präferenzen über die relative Wünschbarkeit von Gütern und sozialen Zuständen zum Maßstab seiner Beurteilung macht. In diesem Sinne muss die ökonomische Analyse wertfrei sein. Beim normativen Ansatz geht es vielmehr darum, Vorstellungen über die Determinanten sozialer Wohlfahrt und die Natur ihrer Verknüpfung, die in der Gesellschaft selbst eine wesentliche Rolle spielen, aufzunehmen und zu operationalisieren. Eine Conditio sine qua non besteht dabei darin, dass das verwendete soziale Wohlfahrtskriterium expliziert wird. So kann der Versuch unternommen werden, von der Gesellschaft hervorgebrachte Allokationen (und Institutionen) an den eigenen Wertvorstellungen der Gesellschaft zu messen und damit Abweichungen aufzudecken, die auf irrtümlich begangene Steuerungsfehler hinweisen oder Anhaltspunkte dafür zu geben, dass gesellschaftliche Handlungsträger tatsächlich andere Ziele verfolgen, als sie vorgeben.
Insgesamt betrachtet ist die Ausbildung einer normativen Komponente notwendig, wenn die Ökonomie auch ein Instrument der kritischen Analyse gesellschaftlicher Zustände und politischer Entscheidungen sein soll. Der normative Ansatz ist keine Spezialität der Wirtschaftswissenschaft. Vielmehr wird eine Vorstellung von dem, was die soziale Wohlfahrt ausmacht, allgemein zur gesellschaftlichen Orientierung als unverzichtbar angesehen. In der öffentlichen Diskussion wird lediglich ein anderer Begriff, nämlich der des »Gemeinwohls«, verwendet. Es gibt wohl keine Gesellschaft, die versucht, ohne diesen Begriff auszukommen.
Andererseits muss jeder, der versucht hat, den Begriff der sozialen Wohlfahrt (des Gemeinwohls) zu operationalisieren und womöglich Bedingungen für ein soziales Optimum (Maximum der sozialen Wohlfahrt) zu identifizieren, einräumen, dass dieses Projekt unter schwerwiegenden grundsätzlichen Problemen und ungezählten Schwierigkeiten im Detail leidet. Hier muss man wohl sagen: Der Weg ist das Ziel.25
Wir wollen das umweltökonomische Anliegen dieses Buches effizient verfolgen und meiden daher den Irrgarten der Wohlfahrtstheorie. Dabei hilft eine einfache (und wohl deshalb in der Literatur sehr populäre) Konvention: Unter der gesellschaftlichen Wohlfahrt verstehen wir die Summe der Nutzen aller Gesellschaftsmitglieder. Die Nutzen können positiv oder negativ sein. Für negative Nutzen hat sich der Begriff »Kosten« eingebürgert.
Ein Zustand ist sozial optimal, wenn er die Differenz zwischen den über alle Gesellschaftsmitglieder aggregierten (positiven) Nutzen und Kosten maximiert. Das Gemeinte wird womöglich (noch!) deutlicher, wenn wir die vorstehend recht allgemein formulierte Frage nach der Definition eines sozial optimalen Zustandes auf das obige Beispiel der Produktion eines Gutes x verengen: Die sozial optimale Produktionsmenge ist dadurch definiert, dass die Differenz zwischen den aggregierten Nutzen und den aggregierten Kosten der Produktion maximal ist.
Natürlich ist mit diesem Konzept gleich die nächste (äußerst unbequeme) Frage aufgeworfen: Wie soll denn der Nutzen gemessen werden? Bei der in Rede stehenden Konvention wird als Näherungsgröße für den Nutzen, den ein Individuum aus dem Gut x zieht, die Zahlungsbereitschaft des Individuums für die Versorgung mit der betrachteten Gütermenge verwendet. Geht es um die Versorgung mit einer zusätzlichen (marginalen) Einheit, so dient entsprechend die marginale Zahlungsbereitschaft als Proxivariable. Nicht alle Individuen ziehen positiven Nutzen aus dem betreffenden Gut. Manche sind vielmehr mit Kosten belastet, insbesondere (im umweltökonomischen Kontext ist hinzuzufügen: aber nicht nur) die Produzenten. Die Zahlungsbereitschaft dafür, Kosten zu tragen, ist negativ. Die negative Zahlungsbereitschaft entspricht der Forderung, für die erlittene Nutzeneinbuße kompensiert zu werden. Geht es um eine (marginale) zusätzliche Einheit des Gutes, so sprechen wir von der marginalen Kompensationsforderung bzw. den Grenzkosten.26
Mit den hier kurz erläuterten Konventionen lautet also die Antwort auf die oben gestellte Frage: Die sozial optimale Produktionsmenge des Gutes x ist erreicht, wenn die Differenz aus der aggregierten Zahlungsbereitschaft für x und den aggregierten von der x-Produktion verursachten Kosten maximal ist.
Betrachten wir nun die marktliche Allokation bei vollständiger Konkurrenz und wenden uns zunächst den Konsumenten als »Nutznießern« der Produktion zu. Da die individuelle Nachfragekurve eines jeden Konsumenten, wie oben begründet, die marginale Zahlungsbereitschaft dieses Konsumenten widerspiegelt, ist die aggregierte Nachfragekurve auf dem Markt eine grafische Illustration des aggregierten »Grenznutzens« (im Sinne der marginalen Zahlungsbereitschaft), den die Konsumenten aus diesem Produkt ziehen. Die Fläche unter der Nachfragekurve repräsentiert daher den gesamten Nutzen der Konsumenten aus dem Gut x.
Wenden wir uns nun der Kostenseite des Marktgleichgewichts und damit den Produzenten als den »Leidtragenden« der Produktion zu. Im idealtypischen Modell, das hier (zunächst) betrachtet wird, spiegeln die Grenzkosten der Produzenten den korrekt bewerteten Ressourcenverzehr wider, der durch die Produktion einer zusätzlichen Einheit des Gutes x entsteht. Die Angebotskurve auf dem Markt repräsentiert daher letztlich die volkswirtschaftlichen Grenzkosten der Produktion des Gutes x. Die Fläche unter der Angebotskurve ist demnach (von den Fixkosten einmal abgesehen) als grafische Illustration der gesamten Kosten anzusehen, die mit der Produktion des Gutes x einhergehen.
Offensichtlich ist das Optimalitätskriterium der Maximierung der Nutzen-Kosten-Differenz dort erfüllt, wo die Differenz der Flächen unter der Nachfrage- und Angebotskurve maximal ist. Anders ausgedrückt, ist die optimale Menge dadurch definiert, dass »Grenznutzen« und Grenzkosten von x einander gleich sind. Dies ist aber gerade im Schnittpunkt von Angebots- und Nachfragekurve der Fall. Damit sind auch zwischen Angebots- und Nachfrageseite die relevanten Marginalgrößen (Grenzkosten und marginale Zahlungsbereitschaft) ausgeglichen. Wir sehen also, dass im idealtypischen Grundmodell der »vollständigen Konkurrenz« der Marktmechanismus im Gleichgewicht die gesellschaftlich optimale Menge des betrachteten Gutes zur Verfügung stellt.
Darüber hinaus können wir sehen, dass der Marktmechanismus den Konsum dieser insgesamt erzeugten sozial optimalen Menge sozial optimal auf die verschiedenen Konsumenten aufteilt und die Produktion der gesamten Menge in optimaler Weise den einzelnen Produzenten »zuweist«.27
Betrachten wir als Erstes die Nachfrageseite. Wir haben oben darauf hingewiesen, dass das Gleichgewicht auf der Nachfrageseite dadurch charakterisiert ist, dass sich die marginalen Zahlungsbereitschaften der Konsumenten über die Anpassung der individuell nachgefragten Mengen an den Marktpreis angleichen. Untersuchen wir nun die Optimalität dieses Ergebnisses. Nehmen wir dafür an, die Aufteilung sei statt in der marktgleichgewichtigen Weise so vorgenommen, dass Haushalt kε Einheiten mehr, d. h. und Haushalt lε Einheiten weniger, d. h. erhalten. (Es gilt ) Dann läge (wegen des fallenden Verlaufs der Nachfragekurven) die marginale Zahlungsbereitschaft für das Gut x beim Haushalt k niedriger als beim Haushalt l. Es wäre nun denkbar, dass die beiden Haushalte diese Ausgangslage zum beiderseitigen Vorteil änderten. Sie könnten sich z. B. darauf einigen, dass k dem lε Einheiten des Gutes x zum Preis p* übertrüge. Haushalt k hätte sich durch diesen Tausch verbessert, weil seine marginale Zahlungsbereitschaft für jede Einheit zwischen und unter der dafür erhaltenen Gegenleistung pro Einheit, nämlich p*, läge. Auch Haushalt l würde durch den Tausch bessergestellt. Für ihn läge nämlich die Wertschätzung jeder Einheit zwischen und über dem dafür von ihm an k zu entrichtenden Preis p*. Da also von der zunächst angenommenen Ausgangslage eine Änderung möglich ist, die den Nutzen beider Beteiligten erhöht, kann die Ausgangssituation nicht sozial optimal gewesen sein. Schließlich ist die sozial optimale Aufteilung dadurch definiert, dass die Summe der (über die Zahlungsbereitschaft approximierten) Nutzen der beiden Parteien maximal ist. Der Leser mag sich selbst davon überzeugen, dass eine weitere Erhöhung des über die beiden Konsumenten aggregierten Nutzens nicht mehr möglich ist, sobald die marktgleichgewichtige Allokation , realisiert ist. Das Marktgleichgewicht ist also auf der Nachfrageseite im oben definierten Sinne optimal.
Ähnlich lässt sich für die Angebotsseite argumentieren: Nehmen wir einmal an, in der Ausgangslage werde die insgesamt angebotene Menge x* von den beiden Firmen iund j bereitgestellt, indem i eine Menge und j eine Menge produziert. Dann wären die Grenzkosten von j höher als die von i. Steigert von dieser Ausgangslage ausgehend die Firma i ihre Produktionsmenge auf und senkt die Firma j ihre Produktionsmenge auf , so bleibt die insgesamt produzierte Menge bei x*, die dafür aufgewendeten Gesamtkosten sinken jedoch. Die bei Firma i zusätzlich entstehenden Kosten (in der Abbildung die Fläche )28 sind nämlich geringer als der bei Firma j eintretende Kostenentlastungseffekt (in der Abbildung die Fläche ). Die volkswirtschaftlich eingesparten Kosten (Ressourcen) könnten nach dieser Effizienzsteigerung dazu eingesetzt werden, etwas Nützliches (also mit positiver Zahlungsbereitschaft belegtes) herzustellen. Die Ausgangskonstellation war demnach nicht sozial optimal. Der Leser mag sich selbst davon überzeugen, dass diese Bedingung jedoch von der marktgleichgewichtigen Konstellation erfüllt wird.
Die »soziale Optimalität« des Marktgleichgewichts im idealtypischen ökonomischen Modell wurde oben extrem vereinfacht dargestellt. Dies konnte (vergleichsweise) guten Gewissens geschehen: Die Erklärung sollte sich aus didaktischen Gründen auf diejenigen Elemente des Problems beschränken, die im hier gegebenen speziellen Erörterungszusammenhang (»Internalisierung externer Effekte«) unerlässlich sind. Dennoch ist wohl der Hinweis angebracht, dass eine tiefer schürfende Analyse ein wesentlich differenzierteres Bild vermitteln würde als der obige Text. Auf die Probleme des sozialen Wohlfahrtsbegriffs wurde eingangs schon kurz hingewiesen. Außerdem muss erwähnt werden, dass die obige Präsentation aus Vereinfachungsgründen auf die Verhältnisse in einem einzelnen Markt verengt war. Damit wurde das Instrument der Partialanalyse (genauer: der partiellen Gleichgewichtstheorie) eingesetzt. Eine differenziertere Behandlung müsste jedoch das Zusammenspiel der Vorgänge auf verschiedenen Märkten thematisieren (Totalanalyse (genauer: allgemeine Gleichgewichtstheorie)). Dem Versuch, ein vollständiges Marktsystem mit allen Interdependenzen abzubilden und sein Allokationsergebnis zu bewerten, kommt in der Volkswirtschaftslehre eine fundamentale Bedeutung zu. Die Bemühungen wurzeln schon in den Werken der Gründungsväter der Nationalökonomie z. B. in An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of the Nations, 1776, von Adam Smith. Sie wurden von Kenneth Arrow und Gerard Debreu perfektioniert, die für ihre Beiträge 1972 bzw. 1983 jeweils mit dem Nobelpreis für Ökonomie ausgezeichnet wurden.29
Wir haben oben die soziale Optimalität eines idealtypischen Marktmodells mit einer modellgestützten Plausibilitätsüberlegung erörtert. Unter dem sozialen Optimum wurde dabei diejenige Allokation verstanden, welche die soziale Wohlfahrt maximiert. Die soziale Wohlfahrt ist dabei als Überschuss der aggregierten Zahlungsbereitschaft über die Kosten definiert worden.
Im Hauptstrom der folgenden Darstellung behalten wir diesen Begriff von sozialer Optimalität bei. Bisweilen ist es jedoch (insbesondere aus didaktischen Gründen, aber auch um der besseren Anbindung an die einschlägige Literatur willen) angezeigt, einen etwas anderen Begriff von sozialer Optimalität zu verwenden. Dieser ist in der wirtschaftstheoretischen Literatur ebenfalls gängig und wird als Pareto-Optimum bezeichnet. Das betreffende Kriterium für die soziale Beurteilung von Zuständen lautet: Ein gesellschaftlicher Zustand A ist einem anderen Zustand B vorzuziehen, wenn sich in A mindestens ein Mitglied der Gesellschaft besser und kein anderes Mitglied schlechter stellt als in B. Dabei wird die individuelle Befindlichkeit stets vom betreffenden Individuum selber eingeschätzt. Dieses Konzept der Operationalisierung des sozialen Wohlfahrtsbegriffs geht auf den italienischen Soziologen und Ökonomen Vilfredo Pareto (1848-1923) zurück und wird als Pareto-Kriterium bezeichnet. Nach dem Pareto-Kriterium ist ein Zustand sozial optimal (»pareto-optimal«), wenn von ihm ausgehend keine Änderung mehr möglich ist, die auch nur ein Mitglied der Gesellschaft besserstellen würde, ohne ein anderes schlechterzustellen.
Das Pareto-Kriterium hat gegenüber dem oben kurz erklärten Konzept der Maximierung der sozialen Wohlfahrt als Summe individueller Nutzen den großen Vorteil, dass es ohne ein kardinales Nutzenkonzept auskommt. Für die Anwendung des Pareto-Kriteriums müssen wir weder voraussetzen, der Nutzen eines einzelnen Individuums könne quantitativ bestimmt werden noch davon ausgehen, ein Nutzenvergleich zwischen verschiedenen Individuen sei möglich. Da kann an der ordinalen Nutzentheorie geschulten Wohlfahrtsökonomen schon ein Stein vom Herzen fallen.30 Der Vorteil des Pareto-Kriteriums mit schwächeren Annahmen auszukommen, hat jedoch seinen Preis:31
Anders als die Idee der Maximierung der aggregierten Nettonutzen der Gesellschaft leidet das Pareto-Kriterium darunter, dass es unendlich viele Zustände gibt, bei denen das Kriterium überhaupt nicht in der Lage ist, eine Ordnung nach deren sozialer Erwünschtheit aufzustellen. Es ist per definitionem nach dem Pareto-Kriterium nicht zu sagen, ob ein Zustand C oder ein Zustand D sozial vorgezogen wird, wenn in C ein Mitglied der Gesellschaft besser steht als in D, ein anderes aber schlechter. Außerdem gibt es unendlich viele Pareto-Optima. Es ist noch nicht einmal so, dass ein beliebig herausgegriffener pareto-optimaler Zustand nach dem Pareto-Kriterium stets einem beliebig herausgegriffenen nicht pareto-optimalen Zustand sozial überlegen ist.
Mit Blick auf das umweltökonomische Anliegen dieses Buches können wir diese wohlfahrtsökonomischen Aussagen hier nicht ausführlicher erläutern. Sie können sie bei Bedarf jedoch leicht nachvollziehen, wenn Sie in einem mikroökonomischen Lehrbuch den Text zur Edgeworth-Box aufsuchen.32 Pareto-optimale Zustände finden Sie in Hülle und Fülle auf der »Kontraktkurve«, die in dieser Box illustriert ist. Nicht pareto-optimale Zustände gibt es diesseits und jenseits dieser Kurve – und zwar ohne Ende.
IV. Abweichungen zwischen Gleichgewicht und Optimum durch externe Effekte: Das Problem des »Marktversagens«
Natürlich stellt das oben kurz skizzierte ökonomische Modell eine radikale Vereinfachung der in der Realität herrschenden Verhältnisse dar. Berücksichtigt man seine außerordentliche Schlichtheit, so muss es zwar wohl erstaunen, dass es doch mit diesem Modell in Ansätzen gelingt, wichtige Triebkräfte des wirtschaftlichen Handelns bzw. die Natur wirtschaftlicher Institutionen (z. B. Gewinn-, Nutzenstreben, Konkurrenz, Durchsetzung von Präferenz und Kaufkraft auf dem Markt usw.) in Ansätzen darzustellen. Andererseits kann jedoch kein Zweifel darüber bestehen, dass es für eine unmittelbare wirtschafts- bzw. umweltpolitische Anwendung viel zu grob strukturiert ist.
So ist es z. B. offensichtlich, dass in der Realität auch einzelne Anbieter bisweilen erheblichen Einfluss auf den Preis des von ihnen hergestellten Produktes haben. Dies ist für die Optimalität des Marktgleichgewichts sehr folgenschwer. Im Extremfall des Monopols realisiert der Anbieter ein Gleichgewicht, bei dem die Grenzkosten unter dem Marktpreis liegen. Im Gleichgewicht sind daher marginale Zahlungsbereitschaft und Grenzkosten nicht aneinander angeglichen, d. h. die sozial optimale Produktionsmenge wird verfehlt. In ähnlicher Weise wird die Optimalität des Marktgleichgewichts durch staatliche Interventionen, z. B. Zölle oder Produktsteuern, gestört, die einen Keil zwischen den von den Konsumenten gezahlten und den von den Produzenten empfangenen Preis treiben. Auch hier wird ein Ausgleich der marginalen Zahlungsbereitschaften mit den Grenzkosten nicht erreicht. Eine Fehlallokation ist die Folge. Ein weiterer im wirklichen Leben (und in etwas komplexeren ökonomischen Modellen) wichtiger Aspekt, der oben ausgeblendet wurde, liegt darin, dass die Akteure nicht über ausreichende Informationen verfügen, um sich in der oben erklärten Weise zu verhalten. Insbesondere kann die Information (z. B. hinsichtlich der Qualität eines Produktes) zwischen Anbieter und Nachfrager asymmetrisch verteilt sein. Ist der Nachfrager nicht in der Lage, alle relevanten Produkteigenschaften vor dem Kauf zu beobachten, können sich Fehlallokationen ergeben. Die einschlägige ökonomische Theorie geht zurück auf die 1970 erschienene Arbeit über The Market for »Lemons«: Quality Uncertainty and the Market Mechanism von G. Akerlof.33 Der Autor wurde im Jahre 2001 für seine bahnbrechenden Arbeiten zur Informationsökonomik mit dem Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaft ausgezeichnet. Im Kontext unserer mit der Theorie externer Effekte befassten Erörterung verzichten wir auf eine ausführliche Darstellung und begnügen uns mit der folgenden Kurzfassung.
Seitenblick 2:34 Ökonomische Theorie der asymmetrischen Information – Kurzfassung
Keine Frage: Die Liste der in der Realität vorzufindenden Unterschiede zu dem oben skizzierten idealtypischen Modell ist lang. Sie ist Teil der Folklore mikroökonomischer Lehrbücher. Allerdings ist nicht in jedem Erörterungszusammenhang jeder Eintrag in dieser Liste von Interesse. Es sei in diesem Zusammenhang daran erinnert, dass die ökonomische Modellbildung gerade nicht das Ziel verfolgt, die Realität wie ein Foto abzubilden. Wir wollen uns daher im Folgenden auf die für die Analyse von Umweltproblemen relevanteste Abweichung zwischen Realität und Modell konzentrieren:35 In der obigen idealtypischen Darstellung war (implizit) unterstellt, dass von der Produktion des Gutes x lediglich die Produzenten und die Nachfrager (ferner auch die marktlichen Anbieter der zur Produktion erforderlichen Produktionsfaktoren) betroffen sind.
Jegliche Nutzen- oder Kostenwirkung, die mit dem Gut x einhergeht, ist in diesem Modell über Märkte vermittelt: Die Nutzen aus dem Konsum des Gutes x fallen ausschließlich bei den Konsumenten an, die für den Kauf dieses Gutes auf dem Markt für das Gut bezahlen. Die Kosten für die Produktion fallen ausschließlich bei den produzierenden Firmen an, die für ihren Aufwand über den Markterlös kompensiert werden. Sie setzen zur Produktion lediglich Produktionsfaktoren ein, die auf Faktormärkten gekauft werden. In dem oben kurz skizzierten Modell für das Gut x existieren keine Beziehungen, die nicht Marktbeziehungen sind. Dieser Umstand muss angesichts der in der Realität herrschenden Verhältnisse als drastische Vereinfachung gelten. Wir bezeichnen in der Ökonomie über Märkte vermittelte Interdependenzen zwischen Individuen als »interne Effekte«.
Ein »externer Effekt« besteht dagegen darin, dass die Nutzensituation (bei Firmen: Gewinnsituation) eines Individuums unmittelbar, d. h. ohne Vermittlung durch den Marktmechanismus, von einer Aktivität abhängt, die von einem anderen Individuum kontrolliert wird. Legt man diese Definition zugrunde, so wird man unmittelbar feststellen, dass die Lebenswelt jedes Einzelnen ein dichtes Gestrüpp externer Effekte enthält. Nicht alle diese Effekte sind in unserem Zusammenhang relevant und es besteht keineswegs Konsens in der Gesellschaft darüber, um welche es sich dabei handelt. Ein konsensfähiges Beispiel für einen externen Effekt dürfte in der Staubemission einer Firma bestehen.36
Aus einer monetären Bewertung der externen Effekte gehen die externen Kosten hervor.37 Die insgesamt durch die Produktion verursachten Kosten, die »sozialen Kosten«, ergeben sich als Summe aus privaten und externen Kosten.
Zur Erläuterung der Auswirkungen eines externen Effekts auf die Optimalität eines Konkurrenzgleichgewichts kehren wir wieder zu unserem obigen Beispiel der Produktion des Gutes x zurück. Nehmen wir zur Vereinfachung an, es existiere ein dritter Haushalt38, m, der durch die Rußemission (wie auch immer definierte) Schäden erleidet. Es sei möglich, die Höhe der Schäden in Abhängigkeit von der Emissionsmenge in Geldeinheiten anzugeben. Die Auswirkung dieser Modellerweiterung auf die Optimalität des Marktgleichgewichts und damit auf den wirtschaftspolitischen Handlungsbedarf lässt sich durch eine Konfrontation der oben schon erörterten Interessen der Firmen i und j sowie der Haushalte k und l einerseits und des Haushalts m andererseits darstellen. Um die Darstellung nicht unnötig unübersichtlich werden zu lassen, fassen wir die oben besprochenen Interessen von i, j, k und l zusammen, indem wir die Angebotskurve und die Nachfragekurve für das Gut x aus Abbildung 1 saldieren. Die Nachfragekurve gibt, wie oben ausgeführt, den Bruttonutzen der Produktion des Gutes x an. Die Angebotskurve gibt, wie ebenfalls oben aufgeführt, die Kosten dieser Produktion an, soweit sie durch den Verbrauch vermarkteter Produktionsfaktoren entstehen. Daher repräsentiert die Differenz der beiden Kurven die marginalen Nettonutzen der Produktion bei ausschließlicher Berücksichtigung der über den Markt koordinierten Beteiligten (i, j, k, l). In Abbildung 1 sinkt die saldierte Kurve N - A im Punkt optimaler Produktion (x*) auf null ab, über dem die Angebotskurve die Nachfragekurve schneidet. Anstatt diese Kurve in konventioneller Weise von null ausgehend in Richtung zunehmender Produktionsmengen abzulesen, können wir sie auch umgekehrt, d. h. vonx* in Richtung 0 betrachten. Dann gibt uns die Kurve an, wie hoch der Nettonutzen ist, auf den die Gesellschaft, soweit sie am Markt für x repräsentiert ist, verzichtet, wenn die Produktion von x eingeschränkt wird. Diese Nutzenverzichte sind nichts anderes als die Opportunitätsgrenzkosten einer Verminderung des Produktionsniveaus. Unterstellen wir, dass der externe Effekt (hier die Rußemissionen der Produzenten) strikt proportional zur Produktionsmenge ist39, so können wir die saldierte Kurve als Grenzvermeidungskostenkurve der Rußemission bezeichnen. Die Grenzvermeidungskostenkurve, GVK, ist in der Abbildung 2 eingetragen.40 Außerdem enthält die Abbildung die beim Haushalt m anfallenden Grenzschäden, GS, in Abhängigkeit vom Produktions-(Emissions-)Niveau.41
Damit ist die Bühne für die Aufführung des Programms »Internalisierung externer Effekte« bereitet. Darunter versteht man die Anlastung der externen Kosten beim Verursacher. Gelingt die Internalisierung, so berücksichtigt dieser bei seinen Allokationsentscheidungen nicht nur die privaten, sondern auch die externen – insgesamt also die sozialen – Kosten. Damit ist private und gesellschaftliche Rationalität harmonisiert. Zur näheren Erläuterung dieser Zusammenhänge kann zunächst in vollständiger Analogie zu den obigen Ausführungen zum Marktgleichgewicht und zum in der Ökonomie
Abb. 2
üblichen Optimalitätskriterium das optimale Niveau der Emissionen bestimmt werden.42
Die den externen Effekt verursachende Aktivität muss nach der oben dargestellten Logik auf dasjenige Niveau begrenzt werden, für das der Nettonutzen der Begrenzung maximal ist. Dieser Nettonutzen ergibt sich aus dem Bruttonutzen abzüglich der Kosten der Begrenzung. Betrachten wir die Rückführung der emissionsverursachenden Aktivität x von der Ausgangslage x* auf eine geringfügig darunter liegende Menge x*− ε. Der Bruttonutzen der Reduktion der Aktivität um ε liegt in den damit vermiedenen Schäden. In der Grafik wird dieser Effekt durch das Integral (die Fläche) unter der Grenzschadenskurve in den Integrationsgrenzen x*− ε bis x* symbolisiert (vgl. die Fläche x*− ε, x*, A, B). Die Kosten, die der Gesellschaft durch diese Reduktion aufgebürdet werden, sind dagegen als Integral unter der GVK-Kurve in denselben Grenzen abzulesen (vgl. die Fläche x*− ε, x*, C). Geben die in die Grafik eingetragenen Kurven die Verhältnisse aus unserem Beispiel korrekt wieder, so liegt der Bruttonutzen einer Reduktion des externen Effekts (gemessen als Vermeidung des Schadens) um ε Einheiten deutlich über den Kosten der Reduktion.
Das sozial optimale Reduktionsniveau ist erreicht, wenn die Menge von x* auf x** zurückgeführt wird. Hier ist die Differenz zwischen den Nutzen und Kosten der Reduktion maximal. Mit anderen Worten: Die Grenznutzen entsprechen den Grenzkosten. In der Grafik ist die optimale Emissions-(Produktions-)Menge durch den Schnittpunkt der GVK- mit der GS-Kurve charakterisiert. Wir erkennen hier deutlich die Analogie zwischen dem umweltökonomischen Konzept der optimalen Emissionsmenge und dem traditionellen mikroökonomischen Konzept der optimalen Produktionsmenge. Beide Optima sind charakterisiert durch den Ausgleich marginaler Wertgrößen, die sich jeweils als Grenznutzen und Grenzkosten der zu optimierenden Größe interpretieren lassen.43
Schon an dieser Stelle wird deutlich, dass es sich bei der hier vorgetragenen Umweltökonomie um eine strikte Anwendung der traditionellen Mikroökonomie (mit all ihren Stärken und Schwächen) handelt. Allerdings fällt die Bewertung des Marktmechanismus nach diesem einheitlichen Optimalitätskonzept im Fall des Vorhandenseins externer Effekte diametral entgegengesetzt zum idealtypischen Modell vollständiger Konkurrenz aus. Während bei letzterem dem Marktmechanismus Optimalität bescheinigt wird, fallen Marktgleichgewicht (x*) und Optimum (x**) bei Anwesenheit externer Effekte auseinander. Weicht das Allokationsergebnis eines Mechanismus vom Optimum ab, so sprechen wir in der Ökonomie vom »Versagen« dieses Mechanismus. Handelt es sich bei dem betreffenden Allokationsmechanismus wie im hier erörterten Fall um das Marktsystem, so sprechen wir von »Marktversagen«.44
Natürlich birgt diese Terminologie bei umgangssprachlichem Verständnis die Gefahr der Fehlinterpretation. Versagt ein Mechanismus, so könnte man meinen, muss man ihn schleunigst durch einen anderen ersetzen. Dabei sollte man allerdings Vorsicht walten lassen. Es könnte sich ja herausstellen (und so ist es denn auch), dass kein realer Allokationsmechanismus das anspruchsvolle Optimalitätskriterium der sozialen Nettonutzenmaximierung erfüllt. Lehnte man alle Konzepte ab, die das Kriterium nicht erfüllen, so bliebe keines übrig. In der Literatur wird daher dem »Marktversagen« gern das »Staatsversagen« zur Seite gestellt. Jüngst ist häufig auch von (oh Schreck!) »Wissenschaftsversagen« die Rede.
Wir müssen daher für die praktische Wirtschafts- bzw. Umweltpolitik damit leben, dass wir nur unter unvollkommenen Allokationsmechanismen wählen bzw. diese kombinieren können. Das Optimalitätskonzept dient dabei lediglich (immerhin!) als (gelegentlich defekter) Kompass, an dem wir ablesen können, in welcher Richtung reale Allokationsmechanismen und deren Kombinationen verändert werden müssen.
V. Die Internalisierung externer Effekte zur »Wiederherstellung« der »verlorenen« Optimalität des Marktgleichgewichts
Mit der Charakterisierung des Gleichgewichts einerseits und des Optimums andererseits und der Feststellung ihrer Divergenz ist ein Problem aufgezeigt, aber noch kein Weg zu seiner Lösung gewiesen. Fassen wir, ehe wir uns den Lösungswegen zuwenden, noch einmal die oben gewonnen Einsichten über die Optimalität des Konkurrenzgleichgewichts im idealtypischen Modell und seine Suboptimalität im Modell mit externen Effekten zusammen: