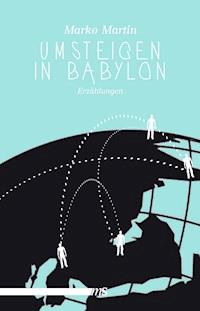17,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Tropen
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Was können wir tun – achshav? Jetzt? Ovid Preis 2025 Reiner-Kunze-Preis 2025 Der 7. Oktober 2023 – ein Schreckenstag, dessen Ausmaß noch immer nicht abzusehen ist. Marko Martin beschreibt, was im Jahr danach geschah. Auf der einen Seite die sich polarisierende Öffentlichkeit, die Relativerungen und Rechtfertigungen. Auf der anderen die Jüdinnen und Juden in Deutschland und Israel, in deren täglichen Leben nichts ist wie zuvor. Die furchtbaren Bilder, der Verlust von Freunden und Verwandten, die Angst auf der Straße hier in Deutschland, und immer wieder Frage: Was können wir tun – achshav? Jetzt? Ein Buch der Zwischenräume und Zwischentöne, das dem Hass die Geschichten der einzelnen Menschen entgegensetzt. Ein Plädoyer für Tikkun Olam, die Reparatur der Welt. Das Jahr nach dem 7. Oktober führt in viele Abgründe. Jüdinnen und Juden machen wieder die Ur-Erfahrung der Schutzlosigkeit, besonders nach den Bildern jubelnder Islamisten in deutschen Großstädten. In Israel hat der Massenmord der Hamas tiefe Wunden gerissen, Kindergärten, Bibliotheken, Kibuzzim – plötzlich Schauplätze des Terrors. Das entsetzliche Schicksal der Geiseln. Dazu der Gaza-Krieg und eine Regierung, gegen die Hunderttausende Israelis protestieren. Und immer diese Frage: Wie miteinander weiterleben? Die eine Lösung gibt es nicht, aber doch viele Möglichkeiten erster Hilfe, Gründe für Zusammenhalt. Marko Martin hat sie gesucht und gesammelt und auf bewegende Weise zusammengeführt. »Marko Martin ist ein wahrer Humanist.« Anne Applebaum »Marko Martins Tel Aviv-Szenen erinnern an die Geschichten Bruce Chatwins.« Ha'aretz
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 238
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Marko Martin
Und es geschieht jetzt
Jüdisches Leben nach dem 7. Oktober
Tropen Sachbuch
Impressum
Dieses E-Book basiert auf der aktuellen Auflage der Printausgabe.
Tropen
www.tropen.de
© 2024 by J. G. Cotta’sche Buchhandlung Nachfolger GmbH, gegr. 1659, Stuttgart
Alle Rechte inklusive der Nutzung des Werkes für Text und Data Mining i. S. v. § 44 b UrhG vorbehalten
Cover: Zero-Media.net, München
Gesetzt von C.H.Beck.Media.Solutions, Nördlingen
Gedruckt und gebunden von CPI – Clausen & Bosse, Leck
ISBN 978-3-608-50255-8
E-Book ISBN 978-3-608-12363-0
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Mit welchem Gehör soll man die vielen Stimmen hören und mit welchem die Stille.
Amos Oz, Auf dieser bösen Erde
Eins
In Adis Brillengläsern spiegelt sich das Sonnenlicht, sogar der Wandspiegel hinter ihr reflektiert die Strahlen.
»Willst du die Fotos und Videoaufnahmen sehen, die Bilder aus den Bodycams? Ich kann dir weder abraten noch zuraten. Du entscheidest.«
»Es geht hier definitiv nicht um mich.«
»Zum Glück ist Daniel noch zu klein, um auf dem Smartphone herumzuwischen.«
Noch eine halbe Stunde, dann wird Adi ihn aus dem Kindergarten abholen. Und all die anderen Kinder – die aus den Kibbuzim, die Verbrannten in den Wohnungsküchen, in die die Terroristen eingedrungen waren, um zu schlachten?
»Zu sagen, dass es unerträglich ist, wäre schon eine Untertreibung. Versuchen wir zumindest, so präzise wie möglich zu sein.«
Adi lächelt, wuschelt mit den Fingern durch ihr lockiges Haar, wendet die tränennassen Augen ab. »Und nimm jetzt bitte endlich was von dem Gebäck auf dem Teller. Muss sich doch gelohnt haben, dass ich inzwischen wieder halbwegs normal rüber zu Lidl gehen kann …«
Ende November in Berlin, gestern ist der erste Schnee gefallen. In der Straßenbahn von der Osloer Straße im Wedding hinüber in den Prenzlauer Berg – und schon auf der Fahrt die seltsame Frage, ob Adi wohl mit ihrem Sohn zurzeit hebräisch sprechen kann, in der Öffentlichkeit.
»Tu ich, aber leise. Und ertappe mich dabei, wie ich mich umschaue. Als wäre ich para oder so.« Daraufhin ihr plötzliches Lachen, dieses helle Glucksen, das ich über die Jahre hinweg so oft gehört und geliebt habe, in Tel Aviv und Berlin, an den Sommerabenden am Rothschild Boulevard oder draußen an den Trottoir-Tischen in der Oderberger Straße. Adi dabei stets an der Seite ihres deutschen Mannes, aus dessen früher skeptischem Schmunzeln inzwischen das gleiche komplizenhafte Lachen geworden ist. (»Hey, wie sagt man Honigkuchenpferde auf Hebräisch?« – »Chiychu me’ozen le’ozen, wenigstens so ungefähr.«)
»Ingo spricht mit dem Kleinen ja deutsch, da kann er zum Glück vieles übernehmen. Es ist so viel passiert seit dem …«
Adis Facebook-Einträge vor und nach dem 7. Oktober. Nur ein paar Wochen zuvor waren sie noch alle zusammen nach Sderot im Süden Israels gefahren, Adis Heimatstadt. Bilder mit der Familie, Nachkommen marokkanischer Einwanderer und ihr Stolz auf die Tochter, die nun in einem städtischen Kulturhaus aus ihrem ersten Buch las, vorgestellt von zwei Unidozenten aus Jerusalem, in deren Gegenwart die Eltern sich entspannt und wohl fühlten. Ein weiteres Bild zeigt sie neben ihrem Kindheitsfreund, dem wuchtigen Schnauzbärtigen und berühmtesten Sohn der Stadt, der ebenfalls zu Adis Buchvorstellung gekommen war.
Amir Peretz, auch er ein »Marokkaner«, der Vater Fabrikarbeiter, die Mutter Wäscherin, war als junger Mann in den achtziger Jahren für die sozialdemokratische Arbeitspartei zum Bürgermeister der Stadt gewählt worden. Später wurde er Gewerkschaftsvorsitzender, Minister in verschiedenen Kabinetten und gleich zweimal Parteichef. Vor allem aber war er Initiator des Iron Dome, dem spätestens seit 2012 berühmt gewordenen Raketenabwehrschirm, der enorm viele der Geschosse aus dem Gazastreifen effektiv abfangen kann und damit Menschenleben rettet. Für diese Idee hatte Amir Peretz zuvor viel Kritik, ja Spott bekommen, vor allem von Seiten der israelischen Rechten, nahezu jeder von ihnen ein selbsternannter Mister Security. Finanziert wurde der Iron Dome schließlich vor allem dank der signifikant aufgestockten Militärhilfe durch die Obama-Regierung, obwohl Premier Netanyahu dieser ebenfalls vorwarf, naiv, wenn nicht gar »israelfeindlich« zu sein.
»Wir haben gelacht und debattiert und Erinnerungen ausgetauscht, bei ungefähr dreißigtausend Einwohnern kennt hier doch fast jeder jeden. Sie hatten Wein aus Plastikbechern getrunken und nach der Buchpräsentation ein paar Bilder für Facebook gemacht. Amir, ich und die Family, Ingo mit Daniel auf dem Arm. Wer hätte gedacht, dass ausgerechnet hier, vor der schönen kleinen Bibliothek in Sderot und an all den Stätten meiner Kindheit, ein paar Wochen später gekämpft würde, die Stadt ein Schlachtfeld, die Eltern in ihrem Haus tagelang hinter verschlossener Tür, drei davon ohne Strom und Wasser. Todesangst und dazu diese noch am 7. Oktober so unerträgliche Hitze. Zuerst die Raketen am Himmel, dann Schüsse auf der Straße. Und die Toyota-Pick-ups der Hamas.«
7. Oktober. Fast scheint es, als könnte erst jetzt, aus der Distanz von einigen Wochen, annähernd beschrieben werden, was dieser schier endlose Tag auch den Lebenden und Überlebenden angetan hat. (Unter den Opfern und Geiseln sind auch Adis Verwandte, überdies Freunde und Bekannte, Nachbarn und ehemalige Lehrerinnen.)
Aber geht denn so etwas – die Ermordeten, pars pro toto von über 1200 – in Klammern? Doch wie von ihnen erzählen, von ihrem Leben und ihren Biografien, ohne in die Nähe einer unsäglichen Anmaßung zu geraten, und das auch noch aus räumlicher Distanz? Dazu all die Geiseln, darunter Kinder und Alte, die sich genau jetzt, während wir hier in Adis und Ingos Wohnung im Prenzlauer Berg sitzen, noch immer in der Gewalt der Hamas befinden, unter Tage in den Tunneln oder vielleicht als menschliche Schutzschilder in Krankenhäusern und Schulen. Welche Anmaßung, in ihrem Namen zu sprechen. Totenklagen zu wagen und Imaginationen ihres Schicksals. Ein unangemessenes Schönschreiben, das sich vor allem an sich selbst berauschen würde. Stattdessen der Versuch – und mehr als ein Versuch kann es ja gar nicht sein –, das Danach ebenso wie das Davor zu umkreisen, in den Gesprächen mit den Lebenden. Und auch diese Lebenden sind nicht »repräsentativ«, sind nicht Objekt irgendeiner »Langzeitstudie«. Sind Freunde und Freundinnen, und sie eröffnen diesen Raum der Erinnerung und des Nachdenkens.
»Inzwischen kann ich es zumindest für mich einigermaßen einordnen«, sagt Adi. »Nicht das Geschehen auf dem Festival, auf den Straßen, in den Kibbuzim und danach in den Wohnungen, in den Schlaf- und Wohnzimmern, in den Küchen und den Safe Rooms und Shelters, die ja dafür gebaut worden waren, um bei Raketenangriffen Schutz zu bieten, aber doch nicht für… die größte Abschlachtung nach dem Holocaust. Ich werde dir von meinem Cousin erzählen, der danach in der Shura Base die Leichensäcke öffnen musste und deren ›Inhalt‹ zu ordnen hatte, ich …«
Adi schaut auf den Teller, rührt selbst ihr Gebäck nicht an. Dreht den Kopf zur Seite, doch die Sonnenstrahlen, vom Fenster und im Spiegel, sind weitergewandert und nicht mehr auf der Höhe unserer Brillengläser.
»Gut… lass es mich versuchen. Samstagmorgen, Ingo und Daniel schlafen noch, aber mein Handy ist an, und ich höre das Summen der hereinkommenden WhatsApp-Nachrichten. So what, denke ich im Halbschlaf. Meine ganze Family ist in einer WhatsApp-Gruppe, da gibt’s dauernd was zu teilen und mitzuteilen; Kommentare, Grüße, Kochrezepte, all that stuff. Aber morgens um 6:28 Uhr, am Schabbat?«
(Aber morgens um 6:28 Uhr, am Schabbat? Exakt die gleiche Frage, die gleiche Erinnerung bei den Freunden in Israel, als wir uns das erste Mal nach jenem Tag von Angesicht zu Angesicht sehen, via Zoom und per Skype. Als wäre die größtmögliche Präzision – Ort, Uhrzeit, Stand der Information, gegenwärtige Situation der Sender und Empfänger – der einzige Halt, die Möglichkeit eines Halts, um sich nicht einquirlen zu lassen vom Mahlstrom des Schreckens, der in der Panik um das Leben der Verschleppten fortdauert. Einer der Freunde, Fingerknöchel an den Augenrändern, Grimasse eines Lächelns: »Jetzt lassen sie uns sogar mit den Amerikanern und Europäern gleichziehen: ›Wo warst du, als die Nachricht von Kennedys Ermordung kam? Und wo bei der Mondlandung, dem Mauerfall und 9/11?‹ Du wirst sehen, noch nach Jahren und Jahrzehnten …«)
Adi spricht vom bislang längsten und furchtbarsten Tag ihres Lebens. Tippt immer wieder sacht mit den Fingerspitzen auf die bunt gemusterte Tischdecke, sieht mich an und schaut weg, ihre Stimme bleibt deutlich und klar. Das Summen des Handys, das von da an nicht mehr aufhörte. Der mit jeder Minute mehr und jedes Mal grauenerregender zur Gewissheit werdende Verdacht, dass das hier kein neues, aber einzuordnendes Kapitel von Ha-Matzav, der gegenwärtigen Lage, war. Dass es mehr als die üblichen Raketenangriffe gab, nämlich eine Invasion zu Land und in der Luft – mit Jeeps, Motorrädern und Paragleitern. Und dass nicht nur geschossen, sondern erschossen wurde, erdolcht, erwürgt und verbrannt. Kein bloßer »Angriff«, sondern ein mit Google Maps, Granatwerfern, Maschinenpistolen und Hackbeilen orchestriertes Mordfest, wie es dies seit den Pogromen und der Shoah nicht mehr gegeben hatte.
Als die Pick-ups mit den bewaffneten Hamas-Terroristen in der Straße vor Adis Elternhaus auftauchten. Als die Eltern zur gleichen Zeit die Nachrichten aus den Kibbuzim erhielten und an Adi weiterleiteten. Als verwackelte Videos gesendet wurden, die Münder ganz nah am Display und flüsternd, während im Hintergrund Allahu Akbar-Rufe zu hören waren und Schreie und Schüsse auf dem Festivalgelände und in den nur geringen Schutz gebenden Gebüschen und Pinienhainen, auf den Straßen und in den Häusern. Schreie und Schüsse und immer wieder die verzweifelte Frage, wo denn die Armee bleibe, doch Garant dafür, dass es seit dem Holocaust eine sichere Heimstatt gab für Juden, also doch auch für die Kibbuzniks und die jungen Leute auf dem Supernova-Festival, für die Bewohner von Sderot. Halten wir durch, die Einheiten sind schon unterwegs, nur Minuten kann es noch dauern, sie sind auf dem Weg, sie werden bei uns sein.
»Sechs Stunden sind es geworden. Inzwischen waren über tausend Israelis, Zivilisten und völlig überraschte Sicherheitskräfte abgeschlachtet, und viele der Frauen, ehe man ihnen in den Kopf schoss, dazu auch noch… Aber das wissen wir ja alles.«
Noch im Schockzustand hatte dann, im Ausland eher unbemerkt, in Israel sofort die Debatte begonnen: Weshalb hatte es so lange gedauert, bis genügend Armeekräfte eingetroffen waren, um das Festivalgelände, um Sderot und die Kibbuzim – zumindest das, was von ihnen übrig geblieben war – freizukämpfen und die Überlebenden zu evakuieren? Vielleicht auch deshalb, weil die ultrarechte Regierung andere Prioritäten hatte und zahlreiche Armeeeinheiten im besetzten Westjordanland gebunden waren, um dort die religiösen Siedler zu schützen, die gerade ihr Simchat-Tora-Fest feierten?
Nicht ihr Fest, widersprachen andere, sondern unseres: Schließlich wird beim »Fest der Tora-Freude« an den Moment erinnert, in dem Moses auf dem Berg Sinai die Gesetzestafeln erhalten hatte – auch in säkularer Interpretation ein Zivilisationssprung sondergleichen, da hier ein Gott vom enigmatisch Dräuenden zu einer Instanz geworden war, die Verpflichtungen einging und Regeln formulierte. »Na wunderbar, und seit Jahren haben wir mit König Bibi einen Premier, der sich einen Dreck um Regeln und Gesetze schert, dem die Kontrolle über die Justiz und die Entmachtung des Obersten Gerichts wichtiger sind als der Schutz der Bevölkerung, und der deshalb sogar Faschisten und komplett Irre in seine Koalition aufnimmt, um an der Macht und immun zu bleiben.« So ging es im Land hin und her – unversöhnt und in wütender Vitalität zugleich, nach Ursachen forschend und doch hilflos, während die Zahl der geborgenen Toten oder ihrer verkohlten Überreste stieg und stieg. Immer mehr Menschen im Land erfuhren, dass sie ihre Liebsten auf immer verloren hatten und unzählige andere wahnsinnig vor Angst wurden um die in den Gazastreifen Verschleppten, über 240 Menschen, für die sie dann sofort demonstrierend auf die Straßen gingen. Bring them home – now.
»Hatte ich vorhin etwas von ›einordnen‹ gesagt?«, fragt Adi. »Siehst du… Und doch muss ich’s versuchen, schon Ingo und Daniel zuliebe und für meine ganze Familie und die Freunde in Israel, die es noch viel schwerer haben. Zuerst war ich, wie alle, wie gefroren in dieser Starre. Dann löste sich das auf und wurde zu dem Nebel, in dem ich die ersten Tage und Wochen zugebracht hatte. Sogar beim Einkaufen wie durch Schwaden wandernd. Vielleicht ganz gut, dass wir uns in dieser Zeit nicht gesehen haben.«
»Wir haben uns geschrieben, ich habe deine Facebook-Einträge gelesen, deinen Sieg über den Nebel.« Adis Erinnerungen an die Ermordeten und an die massakrierte Landschaft ihrer Kindheit – auf Hebräisch geschrieben und in Sekunden auf Deutsch zu übersetzen – waren konkret, schnörkellos, mit Frage- statt Ausrufezeichen. Und gerade deshalb ein leises Schreien, eine Flaschenpost voller Verzweiflung. Sollten wir noch einmal davon sprechen?
»Aber ja doch, auch wenn’s keine Therapiestunde werden soll …«
Eine Freundin von Adi, die an diesem 7. Oktober über hundert Menschen verloren hat, die sie persönlich kannte. Einer von Adis ehemaligen Lehrern. Der Neffe und der Schwiegervater eines Freundes. Nachbarn. Verwandte der Nachbarn. Dazu die Ängste hier in Berlin: Die zum Lobpreis des Massenmordes verteilten Süßigkeiten auf der Sonnenallee. Die an Häuserwände gesprühten Davidsterne, das Markieren jüdischer Bewohner. Die Angst deutscher Juden und hier lebender Israelis, ihre Kinder weiterhin in die Schulen und Kindergärten zu schicken. Die Demonstrationen in Berlin und im Ruhrgebiet, auf denen die Hamas gefeiert und Israel die Vernichtung gewünscht wurde. Bis in Deutschland und anderswo in der Welt, modisch gesprochen, das Narrativ um 180 Grad drehte und das zuvor noch als Objekt kommender Auslöschung verspottete Land plötzlich die Subjektrolle eines infamen »Völkermörders« einzunehmen hatte. Die Pöbeleien und tätlichen Angriffe auf hebräisch Sprechende oder anderweitig als Israelis und Juden erkennbare Menschen. Der Brandanschlag auf die Synagoge in der Brunnenstraße.
Fast vis-à-vis dem Haus, in dem H. und ich in den neunziger Jahren als Studenten gewohnt hatten. Die seither unterhalb der Grenze zum Wedding hip gewordene Straße, zwischen deren neu eröffneten Cafés und stylishen Einrichtungsläden die winzige Polizeikabine an der Ecke zur Anklamer Straße ebenso wenig auffiel wie die zwei Uniformierten vor der stets verschlossenen Tür zur kleinen Hinterhof-Synagoge. Was deshalb auch zu fragen wäre: Welche Stadt war Berlin und welches Land war Deutschland vor 10/7? Weshalb musste schon damals die ohnehin überschaubare Anzahl von Synagogen und jüdischen Kindergärten – im Gegensatz zu allen anderen religiösen Einrichtungen – von bewaffneter Polizei geschützt werden? Weshalb neigten nicht wenige jener, die etwa nach dem rechtsextremen Anschlag auf die Hallenser Synagoge am 9. Oktober 2019 sofort ihr Entsetzen gezeigt hatten, derart häufig dazu, den ebenso ostentativen Judenhass in manchen Einwanderermilieus kleinzureden und sophistisch klügelnd von einer »drohenden Diskursverschiebung nach rechts« zu raunen?
Weshalb wohl interessieren sich noch immer vor allem jene Progressiven, die stets so wortreich den Begriff des »importierten Antisemitismus« kritisieren, da dieser angeblich den autochthon deutschen leugne, kaum für den weiterreichenden Kontext, der sie doch eher von einem »re-importierten« Antisemitismus sprechen lassen müsste? Wie viele Tatsachen, noch immer verdrängt: Die auf Arabisch ausgestrahlten und damals weithin gehörten Sendungen des NS-Auslandsradios zur Aufstachlung der lokalen Bevölkerung in den britisch besetzten Gebieten des Nahen Ostens. Hitlers und Himmlers Empfang des Jerusalemer Großmuftis Al-Husseini, eines begeisterten Unterstützers der nationalsozialistischen Ausrottungspolitik, die er unbedingt auch im damals britischen Mandatsgebiet durchgesetzt wissen wollte. Al-Husseinis von Historikern längst en détail dokumentierte Mittlerrolle, um den nazi-deutschen Afrikafeldzug Rommels auf das damalige Palästina auszudehnen und die dort ansässigen Juden zu ermorden. Was unter Führung der »Einsatzgruppe Ägypten« geschehen sollte, geleitet von Walther Rauff, Massenmörder und Erfinder der lokalen »Gaswagen«. Parteigenosse Rauff, nach Kriegsende u. a. in Syrien untergetaucht, in Chile kurzzeitig Agent für den bundesdeutschen BND und nach Pinochets Putsch 1973 dann erneut in diverse Mordaktionen verstrickt. Deutsche Kontinuitäten.
Dazu Al-Husseinis weitreichende Nachkriegs-Aktivitäten in der extremistischen ägyptischen Muslimbruderschaft und als Star der »Dekolonisierung« 1955 auf der berühmten Konferenz im indonesischen Bandung, der Geburtsstunde des »Globalen Südens«, avant la lettre. Seine enge Freundschaft mit dem damals jungen Jassir Arafat wie auch mit geflohenen Nazis und jenem ehemaligen Goebbels-Vertrauten, der sich nun in Ägypten um eine Neuübersetzung von Hitlers Mein Kampf und der Fake-Protokolle der Weisen von Zion kümmerte – bis heute Longseller in den arabischen Ländern. Und all diese Wucht der Fakten, die nachzuverfolgenden Verbindungslinien zwischen nationalsozialistischem und arabischem Judenhass, ist nicht etwa allein in abgelegenen Spezialpublikationen auffindbar, sondern für jedermann, sogar auf Wikipedia.
Und heute: Die Hamas als Mitglied eben jener Muslimbruderschaft, die keine Sekunde an eine mögliche »Zweistaatenlösung« denkt, sondern stattdessen in ihrer Charta die Auslöschung Israels zum Endziel erklärt. So wie die Mörder vom 7. Oktober während des Abschlachtens keineswegs Free Palestine, sondern Allahu Akbar geschrien hatten und in ihren Nachrichten an die Familien im Gazastreifen nicht etwa von »Israelis« sprachen, sondern von »Juden«, die man soeben erschossen oder mit eigenen Händen erwürgt oder erstochen hatte. Context matters.
»Die Sache mit euren Nachbarn, hier im Haus …«
Einer der ersten Facebook-Posts von Adi nach jenem Samstag, auf Hebräisch, ein weiterer leiser Schrei: Diese furchtbare Stille. Kein Türklingeln oder Klopfen, nicht einmal eine WhatsApp-Nachricht. Obwohl man einander doch kannte und auch mochte, sich häufig im Treppenhaus traf und mitunter sogar die Kindergeburtstage gemeinsam feierte. Obwohl die Nachbarn wussten, dass Adi aus Sderot kommt, der nun zum Schlachtfeld gewordenen Kleinstadt. Doch kein »Wie geht es dir und deiner Familie?«, kein »Kommt ihr klar?«; nichts. Nur ein gewisses, womöglich peinlich berührtes Verwundertsein, als Adi am Montag nach jenem Wochenende einen der Nachbarn bat, doch bitte auf keinen Fall Auskunft zu geben, falls unten an der Haustür irgendwer fragen sollte, ob hier Juden oder Israelis lebten. Keine brüske Abwehr, das nicht. Nur eben dieses (vielleicht auch nur angedeutete) Kopfschütteln, skeptisch-souveräne Stirnfalte, mimisch irgendwo zwischen Jetzt-mal-nicht-gleich-übertreiben und Du-kommst-ja-auf-Ideen. Und kein Trost, keine Nachfrage, keine einzige.
Nun, ein paar Wochen später: »Das war direkt in dieser Nebelphase, weißt du? All unsere deutschen Freunde hier in Berlin hatten mit Fragen oder auch nur kurzen, uns jedenfalls ermutigenden Text- oder Sprachnachrichten reagiert, denn die Horrormeldungen aus Israel nahmen ja kein Ende. An manchen Orten wurde noch immer gekämpft, die Zahl der geborgenen Leichen, der Toten stieg stündlich – sofern sie denn überhaupt zu identifizieren waren und nicht ein einziger blutiger Brei oder gänzlich verkohlt. Die ebenso stündlich nach oben korrigierten Zahlen der nach Gaza Verschleppten, von Kleinkindern bis zu Greisen. Und ganz Israel schien zu einer einzigen WhatsApp-Telegram-Facebook-Gruppe geworden zu sein, Kakophonie des Schreckens. Hinzu kamen die Radio- und Fernsehnachrichten, die immer neuen Hilfsersuchen zur Unterstützung der Überlebenden aus den zerstörten Kibbuzim, die bei ihren Verwandten oder später dann in Hotels untergebracht werden mussten, die vielen Privatinitiativen der Leute, die Lebensmittel und Babynahrung hinunter in den Süden brachten. Während hier, in Berlin …«
Adi macht im Mundwinkel eine Art schnalzendes Geräusch, schmerzliches Lächeln. »Daniel war in diesen ersten Tagen natürlich nicht im Kindergarten, wie die meisten anderen jüdischen und israelischen Kinder. Denn auch zwischen den deutschen Juden und den hier lebenden Israelis wurden ohne Unterlass Nachrichten, Warnungen und Ratschläge ausgetauscht. Alltagstricks wie etwa das Vermeiden von Hebräisch-Sprechen in der Öffentlichkeit oder zur Sicherheit falsches Namen-Geben beim Bestellen eines Taxis, um mögliche Hassausbrüche arabischer Fahrer zu vermeiden. Keine Luxus-Paranoia, sondern Reaktionen auf Geschehenes, auf den hämischen Kommentar etwa von jungen und maskulin-agilen Uber-Fahrern, zumindest wüssten sie jetzt, wo ihre jüdischen Fahrgäste wohnten. Also Mimikry, Angst und Vorsicht und Verstecken und Low Profile. All das eben, wenn auch auf andere, nun neue Weise, seit über zwei Jahrtausenden zum Überleben Erprobte – und zwar nahezu völlig unter dem Radar der deutschen Öffentlichkeit und ihrem routinierten, jahrzehntealten Mantra vom Nie wieder …«
Adi unterbricht sich, sieht mich fragend an, nickt dann ihren Worten gleichsam bestätigend nach. Nein, das ist keine Übertreibung, keine Anklage, ist lediglich Bericht.
»Ingo hatte für sich ein paar Tage Homeoffice herausschlagen können, und da saßen wir nun… Das schier nicht endende Vibrieren des Smartphones. Und draußen diese Stille. Immerhin hatte es hier im Prenzlauer Berg nicht wie in Neukölln solch widerliche Jubelfeiern gegeben, die dann sofort in dieses Kindermörder Israel-Skandieren übergegangen waren. Doch all die freundlichen, aufgeklärten jungen Leute, die bei uns im Viertel wohnen, die politisch progressiven und ökologisch achtsamen Familien, die dynamischen Berlin-Mitte- oder NGO-Job-Väter auf ihren Fahrrädern, die Bommelmützen-Muttis auf den Kinderspielplätzen …«
Dabei hatte es sogleich am 8. Oktober eine Kundgebung vor dem Brandenburger Tor gegeben. Doch obwohl das Junge Forum der Deutsch-Israelischen Gesellschaft zu dieser Solidaritätsveranstaltung aufgerufen hatte – andere, größere und bekanntere Organisationen der deutschen Zivilgesellschaft hatten sich offenbar nicht zuständig gefühlt –, waren nach den Eindrücken so mancher der rund zweitausend Teilnehmer vor allem Ältere auf den Pariser Platz gekommen; fünfzig plus.
»Da hättest inzwischen auch du den Altersdurchschnitt nicht mehr radikal senken können, Chatich«, sagt Adi. Und hat tatsächlich in diesem Augenblick wieder das spöttische Glitzern in den Augen, mit dem sie damals – in einem anderen Land und wie in längst vergangener Zeit – meine Tel Aviver Aufbrüche kommentiert hatte, von ihrem und Ingos Abendbrottisch hinein ins Nachtleben auf der Allenby Street und in den Paradise-Club. Oder hinunter zum Strand, wo im Orthodoxen-Areal hinter dem Hilton Beach, durch eine ins Meer führende Holzwand von den Säkularen getrennt und doch nach Mitternacht allen frei zugänglich, auf dem feinkörnigen Sand die denkbar friedvoll physischen Durchmischungen stattfanden zwischen Zugereisten und Israelis, Juden und Nicht-Juden, inklusive der aus Jaffa und Nazareth fürs multiethnische Ausschweifungs-Wochenende nach Tel Aviv gekommenen Araber. (Und wo waren die deutschen AltersgenossInnen dieser jungen Israelis geblieben, an diesem Berliner Oktobersonntag 2023?)
Ich sage: »Ich hatte noch immer diese üble Bronchitis, und H. riet, ich solle deshalb der Kundgebung lieber fernbleiben, um die anderen Teilnehmer nicht zusätzlich mit einer Ansteckung zu belasten …«
»Good boys!«
Kurzes Auflachen und die nicht offen ausgesprochene Frage, ob unser seit Jahren erprobtes Pingpong-Gewitzel je wieder so gut gelaunt-bodenlos werden könnte wie zuvor.
»Wenigstens wirst du mich ab jetzt nicht mehr ›Rave‹ nennen«, hatte Ravé ein paar Tage nach dem Massaker auf dem Festival zu mir gesagt. Zum ersten Mal nach Jahrzehnten sahen wir uns nur von Bildschirm zu Bildschirm. Im Hintergrund ein überraschend geräumiges Wohnzimmer mit einigen nachgebauten Antikmöbeln aus der Tischlerwerkstatt seines Vaters, für die er seit ein paar Jahren Buchhaltung und Werbung übernommen hatte. Ravé, inzwischen Anfang vierzig und ein paar Kilo zugelegt – »für jeden Quadratmillimeter gelichtetes Kopfhaar ein paar Gramm Bauchspeck, lol«. Der Kopf deshalb rasiert, Dreitagebart und Augenringe, das Gesicht und die Augen aber noch immer von jugendlicher Kraft, ein Wechselspiel von Trauer und Freude.
Als wir uns im Sommer 2000 kennengelernt hatten, war ich 29 Jahre alt gewesen und er ein 19-jähriger Soldat, Typ lockenhaariger Ephebe – wie enorm schien damals die Altersdifferenz zu sein, Herausforderung, sie in gemeinsamer Lust und Sprachjokes zu überspringen. Aus Ex-Premier Shimon wurde »Shemale« Peres, aus Schabbat Shalom ein dem Inlandsgeheimdienst geltendes »Schabak Shalom«, aus der damals noch existenten Café-Kette Kapulsky ein »Katschwulski« und aus dem Toledo, unserem heruntergekommenen Ausflugshotel in Tiberias, ein »Proleto«. Gelächter und plötzlich Ravés sich verdüsternde Miene. Wenn er von den Stunden und schier endlosen Tagen an diesem Checkpoint im Westjordanland zu erzählen begonnen hatte, von den noch offenen Gesichtern der palästinensischen Kinder, für die er aus der Hemdtasche seiner Uniform Schokoladenriegel hervorzauberte, vom unbändigen Hass in den Augen der Jugendlichen, die er zur Leibesvisitation zu einem älteren Vorgesetzten winkte, von der Müdigkeit der Älteren in den Autos, von der riesigen Warteschlange im kahlen, winddurchzogenen Nirgendwo zwischen Ramallah und Bethlehem. »Sag mir, was verdammt machen wir dort? Und welche garantierte Sicherheit und welchen Frieden gäbe es, wenn wir nicht mehr da wären?«
Kurz darauf dann das Scheitern der von US-Präsident Clinton initiierten Camp-David-Gespräche, in denen Israels Premier Ehud Barak, obwohl zu Hause in Israel übel angefeindet von der nationalistischen Rechten, Palästinenserpräsident Arafat ein ganzes Bündel von Staatsgründungsvorschlägen überreicht hatte – unendlich mehr, als die Palästinenser je wieder erhalten würden. Der verblendete alte Mann im Kampfdrillich aber hatte brüsk abgelehnt. Wenig später brach die Zweite Intifada aus. Und als dann beinahe jede Woche in Jerusalem, in Haifa und Tel Aviv, ja selbst in der Gegend um den See Genezareth Selbstmordattentäter andere Menschen in den Tod rissen, hatten Ravé und ich regelmäßig telefoniert.
»Sag, bist du okay?«
»Und ob, bedank’ dich bei meiner Mutter, funny Fanny. Versteht null von Politik, wählt als gehorsame Tochter marokkanischer Einwanderer natürlich stramm die religiösen Diebes-Irren von der Schas-Partei, schimpft mit ihrem schwulen Erstgeborenen aber nur, wenn er zu spät zu Hause auftaucht und sie sich schon vor Angst die Fingernägel rot gebissen hat. Dann lacht und umarmt sie mich und macht für uns alle ihre koscheren Burger. So werden wir zwar entsetzlich fett und sterben irgendwann wahrscheinlich an zu viel Cholesterin, riskieren dafür aber wenigstens nicht, in Cafés oder vor Bushaltestellen zerrissen zu werden, haha.«
Nach dem 7. Oktober 2023 dann die Bilder von den Bushaltestellen im Süden. Notdürftig mit Tüchern verhüllte Leichen, Blutspuren auf den Plastiksitzen und den seitlichen Glaswänden, Blut auch auf den kleinen Wagen, mobilen und kostenlosen Buch-Ausleihstationen, wie es sie im ganzen Land gibt.
»Sag, wie geht es dir?«
Ravé erzählt mit beherrschter, ruhiger Stimme von Nachbarn und Freunden, deren Verwandte im Süden umgebracht worden waren oder die noch immer vermisst sind, ebenfalls tot oder Geiseln der Hamas. »Erst vorgestern gab’s wieder Luftalarm, sogar hier draußen in Rehovot. Die Hamas schießt weiter Raketen ab, und als wir gemeinsam nach unten über die Treppen in den Schutzraum gerannt sind, hat sich Fanny in ihrer Panik und Hast den großen Zeh gebrochen. Ein wahres Gottesgeschenk, denn nun kann sie endlich über etwas klagen, was reparabel ist, anstatt mit ihrem liberalen Sohn weiter darüber zu streiten, ob Premier Netanyahu nun der Retter ist oder nicht doch Israels Risiko.« Ravés Tränen in seinem lachenden und dann wieder wütenden Gesicht.
Die deutschen Generationsgenossen von Ravé waren auch bei den darauffolgenden Kundgebungen weniger sichtbar als die Älteren, von denen am 22. Oktober in Berlin immerhin knapp zehntausend Bundespräsident Steinmeier und den Rednern der demokratischen Bundestagsparteien Beifall für deren Solidaritätsbekundungen mit Israel zollten. Womöglich weil diese früher Geborenen – in der Schule und an den Universitäten – noch mit einer Wissensvermittlung aufgewachsen waren, welche die Shoah nicht lediglich als ein Gewaltereignis unter vielen anderen katalogisierte und den Staat der Überlebenden bei aller Detailkritik nicht völlig ahistorisch als »weißes Kolonialprojekt« denunzierte?
Was aber, wenn diese Demo-Anwesenden sogar in ihrer eigenen Alterskohorte eine Minderheit darstellten und die These von einem jetzigen Generation Gap nicht nur steil wäre, sondern vollkommen in die Irre führte? Was, wenn all die jungen »Biodeutschen« – nicht zu vergessen jene mit Migrationshintergrund und die Expats ihrer Generation –, die erst wenige Tage zuvor während einer medienwirksam inszenierten Sitzblockade vor dem Kanzleramt »Free Palestine from German Guilt« riefen, sich nicht allein als die jüngeren Verwandten von AfD-Höcke herausgestellt hätten und dessen herausgebellten Forderungen nach einem »Ende des Schuldkults«? Was, wenn gar nicht wenige der jüngeren »Biodeutschen« die Nach-Nachkommen schweigender Täter und Mitläufer wären, Enkel jener Achtundsechziger, die »Schlagt die Zionisten tot, macht den Nahen Osten rot!« skandiert hatten, und/oder Söhne und Töchter jener entweder konservativen oder progressiven Gutbürgerlichen, die mit Verweis auf reichlich Anne-Frank-Lektüre und Klezmer-Abende sowie auf fortgesetzte israelische Besatzungspolitik zu der Erkenntnis gekommen waren, dass es ja nun auch mal gut sei und das »Ende der Schonzeit« gekommen und die Israelis von heute ohnehin et cetera pp.?
Und die anderen Youngster, die sich danach in Interviews derart selbstbewusst als britisch, US-amerikanisch, chilenisch, pakistanisch, malaysisch oder japanisch, doch allesamt »israelkritisch«, wenn nicht als »Voices from the Global South« vorstellten – tatsächlich bis ins Tiefste angerührt vom realen Leid der Palästinenser, von denen sie so wenig wussten, dass in ihren Statements nicht einmal deren fortdauernde Hamas-Geiselhaft Erwähnung fand? Wirklich unfair, sich diese eloquenten Expats als die Spoiled Kids von Upper-middle-class-Eltern vorzustellen, die beim abendlichen Dinner das eigene privilegierte Verwobensein mit ihren jeweiligen Gesellschaften ungleich seltener ansprachen als das, was laut Medienberichten die Israelis respektive the Jews mal wieder alles getan oder sträflich unterlassen hatten?
»Immerhin…«, sagt Adi und sieht auf die Uhr – höchste Zeit, Daniel aus dem Kindergarten abzuholen, am besten wir bestellten gleich ein Taxi – »… immerhin hatte sich gegen Ende des Monats der Nebel um mich herum etwas zu lichten begonnen und es fing das an, was ich erneutes Freezing nennen müsste. Kalt, ultrakalt, alle störenden Emotionen im Blick auf die Außenwelt suspendiert. Wärme nur noch im schützenden Familien- und Freundeskreis, ansonsten wie eingefroren. Unzähligen anderen ging es genauso. Denn wie die mit jedem Tag visueller und individueller werdenden Gräuel verarbeiten, die schockierenden Zeugenberichte der Überlebenden, die Schreie bei den im Stundentakt stattfindenden Begräbnissen, die in den sozialen Medien kommunizierte Höllenangst der Geisel-Angehörigen? Dieses Gefühl des totalen Ausgeliefertseins, das bislang keiner von uns Nach-Holocaust-Juden und Israelis kennengelernt hatte – und zwar kollektiv. Was war aus Israel als ›sicherer Heimstatt‹ geworden? Da wir ja nicht von Kriegshandlungen oder einzelnen Attentaten sprechen, sondern etwas geschehen war, das seit Ende des Zweiten Weltkriegs… Freezing, Marko, Freezing. Alles schien Eiszacken bekommen zu haben und war eben nicht nur Verformung und Verhärtung. In manchem wurden die Konturen erst jetzt radikal sichtbar, obwohl sie es vielleicht schon immer gewesen waren.«