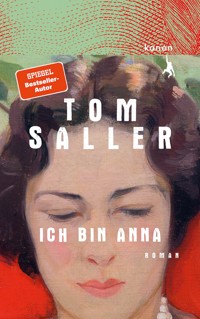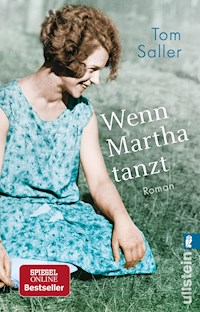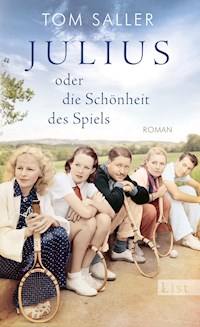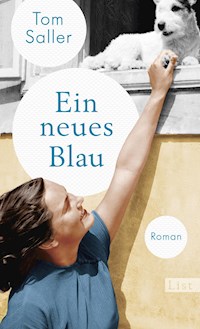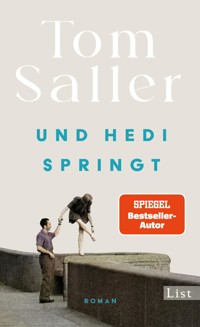
18,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ullstein eBooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die Geschichte einer unmöglichen Liebe Im Hungerwinter 1946/47 begegnet Hedi, hochschwanger und junge Flüchtlingsfrau aus Pommern, Alfons Müller-Wipperfürth, einer der schillerndsten Gestalten im Deutschland der Nachkriegszeit. Die Welt des zukünftigen Hosenkönigs sind Stoffe, Schnittmuster und Nähmaschinen. Hedi avanciert zu Müllers persönlicher Assistentin, und eine Geschichte von Aufstieg und Fall in der noch jungen Bundesrepublik nimmt ihren Lauf. Als alleinerziehende Mutter kämpft Hedi gegen Vorurteile und Misstrauen. Aber ihre beharrliche Suche nach Freundschaft und Liebe wird belohnt – bis vollkommen unerwartet der Vater ihres Kindes vor der Tür steht. Es ist eine Geschichte des Nichtaufgebens und einer Wiederauferstehung. Persönlich, wirtschaftlich und letztlich die eines ganzen Landes und seiner Menschen. *** »Zu Lebzeiten meines Vaters hätte ich dieses Buch nicht schreiben können. Nach seinem Tod aber musste ich es.« Tom Saller ***
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Und Hedi springt
TOM SALLER geboren 1967, hat Medizin studiert und arbeitet als Psychotherapeut. 2018 erschien sein Debütroman Wenn Martha tanzt rund ums Bauhaus und wurde umgehend ein großer Erfolg.Und Hedi springt ist sein fünfter Roman. Während Wenn Martha tanzt ein autofiktionales Porträt von Tom Sallers Urgroßmutter ist, widmet er sich in Hedi dem Leben seiner Großmutter und ihres Sohnes – seinem Vater. Tom Saller lebt in Wipperfürth, einer kleinen Stadt im Bergischen Land.
Es ist die Heimat in uns, die trägtIm Hungerwinter 1946/47 begegnet Hedi, hochschwanger und junge Flüchtlingsfrau aus Pommern, Alfons Müller-Wipperfürth, einer der schillerndsten Gestalten im Deutschland der Nach-kriegszeit. Die Welt des zukünftigen Hosenkönigs sind Stoffe, Schnittmuster und Nähmaschinen. Hedi avanciert zu Müllers persönlicher Assistentin, und eine Geschichte von Aufstieg und Fall in der noch jungen Bundesrepublik nimmt ihren Lauf.Als alleinerziehende Mutter kämpft Hedi gegen Vorurteile und Misstrauen. Aber ihre beharrliche Suche nach Freundschaft und Liebe wird belohnt – bis vollkommen unerwartet der Vater ihres Kindes vor der Tür steht.Es ist eine Geschichte des Nichtaufgebens und einer Wiederauferstehung. Persönlich, wirtschaftlich und letztlich die eines ganzen Landes und seiner Menschen.
Tom Saller
Und Hedi springt
Roman
Ullstein
Besuchen Sie uns im Internet:www.ullstein.de
© Ullstein Buchverlage GmbH, Friedrichstraße 126, 10117 Berlin 2025Wir behalten uns die Nutzung unserer Inhalte für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG ausdrücklich vor.Alle Rechte vorbehaltenUmschlaggestaltung: Lübbeke Naumann Thoben, Köln
Umschlagabbildung: © Yuri Belinsky / TASSFoto des Autors: Gerald von ForisE-Book Konvertierung powered by pepyrusISBN: 978-3-8437-3726-5
Emojis werden bereitgestellt von openmoji.org unter der Lizenz CC BY-SA 4.0.
Auf einigen Lesegeräten erzeugt das Öffnen dieses E-Books in der aktuellen Formatversion EPUB3 einen Warnhinweis, der auf ein nicht unterstütztes Dateiformat hinweist und vor Darstellungs- und Systemfehlern warnt. Das Öffnen dieses E-Books stellt demgegenüber auf sämtlichen Lesegeräten keine Gefahr dar und ist unbedenklich. Bitte ignorieren Sie etwaige Warnhinweise und wenden sich bei Fragen vertrauensvoll an unseren Verlag! Wir wünschen viel Lesevergnügen.
Hinweis zu UrheberrechtenSämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken, deshalb ist die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
Inhalt
Titelei
Das Buch
Titelseite
Impressum
Prolog
Prolog
Teil I
Geister
Das andere Ende der Welt
Fringsen
Pimocken
Glückstag
Meine Ehre heißt Treue
Zwei Seelen
Trümmerfrauen
Ein Schneider langer Hosen
Hosen runter
Tutti
Bierlachs
Blut
Zu voll
Männer
Plätzchen backen
Die Ohrfeige
Licht
Schatten
Wipperfürth, 2015
Teil
II
D-Mark
Lösungen
Harem und Heimat
Frohe Weihnacht
Trümmerschau
Nettsein
Moses
Wipperfürth, 2015
Teil
III
Flughöhe
Schläge
Leidensgenossen
Wortlaufen
Romeo und Julia
Angriff
In der Schweiz, in der Schweiz, in der Schweiz
Heimkehr
Paare
Die Hochzeit
Schwarzes Fleisch
Das Verhör
Wipperfürth, 2015
Epilog
Planen statt Träumen /
ZEIT
ONLINE
Anhang
Dank
Anmerkungen
Social Media
Vorablesen.de
Cover
Titelseite
Inhalt
Prolog
Widmung
Für Hedwig (»Hedi«) Saller,
meine Großmutter,
und
Siegfried (»Sigi«) Saller,
meinen Vater
Motto
Erzählende Prosa ist sowohl Kunst als auchWirklichkeit, sie trickst, und sie istwirklichkeitsgetreu, und beide Aspektelassen sich ohne Weiteres zusammenbringen.James Wood, Die Kunst des Erzählens
Prolog
Prolog
Hedi springt.
Kopfüber. Ein eleganter Sprung, kraftvoll und anmutig zugleich, einer jungen, gut ausgebildeten Tänzerin würdig. Allein der schwere Rucksack stört das Gleichgewicht – ihres und das des Bildes. Im nächsten Augenblick durchstoßen die wie zum Gebet aneinandergelegten Fingerspitzen die Wasseroberfläche, und die dunklen Fluten der Ostsee nehmen sie gewaltsam in die Arme. Wo eben noch ein unerträglicher Missklang aus Explosionen, Schreien, berstendem Metall und schrillen Sirenentönen die Nacht durchdrungen hat, herrscht nunmehr Stille. Eine dumpfe, betäubende Unterwasserstille, einzig synkopiert vom Einschlagen weiterer Treffer in den stählernen Leib der Wilhelm Gustloff.
Ein Rhythmus, weit entfernt vom gleichmäßigen Takt, der bislang ihr Leben bestimmt hat. In Türnow, im Großen Haus, mit Elfriede und Otto, Martha und Johann – der Familie – und mit Wolfgang, wenn auch nicht blutsverwandt, so doch mitnichten weniger Familie. Außerdem mit all den Musikern aus Ottos Kapelle, die sich in Kost und Logis im Hause Wetzlaff befinden und im Gegenzug Musik für die Menschen in diesem Teil Hinterpommerns machen. Und – mit Adam, aus dem polnischen Viertel, jenseits des Flusses, dessen Gesicht in den zurückliegenden Jahren immer mehr zu einem fernen Sehnen geworden ist. Doch es stimmt nicht.
Es ist ein Traum-, ein Wunschbild.
Die ersten falschen Schläge, abrupten Taktwechsel und missratenen Akzente sind bereits früher erklungen, weit vor der Flucht, haben auch Türnow nicht verschont.
Die hohlwangigen Gesichter der Zwangsarbeiter in Karl Theodor Walens Druckerei. Des Gauleiters, dessen Schnäuzer über die Jahre immer schmaler geworden ist, bis er zuletzt wie eine fette Fliege unter seiner Nase saß. Die Fußgänger mit dem Judenstern am Revers, für zehn Pfennig das Stück erzwungenermaßen erworben, die immer seltener in der Öffentlichkeit zu sehen gewesen sind, bevor sie und ihre Familien schließlich endgültig verschwunden waren. Und Elfriede, Martha und sie selbst, die mit angehaltenem Atem vor dem Volksempfänger in der Küche gehockt und der bis zu einem Flüstern herunterregulierten Stimme des BBC-Sprechers gelauscht haben – immer in der Angst, von einem missgünstigen Nachbarn denunziert zu werden. Hinter ihnen, im Schatten, Otto. Hat er sich einst dem Fortschritt lautstark verweigert und über das neumodische Ding im Haus geschimpft, nimmt er nun die Nachrichten über den Rückfall in die Barbarei schweigend hin: Berichte über angebliche Siege, vermeintliche gegnerische Niederlagen und verschwiegene Verluste.
»Tote«, sagt er hinterher, »einzig und allein Tote. Ein Requiem ohne Musik.«
Abrupt wendet er sich ab und geht hinaus. Wenig später dringen Töne von quälender Schönheit und nicht enden wollendem Verlust aus dem Proberaum, so zart, wie man sie nie zuvor von ihm und seiner Tuba gehört hat.
Otto in Moll.
Nein, die Zeiten des Gleichmaßes liegen weit hinter ihr, sind nicht erst mit dem Ablegen der Gustloff am Pier in Gotenhafen zurückgeblieben.
Für etwa zweitausend Passagiere und Besatzungsmitglieder sei der Dampfer ausgelegt, hat ihr der Matrose mit dem bleichen Gesicht erklärt, bei achttausend habe man aufgehört zu zählen. Dann hastet er weiter, hoffnungslos überfordert mit einer Situation, in der Menschen bloß noch Menge und Masse sind, man ihnen jedwede Individualität genommen und sie zu unförmigen Bündeln und Gepäckstücken degradiert hat. Lasten, die es zu transportieren gilt, fernab jeder christlichen Seefahrt.
Wie alle anderen hat sie die Gefahr nicht kommen sehen, das Ende nicht kommen hören; da war nichts außer dem Ächzen und Stampfen der überlasteten Maschinen in der Nacht. Plötzlich eine Explosion, der eine weitere folgt, ein Zittern und Beben, das durch den mächtigen Schiffskörper geht, und eine Stimme, die brüllt:
»U-Boot-Angriff!«
An seiner empfindlichsten Stelle aufgerissen, werden die Innereien des Schiffsleibs entblößt. Wasser dringt ein, eisige Fluten künden den in den überfüllten Kabinen und Gängen kauernden Menschen von einem dunklen, feuchten Grab.
Oben an Deck bricht Panik aus, planlos fallen Rettungsboote ins Wasser. Männer fluchen, Kinder weinen. Seltsam: Viele der an Bord befindlichen Frauen bleiben stumm, haben in den zurückliegenden Kriegsjahren zu viel Leid erfahren, um ein weiteres Mal gegen das Schicksal aufzubegehren.
Auch Hedi weint nicht, hadert nicht. Aber irgendetwas in ihr sträubt sich, lehnt sich auf, ein letzter trotziger Impuls der Selbstbestimmung – sie wird sich nicht wie eine räudige Katze ertränken lassen. Ihr Blick fällt auf den weiß gestrichenen Davit, nur wenige Schritte entfernt, dessen kranartige Silhouette sich vor den flackernden Flammen auf der Ostsee abzeichnet. Zwei einsame Trossen baumeln in der Luft, wo eben noch ein Rettungsboot gehangen hat. Sie setzt sich in Bewegung, drängt durch die Menge, stemmt sich gegen den Strom der Menschen, die verzweifelt zur anderen Seite des Schiffes streben, auf der Suche nach einem noch intakten Boot. Sie erreicht die Reling, zurrt den Rucksack fest und beginnt zu klettern. Erklimmt gebückt, Schritt für Schritt, den eisernen Ausleger unter ihren Händen und Füßen. Oben richtet sie sich auf, steht für einen Moment in ganzer zerbrechlicher Größe an der Spitze des Metallträgers. Sie schließt die Augen, stellt sich auf die Zehenspitzen und reckt die Arme gen Himmel. Dann stößt sie sich ab.
Ein Akt grenzenloser Schönheit. Ein einsames Gleiten durch die Nacht, von niemand bemerkt.
Sekundenbruchteile später taucht sie in die atemraubend kalte Ostsee ein, ringsum undurchdringliches Schwarz. Unaufhaltsam zieht das Gewicht des Rucksacks sie in die Tiefe, Wasser dringt in ihre Lungen, verzweifelt ringt sie nach Luft, bis – bis mit einem Mal aus unten oben wird, aus nachher vorher und aus schwer leicht.
Von allem befreit, schwebt sie ihnen entgegen.
Otto und Elfriede. Martha und Johann. Wolfgang.
Ihr Tanz auf Erden nur allzu kurz.
Teil I
Geister
Wohl kaum eine Gemeinde in der Bundesrepublik war so sehr mit dem Problem der Heimatlosen belastet wie Wipperfürth. Hier war das große Landeslager von Nordrhein-Westfalen, über das von 1946 bis 1960 mehr als eine Million Flüchtlinge geschleust wurden.
Wilhelm Kaupen, Stadtdirektor a. D.
Kalt, so kalt.
Frühmorgens im zweiten Winter nach dem tausendjährigen Grauen. Fahles Licht, das durch die verschmutzten Barackenfenster fällt, der Inhalt der Nachttöpfe unter den Stockbetten gefroren. Eine stumpfe, undurchsichtige Masse in zerbeulter Emaille und gesprungenem Porzellan.
Alte. Junge. Kinder.
Die Szenerie auf groteske Weise gedrängt, verdichtet. Als wären die Menschen in einem Luftschutzkeller verschüttet worden und harrten seitdem vergeblich auf Erlösung.
Einhundertzwanzig Stockbetten, meist mehrfach belegt. Etwa vierhundert Männer und Frauen. Den Gesetzen der Natur gehorchend die Alten unten, die Jungen oben. Zusammengepfercht in einem hastig errichteten Behelfsbau – niemals auf Dauer gedacht.
Keine Stühle, keine Tische, keine Schränke. Nur das nackte Nichts. An der Wand die eiserne Brennhexe, unter dem Spitzgiebel quert das Abzugsrohr den Raum. Doch Wärme Fehlanzeige, Briketts ein ferner Traum. Kinder hocken auf dem Boden, spielen mit einem verrosteten Nagel, einer Scherbe, einem Stein. Kaum mehr als ein Quadratmeter Platz für jeden. Allein die schmalen Gänge zwischen den Betten täuschen Abstand vor.
Eine Grenze, die keine ist.
Bis in den letzten Winkel sind die Miasmen menschlicher Ausdünstungen vorgedrungen. Ungewaschene Körper, eitrige Wunden und seit Wochen und Monaten nicht gewechselte Kleidung.
Eine olfaktorische Tätowierung.
Manch einer würde den Geruch ein Leben lang nicht loswerden.
In der Nacht sind feine Schneeflocken durch die Schlitze in den Bretterwänden geweht, das Moos zum Abdichten, wie alles Brennbare, längst verfeuert. Blasser Flaum auf rauen Wolldecken. Weiß bestäubte Grabhügel, unter denen sich die Umrisse menschlicher Körper abzeichnen.
Zu Hause, im Osten Europas, sind die Winter ebenfalls hart, sogar härter. Die Mauern fest. Fest, aber vertraut. Hier sind sie fremd.
Die Menschen.
Die Mauern unsichtbar.
Ein erstickter Schrei. Husten, Stöhnen. Unförmige, in löchrige Hosen, Röcke, Jacken und Mäntel gewandete Gestalten. Nicht wenige wälzen sich im Schlaf unruhig hin und her. Die meisten aber liegen still. Still und starr. Keiner weiß, wie viel Leben in ihnen steckt. Sie selbst am allerwenigsten.
Hedi ist aus einem Traum aufgeschreckt. Aus ihrem Traum, dem immer wiederkehrenden Albtraum, in dem sie mit Martha und der Wilhelm Gustloff untergegangen ist. Selbst im Schlaf durchbohrt sie der Verlustschmerz messerscharf, raubt ihr den Atem, lässt sie nach Luft ringen.
Aber sie war nicht an Bord, ist stattdessen auf der Potsdam, dem Schwesterschiff der Gustloff, nach Dänemark übergesetzt. Anders als ihre Mutter hat sie überlebt, ist nicht tot. Ebenso wenig wie die Männer und Frauen um sie herum.
Doch bedeutet Nicht-tot-Sein leben?
Sie ist vier oder fünf, als Otto und Elfriede einen Ausflug mit ihr unternehmen. Einen Sonntagsausflug zu der alljährlich stattfindenden Kirmes in Lauenburg.
Da ist Elfriedes Stimme, die mahnt: »Du kannst mit einem kleinen Mädchen nicht in die Geisterbahn gehen!«
Und Otto, der sich zu ihr herabbeugt, ihr die Hand auf die Schulter legt. »Hör nicht auf Oma Elfi, Prinzessin. Geister sind überall. Aber hier kannst du ihnen wenigstens ins Gesicht sehen.«
Sie ist ein Geist. Ein Geist, der mit den Lebenden gestorben ist und der mit den Toten leben muss.
Unter der dreifachen Schicht Kleidung und der Decke, in die sie sich gehüllt hat, spürt sie ihren Bauch; warm wie ein Laib Brot. Spürt, wie sich etwas in ihr bewegt.
Kein Geist.
Zumindest keiner, dem man ins Gesicht sehen kann.
Noch nicht.
Das andere Ende der Welt
Sie lebt noch im Lager, dem riesigen Lager in Oksbøl, in Dänemark, in dem sie beinah zwei Jahre verbracht hat, als aus dem Radio im Gemeinschaftssaal die Stimme des CDU-Fraktionsvorsitzenden Konrad Adenauer tönt:
»Das Deutsche Reich besteht faktisch nicht mehr, es besteht keine Regierungsgewalt aus eigenem Recht. Die Alliierten besitzen die volle Gewalt. Unser Ziel ist die Wiedererstehung Deutschlands.«
Eine merkwürdige Vorstellung, denkt Hedi, Deutschland, das Großdeutsche Reich, existiert nicht mehr. Eine Lücke hat sich aufgetan, ein gigantischer Abgrund. Aber wer ist zuständig für ein Land, das es nicht mehr gibt?
»Ich komme aus Dänemark«, sagt sie. Drei Stunden lang hat sie auf dem Gang der Lagerverwaltung gewartet. Aber so ist es derzeit in Deutschland. Alle warten. Niemand weiß, worauf. Außer Konrad Adenauer vielleicht.
Dieses Wipperfürth mit seinem Durchgangslager, in dem sie am Tag zuvor angekommen ist, liegt in der britischen Besatzungszone, und auch wenn London weit entfernt ist: Die englische Bürokratie ist es nicht.
Die Frau in der Uniform der englischen Besatzungskräfte fragt: »Sie sind Dänin?«
Sie gehört zur Jüdisch-Britischen Einheit 92, einem Kommando der Jewish Relief Unit, und ist für Displaced Persons jüdischer Abstammung zuständig. Für Menschen also, die nicht an diesem Ort beheimatet sind, die gewaltsam entheimatet wurden. Aber mit Ausnahme der wenigen überlebenden jüdischen Zwangsarbeiter in Baracke sechs finden sich hier keine Juden. Weder im Lager noch außerhalb davon. Nicht mehr. Niemand weiß, wo sie sind. Oder will es wissen. Das eigene Leid ist einem näher als das der anderen, Hunger eine ebenso schlechte Grundlage für Schuldgefühle wie für ein gutes Gedächtnis. Man sieht sich lieber als Opfer denn als Täter.
So leistet die Engländerin notgedrungen Amtshilfe, unterstützt ihre Kolleginnen und Kollegen in der überbordenden Frage der nichtjüdischen Flüchtlinge.
»Nein, ich war dort die beiden letzten Jahre im Lager.« Hedi stockt. »Ursprünglich stamme ich aus Türnow, in Hinterpommern.«
Mit gefurchter Stirn studiert das englische Fräulein die Karte Mitteleuropas an der Wand. Die neue Karte, mit der Westverschiebung der polnischen Grenze. Es packt den Stift fester, das Fräulein. »Dann sind Sie also Polin?«
Die junge Engländerin weiß genau, Hedi ist Deutsche – so wie ihre eigene Mutter. Während des Studiums hatte jene sich in einen hochgewachsenen Engländer verliebt und ihn geheiratet. Der Großteil der Familie ihrer Mutter ist in Auschwitz ermordet worden, und das wird sie, die Tochter, die Nichte, die Enkelin, den verfluchten Jerrys nie verzeihen.
Einschließlich Hedi.
»Nein«, entgegnet diese, »ich bin Deutsche. In Pommern geboren und aufgewachsen und über die Ostsee nach Dänemark geflohen. Ich war dort im Lager, in Oksbøl. Aber dann habe ich über das Internationale Rote Kreuz erfahren, dass hier, vor Ort, jemand namens Styp lebt.« Sie zieht einen zerknitterten Umschlag aus der Tasche ihres viel zu großen Männermantels.
»Eine Verwandte meines Vaters«, sie zögert, »eine … nahe Verwandte. Ich habe einen Passierschein in die britische Zone beantragt. Zwecks Familienzusammenführung. Hier ist ihre Adresse.«
Genau genommen hat Hedi die Frau nie gesehen. Eine Cousine Johanns, die bereits Anfang der Zwanziger ihr Glück in der Fremde gesucht und die es hierhin verschlagen hat; von Türnow aus betrachtet ans andere Ende Deutschlands.
Für Hedi hätte es genauso gut das andere Ende der Welt sein können.
Kurz darauf hält sie den Meldezettel mit ihrem Namen und ihrem Geburtsdatum in der Hand. Außerdem ist Entlaust und Frei von ansteckenden Krankheiten daraufgestempelt. Nach der Ankunft gestern und noch bevor man ihr einen Schlafplatz in der Baracke zugewiesen hat, ist sie ärztlich untersucht und mit einem stinkenden Pulver namens Jacutin behandelt worden.
Es ist ein unscheinbares, auf billiges Papier gedrucktes Dokument, das die Engländerin ihr schließlich ausgestellt hat. Eines, das ihr erlaubt, sich für eine Unterkunft zu bewerben und eine Arbeitsstelle zu suchen. Erneut spürt sie eine Bewegung in ihrem Bauch.
Wie soll sie arbeiten?
Wer soll auf das Kind aufpassen?
Sie ist allein an einem ihr vollkommen fremden Ort.
Fringsen
Der Himmel milchig, seltsam gestaut. Die blasse Wintersonne bloß ein scheues Licht. Mehr Schnee liegt in der Luft. Das Thermometer zeigt minus zwanzig Grad Celsius. Stumm harren die Menschen in den Baracken aus. Hedi steht vor dem Gebäude der Lagerverwaltung, in dem sich das Büro der Engländerin befindet, und weint. Lautlos.
Wattierte Stille, die darauf wartet, dass etwas geschieht.
Am äußeren Rand ihres Blickfeldes erscheint eine einsame Gestalt, schwarz wie die Krähen in den kahlen Baumwipfeln ringsum. Gebeugt nähert sich der Mann durch die Lagergasse, die an den Baracken entlang verläuft. Das Balkenkreuz auf seiner Schulter zeigt mit einem Arm gen Himmel.
Ein Bild, der Menschheit vertraut wie kaum ein anderes. Nie zuvor war Hedi dem Himmelreich so nah und so fern.
Unsicher blinzelt sie durch den Tränenschleier. Es kann nicht sein, ist unmöglich. Eine Sinnestäuschung, ein Trugbild, eine ihrem quälenden Hunger geschuldete Halluzination.
Und doch, das wuchtige Kreuz mühsam geschultert, ist es der Herr selbst, der sich ihr an diesem unwahrscheinlichsten aller Orte zeigt, gefolgt von dunklen Spuren im Schnee – dem Heiligen Geist?
Er ist es, der Herr. Gleichzeitig ist er es nicht.
Schüchtern nickt Hedi dem Geistlichen in der bis zu den Knöcheln reichenden Soutane zu. Die gekreuzten Balken auf seiner Schulter sind mit einer sorgfältig geschnitzten Erlöserfigur geschmückt.
Der Mann grüßt zurück und ist schon fast vorüber, als er stehen bleibt und seine Bürde behutsam auf dem Boden absetzt. Stöhnend richtet er sich auf.
»Sie weinen, Frollein«, bemerkt er und streckt den Rücken.
Hedi schnieft. »Verzeihung, es ist gleich vorbei.«
Der Mann in dem schwarzen Gewand mustert sie, sieht ihren sanft gerundeten Leib. Seine Augen wandern weiter, über die baufälligen Baracken, das verlassen daliegende Bahnhofsgelände und die von Raureif überzogenen Schienen. Nachdenklich betrachtet er das Schild mit der Aufschrift Hauptdurchgangslager, bis sein Blick schließlich auf dem an seiner Hüfte lehnenden Jesus verharrt.
»Wünschten wir das nicht zuweilen alle, mein Kind?«
Der Geistliche hat Hedi in das Gebäude der Lagerverwaltung gebeten, wo sie wenige Minuten zuvor mit der Engländerin gesprochen hat. Er stellt sich ihr als evangelischer Seelsorger vor. »Ich heiße Geduhn.«
»Guten Tag«, sagt Hedi. »Mein Name ist Wetzlaff. Hedi Wetzlaff.«
Bevor Geduhn den kleinen Raum hinter dem Büro der Engländerin aufschließt, deutet er auf eine helle Stelle an der Wand neben der Tür.
»Hier hing das alte Erlöserkreuz. Ich fürchte, inzwischen ist es längst verfeuert worden.«
Fragend blickt ihn Hedi an. »Sie sind evangelisch und hängen ein Kreuz mitsamt Jesus auf?«
»Ich gehöre der lutheranischen Kirche an. Wir tun so etwas. Genau wie unsere katholischen Glaubensbrüder.« Geduhn verzieht die Mundwinkel. »Allerdings fühlen die sich hier nicht zuständig, weil es sich bei einem Großteil der Flüchtlinge um evangelische Christen handelt. Doch egal, ob evangelisch oder katholisch, spätestens seit der Kölner Kardinal Frings am Silvesterabend seine berühmte Predigt gehalten hat, macht das Fringsen vor nichts und niemandem mehr halt. Auch bei den Protestanten nicht.« Geduhn seufzt. »Nicht nur hier im Lager, überall ist Brennmaterial absolute Mangelware. Sogar Trümmerholz gibt es nur auf Bezugsschein.« Erneut ruht sein Blick auf dem gekreuzigten Christus. »Bereits vor zweitausend Jahren haben seine Schäfchen dem Herrn übel mitgespielt. Seitdem hat sich nicht viel verändert. Besser, ich hänge den Erlöser diesmal in die Kammer.« Grimmig fügt er hinzu: »Der Tod am Kreuz befreit die Menschen von ihren Sünden. Einen weiteren, auf dem Scheiterhaufen, sieht das Neue Testament nicht vor.«
Pimocken
Sie sitzen sich auf zwei schlichten Stühlen an einem nicht weniger schlichten Tisch gegenüber. An der Wand ein verblichenes Bild von Maria, darunter das Kreuz mit ihrem Sohn, das Geduhn auf den ungehobelten Dielen abgestellt hat.
»Ein Missverständnis«, sagt er und schließt für einen Moment die Augen, »ein einziges Missverständnis.« Er öffnet sie wieder und schüttelt den Kopf. »Ende 1945 auf Anordnung der Briten errichtet, war das Lager lediglich als Durchgangslager gedacht, für die Dauer von höchstens zwei, drei Monaten. In erster Linie zur Rückführung der Rheinländer, die während des Krieges nach Bayern und Österreich evakuiert worden waren. Darum liegt es direkt hinter dem Güterbahnhof.« Er faltet die Hände vor der Brust. »Niemand sollte mehr als eine Nacht hier verbringen. Und anfangs war es auch so. Die Rheinlandheimkehrer, die in den Zügen ankamen, wurden registriert und innerhalb von vierundzwanzig Stunden in ihre Heimatorte weitergeschickt.« Er räuspert sich. »Nun ja, in das, was davon übrig ist.«
Hedi schweigt. Und denkt nach. Zwei, drei Monate. Aber jetzt gibt es das Lager schon mehr als ein Jahr. »Was ist passiert?«, fragt sie.
»Die Vertriebenen sind passiert.« Geduhn berührt den winzigen Christophorus auf seiner Brust. »Die Flüchtlinge aus Ost- und Westpreußen, aus Pommern, Schlesien und dem Warthegau. Die in Dänemark Internierten. Außerdem die Zwangsarbeiter sowie die illegalen Grenzgänger aus der SBZ. Sie alle sind passiert. Niemand hat sie auf der Rechnung gehabt. Auch dich nicht, mein Kind.«
Hedi folgt seinen Worten und folgt ihnen nicht. Sie ist hungrig und erschöpft, ihr ist schwindlig. Sie denkt an die nicht enden wollende Fahrt in dem überfüllten Waggon von Dänemark nach Schleswig-Holstein und von da aus über unzählige Zwischenstationen bis hierhin. Für den Transport empfindlicher Waren ungeeignet, da nicht wasserdicht, stand auf den Wagen. Fünf endlose Tage und Nächte dauerte die Reise.
Zuweilen warteten sie stundenlang auf einem Abstellgleis, ohne zu wissen, ob es überhaupt weiterging. Waren die Schienenstränge vor ihnen zerstört, mussten riesige Umwege in Kauf genommen werden. Auf den wenigen intakten Bahnhöfen Frauen mit Kopftüchern, Hüten oder barhäuptig, die ihnen Hilfe suchend die Fotos ihrer vermissten Männer entgegenstreckten. An einem Rot-Kreuz-Stand eine wässrige Suppe und eine schimmelige Scheibe Brot – ihre letzte warme Mahlzeit, zwei Tage zuvor.
Zweifelsohne gehört sie zu den Menschen, von denen Geduhn spricht, ist Deutsche, aber unversehens Fremde im eigenen Land. Heimatlose, deren Heimat nicht mehr existiert. Wenigstens nicht dergestalt, dass sie dorthin zurückkehren könnte.
Sie spürt ein dumpfes Pochen hinter den Schläfen. Hier, im Lager, ist sie ein Nichts, ein Niemand. Nicht einmal ihr Status ist gesichert. Flüchtling oder Vertriebene? Beides trifft zu: Zunächst ist sie geflohen, jetzt kann sie nicht mehr heimkehren. Aber wie kann man sie »nicht auf der Rechnung«, sie angeblich vergessen haben? Sie beißt sich auf die Unterlippe. Oder würde man sie der Einfachheit halber am liebsten vergessen? So wie viele ihrer Landsleute am liebsten vergessen würden, dass das Deutsche Reich den Krieg begonnen und verloren und somit das allgegenwärtige Leid zu verantworten hat?
Als könnte er ihre Gedanken lesen, sagt Geduhn: »Derzeit wird vermutet, beinah die Hälfte aller Deutschen befand sich bei Kriegsende da, wo sie nicht hingehörte. Die größte Völkerwanderung der Menschheitsgeschichte. Ob freiwillig oder nicht, sei dahingestellt.« Resigniert zuckt er die Achseln. »Aber was nutzt einem dieses Wissen angesichts der übervollen Züge, die tagtäglich hier ankommen und anscheinend nicht aufhören zu kommen. Tausende von euch Pimocken – Verzeihung, so ist es nicht gemeint –«, hastig schlägt er das Kreuzzeichen über Hedi, »sind bereits hier im Ort und in den umliegenden Städten einquartiert worden. Aber inzwischen gibt es kaum noch Platz, so gut wie keinen freien Wohnraum mehr.« Ratlos hebt er die Schultern. »Die Leute haben selbst nicht genug. Lebensmittel, Kleidung, Brennmaterial – fast alles erhält man nur auf Bezugsschein, und das nicht unbedingt verlässlich. Das wenige, was da ist, muss für beinah doppelt so viele reichen wie vorher. Machen wir uns nichts vor: Je mehr Menschen hier leben, umso knapper wird es für jeden Einzelnen.«
»Aber ich möchte doch einfach nur ein Zimmer zugeteilt bekommen, damit ich nicht noch eine Nacht in diesem schrecklichen Lager verbringen muss«, sagt Hedi leise. Sie zieht den Meldeschein, den ihr die Engländerin ausgestellt hat, aus der Tasche. »Damit müsste es doch gehen, oder etwa nicht?«