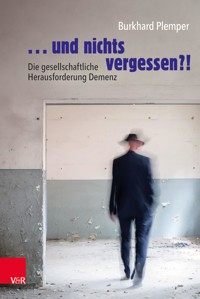
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Vandenhoeck & Ruprecht
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Demenz ist eine gesellschaftliche Herausforderung! Wir dürfen den Umgang damit nicht in die Pflegeheime verbannen und nicht in den Familien verstecken. Wir reden viel über Demenz. Mehr über Menschen mit Demenz als mit ihnen. Mehr über eine ungewisse Zukunft als darüber, was in der Gegenwart zu tun ist. Mehr über befürchtete Einschränkungen als über verbleibende Möglichkeiten. Allerorten wird die alternde Gesellschaft beschworen, wird das Bild einer zunehmend verwirrten und pflegebedürftigen Bevölkerung der Öffentlichkeit präsentiert, für die immer weniger Pflegepersonen bereitstehen werden, geschweige denn das Geld, sie als Dienstleister zu bezahlen. Burkhard Plemper setzt sich aus einem anderen Blickwinkel mit der Demenz auseinander. Er stellt gesellschaftliche Reaktionen in den Mittelpunkt. Der Soziologe lässt die Leser teilhaben am ersten öffentlichen Auftritt einer inzwischen bekannten Aktivistin, die ihr Pseudonym ablegt hat und nun offen mit ihrer Demenz umgeht, an der Verzweiflung und der Hoffnung des Juristen, der trotz der mitunter erdrückenden Fürsorglichkeit seiner Frau noch ein gutes Leben haben will. Eine Demenz weckt Ängste, vor allem, wenn keine Ursache erkennbar ist. Das macht das, was als "Alzheimer" bezeichnet wird, so unheimlich: die Furcht vor dem Kontrollverlust, vor Veränderung, gar Verfall der Persönlichkeit. Diese Angst gipfelt in der Aussage "Lieber tot als dement", vor allem, wenn Symptome wie Verwirrtheit nicht erst in hohem Lebensalter auftreten. Wie leben Menschen mit Demenz und ihre Angehörigen? Demenz ist eine gesellschaftliche Herausforderung und geht alle an. Sie ist eine Aufgabe der Zivilgesellschaft. Burkhard Plemper stellt Mut machende Ideen vor und Mut machende Menschen, die sich ihrer Demenzstellen. Gemeinsame Sorge ist so viel mehr als Pflege.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 483
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Burkhard Plemper
... und nichts vergessen?!
Die gesellschaftliche Herausforderung Demenz
Vandenhoeck & Ruprecht
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.de abrufbar.
© 2018, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Theaterstraße 13, D-37073 Göttingen
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk und seine Teile sind urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung in anderen als den gesetzlich zugelassenen Fällen bedarf der vorherigen schriftlichen Einwilligung des Verlages.
Umschlagabbildung: © Nordreisender – Adobe Stock 67252750
Satz: SchwabScantechnik, GöttingenEPUB-Produktion: Lumina Datamatics, Griesheim
Vandenhoeck & Ruprecht Verlage | www.vandenhoeck-ruprecht-verlage.com
ISBN 978-3-647-90115-2
Inhalt
Wäre es einfach, wäre es keine Herausforderung
Ich rede für mich selbst
Eine Krankheit?
Die Dämonisierung der Demenz
Zeit des Niedergangs in den Medien
Lieber tot als dement?
Der aussichtslose Kampf der Angehörigen
Wohlwollend daneben?
Die Wirkung der Bilder
Stereotype des Alters
Und dann auch noch Demenz
Angst
Woher diese Angst?
Das lohnende Geschäft mit der Angst
Und was ist so furchtbar an der Demenz?
Kleiner Ausflug in die Tiefen der Philosophie
Festplatte gelöscht?
Kommunikation? Geht doch!
Die Grenzen der Zumutung
So wie daheim – in der Nachbarschaft
Menschen mit Demenz gehören dazu!
Notwendige Infrastruktur
Polizei
Rettungsdienst
Demenzsensibles Krankenhaus
Freiwillige – Retter des Sozialstaates?
Der alte Tischler
Horror Heim? – Besseres (als) Heim?
Idylle hinterm Zaun – Von Holland lernen?
Man gibt hier keinen einfach ab!
Selbstbestimmt bis zuletzt?
Die fürsorgliche Einschränkung der Selbstbestimmung
Selbstbestimmung ermöglichen!
Und im Alltag?
Die künstlerische Darstellung der Demenz
Der alte König und sein schreibender Sohn
Demenz auf der Bühne
Der verwirrte Theaterbesucher. Eine tragische Farce
Als Oma seltsam wurde
Da war doch noch was …?
Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner
Literatur
Nützliche Kontakte
Wäre es einfach, wäre es keine Herausforderung
Es ist nahezu unmöglich, dem Thema Demenz zu entgehen. Allerorten wird die alternde Gesellschaft beschworen, wird das Bild einer zunehmend verwirrten und pflegebedürftigen Bevölkerung der Öffentlichkeit präsentiert, für die immer weniger Pflegepersonen bereitstehen werden, geschweige denn das Geld, sie als Dienstleister zu bezahlen.
Neben den anderen Formen der Demenz versetzt vor allem das, was als Morbus Alzheimer bezeichnet wird, älter werdende Menschen und ihre Angehörigen in Angst und Schrecken. Es herrscht weitgehend Konsens darüber, das Phänomen der längeren Lebenszeit und der damit eventuell einhergehenden Abnahme kognitiver Fähigkeiten der Medizin und Pflege zu überantworten. Mittlerweile hat sich ein ständig wachsender Markt entwickelt, auf dem enorme Summen umgesetzt und noch größere Erwartungen geweckt werden.
Dem möchte ich einen anderen Blickwinkel entgegensetzen: Mit der Frage NICHTS vergessen? stelle ich die gesellschaftlichen Reaktionen in den Mittelpunkt. Seit Jahren beschäftige ich mich als Journalist mit diesem Thema, bin kreuz und quer durch die Republik gereist und habe Stimmen und Eindrücke gesammelt – für Dokumentationen und Reportagen, Features und Berichte.
Ich versuche nicht die Fragen zu beantworten, woher die Demenz kommt, wie sie entsteht, wie sie sich heilen oder vermeiden lässt. Das versuchen viele andere – ohne nennenswerten Erfolg, auch wenn sie gern das Gegenteil behaupten. Wenn Sie mich als Leser begleiten, werden Sie nicht am Ende der Lektüre die Lösung für das Demenzproblem haben. Sie werden einige Menschen kennenlernen, die etwas tun. Hier und jetzt. Ganz konkret. Es geht nicht um die Utopie einer Gesellschaft ohne Demenz, sondern um Versuche, mit ihr zu leben.
Menschen mit Demenz kommen zu Wort, ihre Angehörigen und viele der ehrenamtlich und professionell Engagierten. Die sorgen in ihrem jeweiligen Umfeld dafür, dass Menschen mit Demenz nicht ausgegrenzt werden.
Sie lesen es gerade und vielleicht irritiert es Sie: Für mich gibt es nicht die Dementen, sondern Menschen mit Demenz. Das ist mehr als das Vermeiden einer als diskriminierend empfundenen Vokabel. Es ist eine grundsätzliche Haltung, diese Menschen nicht auf vermeintliche oder tatsächliche Defizite zu reduzieren. Es ist der Anspruch, nicht über sie zu reden, sondern mit ihnen.
Meine Überlegungen halte ich nicht für so einmalig, als dass sie niemand vor mir angestellt haben könnte. Wo ich mir dessen bewusst bin, habe ich es kenntlich gemacht. Wo nicht, bitte ich um einen entsprechenden Hinweis. Und sollten Sie der Meinung sein, das, was ich beschrieben habe, sei bei Ihnen doch schon seit langer Zeit alltäglich, sollten wir auch darüber miteinander ins Gespräch kommen.
Burkhard Plemper, Juli 2018
Ich rede für mich selbst
Heute sag ich meinen Namen.
Das Outing der Demenzaktivistin Helga Rohra
Von allen Gespenstern, die umgehen in Europa, verbreitet eins besonderen Schrecken: das Gespenst der Demenz. Es erscheint als Schicksal des Einzelnen, dem zunächst der Alltag entgleitet, bevor er, seiner Persönlichkeit beraubt, nur mit Hilfe anderer überlebt. Dieses Gespenst der Demenz ist das Zerrbild einer Gesellschaft, von der es heißt, sie sei allmählich überaltert und werde die Hilfe für die vielen Verwirrten nicht mehr lange leisten können. Rund 1,7 Millionen Menschen sollen es derzeit in Deutschland sein, schätzt man bei der Deutschen Alzheimer-Gesellschaft.1
Ihre Zahl könnte sich – nach dieser Schätzung – bis zum Jahr 2050 auf drei Millionen fast verdoppeln. Mit zunehmendem Alter – so werden vorliegende Daten interpretiert – soll die Wahrscheinlichkeit einer Einschränkung kognitiver Fähigkeiten steigen.2 Es mag Sie, die Leserin und den Leser3, ängstigen, dass bei über einem Drittel der Menschen über neunzig Jahren eine Demenz angenommen wird. Vielleicht lässt es Sie aber auch optimistisch in die Zukunft blicken, dass dies bei fast zwei Dritteln dieser Hochaltrigen nicht der Fall ist. Nun sagen Sie vielleicht, in einem solchen Alter sei das ja auch nicht so schlimm, aber wenn es einen schon in jüngeren Jahren erwischt …
»Ich heiße Helga Rohra – heute sag ich meinen Namen …« Eine zierliche Frau steht auf der Bühne, den Blick ins Publikum gerichtet, das Mikrophon fest in der Hand. Sorgsam wählt sie ihre Worte. Das Thema ist heikel und es fällt ihr schwer, den richtigen Ausdruck zu finden. »Vor einem Jahr – jetzt im März ist es ein Jahr – da bekam ich diese Diagnose …« fährt sie fort. Helga Rohra, damals 56, hat eine spezielle Form der Demenz. Wie die ihr Leben verändert hat, berichtet sie erstmals vor großem Publikum und mir im anschließenden Interview.4 Über 200 Interessierte sitzen in einem Saal in Stuttgart. Aus ganz Deutschland sind sie angereist. Angehörige, professionelle Helfer, vor allem aber Menschen mit Demenz, die nicht wollen, dass nur ÜBER sie geredet wird. Demenz – diese Geißel der alternden Gesellschaft – wie es oft heißt, dieser Zerfall der Persönlichkeit, bis nur noch eine leere Hülle zurückbleibt, der man eine baldige Erlösung wünscht. Dieses Vokabular des Grauens ist in Stuttgart nicht zu hören, auf dem Kongress, den sie mit Stimmig überschrieben haben. Die Veranstalter finden es stimmig, dass Menschen mit Demenz sich zu Wort melden. Und stimmig war es für die Münchnerin auch, sich mit ihrer Situation auseinanderzusetzen: »Die Diagnose erhielt ich einfach so. Ich saß da vor meinem Neurologen und er fragte, Wollen Sie’s wissen? Und ich sagte ›Ja, ich will es wissen‹«. Der Spezialist attestierte ihr eine sogenannte Lewy-Körperchen-Demenz.5
Bekannt sind Demenzen als eine Erscheinung des hohen Alters: Zwischen dem 70. und 75. Lebensjahr wird nur bei knapp jedem dreißigsten eine solche Beeinträchtigung angenommen; bei den unter 65-Jährigen noch nicht einmal bei jedem sechzigsten. (Deutsche AlzHG Infoblatt 1 – Tabelle 1) Die häufigste Form ist das, was Morbus Alzheimer – Alzheimersche Krankheit – genannt wird. Benannt ist dieses Phänomen nach Alois Alzheimer, der zu Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts nach dem Tod seiner verwirrten Patientin Adele D. Veränderungen in deren Hirnsubstanz festgestellt hat.6 Selten kommt es vor, dass jemand in relativ jungen Jahren Symptome einer Verwirrtheit zeigt. Helga Rohra war erst vierundfünfzig, als die ersten Symptome auftraten:
Ich bemerkte Ausfälle … und das geht … mit so kognitiven Einschränkungen, Sie verlieren ein Vokabular, das Sie immer parat hatten. Sie meinen zuerst, Sie sind erschöpft und mein Arzt sagte, das ist ein Burnout.
Das war es aber nicht, wie am Ende einer umfangreichen medizinischen Diagnostik feststand, durch die ihre Ärzte auch Durchblutungsstörungen, eine Depression und andere behandelbare Krankheiten ausgeschlossen hatten.
Derartige Veränderungen treten nicht von einem Moment auf den anderen auf, aber irgendwann ist in der Selbstwahrnehmung eine Schwelle überschritten, und es fällt auf, dass etwas nicht stimmt.
Ich habe noch keinen passenden Ausdruck, ich sage einfach, im Frühstadium sind Sie etwas schwächer, ich sage einfach, ich schwächel etwas, wenn ich in der Gruppe bin, ja, wir sind eine große Familie, die etwas schwächelt.
Diese große Familie ist ihre Selbsthilfegruppe. Regelmäßig treffen sie sich und tauschen Erfahrungen aus, Menschen im Frühstadium einer Demenz wie die frühere Simultandolmetscherin.
Ihren Zustand bezeichnet die immer noch eloquente Mittfünfzigerin also als Schwächeln: »Vor einem Jahr schwächelte ich sehr sprachlich, ich konnte die Sätze nicht richtig bilden, ich wollte etwas sagen und ich musste umschreiben, den Begriff.« Es war für sie eine Katastrophe: Jahrzehnte hatte sie, in mehreren europäischen Sprachen zuhause, als Dolmetscherin gearbeitet, vor allem auf medizinischen Kongressen simultan übersetzt. Und dann fehlten ihr die Worte:
Ich sage, ich will meine Hausschuhe und ich sage, ich such meine Hosenschuhe, also diese Wortverstellungen, die Orientierung ist sehr eingeschränkt, vor allem räumlich, und dieses Kurzzeitgedächtnis.
Wobei sie sich aber durchaus auf unser Gespräch konzentrieren kann. Auf dem Kongress in Stuttgart redet sie mit anderen Teilnehmern, zum Beispiel mit einem Neurologen und Psychiater, den ich Jahre zuvor als engagierten Chefarzt einer Klinik für Geriatrie und Rehabilitation kennengelernt habe. Neugierig sucht er das Gespräch:
Ich bin sozusagen jetzt sehr enthusiastisch, was ich hier mithöre, mitbegleite und miterfahre, welche gute Stimmung hier ist, es ist sozusagen mitreißend, es macht richtig Spaß, hier ’rumzugehen und zu hören, dass Menschen mit Demenzen sehr wohl zurechtkommen. Sie müssen sich erheblich mühen, müssen erheblich mehr aufwenden, aber sie machen mit, und das ist noch mal begeisternd.7
Gemeinsam mit einer Sozialarbeiterin, Anleiterin einer Selbsthilfegruppe, ist er nach Stuttgart gereist:
Die hat mich auch mit dazu gebracht, mitzugehen, das ist noch mal unterstützt worden von meiner Ehefrau, die gesagt hat, Nein mach das, ich freu mich, wenn du hingehst. Und wenn du dich in die Gesellschaft mit einbringst.
Es war nämlich nicht der volle Terminkalender, der den Endfünfziger hätte abhalten können, sich mit Helga Rohra und den anderen auf dem Kongress zu treffen: »Ich bin selber Demenzkranker auch, also ich hab mich untersuchen lassen und die Diagnose war eindeutig«, nachdem andere Ursachen für seine Störungen ausgeschlossen waren. Das, was die Kollegen bei ihm als Krankheitsbild erkannten, war ihm vertraut; er hatte es bei seinen Patienten oft genug erlebt. Aber nun war er der Patient, erinnert sich der Arzt:
Das ist etwa ein halbes Jahr, ich hab einen großen Schrecken gekriegt, als ich die Diagnose kriegte, war sehr deprimiert auch. Ich hab ’ne sehr gute Familie, mit vier Kindern und ’ner sehr toughen Ehefrau, und die hat gesagt, du machst weiter da. Also du bleibst dabei und läufst nicht weg. Du stellst dich dieser Diagnose und versuchst, damit zurechtzukommen, du wirst damit zurechtkommen.
Er ist damit zurechtgekommen, aber seine Karriere als Arzt und Klinikchef war beendet, lange vor dem Zeitpunkt der regulären Pensionierung. In Stuttgart macht er auf mich nicht den Eindruck eines bemitleidenswerten Opfers eines furchtbaren Schicksalsschlages – oder wie auch immer man im allgemeinen Sprachgebrauch eine derartige Diagnose bezeichnen mag: »Das, was ich jetzt hier mitbekommen hab, die sind ja noch viel schwerer betroffen, ich bin ja noch am Anfang, und das macht Mut.«
»Was ist das Problem?«, habe ich mich zunächst gefragt, als ich mit ihm und Helga Rohra ins Gespräch gekommen bin und sie interviewt habe. Das gelegentliche Ringen um Worte, die mitunter unklare Ausdrucksweise, das Versiegen des Redeflusses mitten im Satz ist etwas, das mich auch im Gespräch mit anderen Menschen bisweilen irritiert. Die immer noch beeindruckende Eloquenz dieser beiden Unter-Sechzig-Jährigen hätte sicherlich auch manch Jüngerer gern – im Vollbesitz seiner geistigen Kräfte. Natürlich ist es einfacher, sich zu Wort zu melden, wenn man am Ende eines Satzes den Anfang nicht verloren hat. Aber auch daran kann man sich gewöhnen – wie Helga Rohra:
Mitten im Redefluss weiß man dann nicht mehr, weiß ich dann nicht mehr, was ich sagen, weitersagen möchte, aber wenn Sie den richtigen Gesprächspartner haben, der, ›ah, du hast ja davon gesprochen‹ sagt. Dann ist es so wie ein Link, wissen Sie, und dann kann es wieder weitergehen.
Diese schlichte Berücksichtigung von Schwierigkeiten in der Kommunikation – ohne dem Gegenüber mit demonstrativer Rücksichtnahme das Gefühl zu geben, es nicht ernst zu nehmen – präge den Kongress, erklärt der Veranstalter Peter Wißmann:
Wir wollen dem Gedanken eine Tür öffnen, dass Menschen mit Demenz nicht nur das sind, was sich die meisten Menschen vorstellen, Kranke, Hilfebedürftige etc., sondern viele, viele Hunderttausende Menschen, die durchaus in der Lage sind, ihre Interessen selber zu vertreten. Zu sagen, was sie sich wünschen, wie sie ihre Situation erleben.
Das bedeutet, dass trotz aller kommunikativen Schwierigkeiten Menschen mit Demenz das Programm mitgestaltet haben. Dabei war es – wie bei anderen Veranstaltungen auch – die Aufgabe der Profis, ihnen die Bühne zu bereiten, ihnen zu helfen, mit ihrem Anliegen an die Öffentlichkeit zu gehen. Das können nur wenige; wenige Menschen mit, aber auch nur wenige Menschen ohne Demenz – was bei denen allerdings selten zu kritischen Fragen führt. Aber einfach denen zuzuhören, die für uns verwirrt sind oder uns verwirren, scheint für viele unzumutbar zu sein. Da steht uns, die wir für uns in Anspruch nehmen, normal zu sein, das Bild im Weg, das wir uns von Menschen mit Demenz machen: alt, hinfällig, kommunikationsunfähig. Dabei betonen Fachleute, dass man vom Erscheinungsbild eines einzelnen Menschen mit Demenz nicht auf die mittlerweile geschätzten 1,7 Millionen in Deutschland8 schließen kann. Genauso unvorstellbar wie die maßgebliche Beteiligung der sogenannten Betroffenen an der Planung eines Kongresses – immerhin über ihre Situation – war es bis vor Kurzem, dass Menschen mit einer landläufig sogenannten geistigen Behinderung mit der Hilfe von Veranstaltungsprofis ein inklusives Filmfestival organisieren. Das haben sie bisher dreimal erfolgreich getan. (Informationen: www.klappe-auf.com)
Die Wahrnehmung von Menschen mit Demenz ist oft auf die Betrachtung eines weit fortgeschrittenen Stadiums beschränkt, auf einen Zustand, in dem tatsächlich eine verbale Kommunikation mit ihnen schwerfällt oder gar unmöglich ist. Dabei lassen wir außer Acht, dass es bis dahin ein weiter Weg ist und viele von ihnen – ob mit oder ohne ärztliche Diagnose – mehr können, als wir ihnen zutrauen. Wir isolieren sie, und sie ziehen sich zurück.
Nicht Christian Zimmermann. Der mittelständische Unternehmer aus München hat vier Jahre zuvor, vor dem sechzigsten Geburtstag, Symptome entwickelt und die Diagnose Alzheimer erhalten (beschrieben in Zimmermann/Wißmann 2011). Für den Stuttgarter Kongress hat er die Schirmherrschaft übernommen, erklärt er mir:
Weil ich mich irgendwo verpflichtet fühle, des zu verbreiten, und da es wenig Leute/Menschen gibt in Deutschland, die Demenz haben und die den Mut haben oder so, dass sie einfach des outen und des öffentlich machen. Und mein Bestreben ist es, dass diese Krankheit einfach nicht … nicht so hässlich ist, formuliert wird, formuliert werden oder so, wie eigentlich so anrüchig, ›der ist ja blöd‹ und so, das ist sicher so. Dass das einfach eine Krankheit ist wie jede andere Krankheit, und die tut auch nicht, die schmerzt nicht, und man kann mit dieser Krankheit eigentlich … gut leben. Es gibt Menschen, die haben zehn Jahre die Diagnose und des ist also dann, das mildert einfach so ’ne Angst, weil ich hab jetzt heute, auf so ’ne, man spricht Event, erst erfahren, dass es welche gibt, die zehn Jahre bereits die Diagnose haben.
Es ist den Kongressbesuchern in Stuttgart wichtig, ihre Beeinträchtigung nicht zu verheimlichen, zu bagatellisieren oder gar in ein romantisches Licht zu tauchen, wenn sie betonen, dass auch mit einer Demenz ein gutes Leben möglich sei. Trotz der Angst, die natürlich für viele eine geradezu beherrschende Rolle spielt. Auch für Christian Zimmermann:
Weil des is ne Krankheit, die kann man auch äh besiegen, des is ganz schwer, so des zu überwinden, die erste Stufe daro, die Krankheit net, des, den Dings des Grauen von der Krankheit wegnimmt. Und da halt muss sich jeder irgendwie so seine Technik erfinden. Dass er’s, wie er’s macht. Also ich bin mit meiner Fähigkeit, dass i gsagt hab, die Krankheit is in mir und ich drück sie und die nimmt mir ja niemand ab, auch nicht meine Frau oder so, ich hab sie und sie wird mich mein ganzes Leben begleiten.
1Deutsche AlzHG Infoblatt 1 Die Häufigkeit von Demenzerkrankungen. Stand: Juni 2018. https://www.deutschealzheimer.de/fileadmin/alz/pdf/factsheets/infoblatt1_haeufigkeit_demenzerkrankungen_dalzg.pdf – abgerufen am 09.07.2018.
2Deutsche AlzHG Infoblatt 1 – Tabelle 1: Prävalenzrate in der Altersgruppe 90 und älter 41 Prozent. Bezug auf Daten von Alzheimer Europe, EuroCoDe Prevalence of dementia in Europe und des Statistischen Bundesamtes.
3Im Folgenden verwende ich der Einfachheit halber die männliche Form; selbstverständlich sind alle Geschlechtsidentitäten gemeint.
4Angaben zu den Interviews finden Sie im Verzeichnis der Gesprächspartner. Informationen zu ihrer Geschichte: Rohra, H. (2011).
5Informationen zur Lewy-Körperchen-Demenz: https://www.deutsche-alzheimer.de/die-krank-heit/andere-demenzformen/lewy-koerper-demenz.html – abgerufen am 08.06.2018.
6Zur Biografie des Arztes Alois Alzheimer siehe z. B. Jürgs 2006. Kritisch beleuchten die Entstehung und Karriere des Morbus Alzheimer Whitehouse 2009, Kap. 3 Das beunruhigende Erbe des Dr. Alois Alzheimer und der Auguste D., und Stolze 2011, S. 16 ff. Die Karriere einer Epidemie.
7Dieser Gesprächspartner bleibt anonym wie alle, die nicht ausdrücklich – wie Helga Rohra – ihrer Namensnennung zugestimmt haben.
8Von dieser Zahl geht die Deutsche Alzheimer Gesellschaft inzwischen aus: https://www.deutsche-alzheimer.de/fileadmin/alz/pdf/factsheets/infoblatt1_haeufigkeit_demenzerkrankungen_dalzg.pdf – abgerufen am 09.07.2018.
Eine Krankheit?
Eine Ursache ist, glaube ich, dass man alleine ist.
Milofa, 52, Passantin
Was ist das nun, was Christian Zimmermann und Helga Rohra schildern und viele andere genauso erleben?
Fachleute sagen: Kennst du einen Menschen mit Demenz, kennst du einen. Im Kölner Volksmund heißt es: Jeder Jeck ist anders – wenn auch nicht auf das Phänomen bezogen, das wir Demenz nennen. Vom Lateinischen hergeleitet klingt es nach wissenschaftlicher Expertise:
Eine Demenz ([deˈmɛns], lateinisch dementia) ist ein psychiatrisches Syndrom, das bei verschiedenen degenerativen und nichtdegenerativen Erkrankungen des Gehirns auftritt. Der Begriff leitet sich ab von lat. demens ›unvernünftig‹, ohne mens, das heißt, ohne Verstand, Denkkraft oder Besonnenheit seiend und kann mit ›Nachlassen der Verstandeskraft‹ übersetzt werden […] (https://de.wikipedia.org/wiki/Demenz abgerufen am 18.01.18)
Das klinische Wörterbuch Pschyrembel erklärt in seiner Online-Ausgabe:
Alltagsaktivitäten beeinträchtigende, erworbene, in der Regel chronisch-progrediente Störung des Gedächtnisses und weiterer kognitiver Funktionen, die über mindestens 6 Monate und nicht im Rahmen eines Delirs besteht.
Symptome werden unter dem Stichwort ›Alzheimer-Krankheit‹ aufgeführt:
Primär degenerative Hirnerkrankung mit progredienter Demenz (häufigste Demenzursache). Mischformen mit vaskulärer Demenz sind möglich. Initial treten subjektive, dann objektivierbare Gedächtnisstörung auf, im weiteren Verlauf zunehmend kognitives Defizit und Demenzsyndrom (Unruhe, Orientierungsstörung, Wortfindungsstörung, Agnosie, Apraxie, Stimmungslabilität, Wahn) […]9
In der Terminologie von Medizin und Pflege werden verschiedene Formen der Demenz unterschieden. Das, was Morbus Alzheimer genannt wird, also Alzheimer-Krankheit, ist nur eine Form, wenn auch die häufigste. Wenn nach längerem Vorhandensein bestimmter Symptome und am Ende aufwendiger Untersuchungen keine Pick’sche Krankheit festgestellt wurde, wie die Frontotemporale Demenz auch genannt wird, keine Durchblutungsstörungen, die eine sogenannte Vaskuläre Demenz zur Folge haben, keine Beeinträchtigung durch Lewy-Körperchen vorliegt usw., dann nennt man es eben Alzheimer.10
Was Alois Alzheimer bei seiner Patientin Auguste Deter zu Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts gefunden hat, physiologische Veränderungen der Hirnsubstanz, kann man zu Lebzeiten nicht feststellen, sondern erst durch einen Gehirnschnitt nach dem Tod. Selbst die Deutsche Alzheimer Gesellschaft schränkt ihre zuvor optimistisch verkündete Botschaft »Auch die Alzheimer-Krankheit kann mit geringem diagnostischen Aufwand gut erkannt werden« wie folgt ein: »Mit endgültiger Gewissheit lässt sich die Diagnose der Alzheimer-Krankheit nur durch die Untersuchung des Gehirns nach dem Tod stellen.« (https://www.deutsche-alzheimer.de/fileadmin/alz/pdf/factsheets/FactSheet03_2012.pdf)
Immer noch. Auch deshalb gibt es harsche Kritik an der als vorschnell empfundenen Behauptung, ein Patient habe diese Krankheit. Etwa im Buch Vergiss Alzheimer! von Cornelia Stolze, die im Untertitel Die Wahrheit über eine Krankheit, die keine ist, kundtut. Oder bei den Soziologen Reimer Gronemeyer und Rüdiger Dammann, die provozierend fragen: Ist Altern eine Krankheit?
Aber was ist das nun: Eine mögliche – wenn auch seltene und unangenehme – Form des Alterns? Oder ist es eine Krankheit? Diese Frage mag erstaunen, wenn ein Nicht-Mediziner die gesellschaftliche Herausforderung Demenz thematisiert. Aber die Überantwortung dieses Phänomens an Experten in Medizin und Pflege ist Teil des Problems, das ich hier darstellen möchte.
Ich bin von meinen Kollegen schon mal sehr, sehr gescholten worden, als ich mich öffentlich geäußert habe zu dieser Frage und behauptet hab, man könne es eigentlich nicht als Krankheit bezeichnen, da es so regelhaft im Alter auftritt.
… hat sich der Direktor einer großen Psychiatrischen Klinik vorgewagt, Professor Hans Förstl. Als regelhaft im Alter erkennt der Nervenarzt das Auftreten von Demenzen – je älter jemand wird, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, Anzeichen von Verwirrung zu zeigen. Bei einem Alter über neunzig Jahren werden sie bei mehr als jedem Dritten beobachtet (Deutsche AlzHG Infoblatt 1 – Tabelle 1).
Andererseits ist es natürlich so, dass ich schon zugeben muss, nicht alle erleben ihre Demenz, den Morbus Alzheimer, und ich sehe Chancen, dass man es eines Tages verhindern oder – besser noch – wird behandeln können […] vielleicht sollte man da keinen akademischen Streit vom Zaun brechen,
… formuliert der Nervenarzt mit professionellem Optimismus seine Utopie. Es geht aber nicht nur darum, wer in einer wissenschaftlichen Kontroverse Recht behält. Die Definition hat erhebliche Konsequenzen im Alltag: »Es ist eine schwere Krankheit, die vor allem alte Menschen trifft«, widerspricht auf Grund seiner praktischen Erfahrung Jan Wojnar dem Münchner Klinikdirektor. Lange Jahre hat der Gerontopsychiater als Heimarzt die Bewohner in den damals städtischen Pflege-Einrichtungen Hamburgs betreut.
… und ich finde das unverantwortlich, wenn man versucht, die Demenz nur als eine Alterserscheinung zu bagatellisieren, weil man dadurch auch dem Kostenträger gute Argumente liefert, eventuell weniger Geld in diesen Bereich zu investieren und dadurch das Leben der Demenzkranken viel schlimmer [zu] gestalten als es möglich wäre.
Ein nachvollziehbares Argument aus der Alltagssicht des Heimarztes, dessen Patienten meist an einer Vielzahl von Krankheiten leiden – Multimorbidität genannt. Seine Auffassung ist wahrlich kein Argument in einem akademischen Streit, sondern darin begründet, wie wir unser Versorgungssystem organisiert haben: Mit der Definition als Krankheit werden Menschen mit Demenz zu Patienten und haben Anspruch auf Leistungen des medizinischen Systems – und seit Januar 2017 auch der Pflegeversicherung.
Ist das sinnvoll? Mancher wird sich erinnern, wie lange es gedauert hat, Alkoholabhängige als therapiebedürftig anzusehen und nicht mehr als liederliche Trunkenbolde, die es trockenzulegen oder zu verwahren galt. Im Jahr 1952 hat die Weltgesundheitsorganisation WHO Alkoholismus als Krankheit anerkannt; erst im Jahr 1968 hat das Bundessozialgericht diese Definition übernommen.11Andererseits war noch bis 1992 Homosexualität im internationalen Klassifikationssystem ICD 9 unter der Nummer 302.0 als eine Krankheit verzeichnet, die behandelt werden sollte. Heutzutage mutet das grotesk an – außer für Menschen mit einem entsprechenden Weltbild.
Für die Deutsche Alzheimer Gesellschaft steht fest:
Die Alzheimer-Krankheit ist eine fortschreitende hirnorganische Erkrankung, die zur Zeit nicht heilbar ist. Sie ist die häufigste Form einer Demenzerkrankung und keine zwangsläufige Alterserscheinung. […] Die Erkrankten haben sowohl ein Recht auf Diagnostik und Behandlung als auch auf umfassende Versorgung und Begleitung. (https://www.deutsche-alzheimer.de/ueber-uns/leitbild.html, abgerufen am 22.01.2018)
Die Selbsthilfeorganisation der Menschen mit Demenz, in der Anfangszeit vor allem ein Zusammenschluss ihrer Angehörigen, unterwirft sich der medizinischen Sichtweise und Definition. In ihrem Leitbild betonen die – wenn man sie salopp so nennen darf – Lobbyisten der Verwirrten vor allem aber ihre gesellschaftliche Verantwortung:
Wir werben in der Öffentlichkeit um Verständnis, indem wir über das Krankheitsbild der Alzheimer-Krankheit und anderer Demenzerkrankungen aufklären und die Berichterstattung über die Krankheit und der von ihr Betroffenen fördern. Als Lobbyorganisation nehmen wir im politischen Umfeld Stellvertreterfunktion wahr.
Professor Reimer Gronemeyer, emeritierter Soziologe an der Universität Gießen und Vorsitzender der Aktion Demenz, lehnt den Begriff Krankheit als Pathologisierung und Medikalisierung dieses Phänomens in einer Gesellschaft mit wachsender Zahl alter Menschen strikt ab. Demenz ist keine Krankheit, hat er deshalb sein Buch genannt, in dem er den Medizinern die Deutungshoheit streitig macht:
Die Medikalisierung der Demenz ist ein Irrweg, der – angesichts der Hilflosigkeit der Medizin im Umgang mit der Demenz – mehr zum Elend der Menschen mit Demenz beiträgt, als dass er aus dem Elend herausführt oder es mildert. (Gronemeyer 2013, S. 39)
Die Biologin Cornelia Stolze hat ihren Rat Vergiss Alzheimer! mit dem Geschäft mit der Angst vor dem Vergessen begründet – neben der Kritik an der nach ihrer Ansicht mangelnden Sorgfalt der Wissenschaftler in diesem Bereich der medizinischen Forschung. (Stolze 2011, S. 30 ff.)
Die Auseinandersetzung um die Einordnung der Demenz ist in der Tat ein Streit nicht nur um die Deutungshoheit. Es geht um Geld, viel Geld, um die Kosten für und die Einnahmen aus Diagnostik und Behandlung, Betreuung, Versorgung und Pflege der Betroffenen, um lockende Etats für die Forschung, um einen Markt, der viel verspricht: »Die Zahl der Demenzkranken steigt rasant – doch nur wenige Unternehmen erkennen die Geschäftschancen«, bedauerte medbiz Magazin für Gesundheitswirtschaft der Financial Times Deutschland in seinem Schwerpunktheft Vorsorge, Alter, Pflege. Diese Wirtschafts-Zeitung, die es längst nicht mehr gibt, verbreitete daraufhin Hoffnung für wenigstens einen Teil ihrer jung-dynamischen Leserschaft: »Die Pharmazeutische Industrie hat die Demenzpatienten längst entdeckt«, frohlockte die Autorin über die Vorreiter und mahnte eine ähnliche Entwicklung in anderen Zweigen der Wirtschaft an, etwa bei Unternehmen, die technische Überwachungssysteme entwickeln: »In Singapur spricht man von einem silbernen Tsunami. Auch in Deutschland wird die Gesellschaft immer älter.« (Spanner 2009) Zweifellos. Und mit dieser Entwicklung lassen sich gute Geschäfte machen. Für die Kanalisierung der gewaltigen Geldströme geht es dann natürlich um die Definition dessen, was als Problem gesehen wird.
Was haben die Ärzte da zu bieten? In der Reihe der systematisch erarbeiteten oder zufällig entdeckten Erkenntnisse der Medizin steht Alois Alzheimer mit seiner Arbeit neben den ganz Großen wie dem Erforscher der Tuberkulose Robert Koch oder dem ›Retter der Mütter‹ Ignaz Semmelweis, der die Ursache des Kindbettfiebers fand. Die Erfolgsgeschichte der nach ihm benannten Krankheit begann mit einem Vortrag Alzheimers im Jahre 1906 vor einer Versammlung damals sogenannter Irrenärzte über seine Patientin Auguste D. Die hatte bereits mit 51 Jahren die Auffälligkeiten gezeigt, die heute bei einer Reihe vor allem älterer Menschen festgestellt werden. (Beschrieben u. a. in Jürgs 2006, S. 47 ff.)
Zwei Phänomene der Moderne mussten dazu kommen, um Morbus Alzheimer den heutigen Boom zu bescheren: Die Tatsache, dass immer mehr Menschen in den Industrie-Nationen durch verbesserte Lebensbedingungen relativ gesund ein Alter erreichen, das in früheren Zeiten nur wenigen vergönnt war. Dazu kommt die enorme Leistungsfähigkeit der Medizin. Die hilft vielen, Krankheiten zu überstehen, die ihre Großeltern noch dahingerafft hätten. Aber dann gibt es Probleme bei den Synapsen, schlagen Plaques und Fibrillen im Hirn gnadenlos zu – verkünden Neurologen und Psychiater. Die lassen Alte erst wunderlich und dann für ihre Umgebung oft unerträglich werden. Das mag schon immer so gewesen sein, fällt aber der Öffentlichkeit erst auf, seitdem die Zahl der Hochbetagten so enorm zugenommen hat. Wenn das, was gemeinhin als Alzheimer bezeichnet wird, tatsächlich eine Krankheit ist, sollte ein als Ursache festgestelltes Merkmal die Gruppe der Kranken von der der Gesunden trennen.
Im Jahr 2001 hat die sogenannte Nonnenstudie (Snowdon 2001) Aufsehen erregt, jüngst auch entdeckt vom Neurobiologen Gerald Hüther (Hüther 2017): Von einem gut kontrollierten Kollektiv – Nonnen des Ordens School Sisters of Notre Dame – sind Lebensumstände, Lebens-Äußerungen und biologische Befunde nach dem Tod ausgewertet worden. Es zeigte sich, dass die Verwirrten unter ihnen nicht unbedingt die berüchtigten Fibrillen und Plaques im Hirnschnitt zeigten und andere, bei denen das Präparat mit eben diesen Veränderungen eine fortgeschrittene Demenz vermuten ließ, ohne Verhaltensauffälligkeiten ein hohes Alter erreicht hatten, gar als hochintelligent galten. Vielleicht ist es eine Frage der Perspektive.
Ich bin mir aus meiner nervenheilkundlichen Sicht einigermaßen sicher, dass es so etwas wie – in Anführungszeichen – normales Altern, gesundes Altern geben könnte. Aber alles, was ich kenne, beruflich, ist krankhaftes Altern. Und auch, wenn jemand die Stadien der eindeutigen … Jetzt habe ich mir gerade widersprochen, wie ich merke … Also, alles, was ich an Altersveränderungen wahrnehme, was die Leistung betrifft, was die Hirnveränderung betrifft, das ist nicht vorteilhaft im höheren Alter,
… bekennt der Psychiater Förstl freimütig die Schwierigkeiten, Alzheimer richtig einzuordnen. Dagegen wartet der Soziologe Gronemeyer mit einer ganz anderen Art von Erklärung auf:
Ich erinnere mich an meine Kindheit, an eine Frau, die nach heutigen Maßstäben und Diagnosen wahrscheinlich alzheimerkrank wäre, wo damals, auf der Nordseeinsel, gesagt wurde, ›die ist eben tüttelig‹. Und dafür hatte man auch seine Erklärung: Der war nach Ansicht der Kinder eine Fliege ins Ohr gekrochen und die war ins Gehirn gelangt und summte da herum. Nicht unbedingt ein naturwissenschaftlich haltbares Argument, aber es war die Folge, dass sie in ihrem sozialen Kontext sehr gut weiterleben konnte und mit den Aufgaben betraut war, die sie bewältigen konnte.
Sozialwissenschaftler wie Gronemeyer kritisieren, dass alte Menschen, die ein bestimmtes Verhalten zeigen, deshalb etikettiert werden. Eine Überlegung, die für viele naturwissenschaftlich orientierte Mediziner eine Zumutung ist, zumindest etwas, das sie nicht ernst nehmen.
Aber vielleicht lassen die sich durch die Bedenken eines Vordenkers ihrer Zunft verunsichern. Als solchen kann man Peter J. Whitehouse getrost bezeichnen, Psychiater und Neurologe in den USA; er forscht und lehrt an der Case Western Reserve University in Cleveland/Ohio. Für mehr als drei Jahrzehnte war er dem gängigen Erklärungsmuster verhaftet, hat multinationale Pharmafirmen beraten und Millionen Dollar an Forschungsmitteln verbraucht. Diesem Star seines Berufsstandes ist irgendwann aufgefallen, dass sein wissenschaftliches Fundament höchst fragil war. Den gängigen Versuch, die Verwirrtheit alter Menschen zu erklären, führt er auf einen Mythos zurück und ist bemüht, die diesem zugrunde liegenden Annahmen zu erschüttern.
Er betont, dass »die sogenannte Alzheimerkrankheit sich vom normalen Alterungsprozess nicht wirklich unterscheiden lässt und dass kein Krankheitsverlauf mit einem anderen identisch ist« (Whitehouse 2009, S. 34). Im Interview, das ich mit ihm geführt habe, drückt er es so aus:
Wenn wir altern, laufen bei uns allen einige der biologischen Prozesse ab, die unser Gedächtnis beeinflussen. Einige von uns haben das Glück zu sterben, bevor wir ernste Schwierigkeiten bekommen, und unglücklicherweise haben andere erhebliche Gedächtnisprobleme.
Die Folge für den Neurologen und Psychiater ist, »dass wir nicht einmal wissen, wie wir die Alzheimerkrankheit diagnostizieren sollen, geschweige denn, wie die Zahlen der von der Krankheit Betroffenen darzustellen sind« (Whitehouse 2009, S. 34). Er bezieht sich selbstverständlich auch auf die berühmte Nonnenstudie Snowdons (S. 101/107), die auch bei ihm Zweifel am Zusammenhang zwischen nach dem Tode festgestellten physiologischen Veränderungen der Hirnsubstanz und dem Auftreten von Verwirrtheit genährt hat. So zieht er mir gegenüber den Schluss: »Es ist überhaupt keine Krankheit!« Mit dem, was Mediziner heute als Alzheimer bezeichnen, erst recht, was sie zur Bekämpfung oder Behandlung der Alzheimer-Krankheit veranstalten, werde dem Namensgeber »schweres Unrecht« (S. 47) angetan. Dazu komme, führt er im Gespräch aus, dass der Begriff Alzheimer mysteriös sei, schließlich liege die Macht dieses Wortes in der Angst:
Wir haben damit klar gemacht, dass es schlimmer ist als der Tod und die Leute sich davor fürchten sollten. Und sie sollten auf eine magische Antwort auf ihre Angst hoffen.
Ein solches Argument würden die Vertreter der herkömmlichen Medizin normalerweise nicht einmal achselzuckend zur Kenntnis nehmen. Einen der ihren, der Whitehouse zweifellos ist, können sie aber nicht einfach ignorieren.
Der Peter Whitehouse ist ein sehr erfahrener Alzheimerforscher, auch ein Mann der ersten Stunde, der früher grundlagenmäßig gearbeitet hat, auch ein sehr ethisch interessierter Kollege,
… möchte ihm der Direktor eines namhaften Südwestdeutschen Forschungsinstituts den Respekt nicht versagen – beim Symposion eines großen Pharmaherstellers. Deshalb – vielleicht könnte jemand seine Unabhängigkeit bezweifeln – sei zum Schutz seiner Reputation sein Name hier verschwiegen. Das kennt der Amerikaner Whitehouse von seinen Kollegen, dass die seine Argumente aus fachlicher Sicht nachvollziehen können, aber davor zurückscheuen, es zu tun, auch weil sie fürchten, Gelder für die Forschung zu verlieren:
So ist es beides: in der persönlichen Begegnung freundlich sein, mich öffentlich ignorieren, aber gleichzeitig mit vielem übereinstimmen, was ich sage – hinter vorgehaltener Hand.
Von seinem deutschen Kollegen kann Whitehouse auf dieser Tagung des Pharma-Unternehmens allerdings noch nicht einmal so etwas wie klammheimliche Zustimmung erwarten:
Ich bin weit davon entfernt, ihm zu unterstellen, dass er da eine Verschwörung konstruiert. […] Aber das ist – sagen wir mal – eine sehr abstrakte Sicht der Dinge, dass […] so ein Kartell zwischen Alzheimer-Gesellschaften, Alzheimer-Forschern und Industrie bestünde, was ja ein Teil seiner These da ist, krankheitserfindend quasi, ja. Das ist, glaube ich, eine Verkennung der Realität.
Peter J. Whitehouse geistert mit der Kritik an seinen Berufs- und Standeskollegen keineswegs durchs Dunkel obskurer Verschwörungstheorien. Die für die Gesundheit der Patienten oft unheilvolle Verquickung wirtschaftlicher Interessen mit ärztlichem Handeln im Bereich der Demenz schildert mit bemerkenswerter Detailgenauigkeit die Biologin und Wissenschaftsjournalistin Cornelia Stolze (2011). Und wie sich geschäftliche Interessen auf die Definition von möglichen psychischen Krankheiten auswirken, zeigt Whitehouses renommierter Kollege Allan Frances, Psychiater in den USA. Lange Jahre hat der das Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, den sogenannten DSM herausgebracht. Dieses Handbuch ist die Grundlage für die Behandlung psychischer Krankheiten. Die Definitionen gehen ein in die Liste gesundheitlicher Störungen der Weltgesundheitsorganisation WHO: ICD – International Classification of Diseases. Von der dritten Fassung des DSM 1980 – die erste stammt aus dem Jahr 1952 – bis zur revidierten vierten im Jahr 2000 war Allan Frances dabei. Danach hat er sich in den Ruhestand verabschiedet und ist entsetzt, was seine Nachfolger daraus gemacht haben (Frances 2013): Er wirft ihnen vor, den Wünschen der Vertreter pharmazeutischer Unternehmen gefolgt zu sein, die ein Interesse daran haben, möglichst viele zuvor als störend, aber nicht gravierend eingeschätzte Beeinträchtigungen als Krankheiten zu klassifizieren. Ist das geschehen, eröffnen diese neuen Krankheiten enorme Chancen, Medikamente dagegen auf den Markt zu bringen. Ein Beispiel, das in Psychotherapeutenkreisen auch in Deutschland für Empörung gesorgt hat, ist der Umgang mit Trauer: Gab es früher – je nach kulturellem Hintergrund – so etwas wie ein Trauerjahr, so ist das im Laufe der Zeit geschrumpft. Künftig soll – nach DSM 5 – die Trauer nach dem Verlust einer nahestehenden Person nach zwei Wochen abgeklungen sein, sonst wird sie als psychische Störung und damit als behandlungsbedürftig eingeschätzt.
Mit der neu eingeführten Diagnose Disruptive Mood Dysregulation Disorder – DMDD werden bisher als alterstypisch eingeschätzte Wutausbrüche von Kindern und Jugendlichen als psychische Krankheit und damit ebenfalls als behandlungsbedürftig definiert. Es ist keinesfalls beruhigend, dass die USA weit weg sind und die Bevölkerung dort vielleicht einen anderen Umgang mit Medikamenten pflegt. Über den ICD – demnächst die Fassung 11 – setzt sich eine solche Sichtweise weltweit durch, bis in Diagnose- und Behandlungspläne bei uns. Psychotherapeuten sind deshalb in Aufruhr und fürchten, ihren Patienten mit schwerwiegenden Beeinträchtigungen künftig noch weniger als jetzt schon gerecht werden zu können: Die müssten längere Wartezeiten in Kauf nehmen, wenn die Praxen von Menschen überrannt werden, die ihre Befindlichkeitsstörungen behandeln lassen wollen, die zwar durchaus nervig sein können, aber von Experten bisher nicht als Krankheit angesehen werden.12
Der Wunsch von Wissenschaftlern, auch der Demenz als einem Geheimnis des Lebens auf die Spur zu kommen, ist verständlich, auch ihr Ehrgeiz, eine bahnbrechende Entdeckung zu machen und den eigenen Namen in der Ruhmeshalle der Medizin zu verewigen. Noch wichtiger dürfte auch ihnen die darauf aufbauende Suche nach einem Impfstoff oder einer wirksamen Therapie sein, deren Entdeckung neben Ruhm auch sehr viel Geld verspricht. Und da sind die eifrigen Forscher – wie sie selbst zugeben – noch sehr, sehr weit entfernt von dem, was den Menschen helfen könnte, die auf Heilung hoffen oder darauf, irgendwie das im Alter drohende Unheil abzuwenden.
Was aber sagt der Kritiker Peter Whitehouse den Patienten, ihren Angehörigen und all den anderen, die fürchten, irgendwann einmal eine Demenz zu entwickeln – schließlich forscht er nicht nur als Wissenschaftler, sondern ist auch Arzt?
Erst einmal sage ich, dass ich hoffe, falsch zu liegen: Morgen lese ich vielleicht ein Paper und es gibt die Heilung. So muss ich ehrlicherweise sagen, ich weiß die Antwort auch nicht. Aber ich bin misstrauisch genug zu sagen, dass diese Geschichte wohl nicht wahr ist, dass wir über andere Wege nachdenken müssen, um Hoffnung zu schöpfen. Für mich liegt diese Hoffnung nicht in Zauberpillen, nicht in Versprechungen für die Zukunft. Sie liegt in den Gemeinden, in denen wir alle leben.
Es kommt nicht allzu oft vor, dass ein sogenannter Schulmediziner so selbstkritisch die Möglichkeiten seiner Profession einschätzt und, statt auf individuelle Diagnostik und Therapie zu setzen, die gesellschaftliche Herausforderung benennt.
Die Befürchtung, die westlichen Industriegesellschaften könnten wegen der stetig steigenden Lebenserwartung irgendwann von einem unüberschaubaren Heer verwirrter Alter überfordert werden, versucht der Münchner Klinik-Direktor Förstl zu zerstreuen. Möglicherweise sind die Schätzungen, wie viele Menschen in einigen Jahren eine Demenz entwickeln, übertrieben, setzt er im Gespräch der aufkommenden Panik etwas entgegen:
Vielleicht müsste man eine Überlegung anstellen, wodurch der Mensch so alt wird in unserer westlichen Gesellschaft. Und das gibt dann auch wieder etwas Hoffnung. Denn wir werden ja so alt, weil wir so lang so gesund bleiben, und davon profitiert natürlich auch das Gehirn. Das zeigt sich auch an den Zahlen aus der Epidemiologie: Man erkennt, dass die Demenzrate pro Altersstufe etwas absinkt. Dieser Effekt konkurriert damit, dass die Lebenserwartung steigt. Und wie das Rennen ausgeht, zwischen den Organsystemen, zwischen diesen beiden Rechengrößen, das ist heute noch gar nicht entscheidbar. Es ist sicher vernünftig, mit hohen Zahlen zu rechnen und entsprechend motiviert an die Sache heranzugehen.
Aber eben ohne in Panik zu verfallen oder hoch motiviert der Versuchung zu erliegen, mit dem Kniff der Dramatisierung die eigene Demenz-Studie in der Prioritätenliste der Forschungsfinanzierung ein wenig nach oben zu schieben. Wie es den Forschern bisher nicht gelungen ist, schlüssig zu erklären, was bei Alzheimer eigentlich vor sich geht, leuchtet ihnen auch nicht ein, dass offensichtlich weniger alte Menschen überhaupt eine Demenz entwickeln. Ein »rätselhafter Demenz-Rückgang« sei das, was US-Forscher jüngst festgestellt haben, meldete die Ärzte-Zeitung online im September 2017.13
Es sind nicht nur rein naturwissenschaftlich orientierte Schulmediziner und sogenannte Leistungserbringer des Versorgungssystems, denen die Definition der Demenz als Krankheit ein Anliegen ist. So empfinden viele Angehörige die ärztliche Diagnose Demenz vom Typ Alzheimer – oder einer anderen Variante – als eine Entlastung. Das ist ein Widerspruch: Einerseits ist es ein Urteil, gegen das keine Berufung möglich ist; schließlich gibt es kein Heilmittel. Andererseits liefert ein solches Urteil eine schmerzliche, aber irgendwie nachvollziehbare Erklärung für die als unerträglich empfundene Veränderung im Verhalten eines geliebten Menschen. Er oder sie spinnt nicht einfach, ist nicht plötzlich gemein geworden, sondern ist – krank. »Gott sei Dank habe ich ihr damals keine Vorwürfe gemacht. Sie wusste bereits: Es ist kein böser Wille. Auch keine Schusseligkeit. Es ist Alzheimer.« So zitiert der Tagesspiegel die Angehörige einer alten Frau mit Demenz.14
Wie sich die so diagnostizierte Frau mit dieser Einschätzung gefühlt hat, ist nicht überliefert. Zahlreich sind die Berichte von Menschen, die als Angehörige bei der Mitteilung der Untersuchungsergebnisse dabei waren und erlebt haben, wie es dem Patienten oder der Patientin in diesem Augenblick und danach ergangen ist. Die Münchener Simultandolmetscherin Helga Rohra erinnert sich:
Nachdem mir der Arzt die Diagnose so gerade heraus ins Gesicht gesagt hatte […], war mir, als ob ich falle. Ich sah mich selbst auf einer Rutsche, die in einem schwarzen Tunnel steil nach unten führte, immer weiter nach unten … Ich fing an zu weinen. Jetzt, wo ich darüber schreibe, ist dieses Gefühl wieder da. (Rohra 2011, S. 37)
Das Verkünden einer schwerwiegenden Diagnose ist immer eine Herausforderung für diejenigen, die diese schlechte Nachricht überbringen. Und oft ist zu hören, dass sie damit überfordert sind. »Die Aufklärung muss […] in einer auf die Befindlichkeit und Aufnahmefähigkeit des Patienten abgestimmten Form erfolgen«, stellt das Klinische Wörterbuch15 klar, worunter sich der medizinische Laie ein Mindestmaß an Zeit, verständlicher Sprache und Einfühlungsvermögen vorstellt. Aber an dieser Stelle geht es mir nicht um die Kommunikation von Ärzten mit ihren Patienten, sondern um die gesellschaftliche Wirkung der Mitteilung, jemand habe eine Demenz von diesem oder jenem Typus:
Eine Alzheimer-Diagnose kann in vielerlei Hinsicht wie eine geistige Todesstrafe wirken, die viele noch funktionsfähige Menschen in einen mentalen Todestrakt einschließt. Unser Versuch, kognitiven Abbau dadurch von seinem Stigma zu befreien, dass man ihn als Krankheit bezeichnet, welche die Last von der Person nimmt, hat die Ausgrenzung der Betroffenen in Wirklichkeit noch verschlimmert. Die Worte, die wir verwenden, um Krankheiten zu beschreiben, besitzen das Potential, emotionalen und sozialen Schaden zu verursachen.16
Nun kann man annehmen, dass sich durch die Zuschreibung Es ist Alzheimer die Herausforderungen des Alltags nicht verändert haben dürften. Die Belastungen, die sie für die Betroffenen und die Menschen in ihrer Umgebung mit sich bringen, dürften gleichgeblieben sein. Aber die bekommen einen Sinn, werden – bei allem Unverständnis für das, was man in Fachkreisen inzwischen als herausforderndes Verhalten bezeichnet – durch diese Deutung vielleicht erträglicher. Denn Ausgangspunkt eines solchen Definitionsprozesses ist ein als absonderlich empfundenes Verhalten, das als herausfordernd und erklärungsbedürftig erlebt wird. Es scheint immer noch so zu sein, dass viele Menschen sich – wenn auch nicht unbedingt von religiösen Würdenträgern – so doch von anderen Autoritäten Orientierung, die Erklärung der Welt, Rat und Hilfe erwarten. Auch in Bereichen, die nicht unbedingt etwas mit deren Profession zu tun haben. Michael Hakeem beschrieb schon in den Fünfzigerjahren des vergangenen Jahrhunderts irritiert, welch gläubiges Vertrauen Psychiatern entgegengebracht wurde, die das damals in den USA heiß diskutierte Problem der Jugenddelinquenz erklären wollten:
Man kann dies nur verstehen, wenn man sich das enorme Prestige vergegenwärtigt, dessen sich der Arzt in unserer Gesellschaft erfreut. Als Arzt verdient er sicherlich Lob. Man hat sich jedoch schon immer nicht nur in medizinischen Angelegenheiten an den Arzt gewandt, sondern ebenso wegen aller möglicher anderer Probleme, selbst in solchen Dingen, die weit jenseits des medizinischen Gebiets liegen. Der Arzt pflegte als der Weisheit Quell in ökonomischen Dingen, Familienschwierigkeiten und Gemeindeproblemen angesehen zu werden. Zu einem gewissen Grade spielt er diese Rolle noch immer, selbst nach dem Heranwachsen einer Schar anderer Disziplinen, die sich mit Gebieten befassen, auf denen früher auch der Arzt als Experte galt. Die Psychiatrie hat wie keine andere Richtung in der Medizin die alte Rolle beibehalten. (Hakeem 1979, S. 282)
Zu fragen bleibt allerdings, ob das ein Problem der Mediziner, speziell der Psychiater war und ist oder eines des gläubig zu ihnen aufschauenden Publikums. Jedenfalls kritisierte Hakeem damit eine Ausrichtung von Medizinern, die sich – nach seiner Einschätzung – eben nicht auf rein naturwissenschaftliche Erklärungsmodelle reduziert hatten. Damit haben die von ihm kritisch betrachteten Psychiater einen Ansatz verfolgt, den der Psychiater Klaus Dörner – bezogen auf Phänomene wie Demenz – grundsätzlich auf einer Veranstaltung in Dresden für richtig hält:
Wir Ärzte, wir Mediziner sind ja […] früher mal – ich sag mal: vor zweihundert Jahren – davon ausgegangen […], dass Menschen aus Beziehungen bestehen, […] vom ersten Atemzug bis zum letzten Atemzug […] Dann erkrankt nicht ein Individuum, sondern dann werden Beziehungen gestört. Ein völlig anderes Modell – erst mal auch diese negative Bewertung: Das ist ein Defekt, ein Defizit, das muss bekämpft, besiegt werden, dann ist das so ein militaristisches Bild, und das führt natürlich total in die Irre. Insbesondere […], wenn es sich um Behinderung handelt oder um psychische Störungen oder eben auch um so etwas wie Demenz.
Festzuhalten bleibt: Für ihn ist eine Demenz also kein Defizit, das in bisher aussichtsloser Schlacht bekämpft werden muss – was andererseits nicht bedeutet, dass die davon Betroffenen sich fatalistisch ihrem Schicksal ergeben. Deshalb möchte ich wie er den grundsätzlichen Streit nicht weiter verfolgen: Schließlich wüssten wir nicht, ob Alzheimer eine Krankheit oder »pures Altern« ist, erklärt er mir. »Und solange wir das nicht wissen, sollten wir uns da auch vornehm zurückhalten«, mahnt uns Klaus Dörner – salopp gesagt –, den Ball flach zu halten. Statt sich wie im Streit der Gläubigen mit den Atheisten gegenseitig auf den Scheiterhaufen bringen zu wollen – oder modern: in die Luft zu sprengen – bietet sich die Haltung der Agnostiker an: Wir wissen es einfach nicht. Und wir verschwenden unsere Energie nicht darauf, es zu beweisen oder zu widerlegen.
Allemal interessanter als die Diskussion in Medizinerkreisen ist die Reaktion der Gesellschaft insgesamt: Wie betrachten wir das Phänomen Demenz und Menschen mit Demenz, wenn wir sie nicht einfach den Profis aus Pflege und Medizin überlassen oder im Alltag versuchen, deren Ansprüchen gerecht zu werden? Wie gehen wir mit diesen Menschen um, wie verhindern wir, dass sie und ihre Angehörigen sich zurückziehen und in die soziale Isolation gedrängt werden?
Zu einem solchen Perspektivwechsel gibt es eine Parallele. Spannend finde ich einen Blick auf die kriminologische Forschung: Traditionell haben Kriminologen nach den Ursachen für abweichendes, delinquentes Verhalten gesucht. Die einen sahen den geborenen Verbrecher wie Lombroso 1876, psychische Probleme, auch mit Krankheitswert, angelernte Problemlösungsmuster, schlechten Umgang, Vernachlässigung im Elternhaus und so weiter.17 Der Deutsche Soziologe Fritz Sack eröffnete dagegen – angeregt durch die Diskussion in den USA – 1968 Neue Perspektiven in der Kriminologie:
Abweichendes Verhalten ist als ein Prozeß zu begreifen, bei dem sich die beteiligten Partner, der sich abweichend Verhaltende auf der einen Seite und diejenigen, die dieses Verhalten als solches definieren, auf der anderen Seite, gegenüberstehen. […] In diesem Sinne ist abweichendes Verhalten das, was andere als abweichend definieren. Es ist keine Eigenschaft oder ein Merkmal, das dem Verhalten als solches zukommt, sondern das an das jeweilige Verhalten herangetragen wird. (Sack 1979, S. 470)
Diese Zuschreibung des Etiketts abweichend ist abhängig von der Macht, eine solche Definition durchzusetzen. Andersherum: Das Risiko, mit diesem Attribut versehen zu werden, ist ungleich in der Gesellschaft verteilt. Je weniger Definitionsmacht eine Person besitzt, desto größer ist ihr Risiko, so etikettiert zu werden. Und je mehr Macht eine Person besitzt, desto mehr kann sie sich erlauben – und sich gegen eventuelle Etikettierungsversuche zur Wehr setzen.18
Mag dieser Ansatz nun einleuchten oder nicht, entscheidend ist, dass dessen Vertreter nicht mehr die Ursache für ein Verhalten gesucht, sondern die gesellschaftlichen Zuschreibungsprozesse und Reaktionen untersucht haben. Genauso möchte ich das Phänomen betrachten, das wir gemeinhin als Demenz bezeichnen: Ein Verhalten, das von Normen und Erwartungen abweicht. Interessant für mich als Sozialwissenschaftler ist, die Definition eines solchen Verhaltens als Abweichung zu betrachten und den gesellschaftlichen Umgang mit diesem – gegenwärtig häufiger als früher wahrgenommenen – Phänomen. Der Aspekt der Interaktion kommt ja auch im Begriff herausforderndes Verhalten zur Geltung: Offensichtlich ist das, was ein Mensch mit Demenz tut, eine Herausforderung für sein Gegenüber. Wenn dieses Gegenüber gelassen reagiert, müsste die Herausforderung damit eigentlich geringer sein. Also auch die Demenz?
9Pschyrembel online, Stichworte Demenz und Alzheimer-Krankheit – abgerufen am 24.01.2018.
10Für Informationen dazu siehe z. B. die Seite der Deutschen Alzheimer Gesellschaft https://www.deutsche-alzheimer.de/die-krankheit.html – abgerufen am 08.06.2018.
11Kurze prägnante Darstellung unter https://www1.wdr.de/stichtag/stichtag3330.html, Sendung vom 18. Juni 2008 zum Anlass des vierzigsten Jahrestages der Gerichtsentscheidung – abgerufen am 08.06.2018.
12So die Kritik anlässlich des Hamburger Psychotherapeutentages am 21.06.2014, dazu die Presse-Information der Psychotherapeutenkammer Hamburg vom 16.06.2014.
13https://www.aerztezeitung.de/medizin/krankheiten/demenz/article/943972/studie-raetsel-haft-demenz-rueckgang-kardiovaskulaer-hypothese.html – abgerufen am 08.06.2018.
14Tagesspiegel Nr. 20603 30.04./01.05.2010, S. 16 ›Margarete Bottin. Geb. 1926‹ – Nachruf.
15Pschyrembel online Stichwort Aufklärung, http://www.pschyrembel.de/Aufkl%C3%A4rung/P03V0/doc/ – abgerufen am 25.01.2018.
16Whitehouse 2009, S. 26, siehe auch Gronemeyer 2013, S. 39.
17Einen guten Überblick liefern – immer noch – Kerscher 1977 und Springer 1973.
18Dazu z. B. Keckeisen 1974, Kap. 3.4, S. 93 ff. Die Dimension der Macht.
Die Dämonisierung der Demenz
Das Leben, kein Mensch mehr zu sein.
Heinrich Grebe, Lieber tot als dement?
Diskussion im Deutschen Hygienemuseum Dresden.
Wird die Herausforderung durch Demenz tatsächlich geringer? Zu beobachten ist eher das Gegenteil: Nicht die nüchterne Analyse unseres Umgangs mit dem Phänomen Demenz ist festzustellen, sondern eine Dramatisierung, gar Dämonisierung der Demenz. Es scheint allgemeine Ansicht zu sein – darauf werde ich später eingehen –, dass Demenzen ungeheuer zunehmen, kein Kraut dagegen gewachsen ist und sie so ziemlich das Schlimmste sind, was einem Menschen im Alter passieren kann. Es ist für mich bei den vielen Menschen, die eine solche Angst äußern, nicht nachzuvollziehen, auf welchen Wegen sie zu dieser Erkenntnis oder zumindest diesem Gefühl der Bedrohtheit gelangt sind. Ich will aber der Frage nachgehen, ob diese Bedrohung, wie sie in weiten Teilen der Öffentlichkeit wahrgenommen wird, ein Konstrukt ist. Das klingt nach einer gewagten These, die gegen alles spricht, was an Wissen nicht unbedingt gesichert, aber doch weit verbreitet ist.
Ein solches Wissen zu hinterfragen, sich anzusehen, wer es generiert und auf welchen Wegen verbreitet, ist weder neu noch originell, sondern anerkannte wissenschaftliche Praxis – auch in der Soziologie. So fragen etwa Peter L. Berger und Thomas Luckmann, welche Bedingungen bei dem eine Rolle spielen, was sie Die gesellschaftliche Konstruktion der Wirklichkeit nennen:
Der Mann auf der Straße kümmert sich normalerweise nicht darum, was wirklich für ihn ist und was er weiß, es sei denn, er stieße auf einschlägige Schwierigkeiten. (Berger/Luckmann 1970, S. 2)
Auf die stößt auch, wer sich dem Thema Demenz nähert, falls er oder sie es zulassen kann, den Boden vermeintlich gesicherten Wissens zu verlassen. Und auch wenn Mediziner sich gern auf naturwissenschaftliche Gegebenheiten berufen, setzt sich bei etlichen von ihnen die Erkenntnis durch, dass man viele Dinge auch ganz anders sehen kann:
Gesundheit und Krankheit, Sterben und Tod sind nicht nur biologische Vorgänge, auch nicht nur psychische Phänomene, sie sind, wie M. Pflanz ausgeführt hat, ›wichtige Bausteine im Wertgefüge jeder Gesellschaft; das heißt, sie sind nicht, wie es die individualistische Medizin sieht, extrakulturell und außerhalb der Gesellschaft liegend, sondern sie liegen im Gegenteil im Zentrum der Gesellschaft. Sie sind daher abhängig von den vorherrschenden Ideologien, von den Glaubenshaltungen, vom sozialen Wandel. (v. Uexküll 1973, S. XII)
So zitiert der Begründer der psychosomatischen Medizin, Thure von Uexküll, seinen ehemaligen Schüler Manfred Pflanz mit dessen Werk Medizinsoziologie als Selbstreflexion des Arztes. Mit seiner Aussage stützt v. Uexküll die Thesen des amerikanischen Soziologen David Sudnow. Der – ein Schüler von Erving Goffman,19 hat etwas für viele Menschen Verwirrendes getan: Er hat das vorherrschende Verständnis von Tod und Sterben in Frage gestellt: Sudnow unterscheidet in seiner Untersuchung des Sterbens in Krankenhäusern drei Kategorien:
Den ›klinischen Tod‹, der vom Arzt anhand bestimmter Symptome konstatiert wird, den ›biologischen‹ Tod, der sich durch das völlige Erlöschen des Zellmetabolismus definieren ließe, und den ›sozialen Tod‹, der sich […] durch den Zeitpunkt bestimmen lässt, von dem ab der – ›klinisch‹ und ›biologisch‹ noch lebende – Patient im wesentlichen als Leiche behandelt wird. (Sudnow 1973, S. 98)
Das klingt ungeheuerlich und ruft bei dem einen oder anderen vielleicht Schreckensbilder von vernachlässigten Patienten in einem heruntergekommenen Krankenhaus mit überfordertem Personal hervor. Das ist nicht gemeint, sondern: Ein Patient in der Klinik gilt nicht als tot – außer er weist die sogenannten sicheren Todeszeichen auf – bevor ihn nicht jemand, der dazu befugt ist, für tot erklärt hat. Ich habe das in einem Film gezeigt: Ein Patient, von dem mehrere aus dem Team annahmen, er sei aufgrund der einige Zeit andauernden Anzeige auf den Überwachungsmonitoren bereits verstorben, wurde so lange weiter reanimiert, bis zwei leitende Oberärzte sich davon überzeugt hatten, dass wirklich kein Funken Leben mehr in ihm war.20 Sudnow betrachtet das Ergebnis eines solchen Vorgangs als sozialen Tod:
Man könnte sagen: der ›soziale Tod‹ tritt in dem Augenblick ein, in dem die sozial relevanten Attribute des Patienten für den Umgang mit ihm keine Rolle mehr spielen und er im wesentlichen schon als ›tot‹ betrachtet wird. (Sudnow 1973, S. 98)
Inzwischen hat in der Öffentlichkeit eine gewisse Verunsicherung in der Definition des Zeitpunkts weiter um sich gegriffen, zu dem ein Mensch denn nun tatsächlich tot ist – was auch immer das bedeuten mag. Noch aus dem 20. Jahrhundert sind schauerliche Geschichten in Erinnerung von Menschen, die unvermutet aus dem Scheintod wieder ins Leben zurückgekehrt sind.21 In der Diskussion um die Entnahme von Organen zur Transplantation und der bangen Frage, ob der Spender denn nun wirklich tot sei, zeigt sich ein tiefes Misstrauen denen gegenüber, die darüber zu entscheiden haben. Es hat den Anschein, als traue man ihnen ziemlich viel Schlechtes zu.
Erstaunlich ist dann, welches Vertrauen diejenigen genießen, die von den wenigen Kritikern dem Alzheimerimperium zugerechnet werden, wie etwa Wißmann die Szene der Experten nennt (Wißmann 2016, S. 52 ff., Bezug auf Whitehouse).
›Alzheimer‹ ist eine milliardenschwere Industrie und die Kennzeichnung wird zu einem großen Teil von der Pharmaindustrie und ein paar akademischen und anderen Experten gesteuert, welche die überzogene Charakterisierung Alzheimerkrankheit unternehmerisch nutzen, um eine größtmögliche Beunruhigung um Demenz zu begünstigen. (Whitehouse 2009, S. 26)
Peter J. Whitehouse, den seine Kollegen in die Nähe von Verschwörungstheorien rücken, sieht diese seinerseits als Teil des Problems, da sie von diesem System profitieren.
Die medizinische Erzählung der Alzheimer-Demenz erzeugt Furcht, Paranoia, Angst (Hervorh. i. Orig., d. Ü.) und Stigmatisierung und ruft zugleich wirkmächtige soziale und affektive Bilder hervor. (S. 26)
Diese Einschätzung dürften auch diejenigen teilen, die diese Furcht und Angst nutzen und mit zweifelhaften Mitteln versuchen, ihrer gut betuchten Kundschaft zu versichern, dass keine Gefahr drohe. Auf die naheliegende Idee, stattdessen die Mechanismen der Produktion von Angst zu thematisieren, kommt kaum jemand. Warum? Dieser Frage möchte ich hier nachgehen. Um die gesellschaftliche Herausforderung der Demenz zu beleuchten, beschränke ich mich auf den Aspekt der Vermittlung über die Medien. Es liegt mir fern, in den Chor derer einzustimmen, die die Medien für vieles verantwortlich machen, was ihnen an der gesellschaftlichen Entwicklung nicht gefällt. Es lohnt aber die Frage, woher die wirkmächtigen sozialen und affektiven Bilder kommen, von denen Whitehouse spricht.
Zeit des Niedergangs in den Medien
Über die Bilder, die mit dem Begriff Alter verbunden sind, über Zuschreibungen, über die soziale Konstruktion ist viel geschrieben worden – etwa in den zahlreichen Veröffentlichungen aus dem Institut für Gerontologie der Universität Heidelberg.22 Unterschiedliche Antworten hört man auf die Frage, mit welchem Geburtstag die Phase des Alters beginnt.23 So gibt es Institutionen, die gezielt die Altersgruppe 50 plus ansprechen.24 Andere legen ein paar Jahre drauf und landen mit ihrer Spätlese bei 55 plus.25 Für die einen mag das den gleitenden Übergang in den Ruhestand bedeuten, während es für andere ein geradezu absurdes Ansinnen ist, sie allmählich auf Wassergymnastik, Ausfahrten ins Grüne und besinnliche Nachmittage einstimmen zu wollen. Die Frage, ob das Alter nun mit Mitte Fünfzig beginnt, mit dem Ausscheiden aus dem Erwerbsleben oder bei denen, die es sich zuvor leisten konnten, wenn die Jahre der weiten Reisen vorbei sind, ist bereits Teil der gesellschaftlichen Konstruktion des Alters.
Im Folgenden will ich auf einige empirische Befunde zur Präsentation des Alters in Medien eingehen und auf die Darstellung von Menschen mit Demenz.
In einer umfangreichen Untersuchung weist Matthias Vollbracht nach, dass alte Menschen allgemein – salopp gesagt – nicht gerade gut wegkommen in der öffentlichen Darstellung (Vollbracht 2015). Über 400.000 (!). Beiträge in Zeitungen, Zeitschriften, Radio- und Fernsehsendungen des Jahres 2014 hat er im Schweizer Institut Mediatenor ausgewertet, erklärt im Vorwort dieser Studie der Auftraggeber, Stephan Brandenburg, Hauptgeschäftsführer der Berufsgenos senschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege – BGW. Ziel der Untersuchung war, in den Medien transportierte Altersbilder im Zusammenhang mit Medienbildern der Altenpflege und deren Berufsprestige zu analysieren. Vollbracht streift u. a. Mechanismen der Medienproduktion, etwa die Selbstreferenzialität des Journalismus: Journalisten schreiben oft, was andere Journalisten auch schon geschrieben haben (S. 6).
Vollbracht untersucht die Sichtbarkeit alter Menschen in den Medien, schätzt die in den Darstellungen enthaltenen Wertungen – positiv/negativ – ein und betrachtet, mit welchen Themen sie überhaupt in einen Zusammenhang gebracht werden. Im Mittelpunkt steht für ihn – entsprechend seinem Auftrag – die Fokussierung auf das Feld der professionellen Altenpflege. Ihn interessiert also weniger das Bild alter Menschen allgemein als vielmehr dessen Auswirkung auf das Image derer, die sich professionell um die Alten kümmern, sie pflegen. Dabei bezieht er sich auf die sogenannte Agenda-Setting-Theorie, deren Gegenstand die Beziehung zwischen Realität, Medienberichterstattung und öffentlicher Meinung ist. Große Bedeutung hat dabei das Narrativ, also die Frage, ob die Geschichte der Protagonisten in einer problematischen Lebenssituation als die von Versagern erzählt wird, oder ob sie nicht beeinflussbaren äußeren Umständen ausgesetzt sind (S. 5).
Anhand seines ausgewerteten Materials findet er heraus, dass »Senioren als Gruppe der Gesellschaft nur am Rande vorkommen«, nämlich mit 0,1 Prozent als Hauptakteure in der Berichterstattung, während ihr Anteil zum Zeitpunkt der Untersuchung 20,63 Prozent der Gesamtbevölkerung beträgt (S. 28). Eine stärkere mediale Präsenz sieht er bei sogenannten Promis, Menschen, denen zumindest ein Teil der Öffentlichkeit großes Interesse entgegenbringt – unabhängig von ihrem Alter. »Der Ton der Berichterstattung über Senioren als Gruppe ist überwiegend kritisch«: Er erkennt in seiner Auswertung einen Anteil ausgeprägt negativer Wertungen von 35 Prozent, der Anteil positiver Darstellungen liegt nach seiner Erkenntnis bei 18 Prozent (S. 28). Entscheidend für diese Einschätzung ist für Vollbracht der Zusammenhang, in dem über Alte überhaupt berichtet wird: »Die Probleme und kritischen Themen überwiegen […] deutlich«, etwa »Zahlungen an die Senioren, Rente und Rentensystem«. (Vollbracht 2015, S. 15 f.) Als Referenz zieht er das Bild heran, das von Menschen mit Behinderung in den Medien gezeichnet wird. Das sei,
egal ob es sich um körperliche, geistige oder nicht näher bestimmte Behinderungen handelt, […] eindeutig positiv. Dabei steht als Narrativ im Fokus, dass Menschen trotz ihrer Einschränkungen Außergewöhnliches leisten, zum Beispiel als Sportler (Paralympics) oder in der Kunst. (S. 15)
Vollbracht fasst zusammen:
Damit ist das Bild der Senioren deutlich negativer als das anderer gesellschaftlicher Gruppen, zum Beispiel Sportler oder Behinderter. Es ist allerdings weniger negativ gefärbt als das Bild von Kindern und Jugendlichen. (S. 28)
Eine auf den ersten Blick vielleicht erstaunliche Feststellung, deren empirischer Gehalt aber leicht zu überprüfen ist: Beim Blick in aktuelle Medien fallen Kinder und Jugendliche vor allem mit Problemen auf – seltener mit solchen, die sie haben, als vielmehr mit denen, die sie machen, von den saufenden, kiffenden und kriminellen jungen Männern bis zu den vernachlässigten und zu Tode geprügelten Kindern.
Die Berliner Psychologin Eva-Marie Kessler geht in derselben Veröffentlichung der Berufsgenossenschaft auf das mediale Bild alter Menschen näher ein. Sie bestätigt die Erkenntnis, dass diese »deutlich unterrepräsentiert« seien und differenziert nach der Art der untersuchten Medien. In Informationsmedien erfolge eine eher negative Zuschreibung, während in Unterhaltungsmedien und in der Werbung »ältere Menschen als attraktive, aktive und vitale Gruppe dargestellt« werden (Kessler 2015, S. 147). Das ist nicht weiter verwunderlich: Schließlich soll die Darstellung der Alten ein sympathisches Werbe-Umfeld für die angepriesenen Produkte für sogenannte Senioren schaffen. Und Unterhaltungsmedien sollen ja eher zur Entspannung beitragen und den mitunter beschwerlichen Alltag vergessen machen als eben diese Beschwernisse zu thematisieren.
Ihre Erkenntnisse stellt Kessler in einen Zusammenhang mit Studien zu subjektiven Theorien über Entwicklung im Lebenslauf, nämlich dem »Glauben, dass es im Alter mehr Verluste als Gewinne gibt« (S. 148, mit weiteren Nachweisen). Zu diesen Verlusten gehören »nachlassende geistige Fähigkeiten, Rigidität, Einsamkeit und schlechte Stimmung«. Als typischer Vertreter steht dafür der Griesgram, der »senile, inkompetente, kraftlose Gebrechliche«. Das – wenn auch seltener auftretende – Gegenbeispiel sind die liebevollen und großzügigen Großeltern, geprägt durch ihre positiven Eigenschaften Weisheit, Würde und Gelassenheit (S. 148 f.).
Senil, inkompetent, kraftlos und gebrechlich.





























