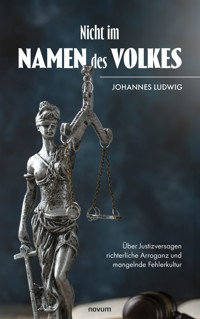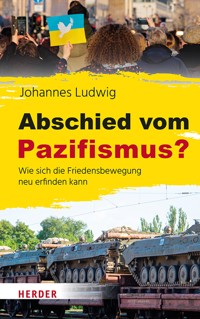5,00 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
In »Ungeschickte Briefe« gelingt dem Autor ein Quasi-Dialog mit überwiegend Künstlern der ersten Hälfte des letzten Jahrhunderts. Vor allem schriftliche Zeugnisse von Macke, Marc, Kandinsky, Klee usw. werden in Beziehung gebracht mit der Kunst von heute - und was sich dafür hält. Als Insider für die gestalterische Seite der Kunst - Johannes Ludwig lehrte Gestaltungsgrundlagen und Farbenlehre an der Hochschule - hat er mehr als nur ein Gespür für Scharlatanerie und Schaumschlägerei. Es ist die Sicht eines Maler-Kollegen, der über das Trennende und das Gemeinsame zweier Zeiten nachsinnt. Ein Buch ohne Abbildungen; aber wo eine hilfreich sein könnte, gibt Ludwig Hinweise, wie sie im Internet zu finden ist.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 353
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Johannes Ludwig, Ungeschickte Briefe zur Kunst
Johannes Ludwig
Ungeschickte Briefe zur Kunst
tredition
2017 © Johannes Ludwig
Cover-Gestaltung: Johannes Ludwig Verlag: tredition GmbH, Hamburg ISDN 978-3-7345-9643-8 (Paperback) ISDN 978-3-7345-9639-1 (Hardcover)
ISDN 978-3-7345-9644-5 (e-book)
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig.
Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Brief an Franz Marc (1)
Brief an Franz Marc (2)
Brief an Franz Marc (3)
Brief an Franz Marc (4)
Brief an Johann Wolfgang Goethe (1)
Brief an Johann Wolfgang Goethe (2)
Brief an Wassily Kandinsky (1)
Brief an Wassily Kandinsky (2)
Brief an Wassily Kandinsky (3)
Brief an Franz Marc (5)
Brief an Wassily Kandinsky (4)
Brief an Wassily Kandinsky (5)
Brief an Franz Marc (6)
Brief an Franz Marc (7)
Brief an Franz Marc (8)
Brief an Franz Marc (9)
Brief an Franz Marc (10)
Brief an Franz Marc (11)
Brief an Franz Marc (12)
Brief an Franz Marc (13)
Brief an Wassily Kandinsky (6)
Brief an Wassily Kandinsky (7)
Brief an Robert Delaunay (1)
Brief an Robert Delaunay (2)
Brief an August Macke (1)
Brief an August Macke (2)
Brief an August Macke (3)
Brief an August Macke (4)
Brief an Franz Marc (14)
Brief an August Macke (5)
Brief an August Macke (6)
Brief an Franz Marc (15)
Brief an August Macke (7)
Brief an Franz Marc (16)
Brief an August Macke (8)
Brief an Franz Marc (17)
Brief an August Macke (9)
Brief an Franz Marc (18)
Brief an August Macke (10)
Brief an Franz Marc (19)
Brief an August Macke (11)
Brief an Franz Marc (20)
Brief an August Macke (12)
Brief an Franz Marc (21)
Brief an Franz Marc (22)
Brief an August Macke (13)
Brief an Franz Marc (23)
Brief an Paul Klee (1)
Brief an Paul Klee (2)
Brief an Paul Klee (3)
Brief an Paul Klee (4)
Brief an Paul Klee (5)
Brief an Paul Klee (6)
Brief an Franz Marc (24)
Brief an Paul Klee (7)
Brief an Lyonel Feininger (1)
Brief an Lyonel Feininger (2)
Brief an Franz Marc (25)
Brief an Johann Wolfgang Goethe (3)
Brief an Franz Marc (26)
Brief an Wassily Kandinsky (8)
Brief an Wassily Kandinsky (9)
Brief an Max Burchartz (1)
Brief an Max Burchartz (2)
Brief an Paul Klee (8)
Brief an Franz Marc (26)
Brief an Ludwig Hirschfeld-Mack (1)
Brief an Wassily Kandinsky (10)
Brief an Ludwig Hirschfeld-Mack (2)
Brief an Ludwig Hirschfeld-Mack (3)
Brief an Karl Hofer (1)
Brief an die Leser (anstatt eines Nachwortes)
Personenregister
Vorwort
Um es gleich zu sagen: Die Briefe habe ich zwar geschrieben, aber nicht einen davon jemals versendet; sie blieben ungeschickt. Was will man machen, wenn alle Adressaten bereits gestorben sind? Und dabei hätte ich so gern mit ihnen einen Dialog geführt. Ich hatte viele Fragen zu ihrer Zeit, zu ihren Problemen in ihrer Zeit. Was hätten andererseits die damaligen Künstler zu unseren heutigen Kunst- Vorstellungen und schrillen -Auswüchsen gesagt, natürlich den Kunstmarkt eingeschlossen? Wie unterscheidet sich ihr »Zeitgeist« von unserem? Wie waren ihre Befindlichkeiten – auch neben der Kunst? Wie war ihr Umgang miteinander, wie fest oder labil ihre gegenseitige – oder auch eigene – Wertschätzung? Ferner hat mich interessiert, wie sie ihre zeitgemäße Leistung im kunstgeschichtlichen Kontext, also ihren Beitrag zur Entwicklung der Kunst, bewertet haben. Hätte ich die Briefe abgeschickt, wären sie mit dem Vermerk »Empfänger verstorben« zurückgekommen.
Und dann habe ich trotzdem Antworten erhalten, die mich gewissermaßen auf Umwegen erreicht haben. Schriftliche Zeugnisse in Briefen, Vorträgen und Texten, interessante Aussagen, die oft auch zwischen den Zeilen einiges hergaben, zumal, wenn man Zusammenhänge herstellt.
Ach ja, da ist doch noch eine zweite Bedeutung, die das Wort »ungeschickt« haben kann: Wenn man kritisch ist, eckt man auch hier und da einmal an. »Wie ungeschickt«, könnte man sagen, wenn man den Vertretern des modernistischen Zeitgeistes auf die Zehen tritt. Ist denn die Kunst nicht »frei«? Meine klare Aussage dazu: Kunst und Kunstkritik sind frei, aber auch das gilt für beide: Es gibt keine Freiheit ohne Verantwortung.
Sie lesen ein Buch ohne Abbildungen. Das ist für ein Kunstbuch eigentlich ungewöhnlich. Da wir jedoch über das Internet einen Zugang zu den Bildern der Welt haben – auch zu den Abbildungen der Kunst –, können wir so gut wie jedes Werk aufrufen.
Es ist ein »Quasi-Dialog« zwischen Künstlern, manchmal bis hin zur Fachsimpelei. Und es ist die Sicht eines Kollegen, der über das Trennende und das Gemeinsame zweier Zeiten nachsinnt.
Die Kunst –
Gleichnisse des Lebens; die Idee, das Wirken und die Früchte.
Und über die Gegenwart hinaus:
Sind diese Früchte taub, oder sind sie der Samen für unsere Zukunft?
Lieber Franz Marc, (1)
mit ausgestreckten Beinen sitze ich auf der Bank vor der Staffelalm. Ein wenig ermüdet durch den Aufstieg an der Orterer-Alm vorbei, genieße ich, die Hütte und den Rabenkopf im Rücken, den offenen Blick in das trichterförmige Tal, das sich vor mir absenkt in Richtung Jachenau. Wie oft magst Du hier gesessen haben, von der Malarbeit ausruhend, den nötigen Abstand zu gewinnen, den Maßstab wieder einmal auszurichten, Dich neu zu »erden«, wie man heute sagen würde. Eben habe ich durch das kleine Fenster in die Hütte gespäht, um etwas von Deiner Wandmalerei zu sehen; aber die schräge Sicht und das reflektierende Glas machten es mir schwer, etwas Genaueres zu erkennen. 1905 hattest Du Hirsch und Hirschkuh auf die Innenwand gemalt, die von den Restauratoren aus München nun überarbeitet wurden. Übrigens haben wir heute die Möglichkeit, Bilder, wie auch Informationen, die in einem »Internet« genannten riesigen Pool gesammelt sind, auf einem Bildschirm aufzurufen und anzuschauen. Wenn ich Dich neugierig gemacht habe, dann gib einfach ein: [staffelalm > Bilder zu Staffelalm]. Da findest Du etliche Bilder zum Thema, u.a. auch Deine Wandmalerei.
Eine kleine Feier war nach der Fertigstellung veranstaltet worden. Aber so richtig hat man sich wohl nicht getraut, das Ereignis an die große Glocke zu hängen; die Furcht vor dem Ungeschütztsein der Malerei hier oben einerseits und die Angst des Besitzers, eines Landwirtes, vor einer Entwicklung seiner Arbeitsstätte zum Wallfahrtsort – mit all der üblichen Unruhe – haben wohl dazu geführt. Und so ist es ein Geheimtipp geblieben, ruhig und beschaulich – ein Platz für Eingeweihte. Man fühlt sich ein wenig privilegiert, weil man den Hauch der Kunstgeschichte zu spüren glaubt.
Ich packe das Büchlein »Spuren im blauen Land« aus und lese ein wenig darin. In sympathischer Einfachheit und anheimelndem Lokalkolorit hat Max Lautenbacher1 darin zu Papier gebracht, wie sich zu Anfang des zwanzigsten Jahrhunderts das Leben – auch neben der großen Kunst – bei Euch abgespielt hat. Wie in der Sindelsdorfer Gartenlaube, nachdem Euch Maria mit Tee versorgt hatte, die großen Gedankenflüge schließlich die Idee »Der Blaue Reiter« hervorbrachten.
Die Südseite der Benediktenwand liegt weiter links in leichtem Dunst, ich setze zum Schreiben die Sonnenbrille auf – als Schutz vor dem hellen Licht, das vom weißen Papier zurückgestrahlt wird – und lasse meinen Gedanken freien Lauf – – –
Wenn ich mir Deine Bilder in der Gesamtheit anschaue, so fällt mir auf, dass sie einerseits eine relativ starke Kontinuität aufweisen, außerdem aber auch eine faszinierende Zielstrebigkeit in vier Phasen zeigen. Zunächst scheint Dich ein genaues Sehen und Wiedergeben zu interessieren.
Ein Ausprobieren der technischen Möglichkeiten kommt hinzu und es entstehen Werke, denen man das suchende Hineintasten in die Welt der Malerei ansieht.
Um 1904 beginnst Du mit einer Malweise, die sich durch eine sichere Pinselführung auszeichnet und schon leichte Merkmale der Abstraktion zeigt. Diese erreichst Du durch einen breiten Pinselduktus, der aber immer noch vor allem die Darstellung des Gesehenen zum Ziel hat. Lass Dich vom Internet überraschen und wähle: [franz marc bilder > Bilder zu franz marc] Als Beispiele mögen genügen: »Kleine Pferdestudie II«, 1905 und »Zwei Frauen am Berg«, 1906. Die Farbe ist Eigenfarbe, Körperfarbe, sie ordnet sich allem unter.
Erst etwa 1910 erscheinst Du, wie wir Dich kennen und schätzen. Deine Formen und Farben beginnen nun ein Eigenleben; ihr Herr und Meister ist nicht mehr so sehr der Gegenstand, sondern das Bild, die Bildgestaltung. Jetzt erreichst Du durch die zunehmende und gezielte Abstraktion ein Zurücknehmen da und ein Hervorheben dort. Nun kannst Du den Ausdruck steuern, an dem Dir so viel liegt. Du näherst Dich den Grundformen an – gleichgültig, ob Du Rundlichkeit oder Geradheit bevorzugst – und filterst so Nebensächlichkeiten aus. Falls Du Deine diesbezüglichen Bilder noch einmal sehen willst, weißt Du ja Bescheid: [franz marc bilder > Bilder zu franz marc] Da findest Du beispielsweise »Pferd in Landschaft«, 1910, »Hocken im Schnee«, 1911, »Gelbe Kuh«, 1911 oder »Die kleinen blauen Pferde «, 1911.
Die letzten zwei bis drei Jahre gelingen Dir Steigerungen ins Kristalline und auch Dynamische, wobei der Gegenstand immer mehr in den Hintergrund tritt. Aber er geht nicht unter; ganz im Gegenteil – als aktiverer Pol der Polarität Ungegenständlich – Gegenständlich zieht er den Blick auf sich. Das zeigt sich u.a. in »Stallungen «, 1913, »Tierschicksale«, 1913 oder »Kämpfende Formen«, 1914.
Durch Deine Begegnung 1904 mit Jean-Bloé Niestlé wurde Dein Interesse noch mehr auf die Tiere gelenkt. Er gab Dir als junger französischer Tiermaler ganz neue Impulse. Niestlé, dessen Bilder ich am Ende der neunziger Jahre in einer Ausstellung in Benediktbeuern sehen und bewundern konnte, hat Dich mit seiner Malweise wohl ebenso fasziniert wie mich. Ich kann mich an ein Bild erinnern, dass sowohl durch seine zeichnerische Qualität im darstellerischen Sinne, wie auch durch größere Bereiche, deren Struktur in ihrer schon ein wenig abstrakt wirkenden Art ganz andere, eigene Reize entwickelte, sogar ein wenig an Jackson Pollock erinnerte, bestach.
Du sahst Dich also als Tiermaler? Oder hattest Du in erster Linie anderes im Sinn?
Mit freundlichen Grüßen ...
1 Max Lautenbacher: Spuren im Blauen Land; Eigenverlag Sindelsdorf, 1992
Lieber Franz Marc, (2)
Du meinst also, dass Du das Tier als besonders geeignet betrachtest, einen neuen Weg zum Erreichen neuer Ziele erarbeiten zu können, wenn Du schreibst:
»Meine Ziele liegen nicht in der Linie besonderer Tiermalerei. Ich suche einen guten, reinen und lichten Stil, in dem wenigstens ein Teil dessen, was wir moderne Maler zu sagen haben werden, restlos aufgehen kann. [Und das wäre vielleicht ein] <Ich suche mein> Empfinden für den organischen Rhythmus aller Dinge <zu steigern>, [ein pantheistisches Hineinfühlen] <suche mich pantheistisch einzufühlen> in das Zittern und Rinnen des Blutes in der Natur, in den Bäumen, in den Tieren, in der Luft – – –; <suche> das zum [»Bilde«] <Bilde zu> machen, mit neuen Bewegungen und mit Farben, die unseres alten Staffeleibildes spotten. In Frankreich schult man sich seit mehr als einem halben Jahrhundert [auf] <für> dieses Thema. Von Delacroix und Millet über Degas, Cézanne zu van Gogh und den Pointilisten führt ein gerader Weg; und die jüngsten Franzosen sind in einem wundervollen Wettlauf nach diesem Ziel begriffen. Nur gehen sie, sonderbarerweise, dem natürlichsten Vorwurf für diese Kunst sorgfältig aus dem Wege: Dem Tierbild. Ich sehe kein glücklicheres Mittel zur ›Animalisierung der Kunst‹ [,wie ich es nennen möchte,] als das Tierbild. Darum greife ich danach. [Was wir anstreben, könnte man eine Animalisierung des Kunstempfindens nennen; bei] ‹Bei› einem van Gogh oder einem Signac ist alles animalisch geworden, die Luft, selbst der Kahn, der auf dem Wasser ruht, und vor allem die Malerei selbst. Diese Bilder haben gar keine Ähnlichkeit mehr mit dem, was man früher ›Bilder‹ nannte.«1
Könnte es sein, dass Du das Tier nur als Vehikel, als Mittel zum Zweck, benutzen möchtest, um zu einer neuen Bildsprache zu kommen, die Dir spezifischere Ausdrucksmöglichkeiten an die Hand gibt? Du weißt vielleicht, dass Dir einige Kritiker mit dem Rückzug auf das Tier eine Art Realitätsflucht vorwerfen, wie man etwa Hundehaltern oft allzu pauschal den Vorwurf macht, im Umgang mit Menschen ein Problem zu haben und daher eher die Gesellschaft eines Hundes zu bevorzugen. Ich denke eher, dass Du im Tier das Bearbeitungsobjekt gefunden hast, das Dir einerseits ein anspruchsvolles Anforderungsmaß abverlangt und Dir andererseits das Verwirklichen der ersehnten neuen Ziele bietet.
Mehr Probleme habe ich mit Deiner »Animalisierung der Kunst«. Unser heutiger Duden sagt zu dem Begriff »animalisch«: a) vom Tier stammend; b) tierhaft, urwüchsig-kreatürlich; c) triebhaft. Ich setze einmal voraus, dass Du an b) denkst, wenn Du von einer Animalisierung der Kunst sprichst. Mit tierhaft könntest Du ein mehr unbewusstes Arbeiten meinen, befreit von unnötig komplizierenden (= menschlichen), fernliegenden Gedanken und Absichten. Möglicherweise schwebt Dir eine Versinnlichung der Kunst vor, die im wahrsten Sinne des Wortes unsere Sinne anspricht, anstatt einer weiteren Verkopfung Vorschub zu leisten.
Vielleicht interessiert es Dich, wie heute Tiere zu künstlerischen Zwecken genutzt werden.
Den Kopf mit Blattgold, Goldstaub und Honig bedeckt, trat Joseph Beuys 1965 in einer Düsseldorfer Galerie auf. Einen toten Hasen auf dem Arm tragend, zeigte und erklärte er diesem die Werke der Ausstellung. Stundenlang stand das Publikum draußen, um ihm durch die Fenster zuzuschauen. [joseph beuys hase]. Wem diese Kunstform, das Happening, etwas gibt, der soll es genießen; es ist schließlich heute eine mehr oder weniger beliebte Methode, die Zeit auf unterhaltsame Weise totzuschlagen.
Eine andere Geschichte ist die der ausgestellten schmutzigen Badewanne, die von eifrigen Putzfrauen über Nacht gesäubert wurde – diese schlampigen Künstler könnten die Sachen, die sie ausstellen, wenigstens erst mal sauber machen! – und Beuys war verständlicherweise zur Raserei gebracht, denn für ihn hatte der Schmutz eine wichtige Werkfunktion. Du siehst also, einen gewissen Unterhaltungswert hat die »Kunst« unserer Zeit durchaus. Ob aber diese Badewanne, über 40 Jahre nach Duchamps Urinal heute noch besonders originell sein und einen künstlerischen Wert haben kann, ist eine andere Frage. Auch mit weiteren Themen hat Beuys sein feines Gespür für den Zeitgeist bewiesen: Typisch für ihn war seine private Symbolik von Filz, Fett und Honig, die ihren Ursprung in seinen Kriegserlebnissen hatte. Künstlerisch mag er umstritten sein, aber er hat durch seine »Grenzerweiterungen«, durch seine Erkundungen im Vor- und Umfeld von Kunst neue Maßstäbe gesetzt. Hier hat er seine wirklichen Verdienste, doch, wie heißt es so treffend: »Die Geister, die ich rief ...« Die Zahl der Epigonen war und ist endlos ...
Eine Beuys zugeschriebene Äußerung wird von Markus Metz und Georg Seeßlen in ihrem Buch »Geld frisst Kunst/Kunst frisst Geld« folgendermaßen kommentiert:
»Dass ›jeder Mensch ein Künstler‹ sein müsse, ist wahlweise eine triviale Aussage (insofern sie meint, jeder Mensch habe ästhetische Empfindungen und ästhetische Fähigkeiten), eine heuchlerische (denn mit dem Kreativen ist keine ökonomische Donation verbunden), oder gar eine reaktionäre, nämlich die anthroposophische Wolke um ein völkisches Kunstkonzept: das radikale Subjekt, das sich auf einen kulturellen Urschleim beruft. ›Jeder ist ein Künstler‹ ist das rechtspopulistische Pendant zur stalinistischen Kunst für die Massen.«2
Kehren wir zum Thema zurück. Ich schrieb Dir von der Rolle des Tieres in der Kunst unserer Zeit. Da gab es 2001 in Berlin den Aktionskünstler Wolfgang Flatz, der ein totes und gehäutetes Rind aus 40 Metern Höhe von einem Hubschrauber abwerfen ließ. Die Kuh hatte Feuerwerkskörper in ihrem Innern, die beim Aufprall platzten. Gleichzeitig ließ er sich nackt und blutüberströmt abseilen. [wolfgang flatz wikipedia > Artikel im Standard über die Performance »Fleisch« , 2011] Von solchen spätpubertären Gags ist die heutige Kunst vielfach durchsetzt. Wenn schon Geschmack kein Kriterium für gute Kunst ist, so ist deshalb Geschmacklosigkeit noch längst kein Indiz oder gar Beweis für künstlerische Qualität.
Ein letztes Beispiel will ich erwähnen; den in einem Aquarium in Formaldehyd eingelegten und schwebenden Tigerhai eines Damien Hirst von 1991 [damien hirst hai]. Was das mit Kunst zu tun hat, willst Du wissen? Nun, heute gilt: Kunst ist das, was zu Kunst erklärt wird.
Und überhaupt – das Erklären: 1984 fand ich unter den Exponaten der Skulpturentage im Park am Warmen Damm in Wiesbaden ein Objekt, das ich für die Fundamentreste eines Transformatorenhäuschens oder etwas Ähnliches hielt. Ein Schandfleck, der offenbar den Augen der gärtnerischen Pflegekräfte entgangen war, der aber durch ein opulentes, pseudo-psychologisches Katalog-Geschwafel zur Überraschung vieler zu einem aktuellen Kunst-Beitrag erklärt wurde.
Unter den Kunst-Theoretikern scheint es einen Wettbewerb »Wer schreibt zu den sinnlosesten Werken die längsten und hochtrabendsten Texte?« zu geben. Wir Menschen scheinen eine besondere Vorliebe für Extreme zu haben; zugegebenermaßen ist ein allzu verständliches Werk u.a. deshalb schlecht, weil es nicht originär, sondern zu oberflächlich und angepasst ist. Es regt nicht an, statt dessen ist es nichtssagend oder kitschig. Das andere Extrem, in das man leicht verfällt, ist aber genau so negativ; da geht es nicht nur um Originalität, sondern um das Neue um jeden Preis, um Pseudo-Tiefgang bis zum Irrealen, um eine inflationäre Überreizung bis zum Schock. Es sind die beiden Seiten einer Medaille: Seichte Gefälligkeitskunst und abstoßende Hässlichkeit ohne jeden Sinn. Ja, man kann sagen, dass, wie sich im gerundeten politischen Spektrum Links- und Rechtsaußen im Extremismus und in der Radikalität treffen, süßliche Schönheit und brutale Scheußlichkeit im Kitsch sich vereinen.
Aber was willst Du nun eigentlich erreichen? Du schreibst, dass Du eine »gute, reine und lichte« Malweise suchst. Mit neuen Bewegungen und Farben willst Du zu ganz anderen, neuen Bildern kommen. Einen »organischen Rhythmus für alle Dinge« willst Du finden. Das »Zittern und Rinnen in der Natur« interessiert Dich. Aber wie glaubst Du das erreichen zu können? Wie willst Du ein tieferes Verständnis für Tiere, Pflanzen oder andere Objekte entwickeln, und vor allem: Wie, glaubst Du, dieses dann jeweils auch visualisieren zu können?
Für heute will ich schließen und grüße Dich ...
1 Über das Tier in der Kunst, Brief an Reinhard Piper für dessen Buch ›Das Tier in der Kunst‹, München, 1910
2Markus Metz und Georg Seeßlen, Geld frisst Kunst/Kunst frisst Geld, S. 169; Berlin 2015
Lieber Franz Marc, (3)
bevor ich zu Deinen Äußerungen komme, möchte ich auf eine Begebenheit eingehen, die mir zum Thema Tiere in der Kunst noch eingefallen ist. In einer Talk-Runde des Fernsehens mit u.a. Werner Höfer, Rosa von Praunheim, Hermann Nitsch – die Namen der anderen Teilnehmer und der des Moderators sind mir längst entfallen – wurde ein Beitrag Hermann Nitschs in Wort und Bild vorgestellt. Im Jahre 1962 hatten die österreichischen Künstler Hermann Nitsch, Adolf Fechner und Otto Muehl unter dem Oberbegriff »Orgien-Mysterien- Theater« eine dreiteilige »Blutorgel«-Performance durchgeführt. Im abschließenden dritten Teil kam es zur Kreuzigung; ein totes Lamm wurde ausgeweidet, gehäutet, zerrissen und mit dem Kopf nach unten aufgehängt. Die Innereien hatte man auf einen Tisch gelegt und mit Blut und heißem Wasser übergossen. Du findest im Internet unter [hermann nitsch > Das Orgien Mysterien Theater, 122. Aktion] genügend Bilder und Filme.
Nitsch berief sich dabei auf die christliche Religion, nach der das Lamm ein Analogie-Symbol für das Menschenopfer des Kreuzestodes Jesu Christi ist. Auch auf Bezüge zum antiken Dionisos-Kult wurde hingewiesen. Man war stolz darauf, das damalige Publikum mit sadomasochistischen und exhibitionistischen Elementen irritiert zu haben.
Die Gesichter der Runde zeigten, was man sich unter »fremdschämen « vorzustellen hat. Eisiges Schweigen. Die von den Teilnehmern dem Moderator zur Schau gestellte Körperhaltung drückte aus: ›Ich bin im Moment mal nicht da!‹ Jedoch die unvermeidliche Frage »Was halten Sie davon?« des Moderators kommt sofort, und er wendet sich damit an – Werner Höfer. ›Gott sei Dank‹ denke ich, ›jetzt wird das durch viele politische Diskussionen gestählte und erfahrene Schlachtschiff und der nie um eine eigene Meinung verlegene Höfer eben diese seine eigene Meinung zum Ausdruck bringen.‹ Er setzt an: »Man muss die Freiheit der Kunst achten.« ›Sehr gut, mit diesem wichtigen Satz zu beginnen, ist immer richtig und man sagt damit, dass man tolerant und fair zu sein gedenkt – und jetzt muss das »Aber« kommen.‹ Jedoch das Aber kommt nicht. Statt dessen folgen Hinweise auf die eigene künstlerische Laienhaftigkeit, Mangel an Expertenwissen, Recht der Kunst auf Experimente, Schrittmacherfunktion der Kunst und und und ...
Kein Wort über das Recht zur freien Meinungsäußerung, kein Wort zum Missbrauch der Freiheit der Kunst, kein Wort zur Verantwortung des Künstlers. Auch kein Wort darüber, dass es eine gewisse Parallele zu bestimmten Wissenschaften gibt, etwa der medizinisch- biologischen, wo man auch nicht alles machen darf, was technisch machbar ist. Die Diskussion verlor sich in Oberflächlichkeiten. Die Kunst verwandelte sich in eine Gummiwand.
Dass einer mit innovativen Ideen seinen Bekanntheitsgrad explosionsartig steigert – es sei ihm gegönnt. Dass er dies aber mit so perfiden Mitteln wie einer derartigen Blutorgie macht, gibt zu denken.
Was denkst oder empfindest Du, wenn Du das liest und mit Deinen eigenen Zielen im Bezug auf den Umgang mit dem Tier vergleichst? Hast Du das gemeint, als Du nach »dem Zittern und Rinnen des Blutes in der Natur« suchtest?
Heutzutage ist es allemal erfolgversprechend, das Mystische zu banalisieren und das Banale zu mystifizieren. Das gilt nicht nur für die Kunst, sondern auch für die Literatur: wenn eine Handlung ausgelaugt und langweilig ist, braucht man die negative Hauptfigur nur durch Jesus oder Mohammed zu ersetzen; schon wird ein zugkräftiger und profitabler Erfolg daraus. Skandalisierung nach diesem Rezept zu betreiben, ist ein einträgliches Geschäft.
Aber das nur nebenbei bzw. zur Abrundung der Thematik. Kommen wir lieber zurück zu Deinen Zeilen zum Thema Tier. Man sieht an den vielen Einschüben und Begriffsalternativen, dass Du es Dir nicht leicht gemacht hast.
»[Können wir uns ein Bild machen, wie wohl Tiere uns und die Natur sehen?]
Gibt es für Künstler eine geheimnisvollere Idee als die [Vorstellung], wie sich wohl die Natur in dem Auge eines Tieres spiegelt? Wie sieht ein Pferd die Welt oder ein Adler, ein Reh oder ein Hund? Wie armselig, [ja] seelenlos ist unsere [Gewohnheit] Konvention, Tiere in eine Landschaft zu setzen, die unsren Augen zugehört statt uns in die Seele des Tieres zu versenken, [daß wir das seinen Blick Weltbild] um dessen Bilderkreis zu erraten.
[Diese Betrachtung soll keine müßige causerie sein, sondern uns zu den Quellen der Kunst führen.]«1
Deine Frage »wie sieht ein Pferd die Welt oder ein Adler, ein Reh oder ein Hund?« wird auch heute wieder gestellt. Wie Beuys einem Hasen die Kunst erklärt, habe ich Dir schon mitgeteilt. Einen anderen und doch wieder ähnlichen Weg gehen die beiden Schweizer David Weiss und Peter Fischli, wenn sie unter dem Leitgedanken »Was denkt mein Hund?« als Pandabär und Ratte verkleidet im Film die Welt erkunden. In einer Welt aus Plüsch und Plastik wuseln sie parodierend, persiflierend und pseudo-philosophierend herum und wären so durchaus eines Kleinkunstpreises würdig. Nun musst Du wissen, dass es heute bei uns eine Instanz gibt, die regelmäßig die Rangstellen der 100 höchstwertigen lebenden Künstler der Welt verkündet; es ist der Kunstmarkt-Kompass des Magazins Capital. Nomen est omen – hier ist garantiert, dass es um die messbaren echten Werte geht und nicht etwa um so windige und schwer zu durchschauende Spinnereien wie Qualität der Kunst. Und auf diesem Kunst-Kompass nahmen die beiden Schweizer den Rang 11 ein. Ehre, wem Ehre gebührt!
Deinen Vorstellungen entsprechend, lieber Franz Marc, müssten wir unsere Aufmerksamkeit den tierischen Instinkten widmen, ein »Eins-Sein« mit der Natur anstreben und den zweckgerichteten Rationalismus zurückdrängen. Vielleicht bist Du einverstanden, wenn ich das eine »sinngeprägte« Syntax nenne. Dabei ist »sinngeprägt« durchaus in der Doppeldeutigkeit dieses Wortes gemeint: Sinnlich und sinngebend.
Aber wo siehst Du den Unterschied zur alten Malweise? Eine Frucht in einer Schale, ein Tier in einer Landschaft, ein Baum am Straßenrand – hat die Kunst aus Deiner Sicht nicht alles schon ergründet?
Mit freundlichen Grüßen ...
1 Aufzeichnungen über das Tierbild, Winter 1911/12; Nürnberg, Germanisches Nationalmuseum
Lieber Franz Marc, (4)
offenbar nicht, denn Du gibst zu bedenken: »Hat es einen Sinn, einen Apfel zu malen und dazu [eine Zimmerecke] die Fensterbank, worauf er liegt? Was hat der schöne runde Apfel mit der Fensterbank gemein? Wenn man das Problem auf »Kugel und Fläche« stellt, so fällt der Begriff Apfel im Ernste weg; man geht dabei einen interessanten Seitenweg, den uns wunderbare Maler entdeckt haben, wie wenn wir aber den Apfel, den schönen Apfel malen wollen? Oder das Reh im Wald, oder die Eiche?
Was hat das Reh mit dem Weltbild zu thun, [wie] das wir [es] sehen? Hat es irgendwelchen vernünftigen oder gar künstlerischen Sinn, das Reh zu malen, wie es unserer Netzhaut erscheint oder in kubistischer Form, weil wir die Welt kubistisch fühlen? Wer sagt mir, daß das Reh die Welt kubistisch fühlt; es fühlt sie als »Reh«, die Landschaft muß also »Reh« sein. Das ist ihr Prädikat. Die künstleri26kommen und einwandfrei; sie »sehen« das Reh gar nicht und kümmern sich nicht darum; sie geben »ihre« innerliche Welt; das Subjekt.«1
Du sprichst damit eines der faszinierendsten Phänomene in der Kunst an. Es ist der Gegensatz, der zwischen der exakt naturalistischen Wiedergabe und der Konkreten Malerei besteht. Naturalistische Wiedergabe bedeutet eine Vielzahl von Aussagen und Informationen, wobei schon der Gegenstand selbst Information ist; hinzu kommt der literarische Gehalt des Bildes, der in komplizierten Fällen eine ganze Geschichte umfassen kann. Nehmen wir als Beispiel den Dürerschen Hasen [dürer hase], der, was seinen semantischen Gehalt angeht, noch sehr zurückhaltend ist; Das Bild sagt aus, dass es sich um einen Hasen handelt, und zwar der Rasse XY, im ungefähren Alter von soundso viel Jahren, in eine bestimmte Richtung blickend, auf allen vier Pfoten ruhend, das bräunlich-graue Fell aus 184.255 Haaren besteht, wobei die Beschaffenheit des Haares Nr.1 ... Dein Einverständnis voraussetzend, breche ich die Aufzählung hier ab, denn ich bin sicher, dass ich Dir mit dieser kleinen Auswahl klar machen konnte, was ich alles unter »inhaltlicher Aussage« verstehe.
Den typischen Gegenpol dazu hat der nach Dir kommende Maler Piet Mondrian gesetzt [piet mondrian > Mehr Bilder]; mit seinen schwarzen Balkenbildern und den weißen bzw. starkfarbigen Flächendazwischen hat er die inhaltlichen Aussagen weitestgehend aus dem Bild genommen zugunsten einer reinen Syntax. Bis auf die ästhetischen Informationen – Format, Form und Farbe, Größenverhältnisse, Ausrichtung, Hell-Dunkel-Verteilung und dergl. – ist der Informationsgehalt nahe Null.
Mit Deiner Aussage, »Die künstlerische Logik von Picasso, Kandinsky, Delaunay, Burljuk etc. ist vollkommen und einwandfrei« zollst Du den Malerkollegen zwar Deinen Respekt, aber Du selbst scheinst lieber einen anderen Weg gehen zu wollen. Und es ist offensichtlich nicht Dein Anliegen, aus Apfel und Fensterbank eine Kugel auf der Fläche zu machen, obwohl Du es einen »interessanten Seitenweg « nennst.
Dieses sei vorweg gesagt: Jede Zeit in jeder Kultur hatte und hat ihre Bildsprache und damit auch ihren Abstraktionsgrad der künstlerischen Darstellungen. Es wäre vermessen und verfehlt, davon eine qualitative Bewertung ableiten zu wollen, denn die zeitgemäßen Erfordernisse sind es, die den jeweiligen Gehalt von Semantik bzw. Syntax bestimmen. Ein treffendes Beispiel zeigt am besten, was ich damit meine.
In den Persischen Miniaturen gibt es eine Darstellung »Baisonghors Schahnamé, um 1430«, die eine Schlacht zwischen den Armeen Persiens und Turkestans zeigt. Hier ist die klischeehafte Wiederholung das prägende Element. Alle Gesichter der Soldaten ähneln sich. Es scheint wichtig gewesen zu sein, das Aufeinanderprallen der beiden Heere zu zeigen, zum Abzählen und Vergleichen animierend. Das Individuum geht im wahrsten Sinne unter zugunsten eines vermeintlich höheren Zieles. Wichtig noch, am Beispiel der beiden vorgepreschten Krieger zu zeigen, wer der stärkere bzw. auf welcher Seite der visuelle Chronist (sein Auftraggeber, Befehlsgeber) dieses Geschehens zu finden ist. Auch deutlich mehr Gold auf der Seite der Perser. Ferner scheint das standartenähnliche Zeichen oben links den Verlauf der Schlacht anzudeuten. Diese symbolhaften Vereinfachungen haben zur Folge, dass das im Sinne des Gestalters Unwesentliche reduziert wird und das Wesentliche um so deutlicher hervortritt.
Merkwürdig ist aber auch die Ambivalenz, die in diesem Bild den Soldatengesichtern anhaftet; in der damaligen Zeit waren sie als individueller Ausdruck von Menschengesichtern vergleichsweise unwichtig, wichtig allein war die große Zahl der Kämpfer, die zumSieg verhalf. Heute vermittelt uns diese gestalterische Abstraktion der Gesichter (auch Vereinfachung ist natürlich Abstraktion) die zusätzliche Erkenntnis, dass der Einzelne nicht viel galt, lieblos dargestellt (= behandelt) wurde. Ansonsten jedoch gilt: Mit jeder abstrahierenden Maßnahme wird ein gewisses Quantum Semantik herausgenommen und, wenn man es geschickt macht, an der gewünschten Stelle somit die Gesamtaussage verstärkt.
Rund 160 Jahre später begegnen wir einer Gegenstandsbehandlung, die sich deutlich gewandelt hat. In einer Abbildung »Djami al- Tawarikh, 1596«, die Dschingis in seinem Lager zeigt, ist von der stereotypen, beinahe statistisch anmutenden Darstellung der gezeigten Schlachtszene nicht mehr viel übriggeblieben. Gesichter gibt es in vielen Variationen, selbst Bärte kommen in unterschiedlichsten Arten vor. Zelte, Teppiche und Ornamente sind von verwirrender Vielfalt. Auch die Bäume haben sich der unregelmäßig-freien Naturform angenähert. (Beide Abbildungen leider nicht im Internet verfügbar, aber andere zeigen sinngemäß die gleichen Sachverhalte.)
Wenn wir diese beiden Bilder der Persischen Miniaturen miteinander vergleichen, so kann man feststellen, dass bei dem früheren relativ wenig ausgesagt wird, dieses Wenige aber um so prägnanter. Die geordnete Gliederung des Heeres oder die stupide Gleichheit der Gesichter dienen der Unterdrückung ablenkender Sekundär- Informationen und verstärken somit die beabsichtigte Primäraussage.
Umgekehrt bietet das andere Bild ein Vielfaches an inhaltlicher Aussage, an Semantik. Die syntaktische Komponente dieses Bildes tritt ein wenig in den Hintergrund zugunsten einer eher erzählerischen Form.
Doch kehren wir noch einmal zu dem Soldaten-Bild zurück. An ihm wird deutlich, dass es neben Semantik und Syntax noch ein drittes Kriterium gibt, das heißt, dass neben der Bild-Idee und der Bild- Gestaltung noch ein drittes Phänomen existiert, das nach kommunikationstheoretischen Erkenntnissen zu einer umfassenden Bildbewertung gehört; es ist die Pragmatik, die die Fragen medialer, zeitlicher, örtlicher Faktoren und die Situation des Betrachters einbringt. So betrachtet, wird beispielsweise der damalige Mensch die ausdrucksarmen Soldatengesichter anders gesehen und gedeutet haben als wir, weil der Zeitunterschied und damit die veränderte soziale Wertung einen Teil der Wirkung des Bildes ausmachen.
Zum Unterschied zwischen Deiner Malweise und der Deiner Malerkollegen ist zu sagen: Auf einer gedachten Skala, die links von der reinen Semantik begrenzt wird und deren rechter Pol die konkrete Syntax bildet, befindet Ihr Euch alle im Mittelbereich – das »Kugelauf- Fläche«-Beispiel würde ich allerdings deutlich weiter rechts einordnen. Mit dieser Platzierung ist keinerlei Wertmaßstab verbunden; der Trend geht in Deiner Zeit mehr oder weniger nach rechts, in Richtung Syntax – Du wirst ihn selber gehen!
In einer Frage bin ich mit Dir nicht einer Meinung: Du behauptest, dass Picasso, Kandinsky, Delaunay, Burljuk etc. das Reh, um bei Deinem Beispiel zu bleiben, nur wiedergeben, wie sie selbst es sehen. Das ist eine gewagte Behauptung. Außerdem, stellen wir uns einmal vor, sie würden ein und denselben malerischen Weg gehen und das malen wollen und auch können, was das Reh aus seiner spezifischen Weltsicht heraus fühlt und empfindet. Glaubst Du wirklich, dass Du mit den Ergebnissen zufrieden sein könntest? Müsste man nicht befürchten, dass allzu ähnliche Werke entstünden? Es ginge ja schließlich darum, ein völlig identisches Ziel zu erreichen: Das Weltbild des Rehs, wie es fühlt und empfindet. Diese Ausschließlichkeit und Einschränkung würde der Malerei nicht guttun. Wäre es nicht viel besser, wenn Maler darzustellen versuchten, was das Reh aus seiner spezifischen Weltsicht heraus fühlt und empfindet und wie in bewusster und bereichernder Unterschiedlichkeit die verschiedenen Maler selbst das sehen und interpretieren? Ziehen wir doch einfach einmal das Portrait zum Vergleich heran. Ist es nicht ungemein bereichernd, dass hier das Individuelle der dargestellten Person in idealer Weise dargestellt ist, dort dagegen die kreative Malweise des Künstlers im Vordergrund steht? Beide Ziele, einschließlich aller Zwischenformen, sind grundsätzlich wertneutral. Und ich muss doch auch sagen, dass Ihr alle so weit gar nicht von einander entfernt seid.
Wir haben jetzt über Tiere – das Reh – gesprochen, man kann es auch als Metapher sehen; ob Mensch oder Sache, ob Zustand oder Befindlichkeit, ob Abbild oder Prozess – geht es nicht immer zuerst um das Verstehen, zumindest um das Verstehenwollen? Und um es dann um so besser darstellen zu können?
Ich glaube daran, dass, wenn alle Maler die Gesetzmäßigkeiten von Semantik, Syntax und Pragmatik optimal anwenden würden – ich weiß, dass das auch wieder sehr hypothetisch ist – dennoch dieunterschiedlichsten Resultate entstünden. Denn es ist ihre ganz spezifische Seelenkraft, die sie immer wieder aufs Neue antreibt und zu großartigen und glücklicherweise andersartigen und originären Werken finden lässt.
Bedenke bitte, dass es mir immer darum geht, eines ganz deutlich werden zu lassen: durch den souveränen Umgang mit Semantik und Syntax, mit naturnahen und naturfernen Mitteln, mit organischen und geometrischen Formen, mit Körper- und Seelenfarben wirst Du selbst Deinen großen Zielen näher kommen. (Entschuldige, da ich aus einer späteren Zeit komme und Deine letzten Bilder kenne, kann ich leicht den Propheten spielen.)
Es grüßt Dich ...
1 Aufzeichnungen auf Blättern in Quart ohne Titel über das Tierbild, Winter 1911/12; Nürnberg, Germanisches Nationalmuseum
Lieber Johann Wolfgang Goethe, (1)
mit Erstaunen habe ich vernommen, mit welcher Verbissenheit Du Deinen privaten Krieg gegen Isaac Newton geführt hast. Voller Abscheu schreibst Du: »... Aber eine Geschichte der Farbenlehre zu schreiben oder auch nur vorzubereiten war unmöglich, so lange die Newtonische Lehre bestand. Denn kein aristokratischer Dünkel hat jemals mit solchem unerträglichen Übermute auf diejenigen herabgesehen, die nicht zu seiner Gilde gehörten, als die Newtonische Schule von jeher über alles abgesprochen hat, was vor ihr geleistet war und neben ihr geleistet ward. ...«1
Aber sehen wir es einmal von dieser Seite: Vielleicht hättest Du nicht mit dieser Zähigkeit und Ausdauer Deine so überaus zeitraubenden und mit den damals noch so beschränkten technischen Möglichkeiten kompliziert durchzuführenden Versuche und Experimente verwirklicht, wenn diese Feindschaft nicht bestanden hätte. Sie hat Dich immer wieder angespornt, die Thesen Newtons anzuzweifeln und auf Deine – durchaus auch polemische – Art und Weise zu korrigieren. Leider hat Dein Hass Dich auch dazu verleitet, gewissermaßen das Kind mit dem Bade auszuschütten, denn einiges von dem, was Newtons Farbenlehre ausmacht, ist Deinen Erkenntnissen und Argumentationen überlegen und hat sie dementsprechend auch überlebt. So denke ich, dass Du beispielsweise bis zum Schluss nicht so recht begriffen hast, dass Du das Wesen der additiven Farbmischung nicht begriffen hast. Du gehst im Wesentlichen immer von der subtraktiven Mischung aus, wie sie z.B. vorliegt, wenn man in den Grundfarben gelb, rot und blau getöntes Glas übereinander legt: Es entsteht dort, wo alle drei Farben sich überschneiden, ein tiefes Schwarz. Wir haben es hier mit der Subtraktion, der Abnahme von Licht zu tun, also heißt es: Subtraktive Farbmischung.
Bei der additiven Farbmischung handelt es sich um ein Mischen von Lichtfarben. Man stelle sich eine neutrale weiße Fläche vor, auf die mittels Scheinwerfern drei verschiedenfarbige Lichtkegel projiziert werden, und zwar in den Grundfarben Gelb, Rot und Blau. Wir wollen einmal davon absehen, dass im additiven System die Grundfarben Orangerot, Blauviolett und Grün sind; die Grundfarben des subtraktiven sind die Mischfarben erster Ordnung im additiven System und die Grundfarben des additiven sind die Mischfarben erster Ordnung des subtraktiven Systems. Diese unterschiedlichen Voraussetzungen für Farbmischungen wollen wir der Einfachheit halber einmal beiseite lassen. Jedenfalls dort, wo sich alle drei Farben überlagern, entsteht Weiß. Und genau das zweifelst Du an. Du gehst als zu erwartender Ergebnisfarbe von einem Grau aus, womit Du natürlich irrst. Vorausgesetzt, es sind die drei exakten Grundfarben, ist das Resultat wirklich ein reines Weiß.
Im Zusammenhang mit diesem von Newton erzielten Weiß sprichst Du von »Kotweiß«. Ich weiß von einer Anekdote, deren Urheber ich leider nicht kenne, in der Du Newtons Ergebnisfarbe ein »schmutziges Weiß« nennst, und einen deftigen Vergleich ziehst mit der zu befürchtenden Farbe seiner Unterwäsche. Übrigens:
Die auch von Dir gemachten Mischungsversuche durch schnelle Bewegung – Grundfarben auf dem Farbkreisel – haben als Resultat eine graue Farbe; hier kann zwar bestmöglich ein neutraler Ton erzielt werden, aber es ist ein aus den drei Mischfarben gemittelter Helligkeits- bzw. Grauwert. Obwohl die Helligkeit weder zunoch abnimmt, wird diese Art der Mischung ebenfalls zu den additiven gezählt.
Das Echo auf Deine Farbenlehre war zum teil recht positiv, andererseits sprach man – vornehmlich von Seiten der Wissenschaft – von Dir als einem autodidaktischen Dilettanten. Mit anderen Worten: Du hast zwar kräftig ausgeteilt, musstest aber auch so Einiges einstecken. Wie bist Du damit umgegangen?
Mit besten Grüßen aus der Gegenwart
1 Johann Wolfgang Goethe, Die Farbenlehre, Münchner Ausgabe; Bd.10, S.13, (Vorwort); München 1989
Lieber Johann Wolfgang Goethe, (2)
Dir war sicherlich bewusst, dass Du mit einer im Gegensatz zum Wissenschaftler Newton ganz anderen Herangehensweise an die Phänomene der Farbe viele Wissenschaftler gegen Dich aufbringen würdest; Deiner bilderreichen Sprache entsprechend bist Du von Anfang an einen sinnlich-anschaulichen Weg gegangen. Dein Anliegen war nicht nur ausschließlich auf die Theorie gerichtet, sondern genau so auf das sinnliche Erleben und Anwenden der Erkenntnisse. Vielleicht hast Du hier und da auch des Guten ein wenig zu viel getan, beispielsweise bei der Chemie der Farben, was allein schon wegen der zwangläufigen Kurzlebigkeit Deiner Erkenntnisse riskant war.
Aber zurück zu Deiner Rolle in der Vielfalt der Widersprüche gegen Deine Arbeit. Du wehrst Dich mit Nachdruck, wenn Du schreibst: »Die Menge mag wohl jemanden irgend ein Talent zugestehen, worin er sich tätig bewiesen und wobei das Glück sich ihm nicht abhold gezeigt; will er aber in ein andres Fach übergehen und seine Künste vervielfältigen, so scheint es als wenn er die Rechte verletze, die er einmal der öffentlichen Meinung über sich eingeräumt, und es werden daher seine Bemühungen in einer neuen Region selten freundlich und gefällig aufgenommen.«1
Mit dieser Aussage können sich auch heute noch viele – besonders Prominente – anfreunden, die einen Fachwechsel vorgenommen haben, sei es vom Sport zum Singen, oder auch als Schauspieler von einem Seriendarsteller in eine andere Rolle bzw. in ein anderes Fach. Es ist das Problem der Festlegung auf eine Sache; mit Brüchen dieser Art hat der Betrachter immer seine Probleme. Und wenn diese schon im wahren Leben Flexibilität abverlangen und deshalb außerordentlich stören, um wie viel mehr dann, wenn es im Rampenlicht der Öffentlichkeit um den Nachweis von Kompetenz und Fachwissen geht.
Bei Dir kommt dann noch hinzu, dass Du auf einem reputierlichen Wissenschaftsgebiet als Autodidakt gewildert hast. Du hast einen der ihren durch Deine Veröffentlichungen nicht nur postum in seiner Ehre gekränkt, sondern ihn auch noch beschimpft.
Aus heutiger Sicht fällt mir auf, dass sich bezüglich der Begrifflichkeit doch so einiges geändert hat. Die Terminologie ist inzwischen nicht nur komplexer geworden, sie hat auch einige Bedeutungsverschiebungen erfahren. So ist Dein ganzes sinnlich-sittliches Farbempfinden2 mit seinen harmonischen, charakteristischen, und charakterlosen Farbzusammenstellungen mit Mühe zwar noch als Dein Denkergebnis nachvollziehbar, Gültigkeit in der beschriebenen Begrifflichkeit aber hat es keine mehr.
Wenn ich mir einmal das komplementäre Farbenpaar Rot und Grün – das Du als harmonisch bezeichnest – anschaue, dann empfinde ich eher eine gehörige Portion Disharmonie. Und dabei bist Du ganz nahe daran, Recht zu haben, denn: Du hast die Farbe zu eindimensional, zu sehr nur aus dem Blickwinkel des Farbtons heraus betrachtet und dabei vergessen, dass Farbe auch noch zwei weitere Qualitäten aufweist, nämlich Helligkeit und Sättigung. Du hast nur versäumt, auch auf diesen Gebieten nach Deiner Totalität der Farben zu suchen. Erst wenn Du die Pole Hell und Dunkel, sowie Gesättigt und Ungesättigt den beiden Farben in der richtigen Gewichtung zuordnest, ist die unabdingbare Konsequenz vollzogen und auch Harmonie herstellbar.
Nach welchen Kriterien sollte das geschehen?
Die aktivere der beiden Komplementärfarben Rot und Grün, also das Rot, soll den Grad seiner Helligkeit behalten, denn jedes Zugeben von Weiß würde zwar aufhellen, aber dieser Zugewinn an Aktivität würde mit einem Verlust der Farbintensität allzu teuer bezahlt werden müssen.
Das an sich schon passivere Grün sollte mit Schwarz soweit abgedunkelt werden, dass erstens eine deutliche Verdunkelung und zweitens eine starke Brechung der farblichen Intensität zur Folge hat. Damit ist im Zusammenspiel von Rot und Grün ein Höchstmaß an Totalität erreicht, und zwar bei allen drei Qualitäten des Lichts, der Farbe, der Helligkeit und der Buntheit. Es ist die vollkommene Totalität durch die Verwirklichung der lichtspezifischen Polaritäten Farbe – Gegenfarbe,Hell – Dunkel und Sättigung – Nichtsättigung.
Und siehe da – jetzt ist auch die Harmonie vorhanden, wie auch wir sie verstehen.
Du nennst Farbzusammenstellungen, deren Farben sich im Farbkreis nicht direkt gegenüber liegen, aber doch einen erheblichen Abstand von einander haben, charakteristisch.
Wenn ich darunter zwei Farben verstehe, die jeweils ihren eigenen Charakter haben und ihn auch gegeneinander behaupten, kann ich mich ein wenig mit dieser Terminologie anfreunden. Aber als deutliche Klassifizierung halte ich den Begriff charakteristisch trotzdemfür ungeeignet, denn charakteristisch sind auch und besonders die absoluten Gegenfarben, die Komplementärfarben.
Für den Begriff der charakterlosen Farbzusammenstellungen fehlt mir jedoch jegliches Verständnis. Ich sehe mich außerstande, Farben – oder auch Farbkombinationen – nach sittlichen, moralischen oder ethischen Kriterien zu bewerten. Diesen Zwiespalt unserer Meinungen müssen wir wohl ursächlich der veränderten Terminologie zuschreiben.
So ist auch sehr irritierend, dass Du selbst einen Teil Deiner Ausführungen polemisch3 nennst. Ein Redender oder Schreibender, dem man heute Polemik vorwirft, wird sich energisch dieses verbitten wollen. Er wird – ob zu recht oder zu unrecht, sei einmal dahingestellt – behaupten, seine Ausführungen seien argumentativ und von Fakten getragen; er würde den Vorwurf der Polemik als herabwürdigend empfinden und sich entsprechend dagegen wehren. So gern ich Deinen Worten einen anderen, nämlich dem Deiner Zeit entsprechenden Sinngehalt des Wortes Polemik zubilligen möchte – Deine Auslassungen gegenüber Newton sind damals wie heute zum Teil herabsetzend und eines Dichterfürsten – ja, so wirst Du heute von uns genannt – nicht würdig.
Mit freundlichen Grüßen
1 Johann Wolfgang Goethe, Die Farbenlehre, Münchner Ausgabe; Bd.10, S.902, (Konfession des Verfassers); München 1989
2 Ebenda, S.229 ff, (Sinnlich-sittliche Wirkung der Farbe)
3 Ebenda, S.275 ff, (Enthüllung der Theorie Newtons, Des ersten Bandes zweiter, polemischer Teil)
Lieber Wassily Kandinsky, (1)
Deine Aussagen über das Geistige in der Kunst1 und die Anmerkungen über den Weg von der Semantik zur Syntax durch Abstraktion – und auch zum hierarchischen Bildaufbau – finde ich besonders aufschlussreich und anregend. Du schreibst:
»... auf weiterem Wege der Künstler von der ›literarischen‹ Färbung des Gegenstandes zu rein künstlerischen (bzw. malerischen) Zielen zu streben anfängt. Dieser Weg führt zum Kompositionellen. Die rein malerische Komposition hat in Bezug auf die Form zwei Aufgaben vor sich:
1. Die Komposition des ganzen Bildes.
2. Die Schaffung der einzelnen Formen, die in verschiedenen Kombinationen zueinander stehen, sich der Komposition des Ganzen unterordnen [Die große Komposition kann selbstverständlich aus kleineren in sich geschlossenen Kompositionen bestehen, die äußerlich sogar feindlich einander gegenüberstehen, aber doch der großen Komposition (und gerade in diesem Falle durch das Feindliche) dienen. Diese kleineren Kompositionen bestehen aus einzelnen Formen auch verschiedener innerer Färbung.] So werden mehrere Gegenstände (reale und eventuell abstrakte) im Bild einer