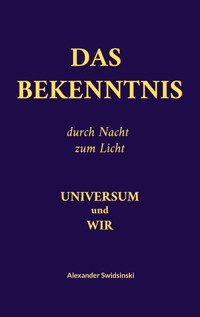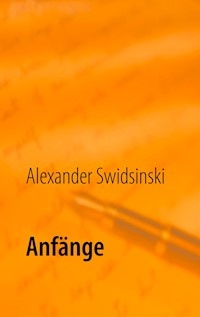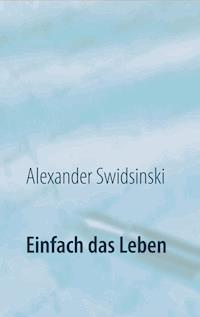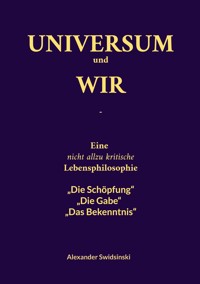
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
Vor dem Einschlafen erzählt man dem Kind eine möglichst ungetrübte Geschichte. Möge der Schatz unbeschwert ruhen und etwas Schönes träumen. Die Erzählung muss nicht simpel sein, darf ruhig nachdenklich stimmen, aber ihre Wendungen sollten stets gut enden. Meine Abhandlung bezweckt das Gleiche für alle Menschenkinder und in jedem Alter. Es ist eine Gute-Nacht-Geschichte für diejenigen, die nicht wissen, was der morgige Tag bringen wird. Sie ist festgehalten in kurzen Fragen und Antworten zu Themen, die wir gewöhnlich für selbstverständlich halten, ohne dass sie es im Geringsten sind. Das sprunghafte Wechselspiel der Darstellung provoziert zuweilen, aber nur, um auf die bestehenden Widersprüche unserer Auffassungen hinzuweisen. Jede Frage bietet Anlass, sich aus dem Alltäglichen auszuklinken und das Gewohnte aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten. Jede Antwort bringt Hoffnung und Neugierde auf weitere Fortsetzungen. Der Inhalt ist systematisch in drei Abschnitte eingeteilt. Die Schöpfung Die Gabe und Das Bekenntnis Das letzte Buch fasst das Wesentliche der ersten beiden Bücher zusammen, ohne auf die Einzelheiten von Physik, Biologie und Kultur einzugehen. Das Bekenntnis geht schnurgerade zum wichtigsten Thema der Trilogie dem menschlichen Geist über, betrachtet seine Entstehung, Gegenwart und ferne Zukunft. Die allzu Ungeduldigen können gleich damit beginnen, werden dort aber keine ausführlichen Erklärungen finden.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 631
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Vor dem Einschlafen erzählt man dem Kind eine möglichst ungetrübte Geschichte. Möge der Schatz unbeschwert ruhen und etwas Schönes träumen. Die Erzählung muss nicht simpel sein, darf ruhig nachdenklich stimmen, aber ihre Wendungen sollten stets gut enden.
Meine Abhandlung bezweckt das Gleiche für alle Menschenkinder und in jedem Alter. Es ist „eine Gute-Nacht-Geschichte“ für diejenigen, die nicht wissen, was der morgige Tag bringen wird. Sie ist festgehalten in kurzen Fragen und Antworten zu Themen, die wir gewöhnlich für selbstverständlich halten, ohne dass sie es im Geringsten sind. Das sprunghafte Wechselspiel der Darstellung provoziert zuweilen, aber nur, um auf die bestehenden Widersprüche unserer Auffassungen hinzuweisen. Jede Frage bietet Anlass, sich aus dem Alltäglichen auszuklinken und das Gewohnte aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten. Jede Antwort bringt Hoffnung und Neugierde auf weitere Fortsetzungen. Der Inhalt ist systematisch in drei Abschnitte eingeteilt.
„Die Schöpfung“
„Die Gabe“ und
„Das Bekenntnis“
Das letzte Buch fasst das Wesentliche der ersten beiden Bücher zusammen, ohne auf die Einzelheiten von Physik, Biologie und Kultur einzugehen. „Das Bekenntnis“ geht schnurgerade zum wichtigsten Thema der Trilogie – dem menschlichen Geist über, betrachtet seine Entstehung, Gegenwart und ferne Zukunft.
Die allzu Ungeduldigen können gleich damit beginnen, werden dort aber keine ausführlichen Erklärungen finden.
Inhalt:
erstes buch
DIE SCHÖPFUNG
DAS LEBEN
EVOLUTION
Erklärungen der Evolution
Zweckmäßigkeit
Zufall und Überlebenskampf
Widersprüche
Verbrechen
Werkzeuge der Evolution
Sexualität
Lebensräume
Geburt
Entwicklung
Hingabe
Jugend, Reife, Alterung
Lebensdauer
Tod
Territorien
Aggression
Grenzen
Glanz
DAS SOZIALE Schwarm, Schar, Rudel, Herde
Hierarchie
Parasitismus
Kooperation
Ehe
GESCHICHTE DES LEBENS
Ozean
Bakterien
Polymikrobielle Gemeinschaften
Eukaryot
Vielzeller
Trilobiten
Wirbeltiere
Landleben
Pflanzen
Insekten
Amphibien
Reptilien
Evolutionsschleife
Einstieg und Aufbruch
Übermacht und Gigantomanie
Untergang
Miniaturisierung
Auf und Ab
TEIL II GENESIS
Autokatalyse
Entscheidung(s)Findung
ERFAHRUNG
Das Genetische
Ausbau des Eigenen
Vernetzung des Eigenen
Vernetzung des Gemeinsamen
Außergenetische Erfahrung
TEIL III VERNUNFT
Freier Wille
Sinn, Reiz und Reaktion
Bedingte/unbedingte Reflexe
Triebe und Organe
Instinkt
TEIL IV LEBENSPHILOSOPHIE
Wahrnehmung
Vorstellung und Phantasie
Erkennen
Abbilder
SYMBOLE, INHALTE, SPRACHEN
Inhalte und Namen
Alle Wege führen zusammen
Doch nicht so!
Nebel der (Un)Logik
(
nicht) Gegebene
Gewissheit
Erklärung
Verstehen
Einfalt des Faches
TEIL V DIE WELT
PHYSIS Raum und Materie
Dualer Charakter des Lichtes
Abstoßung der Schwerkraft
Antigravitation der Entropie
ZEIT
Zeiten
Ursache
ZIVILISATION
KULTUR
Zwang, Tausch oder Ansporn
Kontrolle
Würden sie es wagen?
Führer
Macht
GESTRIGE(N)
Götzendummerung
Mahner
NATUR
Kunst (-liche?)
WIRTSCHAFT
DEFINITIONEN
Werte
Vermögen
Kosten
Ware
Wertschöpfer
Preis
Preisbildung
Verfügbarkeit
Nachfrage
(
Des)Interessen
Markt
EIGENTUM
Ent-und Eignung
FINANZEN
Geld
Gold
Kreditwesen
Banken
Nationale Währungen
KONJUNKTUR
Rezession
Beschäftigung
Grenzen des Wachstums
Mathematik des Wachstums
..
ISMEN der Dämmerung
Kampf der Lüge
Verdinglichung
Scheiterhaufen
Was Sie nicht sagen!
Moral..(an)..Sprüche
Das Gutgemeinte
Wie ich dir…
Rücksicht und Toleranz
Viel Feind’, viel Ehr’!
ALLES WIRD GUT
zweites buch DIE GABE
Die Kunde der Krankheit
Sackgasse der Bedürfnisse
Bedarf
Triebe
Auf und davon
TEIL II QUELLEN des ICHs
"Tamensi movetur!"
Lebensfunke
Genesis
Gelegenheit
DENKEN
Rezeptor-Reiz-Wahrnehmung
GENE
Blamagen-Kreise
Wer im Körper das Sagen hat
Gene und Bücher
Neologismen
Sic transit gloria mundi
EGO und EROS
Divergenz
Verflechtung
Gemeinschaft und Eigensinn
SEXUELLE REVOLUTION
Blick hinter dem Horizont
Bestand statt Wankelmut
Spiele statt Mühsal
Träume statt Arglist
Yin und Yang
Bis der Tod scheidet
Hingebung statt Ruchlosigkeit
Sehnsucht nach Ewigem
Sexempfindlichkeiten
Wozu Geschlechter?
Homo/trans und andere
„Me too“
Promiskuität
Sicherung der Brut
TEIL III LEIB und SINN(E)
GEFÜHLSKULTUR
Anatomie der Gefühle
Vorschuss
Raffgier
Versuchungen
Aufputschen
Rausch
Ungeduld
Verzückung
Gefühlslenkung
Zeichensetzen
Pause
Abstand
(
Ein)Stimmung
SCHLAF
UNSERE TÄGLICH ANGST
Angstbegleiter
Angsttrotzendes
SEELEN(un)RUHE
Das Verzichtbare
Das Bessere und Bequeme
Zurechtbiegungen
Sich-Leisten-Können
Gemeinheit
DAS ICH
Alleinsein
Die Unseren
Sein-Scheinen
Ruhm
TEIL IV WEISUNG UND WEISHEIT
Das Schöne und der Rest
Dieses süße Wort Freiheit
Das Gute und die Güte
BESTIMMUNG
Leiden kommt vom Wollen
Zuversicht
Unerwartetes
Tod im Leben
Umgang mit dem Altern
MENSCHEN(un)WÜRDIGES
Sinn des Lebens
Verblendung
Wahrheit?
Bosheit
Sünde
BEINAH RELIGIÖSES
Unsterblichkeit
Körperlichkeit
Innerlichkeit
Erfüllung
Jedem das Seine
BEWUSSTSEIN
GEIST
Reiner Verstand
Nachwort
drittes buch DAS BEKENNTNIS
URSPRUNG
WEGWEISER
Das Genom
Kultur
Bewusstsein
DAS INDIVIDUELLE
DAS GEMEINSAME
VEREINE
Führung
Werkzeuge der Macht
Recht und Faust
Kompetenz
Verantwortung
Legitimation
SCHÖPFUNG
GEIST UND SEELE
Ego
Zuneigung
Zeugung
Aufstieg der Vernunft
SCHEINALTERNATIVEN
Moralisierungen
DEMOKRATIE
Struktur
Dedemokratisierung
„Triumph des Willens“
Mandate
Verantwortung
Meinungs(un)freiheit
Mogelzahlen
Triumph des Geistes
Vorwärts
DAS GRUNDGESETZ
ZIELE
Verbreitung
Bejahung des Seins
Vervollkommnung
Bewusstseinspflege
Schöpfungsförderung
Mündigkeit
MENSCHEN VON MORGEN
Haus der Menschheit
Insignien
Zur Darstellung:
Alles Zitierte ohne Angabe eines Autors ist kursiv hervorgehoben. Autoren sind nicht erwähnt, wenn sie in Internetsuchmaschinen leicht zu ermitteln sind.
Was man sonst in Fußnoten unterbringt, wurde im Text belassen und in (Klammern gesetzt) oder grau markiert.
erstes buch
DIE SCHÖPFUNG
Es gab eine Zeit, da richteten sich die Menschen nach den Sternen. Dem klaren Nachthimmel zugewandt, träumten Bauern von üppigen Ernten. Jäger und Wanderer entwarfen verwegene Routen, Abenteurer und Gelehrte ersehnten ferne Welten. Diese Sinneshaltung ist abhanden gekommen. Die Erde ist längst vermessen und aufgeteilt. Grelle Lichterwerbung verdrängte die Sterne aus unserer Wahrnehmung. Die einst stille Besinnlichkeit der Nacht ist heute mit aufdringlichen Reizen gefüllt. Schade. Denn die eigentliche Entdeckungsreise steht noch bevor!
Galaxien eines Superhaufens dehnen sich über unvorstellbare 300 bis 400 Millionen Lichtjahre aus. Der Durchmesser unserer heimatlichen Spiralgalaxie beträgt 100 000 Lichtjahre. Die Wissenschaft weitet die Grenzen des Universums Jahr für Jahr immer weiter aus. Faszinierend finde ich allerdings nicht die Dimensionen, sondern den kommenden Menschen, der sich diesen Weiten gewachsen zeigt und sie bezwingen wird.
Der nächstliegende Stern, Proxima Centauri, ist 4,3 Lichtjahre von uns entfernt. Der Abstand zu lokalen Gruppen von Galaxien, wie dem Andromedanebel, beträgt etwa zwei Millionen Lichtjahre. Selbst diese nächsten Entfernungen sind für den heutigen Menschen nicht überwindbar. Alle technischen Raffinessen werden daran nichts ändern. Dennoch muss der Mensch das Sonnensystem verlassen. Die Geborgenheit des irdischen Daseins täuscht. Unsere Sonne hat den Zenit überschritten. Ihre Zeit läuft unaufhaltsam ab. Der Mensch wird eines Tages andere Welten erschließen müssen. Für diesen Sprung reichen weder Motoren noch Raketen. Eine Lebensdauer von 10 000 Jahren dürfte dagegen ein guter Anfang sein. Nur woher nehmen?
Die Industrie überschüttete den Menschen mit Gütern, machte ihm jede Lage genehm. Besser wurde er dadurch nicht. Im Gegenteil! Zwischen Arbeits- und Kaufstätte ist der Mensch fett und träge geworden. Von wegen mehr leisten! Er kann gerade noch das Vorhandene verwalten. Verwundert betrachtet er die Werke seiner Vorfahren. Wie haben sie nur das alles zuwege gebracht? Genervt überlässt er seinen Alltag den Maschinen. Er versteht immer weniger von dem, was ihn umgibt und reagiert nur noch. Wohin wird dieser Weg führen?
Es ist an der Zeit, sich zu entscheiden, was der Mensch eigentlich will: lebenslanges Sattsein mit gesichertem Platz im Pflegeheim, kraftlosem Leib im Rollstuhl, mit Latz um den Hals, schiefem Mund und erloschenem Blick, oder einen schlanken Körper mit Verstand und Seele, die Funken sprühend nach den Sternen greifen.
Ein anderer Mensch muss her! Ein Mensch, der die jetzigen Wertvorstellungen – Vorzeigereichtum, Medienanerkennung, Zugehörigkeit zu einer „überlegenen“ Kultur, großen Nation oder gehobenen Stellung – für Almosen hält. Ein Mensch, der sich statt an Hab und Gut an der eroberten Unendlichkeit misst. Dieser Mensch wird enorme Energiemengen und Ressourcen für seine Unternehmungen beanspruchen. Vor allem aber wird die Lebenszeit dieses Menschen statt weniger Jahrzehnte – Jahrtausende betragen müssen. Die Menschheit darf künftig nur so wachsen, dass jedes ihrer Kinder länger lebt, lernt und wirkt!
Phantasien? Hirngespinste? Ich stelle mir einen Menschen aus dem Jahre 1900 vor. Ich komme aus der Gegenwart, um mit ihm über das Bevorstehende zu sprechen. Würde es mir gelingen, ihn über das Jahr 1914 oder 1939 aufzuklären? Würde er mir glauben, wenn ich ihm von Raketen, Atomkraft, Internet berichte? Wir stellen uns den morgigen Tag und den Tag des Jahres 2100 ähnlich dem heutigen Tag vor. Wird er so sein? Wie wird die Zukunft aussehen, was wird sie dem Menschen bieten? Was erkennt man in einer Glaskugel? Wachswaben menschlicher Häuser, Wälder und Flure zu Erholungsparks umgewandelt, in Reih und Glied übereinander getürmte Schlafboxen – genormt (fantasielos, aber mit einem Fernsehanschluss), Fastfood-Imbisse an jeder Ecke, endlose Strände als Bräunungsstudios unter einem UV-Schutzdeckel. Wird unser blauer Planet zu einer riesigen Retorte, in der es von „Menschenhefen“ wimmelt und gelb-bräunlich gärt?
Ohne mich! Ich habe anderes vor. Viel ist hierzu nicht nötig. Jeder Schritt, der den Menschen klüger, stärker, langlebiger macht, bringt uns den Sternen näher.
–
DAS LEBEN
– Wolf, lass die Geißlein in Frieden, nimm einen Kuchen.
Meine Tochter spielt gern neben dem Schreibtisch, während ich arbeite.
– Wölfe essen keine Süßigkeiten, bemerke ich unbedacht bei diesem naiven Vorschlag.
– Wolf, nimm eine Mohrrübe.
– Wölfe mögen keine Mohrrüben, erwidere ich immer noch arglos.
– Was kann man dem Wolf sonst anbieten? Große Augen schauen mich an.
– Hm? Jetzt bin ich stutzig. – Vielleicht...Bulette.
– Wolf, nimm eine Bulette.
Mein Töchterchen spielt unbekümmert weiter. Mir dagegen verging jegliche Lust zur Arbeit.
Fragen können erheitern wie ein guter Witz und aufschrecken wie ein Schuss in der Stille. Sie führen ihr eigenes Leben, zeigen Ungehorsam, stören, drängeln, lärmen. Sie flüchten wie scheue Tiere vor einer rüden Annäherung, und folgen auf den Fersen, wenn man ihnen entkommen will. Ihre Körperlosigkeit täuscht. Sie wiegen oft schwer und können hart treffen. Viele Umwälzungen begannen mit arglosen Fragen.
Wenn die Erde flach ist, warum sind die Schatten im Zenit je nach Ortslage vom Süden zum Norden verschieden lang, vom Westen zum Osten aber nicht? Ist die Erde etwa rund und dreht sich kreisend um die Sonne? Lässt sich aus den örtlichen Längenunterschieden des Schattens gar der Erdumfang berechnen?
Wenn das Schwere (eine Kanonenkugel) schneller fällt als das Leichte (eine Feder), warum prallen dann zwei ungleich schwere Kanonenkugeln zeitgleich auf den Boden? Ist die Fallgeschwindigkeit etwa nicht vom Gewicht abhängig?
Wenn man sterben muss, was haben Mühen für einen Sinn? Hat der Mensch womöglich eine Seele und ist ihr Wesen unsterblich? Wenn ja, wo findet man sie, woraus und wie ist diese beschaffen? Die gewöhnlichen Dinge sind voller Rätsel. Die Geheimnisse schlummern unter einer vertrauten Oberfläche bis man auf Widerspruch stößt. Die Dämonen der Zweifel erwachen. Die Gewissheit bröckelt, die eingebildete Sicherheit ist dahin. Die Wirklichkeit selbst scheint sich aufzulösen.
Die Bodenlosigkeit ängstigt. Bestürzt zieht der Mensch Abschottung und Mauern – der Ungewissheit, Ausflüchte und Dogmen – den Zweifeln vor. Schade, denn Widersprüche sind weder Fluch noch Bürde, sondern wertvolle Funde. Zweifel sind Wegweiser zur Wahrheit.
Die Menschheit hat sich seit langem damit abgefunden, dass die Erde rund und das Universum unendlich ist. Die verwegenen Hypothesen der Physik bringen niemanden mehr ins Schwitzen oder aus dem Gleichgewicht. Anders, wenn es um das Leben geht. Ein Dickicht an Tabus und Selbstzensur umgibt dieses Thema. Wir wandern mit Scheuklappen an Abgründen, leben in und von selbstgefälligen Mythen und missbrauchen die Wissenschaft zur Rechtfertigung banaler Ausreden.
Das Leben zu verstehen und das Verstandene im Leben umzusetzen, vor nichts zurückzuschrecken und keiner unbequemen Frage aus dem Weg zu gehen, ist das Anliegen der folgenden drei Bücher.
Das erste Buch behandelt die Evolution des Lebens und verfolgt den Weg von einfachen chemischen Reaktionen bis zur menschlichen Zivilisation. Es hat folgende Kernaussage: Die so sehr unterschiedlich anmutende Biologie, Physik, Kultur, Gesellschaft, Wirtschaft und Ideologie haben viel mehr Gemeinsames als wir denken. Ihre Elemente erscheinen unvergleichbar und klar voneinander getrennt. Der Eindruck ist falsch. Alle Gegenstände der einzelnen Wissensgebiete ergeben sich aus dem gleichen Streben des Lebens, sich von Zwängen der unbelebten Welt zu emanzipieren. Die einzelnen Eigenschaften von den Objekten dieser Welt (wie auch die „Objekte“ selbst) sind nicht an sich gegeben. Die Unterschiede im Erfassten wurzeln in den Mitteln, welche das Leben gerade entwickelt hat, um in die Wirklichkeit einzudringen. Jedem Instrument sind spezifische Messwerte und Ausdrucksformen eigen. Sie prägen das resultierende Erscheinungsbild.
Wachsen die Möglichkeiten des Lebens, so ändern sich auch die einzelnen Vorstellungen sowie das ganze Weltbild in einer unvergleichbaren zu der alten Weise, ohne das die Wirklichkeit dabei anders wird.
Das zweite Buch ist spezieller und zugleich konkreter.
Es behandelt die individuellen und ichbezogenen Themen. Sie betreffen den menschlichen Körper, Gefühle, Triebe und das Bewusstsein. Ihre Betrachtung soll ein Kompass für Leib und Seele sein und eine praktische Lebenshilfe bieten.
Die Darstellung beider Bücher ist zwar systematisch um das Phänomen Leben geordnet und vom Primitiven zu immer Höherem gerichtet, jedoch nicht gleichmäßig in ihrem Lauf. Vieles von dem Dargestellten widerspricht manchen Vorstellungen, die sowohl im Alltag wie in der Wissenschaft noch stark verbreitet sind und wird daher detailliert und kritisch besprochen. Was dagegen klar ist, wurde nur kurz angeschnitten, in der Zuversicht, dass der Leser, nach Bereinigung von Fehldeutungen, selbst die Lücken der Darstellung schließt und hierfür keine kleinliche Bevormundung braucht.
Ich habe mich bemüht, so anschaulich wie möglich zu sein und dabei nur die Beispiele aufzugreifen, die entweder jedem bekannt oder in Suchmaschinen wie Google leicht nachzuschlagen sind.
Der polemische Charakter der ersten zwei Bücher sowie die Breite und der Umfang der angeschnittenen Themen machen das Lesen und Aufnehmen des Stoffs nicht gerade leicht. Die besprochenen Details sind vielleicht auch nicht für jeden im gleichen Masse wichtig.
Das dritte Buch kompensiert daher die Turbulenzen, scharfen Kurven, die Polemik und Fülle an Beispielen der ersten beiden. Es beschränkt sich nur auf das Positive und verfolgt geradlinig die Entstehungsgeschichte des Lebens von dessen primitiven Anfängen bis zum menschlichen Geist.
Ausführliche Erklärungen und aufreibender Faktencheck werden hier konsequent vermieden. Wer die Schlussfolgerungen darin für zu banal bzw. unzureichend hält und nach Belegen und Erklärungen sucht, wird auf die ersten beiden Bücher verwiesen.
EVOLUTION
Stein oder Computerchip?
Der Querschnitt eines Steins und die Oberfläche eines Mikroprozessors sehen ähnlich kompliziert aus. Hier und da wechseln Einschlüsse und Schichten sich unregelmäßig, jedoch streng geordnet, ab. Gewundene Linien schimmern in seltsamen Farben. Dennoch ist eine Verwechslung ausgeschlossen. Die Struktur des Steins verkörpert chronologisch die Umstände. Wer die fossile Sprache versteht, erkennt in den bizarren Ablagerungen der Sedimente die Entstehungsbedingungen, Gezeiten und die wechselhaften Ereignisse der Erdgeschichte. Der Mikroprozessor ist ein Werk des Strebens. Sein Schöpfer ist der Zweck. Die Chiparchitektur ergibt sich nicht aus den naturgegebenen Umständen.
Wenn man eine Stufenleiter von den Umständen bis zum Zweck bildet, wo liegt dann das Leben auf einer Skala zwischen dem Stein und dem Computerchip?
Die erste Hilfestellung liefert uns der Sprachgebrauch. Der Begriff „organisch“ hebt das Besondere des Lebenden hervor und grenzt es von dem Unbelebten, dem „Anorganischen“ ab. Worin besteht aber der Gegensatz? Was macht das Lebende organisch?
Organ ist ein griechisches Wort für Instrument. Die Einbindung des Werkzeugs in die Sinngebung des Organischen ist maßgeblich. Ohne diese Verknüpfung verliert das Wort seinen anschaulichen Inhalt. Polyethylen, Latex, Nylon und andere Erzeugnisse der „organischen“ Chemie sind unbelebt, organisch sind wiederum, die aus „anorganischem“ Calciumphosphat aufgebauten Schalen der Meerestiere. Der Stoff, aus dem das Leben besteht, ist für die Definition nebensächlich. Entscheidend ist der damit verbundene Zweck. Das Organische muss dem Leben dienen, die Zusammensetzung und Beschaffenheit des Organischen ergeben sich daraus.
Stehen wir demzufolge einem Computer näher als einem Stein, dem Zweck näher als dem Zufall?
Die Entstehung des Steins ist inzwischen entschlüsselt. Wir können recht genau sagen was, wann, wo geschah und seine einmalige Struktur formte. Wann aber kommt der Zweck in die Natur? Woraus besteht und woraus ergibt sich dieser?
Wie kommt das Leben zu seinen Organen, warum werden diese immer vollkommener? Kurz: Welche Kraft ist der Chipmacher des Organischen?
Erklärungen der Evolution
Die Entdeckungen der Paläontologie, der Wissenschaft über das Erdzeitalter, belegen, dass die Entwicklung des Lebens vom Einfachen zum Komplexen geschah. Wir erfahren, dass aus einem Einzeller ein Vielzeller entstand, dass dieser nach mehreren Entwicklungsschritten zum Menschen wurde. Mit den Deutungen dieser Vorgänge beschäftigen sich die Theorien der Evolution.
Zweckmäßigkeit
Lamarck (1744-1829) leitete die Evolution aus dem Streben zum Besseren ab. Seiner Ansicht nach wuchs der Hals einer Giraffe, weil das Urtier nach immer höheren Zweigen langte. Mit der Vererbung erworbener Eigenschaften nahm die Halslänge zu.
Die Erklärung Lamarcks befriedigte seine Zeitgenossen nicht. Damals stellte man sich Zeugung als eine direkte Vermehrung von elterlichen Eigenschaften vor. Von dieser falschen Annahme ausgehend kam man nicht weiter. Alle Experimente und bekannten Fakten widersprachen ihr.
Der Biologe Weismann amputierte Mäuseschwänze in mehreren Generationen. Die Schwanzlänge neugeborener Mäuse blieb unverändert. Andere Forscher verwendeten aufwendigere Versuchsanordnungen. Sie erhielten bei vielzelligen Organismen stets das gleiche Ergebnis. Die den Eltern beigebrachten Veränderungen waren bei den Kindern nicht zu entdecken. Das Gegenteil belegende Experimente wurden bis in das 20. Jahrhundert wiederholt. Vergeblich. Selbst bei „positivem Ausgang“ erwiesen sie sich später als Selbsttäuschung oder Falsifikationen. Mehr noch, zu Beginn des 19. Jahrhunderts wurden Gene als informative Bausteine des Lebens dem Zellkern zugeordnet. Die Mikroskopie zeigte, dass ein vielzelliger Organismus aus Tausenden von Zellen besteht. Die Kerne aller dieser Zellen enthalten eigene Gene. Die Körperzellen entstehen nicht neu, sondern stammen von Vorgängerzellen ab. Dabei werden Gene kopiert und von der Mutterzelle auf die Tochterzellen verteilt. Einige der Zellen werden nach fortgesetzten Teilungen zu spezialisierten körperlichen, die anderen zu Keimzellen. Diesen Vorgang nennt man Differenzierung. Ein Austausch der genetischen Substanz zwischen einzelnen spezialisierten Körperzellen und Keimzellen ließ sich experimentell nicht belegen. Da die Körperzellen weder ihre eigenen Gene noch die Gene der Tochterzellen oder Keimzellen ändern können, wie sollen sie erworbene Eigenschaften vererben?
Gar nicht – schlussfolgerte Darwin (1809-1882) und lehnte Streben als Instrument der Artenbildung ab.
Zufall und Überlebenskampf
Wenn erworbenen Veränderungen nicht direkt übertragbar sind, was bewegt dann die Evolution?
Erbgut! Sagte die Selektionshypothese. Das Wort „Gene“ wurde zwar später eingeführt, beschreibt aber am nächsten das Gemeinte. Wir werden in unserer Darstellung durchgehend derzeit geläufige Begriffe wie Gen, Genotyp, Mutation und andere verwenden, obwohl die Väter der Selektionshypothese andere, rein beschreibende Bezeichnungen für die gleichen Inhalte nutzten. Diese ursprünglichen Namen sind inzwischen vergessen und sagen dem Gegenwartsleser nichts.
Der Darwinismus erhob den Zufall in den Rang des Schöpfers der Evolution. Demnach erfolgt die Evolution unabhängig von Verhalten und Bestrebungen der Lebewesen. Jede Körper- oder Verhaltensänderung bedarf einer Änderung des Erbguts (der Gene). Gene bestimmen, was der Organismus tut und was er wird. Die Veränderungen der Gene sind rein zufällig und vom Organismus nicht beeinflussbar. Diese unvorhergesehenen Abweichungen wurden später Mutationen genannt. Der Zufall ihres Auftretens lenkt die Evolution.
Minuziös beschreibt Darwin Variationen der erblich bedingten Merkmale innerhalb einzelner (damals nur makroskopisch sichtbarer) Arten. Bakterien und Einzeller waren in die Betrachtungen von Darwin noch nicht einbezogen, denn diese ändern ihre Gene selbständig und direkt. Man wusste jedoch damals von diesen winzigen und „ursprünglichen“ Wesen wenig.
Die Gründlichkeit von Darwins Beschreibungen beeindruckt, erklärt aber nicht, wie die vermeintlichen Mutationen der Erbmasse generell zu einem Zweck führen können.
Um Mutationen Gewicht zu verleihen, führt Darwin den Überlebenskampf ein. Jede Art hat demnach eingeschränkte Ressourcen zum Leben. Eine Vermehrung der Population über das erträgliche Maß hinaus mündet im Überlebenskampf. Die Evolution findet statt, weil die „Schwächeren“ aussterben, die Besseren aber (gemeint sind die Übriggebliebenen) weiterleben. Mit anderen Worten – der Hals der Giraffe wurde länger, nicht weil ihre Vorfahren nach den saftigen Blättern langten, sondern weil ihr Hals länger ausfiel (als bei der Konkurrenz), konnte die Giraffe die höheren Zweige erreichen, überleben und sich vermehren. Die Giraffe hatte schlicht keine andere Wahl.
Die Vorstellungen Darwins wurden von den Vorarbeiten von Malthus gestützt. Malthus leitete soziale Menschennöte aus der „Bevölkerungsfalle“ des vorausgehenden Wachstums ab. Die europäische Kartoffelkrise und die Hungersnot in Irland (1845-1852) kostete Millionen Menschen das Leben und schien die düsteren Visionen einer Überbevölkerung zu bestätigen. Malthus und Darwin machten Kriege und Hungersnöte sowie „die Selektion des Stärkeren“ zum Kerngedanken der sonst so sachlich klingenden „Selektionshypothese". Ihre wirkliche Inspiration holten sie sich aus der Calvinistische Prädestinationslehre und dem erbarmungslosen Kapitalismus der damaligen Zeit.
Eine gleichsam einprägsame wie einfache Behauptung, die dem Sieger bessere Eigenschaften unterstellt und wiederum jedes Mittel rechtfertigt, sein Erbe zu verbreiten, wurde salonfähig und fand Einzug in Politik, Wissenschaft und Kultur. Der Darwinismus fegte die religiösen Dogmen und Entstehungsmythen fort. Darüber hinaus ist wenig Erfreuliches hinzuzufügen. Geist, Seele und selbst Humanismus wurden verworfen. Unverhohlene Gewalt, Zügellosigkeit, Macht- und Geldgier wurden zu neuen Idolen. Die Götzendämmerung kam über die Menschheit. Das Leben wurde zum Spielball blinder Umstände herabgestuft.
Mit der Zeit wurden die Grundgedanken des Darwinismus durch immer neuere Entdeckungen der Genetik vervollständigt und weiterentwickelt. Die Fortschritte der Biologie waren enorm. Das Vokabular hat sich dementsprechend stark geändert. Die Hauptpostulate und die Ablehnung des gestalterischen Potenzials vom Streben blieben gleich.
Widersprüche
Der Darwinismus leitet die Evolution von zufälligen Mutationen ab. Eine Rechenschaft des Machbaren bleibt er schuldig. Schon einfache Schätzungen führen die schöpferischen Möglichkeiten des Zufalls ad absurdum. Zwei, drei Würfe genügen, damit eine Münze auf die gewünschte Seite fällt. Bei einem Spielwürfel sind mehrere Würfe erforderlich. Die Zahl missglückter Versuche explodiert, sollen vier, fünf oder sechs Würfel auf eine bestimmte Seite fallen. Folgt die Evolution des Lebens dem gleichen Prinzip, so müsste mit der wachsenden Komplexität ihrer Schöpfungen entweder die Zahl der Versuche und Aussonderungen hochschnellen oder die Entwicklung sich verlangsamen, falls die Zahl der Würfe begrenzt ist.
Beide Voraussagen treffen nicht zu. Die Evolution wird mit der wachsenden Komplexität von Organismen schneller, während die Zahl an Würfen bzw. Nachkommen abnimmt. Fehlbildungen werden dabei immer seltener.
Etwa vier Milliarden Jahre sind seit der Entstehung des Lebens vergangen. Am längsten verweilte das Leben auf der Stufe der einzelligen Organisation. Dann entsteht der Vielzeller. Sogleich in dem relativ kurzen Zeitraum der letzten 700 Millionen Jahre überschlagen sich die Ereignisse. Dabei beträgt jeder nachfolgende Abschnitt vom Wirbellosen zum Wirbeltier, vom Fisch zum Amphibium und Säugetier, vom Säugetier zum Menschenaffen, vom Menschenaffen zur Zivilisation, vom Vorindustrie- zum Industriezeitalter, von der Industrie- zur Computerzeit nur einen Bruchteil der vorausgegangenen Etappe.
Der Darwinismus sieht Not und Aussonderung als Gestalter der Zweckmäßigkeit. Demnach müssten Organismen mit hohen Geburtenraten und Verlusten die größte Evolutionsgeschwindigkeit haben. In Wirklichkeit ist es umgekehrt. Es gibt bei weitem mehr Mücken als Menschen. Trotz eines hohen Umsatzes an Einzelleben blieben Insekten, kleine Fische oder Amphibien in den letzten Millionen von Jahren auf den gleichen Stufen der Evolutionsleiter oder rutschten sogar ab. Der Hauptstrom der Evolution ist entgegengerichtet. Die Zahl der Nachkommen geht während der Erfolgsgeschichte zurück, höhere Intelligenz, Körpergröße, Widerstandskraft und Beharrlichkeit werden gefördert.
Kleine Fische werfen massenhaft Eier. Der weiße Hai bringt stets einzelne Haie zur Welt. Ein Baby ist bei einer Elefantenkuh die Regel, bei einer Ratte nicht. Die Evolution hätschelt Arten, die behaglich im Überfluss schwelgen und meidet überfüllte Notunterkünfte. Nur Arten, die Gefahren schutzlos gegenüberstehen, haben es mit der Fortpflanzung eilig. Fressen und sich vermehren sind ihre wichtigsten Strategien zur Behauptung. Missgriffe und Missbildungen kommen bei den Voreiligen deutlich häufiger vor, als bei den Behäbigen und Erfolgverwöhnten. Wir kommen darauf noch bei der Eintagsfliege zu sprechen. Dennoch nutzen diese Mutationen ihnen nicht im Geringsten.
Im Gegensatz zu Darwins Behauptungen sind hohe Umsatzraten kein Schmelztiegel der (besseren) Sieger, sondern der Blutzoll von Verlierern. Die Opfergaben an die Umstände wachsen mit der Ohnmacht gegenüber ihrer Willkür.
Nach Darwin müsste Übervölkerung die Evolution befeuern. Die Zeugnisse der Erdgeschichte sprechen vom Gegenteil. Als Dinosaurier ihre Führungsrolle einbüßten, rückten Säugetiere in die leerstehenden Räume nach. Die Vielfalt der Säugerarten explodierte. Dabei waren nur die ersten zehn Millionen Jahre ihrer Ausbreitung von Bedeutung für das Auseinanderdriften von Arten. Aus Meerschweinchen ähnlichen Vorläufern entstanden während dieser relativ kurzen Zeit solch unterschiedliche Geschöpfe wie Fledermäuse und Wale. Danach wurde nur noch an den schon bestehenden Modellen gefeilt.
Einige abgeschiedene Meeresinseln sind arm an Arten. Die Uhr der Evolution läuft dort langsam und bleibt oft stehen. Wenn der Zufall einer neuzeitlichen Art Zugang zur Insel gewährt, überstürzen sich die Ereignisse. Die Eindringlinge finden weder Parasiten noch Konkurrenten, dafür aber reichlich Platz. Sie besetzen ohne Widerstand verschiedene Nischen und nehmen Gestalten an, die ihre Verwandten auf dem Kontinent nicht in Ansätzen besitzen. Der Lauf des Fortschritts beginnt zu rasen. Aus einer einzigen Art entstehen in Kürze mannigfaltige Formen bis die letzte Ecke ausgefüllt ist. Nach diesem flüchtigen Aufblühen stockt die Evolution und fällt zurück in den Schlaf.
Im Widerspruch zu den Anmaßungen des Überlebenskampfs saust die Evolution, wenn es darum geht, freie Räume zu besiedeln und schleppt sich, sobald die Aufteilung vollbracht und alles erkämpft werden muss.
Der Darwinismus wird dem Anspruch einer Erklärung nicht gerecht, deutet alles im Nachhinein und nichts im Voraus. Warum begeben sich einige Arten auf den langen Weg der Evolution und entfernen sich von ihren ursprünglichen Lebensbedingungen weit über die Erfordernisse der Anpassung hinaus? Warum verlassen sie ihre alten Lebensnischen, obwohl diese weiterhin bestehen? Warum verharren andere Arten an ihren Entstehungsorten hunderte von Millionen Jahre und schauen teilnahmslos erdgeschichtlichen Umwälzungen zu? Warum nehmen sie schrumpfende Lebensräume in Kauf und zeigen keine Ambitionen diese zu wechseln? Begegneten diese Arten keinen Katastrophen? Standen sie nicht unter Änderungszwang? Waren ihre Baupläne solider? Sind Mutationen bei diesen Arten seltener? Sind die „lebenden Fossilien“ womöglich den Arten, welche die Evolution vorantreibt, überlegen, eben weil ihre Anlagen gediegener sind?
Andererseits, wie lenken die Umstände die Evolution? Welche Mutationen oder Klimaänderungen können ein Huf- oder Raubtier dazu bewegen, seine Landlebensweise zugunsten des Lebens im Wasser aufzugeben? Wann und wie erfolgte dieser Übergang vom Land ins Meer, der zur Entwicklung der Wale führte? Welche Mutation kann eine solche Änderung der Lebensweise bewirken?
Das Austrocknen seichter Gewässer konnte Fische zum Landleben zwingen. Gewiss. Die Anpassung an die Not führt jedoch nicht notwendigerweise zu einem Frosch. Wirbeltiere wählten einen einzigen Umbauplan für den Übergang vom Wasser auf das Land. Warum zogen sie ihn zwischen unzähligen Varianten vor? Insekten erprobten zum Beispiel alle möglichen Modelle bei der Kolonisierung der Erde. Sie krochen wie Würmer und Schnecken, liefen wie Spinnen und Tausendfüßler, flogen wie Fliegen, Käfer, Schmetterlinge und Libellen beim Übergang vom Wasser zur Landfläche. Der Weg von den Wirbeltieren zu den Amphibien und Reptilien war dagegen fantasielos geradlinig.
Lag das an einer unikalen, hervorragenden, alle anderen weit hinter sich lassenden Mutation, die ausschließlich Amphibien betraf und welche keiner mehr nachmachen konnte? Warum kam sie so spät und erst, nachdem Insekten alles eroberten? Lässt sich diese Mutation identifizieren? – Nein!
Vielleicht lag es an der Einfallslosigkeit der Wirbeltiere, die nichts Vergleichbares zu den Insekten bieten konnten? Waren Fische zu dreisten Innovationen unfähig? Wieso zeigen Wirbeltiere sich dann im weiteren Verlauf allen anderen Tierarten überlegen?
Merkwürdig ist weiterhin der Umstand, dass der Übergang von Pflanzen, Insekten und Fischen vom Wasser zum Land in der gesamten Lebensgeschichte nur jeweils einmal stattfindet, wogegen das Austrocknen seichter Gewässer sich Tag für Tag wiederholt. Waren es wirklich Dürre und Not, welche die Fische ans Land trieben, oder lockte sie die fette Beute eines von leckeren Insekten wimmelnden Kontinents, Entfaltungsmöglichkeiten, die ihnen das Wasser vorenthielt? Und gäbe es kein Austrocknen, hätten die Insekten und Wirbeltiere dann den Weg ans Land nicht gefunden?
Überschwemmungen und Dürrezeiten treten gleich oft auf. Die Bewegungen vom Wasser zum Land und umgekehrt richten sich nicht danach. Viele Landtiere kehren während der Evolution in mehreren Wellen ins Wasser zurück: den Reptilien (Schildkröten, Krokodile) folgen die Dinosaurier (Ichthyosaurier), Vögel (Pinguine) und zuletzt die Säugetiere (Wale, Robben, Biber). Jedoch bestimmen weder Dürre noch Sintflut die Wellen der Rückkehr. Entscheidend waren die Wendungen der Evolutionsspirale, die fortschrittlichere Baupläne hervorbrachten. Die Günstlinge der Stunde eroberten spielend die einst von ihnen verlassenen Lebensräume. Sie taten es frei von Druck, aus Überschuss an Kraft. Es bestand keinerlei Not hierzu. Als die Neuerungen sich vorwiegend im Wasser abspielten, gingen die Kolonisierungswellen vom Wasser auf das Land über. Seitdem der Fortschritt vorwiegend das Landleben betrifft, wird umgekehrt das Wasser vom Festland aus erobert.
Der Darwinismus verneint die gestaltende Rolle des Strebens. Die Evolution ist jedoch unbegreiflich, lässt man die Motive und Entscheidungen ihrer Akteure außer Acht.
Schlangen sind, schon ihrem Namen und der Gestalt nach, ein Ausdruck des Verhaltens, genauer gesagt, einer bestimmten Fortbewegungsweise. Dabei stammen sie von vierbeinigen Reptilien ab. Die einzelnen Etappen der Umwandlung lassen sich an Schleichen verfolgen: von Eidechsen über die Wühlechsen (Scincidae) mit vier winzigen Beinen, die nur beschränkt benutzt werden, weiter über den Scheltopusik (Ophisarius apodus), der nur noch die hinteren, zu Stummeln reduzierten Gliedmaßen hat, bis zu den Blindschleichen.
Die Extremitäten des Walzenskinks im Mittelmeergebiet (Chalcides) sind kurz und unbeholfen. Beim langsamen Gehen bedienen sich diese Echsen ihrer Beine, bei schneller Bewegung legen sie diese an den Körper an und gehen zu einem schlängelnden Kriechen über. Spricht man dem Verhalten eine organgestaltende Rolle ab, muss man annehmen, dass eine Missbildung der Beine Reptilien in Schlangen verwandelte. Denn die Verlängerung des Körpers, der Nerven und Organe, die Änderung von Haut und Muskeln erleichtern zwar das Kriechen in einer anderen Umwelt, auf dem Erdboden, in Bäumen oder im Wasser, erzwingen jedoch nicht das neue Verhalten und bieten Überlebensvorteile erst, nachdem das Tier schon zum Kriechen übergegangen ist.
Der Darwinismus leitet das Geschehene aus dem Gegebenen ab und erklärt das Bestehende für das Bessere. Was aber, wenn das Geschehene eine Fehlentwicklung war und den Entwicklungszweig in eine Sackgasse führt? Ist so etwas ausgeschlossen oder vielleicht selten? Ganz im Gegenteil. Die Evolution ist voll von solchen Dead-Ends. Im Grunde machen gerade die Versager die überwiegende Masse der Evolutionsentwürfe aus. Nur Wenige (meist auf unscheinbaren Umwegen) kommen durch und entwickeln sich weiter. Die meisten landen in der Patsche und scheiden aus. Wenn aber Missgriffe unvermeidlich sind, wie lässt sich dabei das Zukunftsträchtige von dem Abschüssigen unterscheiden?
Das Beispiel der Giraffe illustriert dies eindrucksvoll. Die Halsverlängerung bringt der Giraffe erhebliche Unannehmlichkeiten, wie Disproportionen des Wuchses, enorme Belastungen des Halses bei gleicher Anzahl an Halswirbeln, Überlänge der Speiseröhre, die Unfähigkeit, sich hinzulegen und auszustrecken sowie andere Nachteile. Giraffenbabys stürzen bei der Geburt auf den Boden. Sie tun es im freien Fall aus bis zu zwei Metern Höhe. Die Mutter-Giraffe kann sich nicht hinsetzen oder -hocken, ihre Anatomie lässt es nicht zu. Warum werden die fraglichen Neuerungen bevorzugt, die gravierende Nachteile aber übersehen? Weil sie (nach Darwin) Überlebensvorteile bieten müssten. Tun sie es? Woher die Sicherheit?
Das Überleben wird durch Körperzunahme oder Abnahme, durch Auf- oder Abrüstung, durch Stärke oder Wendigkeit, durch aufdringliches Werben oder lautloses Herumschleichen, durch starre Panzer oder aalglatte Haut erreicht. Worin besteht nun der Fortschritt?
Das Ausgestorbene muss unvollkommen gewesen sein (wie sonst!). Was aber ist besser, was ist schlechter an den noch Lebenden? Kann man mit Bestimmtheit sagen, was gut oder schlecht ist? Muss man erst den Tod eines Tieres, womöglich das Aussterben eines Zweiges abwarten, um eine Lebensform auf- oder abzuwerten? Ist ein Infektionserreger der Überlegenere, weil er seinen Wirt überall ausrottete und nun andere Arten terrorisiert?
Wir müssen zugeben, dass Überleben kein Gradmesser des Fortschritts ist. Anderenfalls dürfte die Evolution sich zwar zu einer zunehmenden Vielfalt von Lebewesen hinbewegen, doch nicht nach oben, wie die gesamte Evolution es vorweist, und nicht nach unten, wie man an Beispielen von Rückbildungen durchaus funktionsfähiger Organe zu nutzlosen Rudimenten sieht, sondern lediglich auseinander. Im Grunde dürfte es Höheres und Niederes nicht geben. Alle existierenden Organismen sind unter den bestehenden Bedingungen gleich gut angepasst und wären daher gleichwertig.
Nun, die Evolution hat aber eine Richtung und der Mensch ist einem Bakterium überlegen. Zwar ist Anpassung eine Voraussetzung des Artbestandes, dennoch irrt der Darwinismus, wenn er das Leben auf Anpassungsfähigkeit reduziert. Das Leben ist eine Gewandtheit im Abwenden der Not, ein „Sich-Erheben“ über drückende Umstände, Vorstoß und Sieg. Nicht eine „optimale“ Anpassung, sondern der Vorsprung, die errungene Freiheit und Wirksamkeit ermessen die Fortschritte einer Lebensform.
Der Darwinismus meidet unliebsame Tatsachen, statt dort anzusetzen, wo der Widerspruch offensichtlich ist. Die ersten Spuren lebender Organismen sind mindestens 3,5 Milliarden Jahre alt. Die ersten Lebewesen sind einzellig und vermehren sich durch einfache Teilungen. Die erworbenen Eigenschaften der Mutterzelle gehen auf die Tochterzellen über. Die direkte Vererbung erworbener Eigenschaften wurde erst mit dem Vielzeller vor ca. 700 Millionen Jahren aufgegeben, nachdem 4/5 der Evolutionsdauer abgeschlossen waren. Wieso? Weder das späte Auftreten noch der Sinn der Änderung und die Mechanismen dahinter sind aus Sicht der „Selektionshypothese“ verständlich. Was bewegt eine Ameise dazu, auf ihre Fortpflanzung zu verzichten (der Kampf ums Überleben wohl kaum) und was hat ihr Leben für einen Sinn, wenn sie keine Nachkommen hinterlässt? Welcher Überlebenskampf gebietet Zellen mit gleichen Genen (und somit auch gleichen Voraussetzungen) in einem vielzelligen Zellverband auf die eigene Vermehrung zu verzichten und sich für das Wohlergehen anderer zu opfern? Nach welchen Kriterien wird die Wahl zwischen den zum Sterben verurteilten Körperzellen und den sich der Zukunft zugewandten Keimzellen getroffen? Wie fällt die Entscheidung und warum unterwerfen sich Zellen dieser? Die körperlichen Zellen haben nicht die Spur einer Chance zum Weiterleben. Sie sind alle ohne Ausnahme bloß ein Sprungbrett für die Zeugung. Wieso nehmen sie diese „Ungerechtigkeit“ hin und streben sie sogar mit aller Kraft an? Was bringt sie dazu? Die Aussichtslosigkeit? Wieso gerade bei ihnen und nicht bei den in Allem identischen Nachbarn? Einige Stammzellen teilen sich doch immer weiter. Ist das der Kampf, der alle anders handelnden Zellen ausmerzt? Wann kommt es zu dieser Ausmerzung?
Innerhalb des Vielzellers erfüllen alle Zellen geordnet ihre Aufgaben. Vom Überlebenskampf fehlt bei der Individualentwicklung jede Spur. Nicht einmal für Verdruss lassen sich Hinweise finden. Vielleicht wurden die Überlebenswettkämpfe zwischen somatischen, Stamm- und Keimzellen früher ausgefochten und die ausgelesenen Gene unabänderlich gemacht? Wo genau und wann hätte solch eine Auslese erfolgen können? Nichts deutet darauf hin!
Wäre die Evolution mit Mutationen wie aus Bausteinchen Ebene für Ebene aufgebaut, so müsste der Beitrag einzelner Mutationen zur Stammesgeschichte stufenweise nachvollziehbar sein. Die Lebewesen gliedern sich tatsächlich in Ordnungen, Klassen und Familien. Der Einteilung liegt jedoch weder eine Mutation noch eine hervorstechende Eigenschaft, sondern ein für das Überleben unter konkreten Umständen neutraler Bauplan zugrunde.
Einst besiedelten Dinosaurier Ozeane, Sümpfe, Wiesen und Wälder. Sie entstanden nicht in diesen Nischen aus Anpassung an die jeweilige Umwelt, sondern rückten aus dem Tiefland in die für sie fremde Gebiete vor. Ein und derselbe Körperbau diente zur Kolonisierung unterschiedlicher Lebensräume. Merkmale, die erforderlich waren, um sich im Wasser, auf dem Baum und in der Luft zu behaupten, kamen erst später hinzu. Die Zukunft zeigte, dass der Bauplan eines Dinosauriers unter keinem dieser Lebensumstände angemessen oder auch nur hinreichend war. Überall versagten die Schreckensechsen. Dabei griffen sie in vielem der Zukunft vor und besaßen Eigenschaften wie: aufrechter Gang, Haarkleid, Warmblütigkeit, größere Gehirne sowie soziale Organisation. Alles umsonst. Die einzelnen zukunftsträchtigen Ansätze wurden nicht aufgegriffen, gebündelt und ausgebaut. Der Gesamtplan wurde im Ganzen verworfen, ungeachtet einmaliger, wahrscheinlich auch bis heute, unerreichter Vorzüge. Den Dinosauriern folgten Vögel und Säugetiere. Die Ereignisse wiederholten sich. Arten, die seit Millionen von Jahren nur Randnischen besiedelten und durch keine speziellen Anlagen oder vorteilhaften Mutationen auffielen, breiteten sich auf einmal wie eine Plage in unterschiedlichsten Räumen aus und verdrängten die bestangepasstesten Ureinwohner. Nachträglich eigneten sich die Neuankömmlinge Körperformen und Organe der Arten an, die sie verdrängten, ohne mit diesen verwandt zu sein. Ähnliche Flügel-, Flossen- und Körperformen wurden bei Dinosaurier, Vogel und Säugetier durch völlig andere Gene erreicht. Die Merkmale überschneiden sich vielfältig während der Ausbreitung und des Rückzugs, spezielle Eigenschaften, Organe, Körperformen kommen und gehen. Ordnungen, Klassen, Familien aber entstehen, entfalten sich und vergehen als Ganzes. Der Zufall der Mutation erklärt weder den Aufstieg noch den Untergang einzelner Entwicklungslinien.
Noch unbeholfener wirken Versuche, die Entstehung komplexer Organe aus Anhäufungen sich ergänzender Mutationen zu erklären. Eine Durchsichtige Hornhaut, Linse, Glaskörper, lichtempfindliche Netzhaut, Versorgungsnetz an Gefäßen und Nerven – bevor ein funktionsfähiges Auge entsteht und Überlebensvorteile bringt, müssen grundverschiedene Elemente zueinander finden. Wie kommt es zu dieser Vermengung (von den an sich im Einzelnen nutzlosen Eigenschaften) vor dem „Überlebensdruck"? Die Erdgeschichte bietet keine Beispiele für die Entstehung eines Organs aus einer Missbildung, im Gegenteil. Das Alte wird lückenlos zu Neuem (wofür es niemals vorgesehen war) umgebaut und ausgebaut: Kiemen zu Kiefern, Flossen zu Beinen, Beine zu Flügeln. Organe folgen dabei den Handlungen und nicht die Handlungen den Organen.
Das Fliegen erfordert mehrere sich ergänzende Eigenschaften: lange Schwanz- und Flügelfedern, pneumatisierte Knochen, Luftsäcke, die Anordnung und Form der Rippen, des Halses, der Wirbelsäule und des Beckens. Das Zusammenfinden der Merkmale ist folgerichtig, wenn man annimmt, dass die Vögel, gleich den Menschen, ihre Flugversuche starteten, bevor sie Anlagen (Fluggeräte) hierfür hatten. Absurd dagegen ist die Vorstellung, dass irgendwann ein zufälliges Aufeinandertreffen von Mutationen (wieso? weshalb? wie?) das Fliegen auf einmal ermöglichte. Die Evolution verändert Organe, indem sie ihnen neue Aufgaben anvertraut.
Lamarck hatte Recht! Nicht die Evolution folgt den Veränderungen (einem langen Hals, einem Flügel oder einer Flosse), sondern neue Verhaltensweisen setzen bestehende Organe auf eine ungewöhnliche Weise ein. Die Körperveränderungen untermauern erst nachträglich ein erfolgreiches Verhalten. Der umgekehrte Weg von der Mutation zur Verhaltensänderung und Organgestaltung wird vom Darwinismus behauptet, allerdings in keiner Weise belegt.
Verbrechen
Das zwanzigste Jahrhundert war geprägt vom Darwinismus. Der Rausch dieses Elixiers des Teufels erwies sich stärker als der kritische Verstand. Mit Eifer ging man daran, die „bahnbrechenden“ Scheinerklärungen umzusetzen. Euthanasie, Kolonialismus, Vernichtungskriege folgten. Angesichts der nie dagewesenen Grausamkeit rebellierte die Menschlichkeit. Der Kulturmensch hat sich bisher mit etwas anderem, als einer ums Überleben kämpfenden Bestie gleichgesetzt. Er glaubte, Träger des Geistes und nicht eine seelenlose Tötungs- und Verdrängungsmaschine zu sein. Der Bruch war unerträglich, die Resultate des Rassenwahns gruselig. Die Vorreiter und Führer des Sozialdarwinismus wurden zu Unholden erklärt. Das geistige Werkzeug des Darwinismus überlebte und gehört leider immer noch zum Schulprogramm. Nur langsam wurde es aus den zwischenmenschlichen Beziehungen verdrängt und in das biologische Laboratorium verwiesen. Aber auch dort sind die Ausbeuten abscheulich. Die Mutagenese (mit und ohne Aussonderung) war nutzlos zur Gestaltung des Vielzellers. Trotz beharrlicher Experimente wurden in den letzten 100 Jahren durch Mutationen weder ein Organ noch eine neue Art, wohl aber grässliche Missbildungen à la Frankenstein hervorgebracht.
Im gleichen Zeitraum feiert die Pflanzen- und Tierzucht ohne Mitwirkung von Mutationen einen Erfolg nach dem anderen. Neue Nutztiere und Pflanzen entstehen zu unseren Lebzeiten. Die vielen Hunderassen von tibetanischen Löwenhunden bis zu dänischen Doggen, von Chinaschoßhunden bis zu englischen Schäferhunden erscheinen einem Laien unterschiedlicher als einige wildlebende Familien und sind dennoch eine Art und von den Eigenschaften des grauen Wolfes abgeleitet.
Die Möglichkeiten der Tier- und Pflanzenzucht sind beeindruckend. Der Darwinismus knüpft absichtlich daran an – allerdings zu Unrecht. Der Kampf ums Überleben gehört nicht zu den Arbeitsmitteln der Aufzucht. Die Bemühungen der Landwirte sind dem Überlebenskampf entgegengesetzt und auf das Ausschalten der Konkurrenz gerichtet. Der Züchter kreuzt die Organismen, zieht die Brut auf, durchstöbert sie nach bestimmten Merkmalen, entfernt das, was seinen Vorstellungen zuwiderläuft, pflegt und hütet den Rest. Obwohl einiges im Topf oder auf dem Komposthaufen landet, entscheidend an dem Vorgang ist das gezielte Hervorbringen neuer Eigenschaften.
Die Selektion ist eine kombinatorische Genetik, welche die Vorstellungen des Züchters in Merkmale von Lebewesen umsetzt. Würde der Züchter den „darwinistischen“ Empfehlungen folgen und die Lebewesen, statt sie auseinander zu pflanzen, zusammenpferchen, wie der Überlebenskampf es vorsieht, so käme es zu einer allgemeinen Degeneration der Population. Neue Merkmale, bessere Eigenschaften blieben aus.
Die landwirtschaftlichen Zuchtmethoden bilden und fördern nie dagewesene Kombinationen. Der Wille eines schaffenden Menschen wird dabei gezielt in neue Rassen umgesetzt. Wessen Wille lenkt aber die Veränderungen in der freien Wildbahn?
Es gibt nur eine Antwort. Gestalter der organischen Evolution ist das Streben.
Werkzeuge der Evolution
Die Einwände des Darwinismus gegen die gestalterische Kraft des Strebens gehen von falschen Annahmen aus. Beweise, die belegen, dass die erworbenen Veränderungen elterlicher Zellen sich nicht auf die Nachkommen übertragen lassen, suggerieren, dass die Fortpflanzung in der Vervielfältigung von Eigenem besteht. Das trifft bei Eukaryoten nicht zu. Die Fortpflanzung eines Vielzellers ist ein Akt der kombinatorischen Schöpfung. Die Eltern suchen sich und ergänzen einander in ihren Kindern. Sie tun es ausgehend von ihren Vorlieben und sind dabei eingebunden in das Wirken von Angehörigen der gesamten Art.
Um die Zusammenhänge zu verstehen, müssen wir uns mit der Sexualität, dem Lebenszyklus einzelner Organismen (inklusive Geburt, Individualentwicklung und Alterung), sowie mit der Organisation von Biozönosen befassen. Darüber hinaus ist es wichtig, sich die Eckdaten der Lebensgeschichte in Erinnerung zu rufen. Die Darwinisten hatten in den letzten einhundert Jahren allein das Wort. Kritische Meinungen wurden als unwissenschaftlich abgetan, Widersprüche vertuscht, Fakten entstellt. Gegenwärtig wird die Lebensgeschichte ausschließlich aus der Sicht der „Selektionshypothese“ behandelt. Es bedarf einer beinahe kriminalistischen Arbeit, um Tatsachen von Verdrehungen zu befreien. Ist diese Aufgabe erst einmal erledigt, so ordnen sich alle Fakten wie von selbst zu einem ganzheitlichen Bild. Die nächsten Abschnitte rekonstruieren die schöpferische Arbeitsweise der Evolution.
Sexualität
Die Sexualität steckt wie ein Knochen im Halse des Darwinismus. Aus der Sicht des Überlebenskampfes dürfte es Sexualität nicht geben.
Die asexuelle Fortpflanzung ist geradlinig, die vorteilhaften Gene der Eltern werden kopiert und gehen unmittelbar auf die Nachkommen über. Bei der sexuellen Zeugung ist die Weitergabe der Gene komplexer.
Alle Vielzeller sind sexuell. Sexuelle Arten haben zwei Sätze an Genen, jeweils einen von der Mutter und einen vom Vater. Beide Gensätze bestehen isoliert voneinander in einzelnen Zellen. Zum Leben wird ein Satz gebraucht, der andere bleibt stumm. Von welchem der Eltern stammt der derzeit aktive Gensatz? Wurde er überhaupt von einem der Eltern benutzt, oder stammt er von unbekannten Ur-, Ur-Großeltern? Die vererbten Gene müssen nicht die Gene sein, die in den Eltern wirken. Die Wahrscheinlichkeit, dass Kinder die aktiven Gene ihrer Eltern erhalten, liegt rein rechnerisch irgendwo zwischen 0 und unter 50%.
Die lineare Vererbung wird somit unterbrochen. Eine zufällig entstandene Mutation geht bei Fortführung einer sexuellen Zeugungsreihe mit hoher Wahrscheinlichkeit verloren, auch dann, wenn sie im Leben eines Elternteils von Vorteil war.
Zum Verzicht auf Weitergabe des größten Teils des eigenen Erbguts kommt das umständliche Sexualverhalten hinzu. Die aufwendigen Trachten, Imponiergehabe, Rivalenkämpfe verhindern die Verbreitung einer zufälligen Mutation. Alles was von den Anforderungen des Paarungsrituals abweicht oder die Erwartungen des Partners nicht erfüllt, kann keine Kinder zeugen. Sexpraktiken sind darüber hinaus gefährlich. Einige Tiere sterben während der Paarung, Lachse kurz danach. Viele Arten werden während der Hochzeit zur leichten Beute von Raubtieren – aufgeben will dennoch keiner, und kann es anscheinend auch nicht.
Die asexuellen Arten sind frei von solchen Hürden. Kinder kopieren ihre Eltern. Genmodifikationen, gute oder schlechte, tragen unmittelbar dem Lebenserfolg und der eigenen Durchsetzung bei. Hinzu kommt, dass der asexuelle Organismus mit der Fortpflanzung beginnt, sobald er hierzu körperlich fähig ist.
Er muss weder Partner suchen noch Rivalen fernhalten.
Gemessen an der Sachlichkeit der asexuellen Fortpflanzung erscheinen die Auflagen der Sexualität als reinste Schikanen. Frei von solchen Auflagen, müssten asexuelle Arten im Vorteil sein und zahlenmäßig überwiegen. Dem ist nicht so. Asexuell sind lediglich primitive einzellige Organismen. Vielzellige Arten sind grundsätzlich sexuell. Die seltenen asexuellen Ausnahmen unter den Vielzellern entstanden aus sexuellen Arten durch Verlust der ursprünglichen Sexualität.
Was macht die Sexualität so zwingend?
Liegt der Vorteil sexueller Arten in einer höheren Mutationsrate oder der besseren Verträglichkeit von Mutationen? Im Gegenteil. Die sexuelle Zeugung erfordert Gemeinsamkeiten der sich verschmelzenden elterlichen Anlagen. Der Körperbau, die Regulation des Stoffwechsels, die Steuerung der Individualentwicklung müssen zusammenpassen. Geringe Diskrepanzen bedeuten selbst dann Unfruchtbarkeit, wenn die Partner sich in allem äußerlich gleichen. Hase und Kaninchen, obwohl zum Verwechseln ähnlich, lassen sich zum Beispiel nicht kreuzen, sie sind zwei verschiedene Arten.
Eine gegenseitige Abstimmung ist überflüssig bei asexuellen Linien. Sie verkraften schwere Mutationen, die bei sexuellen Arten unweigerlich zur Unfruchtbarkeit führen würden. So der Löwenzahn. Von Kindheit an begleitet uns das leuchtende Gelb dieser allgegenwärtigen Blume. Ein Einwohner Sibiriens, am Berliner Flughafen angekommen, ist nicht wenig überrascht, die fröhlichen Kükenfarben auf der Frühlingswiese vorzufinden. Die Blume war vor ihm da. Dabei liegt ihr Ursprungsort im fernen Osten. Allerdings ist der Löwenzahn keine Blume. Einer Kreuzung und gegenseitigen Befruchtung dienen seine Blüten nicht mehr. Die Hybridisierung verunstaltete seinen Chromosomensatz. Mit der Sexualität war es vorbei, das Wachstum seiner Zellen und die vegetative Fortpflanzungsfähigkeit der Pflanze blieben erhalten. Von den Kapriolen der Partnerbewertung befreit, überzog dieser ewige Junggeselle kometenhaft das Festland mit unübersehbaren Zeichen seines Erfolges. Dennoch ist die ungeschlechtliche Pflanze dem Untergang geweiht, da sie keiner gezielten Veränderung fähig ist. Eine Wandlung des geschlechtslosen Löwenzahns ist lediglich durch eine Umsortierung und zufällige Mutation eigener Gene möglich. Einmal umgeschrieben und verändert, ist die Wahrscheinlichkeit einer Rückkehr zu dem Ursprünglichen nichtig. Es sei denn, der Löwenzahl erlangt seine Geschlechtlichkeit zurück.
Der Weg asexueller Arten besteht im Auseinandertreiben und immer schmaler werden ihrer Entfaltungsmöglichkeiten. Die Unbeschwertheit der asexuellen Fortpflanzung wird mit dem Verlust stammesgeschichtlicher Verknüpfungen bezahlt, wiegt den Verlust jedoch nicht auf (wir gehen darauf später noch ausführlicher ein). Bei sexuellen Arten ist alles anders.
Die eigenen Gene sexueller Organismen sind unantastbar. Sowohl den gezielten als auch zufälligen Veränderungen körperlicher Gene wird aufwendig entgegengewirkt. Obwohl unversöhnlich gegenüber Mutationen, weisen sexuelle Arten in der Generationsfolge eine enorme Veränderlichkeit ihrer Merkmale auf und sind in dieser Hinsicht der asexuellen Vermehrung weit überlegen.
In ihrer natürlichen Umgebung sehen Angehörige einer sexuellen Art ähnlich aus, als bleiben sie überall und immer gleich. Der Eindruck täuscht. Sexuelle Arten sind im stetigen Wandel. Allerdings ist dieser Wandel für die Zeitzeugen nicht wahrnehmbar. Das Kreuzen untereinander verteilt die günstigen Merkmale einer sexuellen Art gleichmäßig zwischen allen Angehörigen. Die Art erscheint dem Betrachter deshalb einheitlich. Die Art verändert sich und mitunter recht schnell, nur erfolgen diese Veränderungen im Gleichschritt und sind innerhalb einer Population nicht erkennbar. Das geschieht, weil nur die Erfolgreichen sich untereinander kreuzen, und die Population in ihrer Masse sich danach richtet, was gerade Erfolge bringt. Eine merkliche Wandlung zeigt sich erst bei der Gegenüberstellung der einstigen mit der aktuellen Erscheinung einer Art. Bei einer geografischen Auftrennung der Art ist die Wandlungsfähigkeit ebenfalls unübersehbar. Noch krasser wird diese bei gezielt herbeigebrachten Trennungen. Nutztier- und Pflanzenzüchtungen demonstrieren dies überdeutlich.
Man suche beim Wolf vergebens nach den vielen auffallenden Zügen heute lebender Hunderassen, sie kommen in seiner Variationsbreite nicht vor. Hinweise für Mutationen, die zur Entwicklung des Reitpferdes in den letzten 2 000 Jahren beitragen konnten, fehlen. Dennoch machten diese Haus- und Nutztiere eine rasante Entwicklung durch. Der Mensch löste diese Vorgänge durch eine gezielte Zusammenstellung von Merkmalen aus. Diese Merkmale waren keine Folge der Mutation. Sie bestanden schon vorher als Teile von anderen Anlagen. Dennoch brachte ihre Kombination unerwartetes hervor. Wie? – ist nicht schwer nachzuvollziehen.
Gelegentliche Anomalien, die an die vergangenen Etappen der Stammesgeschichte erinnern, werden Atavismen genannt. Beim Menschen sind Halsfisteln, ein starkes Haarkleid, Schwänzchen, sowie überzählige Brustwarzen bekannte Beispiele. Sie führen uns genetische Anlagen vor, von deren Anwesenheit wir nichts ahnen. Sie schlummern dennoch in jedem von uns, sind äußerst komplex, und lassen sich theoretisch zu allem Möglichen umbauen. Wie viele gibt es davon? Sehr viele! Unsere Stammesgeschichte ist eine Schatzkammer von (sichtbaren und verborgenen) Bausteinen für die Gestaltung. Diese sind oft abgelegt, aber nicht verloren. Die einzelnen Gene, selbst wenn unsichtbar, können jederzeit hervorgeholt werden. So wie die verschiedensten Legobauten keine zusätzlichen Elemente außer eines umfangreichen Satzes an Lego-Steinchen erfordern, sind auch bei organischen „Bauten“ keine zusätzlichen Gene zu den vorhandenen notwendig. Es genügt, diese auf eine neue Weise anzuordnen.
Entgegen den Vorstellungen des Darwinismus besteht die sexuelle Fortpflanzung nicht im Nachlaufen und Kopieren von Mutationen, sondern in der Zusammenstellung erstrebenswerter Eigenschaften in den Nachkommen. Die Liebe gilt schließlich den fremden und nicht den eigenen Genen. Eine Trennung in Geschlechter, von denen jedes ein Gegengeschlecht suchen muss, und dabei auf einen Teil des eigenen Erbguts verzichtet, bindet eine Art zu einer Fortpflanzungsgemeinschaft, deren Kinder Knospen eines gemeinsamen Stammes sind. Die Partner wählen einander und gestalten so die künftigen Generationen. Die Art schlängelt sich durch das Knäuel koexistierender Einzelleben und nimmt dabei ihre jeweilige Form an.
Betrachten wir den Gestaltungsrahmen, in dem die Evolution sexueller Arten stattfindet, etwas genauer. Er erklärt einige, nur scheinbar merkwürdige Details der Evolution. Ist man sich über Mechanismen der Evolution im Klaren so setzt sich das Puzzle der Lebensgeschichte wie von selbst zu einem Bild zusammen. Wir tun diese Synthese am Ende dieses Teils in dem Abschnitt „Evolutionsschleife“.
Lebensräume
Seit Millionen von Jahren ist ein Naturereignis an den Stränden der Südsee zu beobachten. Zu Tausenden schlüpfen niedliche Schildkrötchen und paddeln tollpatschig über den weichen nachgiebigen Sand zum Wasser. Viele von ihnen werden von Vögeln, Krabben und Landtieren aufgefressen, die pünktlich zum Wettrennen erscheinen. Die Vorgänge wiederholen sich Jahr für Jahr. Die Tierarten, die sich am kostenlosen Buffet versammeln, haben inzwischen (getrieben von der Evolution) mehrmals gewechselt. Allein die Schildkröten haben daraus nichts gelernt. Das grausame Abschlachten hat bisher keine bessere Art hervorgebracht.
Die hohen Nachkommenzahlen bei Fröschen, Fischen und Insekten dienen weder der Verschärfung des Überlebenskampfes noch der Beschleunigung der Evolution. Sie überbrücken kritische Umstände, bei denen allein der Zufall entscheidet. Die Evolution bleibt ungerührt von diesen Opfern. Die starke Vermehrung dient nicht der Auslese, sondern der Erhaltung der Population. Die Vorreiter bevorzugen stattdessen hohe Überlebenschancen und geringe Zahlen an Nachkommen. Die Behauptung des Darwinismus, dass hohe Geburtenraten und Überbesiedlung feste (und vor allem nützliche) Aspekte der Evolution seien, ist falsch. Sowohl die Geburtenraten als auch die Besiedlung werden durch die Konfiguration der Lebensräume bestimmt. Sind diese frei, ist die Vermehrung stark. Ist der Lebensraum ausgefüllt, schrumpfen die Zuwachsraten bis zum Erliegen. Mit der Verknappung von Ressourcen wachsen die Beschaffungsmühen für das Lebensnotwendige. Lebewesen haben dann andere Sorgen als ihre Vermehrung. Die Zu- und Abgänge gleichen sich an. In der Wildbahn bewegt sich die Größe einer Population schwankend an der Obergrenze der Entfaltungsmöglichkeit. Abweichungen sind hin und wieder möglich, aber nicht von Dauer.
Das Tier, das in einem ausgefüllten Lebensraum seinen Hals ausstreckt, Blätter von den herabhängenden Baumzweigen kostet und dabei mehr Futter und Lebensfreude erhält, erschließt sich eine neue Quelle. Sie ist den anderen Artgenossen nicht verfügbar. Die Ur-Giraffe entweicht dem herrschenden Entfaltungswiderstand. Ihr Erfolg stört das Gleichgewicht der übrigen Population. Ihre Nachkommen (und die Chancen für solche stehen gut) mögen kurzhalsig geraten. Die Vermehrung einer Untergruppe von Tieren bei gleichbleibenden Ressourcen benachteiligt herkömmliche Verhaltensweisen. Es kommt zu einem weiteren Rückgang der Geburten in „traditionsbewussten“ Subgruppen. Vorzeitig sterben muss dabei niemand. Die „Loser“ leben weiter und mitunter sehr gut, denn sie müssen die Aufwendungen des Kinderkriegens nicht tragen. Auf die Dauer trennt allerdings nicht das eigene Wohlergehen den Erfolg vom Misserfolg, sondern die Hinterlassenschaft. Diese bleibt aus. Der Geburtenrückgang der „weniger geschickten“ Subpopulation bliebe aus, wären alle Tiere den gleichen Bedingungen ausgesetzt. Die vorrangige Vermehrung von Tieren, die sich zu den immer höheren Zweigen hinausstrecken, führt jedoch ebenfalls zu keiner Überbesiedlung. Der Artbestand im Ganzen kann sogar schrumpfen, denn die erfolgreichen Tiere belegen dank ihrer Überlegenheit größere Territorien als ihre Vorgänger und nehmen sich mehr Zeit für den Ausbau und die Sicherung ihrer Ansprüche. Genau diesen Rückgang der Zahl an Nachkommen gepaart mit der Zunahme der territorialen Größe und Lebensdauer einzelner Tiere beobachtet man bei allen Arten auf der Höhe ihrer Evolution. Der Bestand an Buckelwalen kann sich nicht mit dem von Heringen oder Plankton messen.
Der Vorgang des „Sich-Ausstreckens und Reifens“ lässt sich bei Menschen zeitnah beobachten. Der Epochenwechsel vollzieht sich vor unseren Augen. Zu den Anfängen der Zivilisation (und derzeit noch vereinzelt in armen Entwicklungsländern) waren eine Schwangerschaft mit 12-16 Jahren und hohe Kinderzahlen typisch. Mein Vater war das elfte Kind seiner Eltern. Meine Mutter wurde geboren als meine Oma 16 war. Mit Entfaltung der Gesellschaft verschob sich die erste Schwangerschaft allmählich in das Alter von 30-35 Jahren (gegenwärtig), wobei die Lebensdauer und Anforderungen an die Einzelnen (Bildung, Beruf, fester Arbeitsplatz, Wohnung) stiegen.
Miniaturisierung, Überzahlen und kurze Lebzeiten sind dagegen typisch für Zurückgedrängte in der Evolution. Wir werden noch genauer darauf eingehen, wenn wir später auf die Insekten (Eintagsfliegen, Libellen) und Lachse zu sprechen kommen.
Das Leben ist die Evolution des Strebens. Die Starken und Erfolgreichen brauchen keine Mutationen, sondern Platz und Ressourcen zur Entfaltung. Die Giraffe ist dabei keine Ausnahme. Der Vorgang ist generell. Ein Einzelner stößt die Tür zu neuen Lebensräumen auf und erschwert zugleich das Aushalten in der alten Umgebung. Es wird eng und ungemütlich in den üblichen Grenzen. Nicht die am besten Angepassten, im Gegenteil, die Abweichenden, Unzufriedenen, zu einer Neuerung Bereiten finden am ehesten einen Ausweg. Der Erfolg der Ausreißer errichtet ein Gefälle des Entfaltungsaufwandes. Die „hinauf Strebenden“ werden dabei begünstigt und die Evolution wird in eine bestimmte Richtung vorangetrieben. Dabei kommen nicht nur „Langhälse zusammen und bilden Paare, sondern Eltern mit vielfältigen weiteren Eigenschaften, die das neue Verhalten begünstigen, finden zueinander. Der Wandel ist daher immer komplex und alle Merkmale des Körpers betreffend. Mit jedem Individuum im Trend nimmt das Gefälle des Entfaltungsaufwandes zu. Eine Umgestaltungslawine kommt ins Rollen. Sie hält erst an, wenn der neu erschlossene Lebensraum ausgefüllt ist und die weiteren Veränderungen keine Dividenden mehr bringen.
Während der Umgestaltung eines Lebensraumes ändert sich die gesamte Lebensweise einer Art: Geburten, Reifung, Lebensdauer, vielfältige Ansprüche, äußere Erscheinung und soziale Organisation.
Geburt
Die kriechende Raupe eines Monarchfalters verwandelt sich innerhalb von zwölf Tagen in einen graziösen Schmetterling. Diese zierliche Fee kann immerhin über 30 Stundenkilometer schnell fliegen. Im Inneren der Puppe, von der Außenwelt abgeschlossen, vollzieht sich ein Wunder. Aus wulstigen Raupenbeinen entstehen schlanke Gliedmaßen, die Mundteile gehen vom kauenden zum saugenden Typ über. Es entwickeln sich vier Flügel.
Einige Organismen wechseln vier bis fünfmal ihre Gestalt und Lebensbedingungen ehe sie mit der Fortpflanzung beginnen. Warum dieses häufige Starten und Stoppen? Warum wachsen die Organismen nicht immerfort? Wozu die immer wiederkehrende Neugeburt? Nun, eine Vielzahl an Sägen und Äxten in den Händen eines Einzelnen macht sie nutzlos. Die hinzukommenden Werkzeuge stören sich dabei gegenseitig. Die Aufrüstung des Organismus schadet, wenn sie ohne Vergrößerung des Wirkungskreises geschieht. Die Fortpflanzung teilt den Lebensraum auf und erhöht die individuelle Wirksamkeit. Sie ist weder Zweck noch Ziel des Lebens, sondern ein Ausweichmanöver der fortgesetzten Vermehrung. Sie ist dort angesagt, wo das Wachstum zunächst nicht weiter weiß und stockt. Anlass für Neubeginn und Geburt ist die Perspektivlosigkeit der individuellen Fortentwicklung.
Die Aufteilung kann auf zwei oder multiple Organismen erfolgen. Die Zahl der Nachkommen, ihre Größe und Ausstattung wird durch die Beschaffenheit der Lebensräume reguliert. Ist der Lebensraum diskontinuierlich und liegen größere Todes- bzw. Wüstenstreifen dazwischen, so bevorzugen Organismen eine Aufteilung in viele „Sporen“, welche auseinanderfliegen und möglichst klein, anspruchslos und widerstandsfähig sind. Bei Endoparasiten, die zum Leben andere Lebewesen nutzen, wird bei dieser Ausbreitung auf vieles verzichtet, was bei dem Opfer ohnedies zu finden ist. Im Extremfall, kann ein ursprünglich eigenständiger Organismus bis auf ein zeitweise komplett abgeschaltetes „totes“ Viruspartikel schrumpfen.
Ist der Lebensraum kontinuierlich aufgebaut, so wird eine einfache körperliche Teilung bevorzugt und die Lebenstätigkeit sofort aufgenommen. Jedes Neugeborene erhält hierfür einen kompletten Satz an Genen, ein Minimum an Werkzeugen und ein eigenes Betätigungsfeld. Nunmehr kann der Neuling und mit ihm das Leben im Ganzen wieder wachsen.
Entwicklung
Gewöhnlich nimmt man Dinge erst dann ernst, wenn sie zu einem Problem werden. Die Entwicklung ist das Faszinierendste am Leben überhaupt, wird aber im Alltag kaum beachtet. Man setzt voraus, dass aus Samen Bäume wachsen, Raupen sich in Schmetterlinge verwandeln und aus einem Ei ein Küken schlüpft. Erst aufgeschreckt durch Versagen, angesichts eines zweiköpfigen Schafes oder eines einäugigen Embryos im Raritätenkabinett, überkommen uns Schauder und Ehrfurcht vor diesem scheinbar so alltäglichen Mysterium. Millionen von Zellen lösen einander in streng geordneten Teilungen ab. Strahlung, Mutagene, Viren umgeben Embryonen und mischen sich in Vorgänge der Entwicklung ein. Dennoch werden Tag für Tag gesunde Babys ohne besondere Vorkehrungen geboren. Was ermöglicht diesen Vorgang?
Man gibt sich mit der Antwort zufrieden, dass alles genetisch vorgegeben sei. Man denkt dabei an Augen- und Haarfarbe, Gesichtszüge der Geschwister und hört mit Fragen dort auf, wo höchstes Staunen angebracht wäre. Wie so oft, verwechselt man eine Bezeichnung mit der Erklärung. Der Hinweis auf Gene, was erklärt er schon? Pigmentzellen der Haut und Haare werden in der Neuralleiste am Rücken angelegt. Zielsicher wandern sie durch den ganzen Körper zu ihrem Bestimmungsort. Woran und wie orientieren sie sich? Welche Gene schreiben ihnen die Route vor, welche führen sie? Wo befinden sich Gene, die das Farbmuster des Pfauenschwanzes zusammensetzen und hierfür eigenständige frei wandernde Pigmentzellen benutzen? In jeder Zelle des bunten Fächers, gleich welcher Farbe sie sind, gleich welchen Platz sie innerhalb des Musters einnehmen? Wie erfährt eine Zelle im Pfauenauge, dass sie diese und keine andere Stellung beziehen soll, wie kommt sie dorthin, warum verweilt sie dort? Warum wird sie zur Haut statt zu einer Nerven- oder Blutzelle? Fehlen ihr die nötigen Gene, wird sie von fremden Genen gesteuert, und wenn ja, wie wird das Gen einer Zelle von denen anderer reguliert? Wieso unterwirft es sich dieser Regulierung?
Sind nicht alle Gene gleichrangig? Wo liegen die lenkenden Gene? (Falls es sie gibt.) Wie kommt es, dass Zellen mit gleichen Genen (und die meisten Zellen unseres Körpers gehören dazu) unterschiedliche Schicksale haben?
Wäre es möglich, dass nur Keimzellen vollwertig sind? Die somatischen Zellen stammen demnach zwar von den Keimzellen ab, verlieren jedoch mit der Differenzierung überflüssige Gene. Mit jeder Zellteilung schrumpfen ihre Entfaltungsmöglichkeiten, bis sie nur noch Haut-, Nerven- oder Blutzellen werden können.
Diese „Keimbahnhypothese“ der biologischen Gründerzeit ist unhaltbar.
Trennt man die Nachkommen einer Eizelle nach der ersten Teilung, so entfaltet sich jede zu einem erwachsenen Tier. Setzt man diese Trennungen fort, so entstehen vier oder sogar acht Tiere. Dadurch erhält man zum Beispiel genetisch identische Schafe. Die Trennungen sind mitunter spontan. Man kennt dieses Phänomen von eineiigen Zwillingen. Von einem Genverlust ist dabei keine Spur. Auch in folgenden Entwicklungsstadien ist der Genverlust nicht zu belegen. Entnimmt man dem wachsenden Embryo etwas Gewebe, so gleicht er die Verluste aus. Verpflanzt man Zellschichten vom Stamm zum Kopf, bilden sich daraus Augenbläschen anstatt Knospen von Armen und Beinen. Was man dem Keimling auch antut, er versucht, seine Strukturen auf bestimmte Weise umzuordnen. Mechanisch ist er dabei nie, akribisch schon. Diese Verformbarkeit ist bei einzelnen Lebewesen je nach Altersstufe unterschiedlich ausgeprägt, jedoch selbst bei Arten mit einer sogenannten mosaischen Entwicklung vorhanden. (Mosaisch sind Organismen mit einer streng reglementierten und unveränderbaren Endzellzahl z.B. 8, 12, 24. Mehr oder weniger Zellen sind unzulässig. Nach ihrer embryonalen Teilung dürften solche Zellen ihre einst eingeschlagene Orientierung nicht mehr ändern, denn ein Ersatz fehlender Differenzierungen durch Neubildung hierzu erforderlicher Zellen ist nicht vorgesehen. Dennoch, auch diese Organismen bleiben plastisch. Wenn man die Anordnung der Zellen im Organismus ändert, ändern die Zellen ihre Differenzierung und Funktion.)
Pflanzen sind auffallend flexibel. Einige ihrer Zellschichten (Meristem) können sich fortwährend teilen und alle anderen Organe und Gewebe bilden. Ein bekannter Ausdruck dafür ist die vegetative Vermehrung mit Ausbreitung der Ableger und des Wurzelwerks. Jedes pflanzliche Organ besteht gewöhnlich aus meristemalen und enddifferenzierten, nicht mehr teilungsfähigen Zellen. Die Einteilung ist von der Situation abhängig und die enddifferenzierten Zellen sind unter Umständen fähig, sich in die meristemalen Zellen zurück zu verwandeln. Hierfür genügt es, den Zellverband aufzulösen. Die Landwirtschaft macht Gebrauch davon und züchtet ganze Pflanzen direkt aus einzelnen Zellen. Jede Zelle besitzt demzufolge den vollwertigen Gensatz und die Fähigkeit dazu, eine Pflanze zu werden. Im Verband verzichtet sie darauf. Die Aufgabe, der sich die Zelle widmet, bestimmt ihren Weg, ihre Funktion und die Wachstumsraten.
Wie sollen Gene lenken, wenn sie selbst einer Zweckmäßigkeit unterworfen sind? Oder bilden Pflanzen eine Ausnahme?
Tiere in der Wildbahn kennen weder eine vegetative Vermehrung, noch behalten sie im erwachsenen Alter embryonales Gewebe, die neue selbstständige Organismen formen kann.
Die Entwicklungsschritte zu teilungsunfähigen Zellreihen sind normalerweise unumkehrbar. Hautzelle, Darmzelle, ausgereifte Blutzelle können nur noch ihrem Zweck dienen, was sie auch tun, bis sie sich verbrauchen. Dennoch gehen Gene mit der Differenzierung von tierischen Zellen ebenfalls nicht verloren. Die Versuche am Krallenfrosch zeigten dies schon im 19. Jahrhundert.