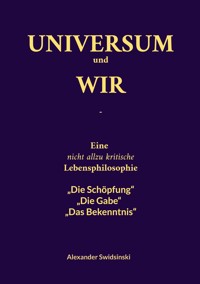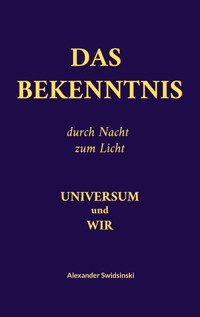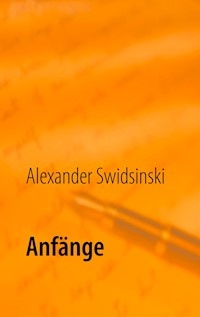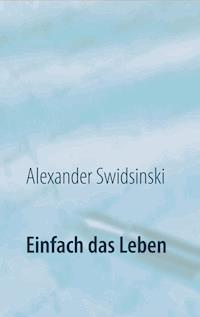
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Eine Gute-Nacht-Geschichte Vor dem Einschlafen erzählt man dem Kind eine Gutenachtgeschichte. Möge das Kleine unbeschwert ruhen und etwas Schönes träumen. Mein Buch ist zum gleichen Zwecke gedacht und wendet sich an alle Menschenkinder für jede Zeit und in jeder Lebenslage. Alexander Swidsinski
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 249
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Charite-Gahro
2018
http://swidsinski.de/themen/buch.pdf
Inhalt
Teil I
DIE GABE
Die Kunde der Krankheit
Sackgasse der Bedürfnisse
Bedarf
Triebe
Auf und davon
Teil II
Das Be- und Unbelebte
"Tamensi movetur!"
Lebensfunke
Genesis
Gelegenheit
Das Denken
Rezeptor-Reiz-Wahrnehmung
Teil III
DIE GENE
Wie die gen-Karten so fallen
Wer im Körper das Sagen hat
Gene und Bücher
Teil IV
DIE EVOLUTION
Ego und Eros
Divergenz
Verflechtung
Gemeinschaft und Eigensinn
Die Erweiterung
DIE SEXUALITÄT
Anfänge der Vereinsbildung
Einklang und Dissonanz
Sexuelle Fortpflanzung
Klonale Vermehrung
Einfache sexuelle Zeugung
Synchronisierte sexuelle Zeugung
Geschlechter
Die sexuelle Revolution
A posteriori statt a priori
Erfahrungsakkumulation
Gestalterische Freiheit
Wunschträume statt Verbissenheit
Sehnen nach ewigem Leben
Die Erschaffung des Mehrzellers
Krone der Schöpfung
Teil V
DAS WAHRE
Alle Wege führen zusammen
Die Stolpersteine
Der Irrtum
Doch nicht so
Die Irrwege der Logik
Zeit und Dauer
Jedem das Seine
Bewusstsein
Teil VI
Illusionen
Menschliches, Allzu-Menschliches
Was man so sagt
Das Können können
Das Bessere und das Bequeme
Erstzunehmende eben gemachte Menschen sein
Die Ismen
Die Wurzeln
Götzendummerung
Die Macht
Würden sie es wagen?
Leben in den anderen
Kontrolle
Ein Mann ein Wort
Arbeitsbienen
Die Moral(an)sprüche
Die Scheiterhaufen
Vom Umgang mit den Meinungen
Rücksicht und Toleranz
Viel Feind’, viel Ehr’!
Teil VII
Leib und Leben
Gefühlskultur
Anatomie der Triebe
Der Vorschuss
Die Raffgier
Versuchungen
Die Aufputschmittel
Ungeduld
Ekstase
Das Medizin
Schlaf
Versinnlichung des Sinns
Teil VIII
Das so Un- und Verzichtbare
Neid
Ärger
Rache
Ungeduld
Sünde
Dummheit
Die Allerersten sein
Eitelkeit
Das Alleinsein
Ruf und Ruhm
Geltung
Teil IX
Weisheit
Das Schöne und der Rest
Dieses süße Wort Freiheit
Das Gute und die Güte
Das Unangenehme
Die Unseren
Unsere täglich Angst
Die Starre
Die Panik
Gutes Ende
Gruseln
Grausamkeit
Medikamente
Shockandawe
Gegenmittel
Mut
Verneinung
Geborgenheit
Hoffnung und Zuversicht
Gelegenheit
Tod im Leben
Umgang mit dem Altern
Teil X
Verband des Lebens
Die Wurzeln
Satzungen
Genom
Kultur
Bewusstsein
Verfügbarkeit
Das Sichaufrichten
Einander finden
Selbsterhaltung
Das Vereinsleben
Das individuelle Weisungsrecht
Faust und Schöpfung
Die Kompetenz
Die Kontinuität
Autorität
Verantwortung
Politik
Rat
Wahlen
Die Rangpyramiden
Legitimation
Die Scheinalternativen
So oder So-ziaismus
Krieg den Palästen
DAS GRUNDGESETZ
Die Ziele
Das Sein
Die Vervollkommnung
Die Gegenseitigkeit
Die Schöpfungsforderung
Die Eigenständigkeit
Der Schutz
Die Freiheit
INSIGNIEN
Teil I
DIE GABE
Das Leben ist im Allgemeinen einfach,
einfach zu leben ist dagegen sehr, sehr schwer
Leben ist das einzige Gut, von dem man nicht genug haben kann. Man möchte alles auskosten, nicht bloß sein, sondern jeden Augenblick genießen, ausfüllen, erweitern. Doch womit und woher nehmen, wie geht man mit Leben um, was versteht man darunter und worum genau geht es dabei?
Auf der Jagd nach Lebensfülle hortet der eine Geld, Kunst, Immobilien der andere Arbeiter, Beamte, Soldaten. Das Zusammengeraffte schwillt zuweilen enorm an, zum Leidwesen der Mehrheit, überschüttet die einen, beraubt die anderen, zieht unüberwindbare Graben zwischen Menschen, Völkern und Rassen.
Und? Was macht dieser Besitz für einen Unterschied, wie sehr bringt es die Eigner weiter?
Es gibt eine Gerechtigkeit, die jeder sozialen Ungleichheit und Willkür trotzt. Sie steht über jedem Gesetz, lässt sich weder bestechen, noch bezwingen, noch irreführen. Wieviel kostet ein klarer Blick, die wonnigen Strahlen der Morgensonne, der betörende Duft der Wiesenblumen, freies Atmen, ein erquickender Gedanke? Nichts und unendlich viel. Diese Gaben sind frei verfügbar und unerschwinglich zugleich.
Das Leben ist das höchste Gut, verliehen durch die Geburt. Jedem werden dessen Schätze in vergleichbarem Umfang zuteil. Was wissen wir von dem in uns eingeschlossenen Reichtum?
Erstaunlich wenig.
Wie nutzen wir diesen? - verschwenderisch und gedankenlos gleich einer laut summenden Fliege, die wirr durch den Raum surrt, um dann irgendwann, wer weiß wo, zu enden. Die gesellschaftliche Stellung: Macht und Reichtum, wie anmaßend sich diese auch gebärden, können dem Körper, zu dem, was er ohnedies schon besitzt, höchstens einen künstlichen Darmausgang und diverse Prothesen zufügen. Weder Geld noch Macht können den Körper verbessern. Krankheiten bringen uns die Einsicht, dass die Lebensgaben nicht selbstverständlich sind. Spätestens im Krankenbett beginnen die Menschen über das eigene Streben und den Sinn des bisherigen „Eilens“ nachzudenken. Sie schauen zurück und fragen sich - war das alles? Oft bleibt keine Zeit für eine Antwort. Aber auch diese unbeantwortete Frage ist viel wert.
Die Kunde der Krankheit
Vater, Vater, warum hast Du mich verlassen!
Patienten klagen in meiner Sprechstunde über vermeintliche Tücken ihres Körpers, fragen bitter und vorwurfsvoll warum dieses oder jenes nicht mehr klappt, wieso es hier oder da weh tut, wie lange ihre Beschwerden noch anhalten werden? Man kann ihren Verdruss verstehen. Von Geburt an erhalten wir unsere Fähigkeiten umsonst, ohne uns um deren Erwerb oder Erhalt zu kümmern. Sie zwingen sich uns geradezu auf. Wir folgen den Trieben und erhalten im Gegenzug Erfahrungen und neuartiges Können. Das Leben wird zunehmend klangvoll und farbenfroh. Wenn uns etwas fehlt, sagen uns die gleichen Triebe was wir tun oder lassen sollen, um die Lebenslust zurückzugewinnen. Wir müssen lediglich unser leibliches Wohl ansteuern, Freuden suchen und das Unangenehme meiden – der Rest ergibt sich von selbst.
Kaum stellen wir uns auf diese Führung ein, schon ändern sich die Regeln. Einst selbstloser Förderer und zuverlässiger Ratgeber verkommt der Körper zum wankelmütigen Waschlappen und rückratlosen Verräter auf den man sich immer weniger verlassen kann. Die Gestalt wird entstellt. An Kinn, Bauch und Hüften sammelt sich Fett. Muskeln hängen. Die Haut wird rau und faltig. Die Kräfte schwinden, die Luft wird knapp. Ja, die Welt um uns scheint zu verderben. Das Gewohnte wirkt fremd. Was bisher stärkte - zehrt. Lieblingsspeisen und Getränke schmecken schal und bitter. Der Genuss schlägt öfter in Völlegefühl, Übelkeit und Schmerzen um. Spiele ermatten, Reize stumpfen ab. Die Nachtruhe treibt sich irgendwo herum und will nicht einkehren, lässt uns mit den Plagen des Tages allein, statt Sorgen zu vertreiben und zu erquicken. Nach den Mühen des Ein- und Durchschlafens kommt kein erlösendes Erwachen. Im Gegenteil – der leere Kopf dröhnt, der Verstand findet sich mit Mühe in der fremd wirkenden Umgebung zurecht. Die Gelenke sind eingerostet, Glieder bleiern, alles kostet Überwindung….
Woher diese Misslichkeiten? Man hat doch nichts falsch, zumindest nicht absichtlich falsch gemacht. Man folgte hörig dem, was der Körper vorsagte und verwöhnte ihn nach Kräften. Gewiss, man hat zuweilen schwer gearbeitet, sich über die Maßen angestrengt, auf manches verzichtet, doch nur, um eine Position zu erreichen, von der aus man alle Wünsche des Körpers erfüllen kann. Sollte man dem Leib versehentlich Wichtiges vorenthalten haben, so ist man bereit, es zu ändern. Jetzt, wo man es sich leisten kann, wird man gern das Fehlende besorgen, Rückstände aufholen, alte Rechnungen begleichen. Nennt die Ursache und das Gegenmittel. Der Preis spielt keine Rolle! Ich bin bereit, mein ganzes Vermögen in die Waagschale zu werfen.
Als wäre es so einfach! Als würde das genügen!
Die Medizin entdeckte viel Außergewöhnliches: Infektionen, Entzündungen, Tumore, Defekte des Stoffwechsels, der Enzyme und Gene. Die Details sind auf hunderttausenden von Büchern verteilt und in mehreren Bibliotheken untergebracht. Niemandem ist es gegeben, das Ganze durchzulesen, geschweige denn sich anzueignen. Es mutet viel an, ist es aber nicht. Vom Ozean der vielfältigen Äußerungen des Lebens erfasst das ärztliche Wissen gerade die Oberfläche. Was ist mit dem Rest? Wo sind die Schlüssel zu den Beschwerden, für die weder Befunde noch erkennbare Gründe vorliegen?
Man erklärt diese für „nicht-medizinisch“. Es wirkt ehrlich. Schließlich berechnet man für ärztliche Dienste Honorare, und man sollte kein Entgelt für mangelnde Leistungen fordern. In Wirklichkeit entzieht man sich bloß der Verantwortung. Die Bezeichnungen „nichtmedizinisch, wie übrigens auch „rein psychisch“, „autoimmun“ und „genetisch“, sind Schattierungen von Demselben und bedeuten so viel wie „selber schuld“. Sie stellen Betroffene selten zufrieden. Anders als Ärzte es ihnen bescheinigen, wissen die Patienten: die Beschwerden sind echt, und sie sind neu. Es muss also einen „wirklichen“ Grund für die Misslichkeiten und deren Auftreten geben. Erkennt man diese, so könnte man den Vorgang stoppen oder gar umkehren.
Auf der Suche nach Ursachen wechseln Patienten die Ärzte, Heilpraktiker, Schamanen, Psychologen, pilgern zu heiligen Orten und befleißigen sich der Mystik. Irgendwann taucht dann eine Diagnose auf. Es ist nebensächlich, ob die Diagnose auf Tatsachen beruht oder überhaupt einen Sinn ergibt. Meist handelt es sich um eine Worthülse ohne Inhalt. Der Name wird dennoch als Erlösung empfunden. Eine Widerlegung ist unerwünscht. Nichts ist undankbarer als einen Patienten über die Leere seiner Einbildungen aufzuklären.
Ich habe mich öfter gefragt: Woher dieser Drang zu Pseudodeutungen stammt, wenn dieser nichts an dem Bestehenden noch an den Folgen ändert? Wozu dient diese aussichtslose Unrast, die zu den eingetretenen Einbußen weitere Lasten zufügt und die verbleibende Lebenszeit raubt? Geht es dabei um Schuldzuweisung?
Vielleicht.
Von Kindheit an lernen wir: Wer unschuldig ist, darf nicht bestraft werden. Schaut, hier ist alles verdreckt. Wer war das? Ich bin nicht schuld, also mache ich keinen Finger krumm! Sollen die Anderen aufräumen. Ist die Diagnose genannt, so ist die Schuldfrage geklärt, und man muss weder sein Leben umdenken noch auf Gewohntes verzichten. Das Zweifeln hat ein Ende, man kann wie bisher im Leben weitergleiten, wohin auch immer es führt.
Die Klärung von Schuldfragen mag erlösend wirken: im Kindergarten, in der Schule, gegenüber einem Vorstand oder einer Wählerschaft. Die Krankheit nimmt keine Notiz davon.
Warum brechen körperliche Funktionen ohne erkennbaren Grund ein und warum schreitet der Verfall fort, obwohl wir dem Körper jeden Wunsch erfüllen?
Die Frage lässt sich so nicht beantworten, da sie die Zusammenhänge verdreht. Die Formulierung setzt voraus, dass Gesundheit und Lebensfreuden selbstverständlich sind, deren Einbruch dagegen etwas Unnatürliches, Außergewöhnliches darstellen. Dabei ist es umgekehrt. Alles bricht irgendwann zusammen. Nicht das Versagen bedarf einer Erklärung, sondern das Leben.
Woher kommt das Leben, worin besteht und wie funktioniert es? Bei diesen Fragen wird uns erst die Schwere der Aufgabe bewusst. Kennen wir die Quellen der Lebenskraft? Verstehen wir das Leben? Können wir die einfachsten Vorgänge des Lebens steuern? Wissen wir, wie sich die einzelnen Zellen zu unserem Körper zusammensetzen und miteinander agieren? Oder zugespitzt - wissen wir, wie aus einer Raupe ein Schmetterling, aus einem Samen ein Baum wird?
Ich kenne die Antworten nicht. Niemand kennt diese. Wir sind erst dabei, Grundsätze der lebendigen Organisation zu erahnen. Nichts davon ist selbstverständlich oder vorausgesetzt. Nichts davon können wir hervorbringen. Das Leben ist ein Wunder. Ich bin voller Begeisterung, Ehrfurcht und Dankbarkeit darüber, dass es überhaupt funktioniert, und zwar völlig ohne unser Dazutun. Atmen, denken, fühlen, Freude und Schmerz empfinden – nichts ist simpel!
Aber muss man so tief schürfen und sich in Einzelheiten verstricken? Letztendlich geht es dem Patienten nicht um Moleküle und Raffinessen des Lebens, sondern um die Einfachheit, mit der sich das Leben bisher anbot. Man stand auf und lief, streckte die Hand aus und griff zu, öffnete die Augen und sah, dachte nach und erinnerte sich, kombinierte Tatsachen und traf Entscheidungen. So wie es war, will man es zurück, nichts darüber hinaus.
Wie naiv!
Ja, es ist mitunter angenehm, leicht und heiter zu leben. Diese Attribute sind jedoch keine Eigenheiten, sondern schwer erarbeitete Vorschüsse. Leben ist nicht leicht – es ist uns leicht gemacht worden. Der Aufwand hierzu ist enorm, er wurde nicht von uns erbracht und untersteht nicht unserer Kontrolle. Unser Körper gehört nicht uns, sondern der Evolution! Der Eintrag im Ausweis täuscht. Wir sind viel älter, als es uns die Zahlen darin bescheinigen. Das Leben ist vor etwa 5 Milliarden Jahren entstanden. Jedes heute existierende Lebewesen ist ein Nachkomme aus der Urzeit. Damals wurden wir geboren und seither leben wir in einer ununterbrochenen Generationsfolge fort. Diese 5 Milliarden Jahre sind das eigentliche Alter jedes heute bestehenden Wesens. Kein Abschnitt lässt sich herauslassen. Gäbe es eine einzige Unterbrechung, wären wir nicht da. Dem Individuum scheint es nur, dass sein Leben von neuem beginnt, ihm gehört und mit ihm endet. Das Individuelle ist ein Stand des Fortwährenden. Zwar empfinden wir die Ereignisse als einzigartig, für die Abläufe, die uns aufbauen, sind sie nicht neu. Unsere Ahnen haben vor uns unter ähnlichen Umständen agiert, die Widrigkeiten bekämpft, Hindernisse gestürmt, gesiegt und versagt. Die Erfahrungen ihrer Siege und Niederlagen laufen verflochten in uns zusammen. Unser Körper ist nichts anderes als ein Vorrat an gelungenen Lösungen, der es uns ermöglicht, aus einem DNA-Strang, Wasser, Licht und Mineralien einen denkenden mehrzelligen Organismus aufzubauen. Wir stützen uns bei der Reifung auf eine lange Geschichte erfolgreicher Vorstöße und erstürmen mit Elan Hindernisse, die einst unsere Vorfahren belagerten und bezwangen. Je ursprünglicher die Stadien der Individualentfaltung sind, desto umfangreicher ist der Erfahrungsschatz und umso seltener sine die unerwarteten Eventualitäten. Der werdende Organismus ist schwach. Seiner Schutzlosigkeit entsprechend müssten die befruchtete Eizelle und der Embryo für Störungen am anfälligsten sein und sich immer wieder in zahlreichen Missgriffen und Missbildungen verirren. Dies ist nicht der Fall. Was auch geschieht, wo man sich auch befindet, was man isst oder tut, der Embryo erfüllt sein Entwicklungsprogramm genau, bis zu den Fingerabdrücken. Trotz schnellen Wachstums und Austauschs von Milliarden von Zellen sind Abweichungen der Embryogenese selten. Erst als die Wissenschaft Substanzen entdeckte, die in der Evolution nicht vorkamen und daher vom Leben nicht berücksichtigt werden konnten, wurden Mutationen und Fehlbildungen alltäglich. Bekannt berüchtigte Beispiele hierfür sind radioaktive Strahlungen und Thalidomid. Die Werbung sagte, die Beruhigungspille (Thalidomid) ist weniger gefährlich als ein Glas Milch und empfahl es besonders den schwangeren Frauen. Das Medikament zeigte keine Nebenwirkungen bei den Frauen, brachte jedoch grässliche Missbildungen, fehlende Arme und Beine bei den Neugeboren hervor. Jenseits solcher Eingriffe, ist die Embryogenese erstaunlich stabil. Aus einer einzigen Zelle formt sich nach mehreren spektakulären Umwandlungen ein Baby, wächst und entfaltet sich immer weiter. Mit jedem abgeschlossenen Reifungsabschnitt gehen Unbeschwertheit und Leichtigkeit zurück, bleiben jedoch beim Kind und Jugendlichen reichlich erhalten. Die Vielzahl an Problemen, denen unsere Art in der Vergangenheit gegenüberstand und die sie löste, erklären, warum uns gerade am Anfang die schwierigsten Aufgaben wie von selbst gelingen. Wir ziehen uns hoch, stehen auf, laufen, lernen, packen an, als hätten wir nur darauf gewartet. Die Sprache wird wie im Vorbeigehen erlernt, wir wissen nicht einmal wie es geschieht, komplexe Fertigkeiten werden spielend angeeignet. Es gibt kaum ein Ereignis, das den wachsenden Körper überrascht, kaum einen Störfaktor, für den kein Gegengift bereitsteht. Die Sinne helfen uns dabei und begutachten die Entwicklung mit weisem Augenmaß der biologischen Erfahrung. Was in der Evolution gut war, erfreut uns beim Wiedereintreten, was kritisch war schmerzt und ängstigt. Wir folgen biologischen Wegweisern ohne nachzudenken, quittieren Erfolge und werden von Gefühlen der körperlichen Zustimmung überschwemmt. Die Jugend ist voller Freuden.
Die heile Zeit der unbekümmerten Entfaltung in den Grenzen des mehrfach Geprüften ist das, was Menschen für Gesundheit halten. Die Zuverlässigkeit, mit der sich das Erprobte durchsetzt, verwechseln sie mit Selbstverständlichkeit und halten sogar das Gelingen für ein Anrecht: Es ging doch bisher, also muss es auch weiter so gehen können. Wenn Probleme auftauchen, gehen sie zum Arzt und verlangen, er möge ihnen die einstige Unbeschwertheit zurückgeben und die schwindenden Kräfte auffüllen.
Sie verlangen Unmögliches, nicht an der richtigen Stelle und von den Falschen.
Wenn ein Krankheitsfaktor den Pfad der Individualentwicklung versperrt: ein Virus, Bakterium, ein Unfall, Mangel an Stoffen, eine Fehlstellung, und der Arzt diese Hindernisse erkennt und beseitigt, so scheint es, als könne er den Körper befehligen, Leben schenken und mehren. Das stimmt so nicht. Der Arzt vermehrt nichts und gibt kein Leben, sondern entfernt Stolpersteinchen aus dem Entfaltungsweg des körperlichen Treibens. Er kann also nur das Bestehende erleichtern. Es mag ungewohnt klingen, aber der Mensch, wie jedes andere Leben, entsteht nicht durch äußere Eingriffe, Zufälle oder Mutationen, sondern gestaltet sich selbst und kann sich nicht anders vervollkommnen als durch das eigene Streben und die Ziele, die er verfolgt.
Wo will der Mensch hin? Was treibt ihn? Macht er sich Gedanken darüber?
Im Allgemeinen kaum. Der durchschnittliche Mensch lässt sich von seinem Körper leiten. Sagt der Körper: das ist gut, so streben Menschen dies an, warnt der Körper vor etwas, so meiden sie es. Man nennt das, seinen Bedürfnissen nachgehen.
Sackgasse der Bedürfnisse
Im 19. Jahrhundert wurden Bedürfnisse auf einmal wichtig. Glückseligkeit, Freiheit, Gewissen, Gott, Menschlichkeit – das alles war gestern: verworren, irreführend und für die Planung unbrauchbar. Bedürfnisse erklärten dunkle wie leuchtende Hintergründe und Motive menschlicher Taten auf einfache, einleuchtende und für alle Zeiten und Länder bindende Weise. Sie ließen sich berechnen und statistisch erfassen. Von nun an dürfte alles klar und wissenschaftlich fundiert sein. Doch die Eintracht ging nicht auf. An dem Satz: „Jeder nach seinen Fähigkeiten, jedem nach seinen Bedürfnissen! – zerbrach die Welt in zwei unversöhnliche, sich bis aufs Blut bekämpfende Lager.
Während der Kapitalismus sich demonstrativ hinter egoistische Triebe stellte, verlangte der Kommunismus dem Menschen Gemeinschaftssinn ab. Je nach Deutung, fielen die Ansprüche und Vergütungsregeln unterschiedlich aus, gemeinsam war nur die Anspannung der Ambitionen. Beide Systeme wetteiferten um das maximale Einbeziehen Einzelner in den Prozess der Güterproduktion. Die Menschheit profitierte von dem Ansporn. Ausgerichtet auf die Befriedigung von Bedürfnissen entfesselte sie im Wettstreit der Systeme ungeheure Kräfte, baute Megastädte, verband die Erde mit Land-, Wasser- und Luftwegen, versetzte Berge, verwandelte Landschaften und flog in den Kosmos. Das bereits Errungene, wie die Erwartungen für das Kommende waren enorm. Die Science-Fiction Romane des 19. und des 20. Jahrhunderts geben die Anspruchshaltung dieser Zeit unverfälscht und eindrucksvoll wieder. Ich wuchs in diesem Optimismus auf und hatte keine Zweifel an der Einstellung. Dem Menschen schien nichts mehr unmöglich und jedes Problem lösbar. Das Moderne schaffte es tatsächlich, in wenigen Jahrzehnten allen biologischen Bedürfnissen Genüge zu tun. Doch es kam anders als gedacht und womit niemand rechnete.
Als alle körperlichen Wünsche erfüllbar wurden, musste man zusehen, wie sich jeder Schritt auf ihre Befriedigung hin aus der Erlösung und Stärkung in das Gegenteil verkehrte. Beachtliche Leistungen des Gesundheitswesens aus dem 19. und 20. Jahrhundert versandeten. Die Erfolge der Medizin wurden schwerfällig, teuer und kleinlich gemessen am Aufwand. Die Erscheinung der Menschheit änderte sich. Statt Sportlichkeit, Grazie und Harmonie breiteten sich Übergewicht, Depression, Fettleber, Alzheimer und andere Zivilisationskrankheiten aus. Inzwischen sind das durchschnittliche und noch mehr das maximale Lebensalter der Menschheit in Gefahr, selbst der IQ ist im Sturzflug. Die USA sind Vorreiter, vom Rückzug ist jedoch die ganze Welt betroffen. Selbst dort, wo die Zahlen standhalten, schrumpfen die Lebensinhalte. Ich war mit 23 Jahren approbierter Arzt und Vater. In diesem Alter waren eine feste Berufsanstellung, ein eigener Wohnsitz und Familie typisch für meine Generation. Burnout war noch nicht entdeckt. Man beklagte Unterforderung. Das eigenständige Berufsleben beginnt heute um das 35. Lebensjahr, das Familienleben (falls es dazu kommt) ebenfalls. Die Vorbereitungszeiten wurden länger, die Belastbarkeit ist, verglichen mit den 50er-80er Jahren des 20. Jahrhunderts, deutlich geringer, und die physikalische Zeit zum eigentlichen Leben knapp.
Meine Generation träumte vom Fliegen und dem Erkunden von Makro- und Mikrokosmos. Heute finden Berufe wie Physiker, Techniker oder Ingenieur kaum Bewerber. Die Visionen des Fortschritts wurden von Fantasie- und Mystik-Literatur mit finsteren Gestalten des Mittelalters abgelöst. Ich wurde über 2 Meter groß. Doch im Kindergarten, in der Schule und im Institut waren viele Jugendliche größer als ich. Die Akzeleration war sichtbar, sobald Klassen die Aula oder den Sportsaal füllten und sich nach Jahrgängen neben den deutlich kleineren Lehrern aufstellten. Damals glaubte ich, dass meine Körpergröße in der Zukunft zum Durchschnitt wird. Es kam anders. Die Menschen wurden nicht größer, sondern fetter und schwerfälliger. Was ist schief gegangen?
Am treffendsten kann man es mit dem Verlust der Orientierung beschreiben. Dabei lag der Fehler weder bei den politökonomischen Theorien noch bei deren Umsetzung, sondern in dem Wesen der Bedürfnisse selbst. Die Gründer der Politökonomien machten sich keine Gedanken darüber, was Bedürfnisse sind. Bedürfnisse waren eine Selbstverständlichkeit, die keiner weiteren Erklärung bedurfte. Allerdings verhält es sich mit allen Selbstverständlichkeiten so. Himmel und Erde treffen sich am Horizont der sichtbaren Erdscheibe, die Sonne geht am Rand auf und wandert über die Himmelskuppel, das Schwere fällt herunter, das Leichte steigt auf und schwimmt. Selbstverständlich sind Dinge deren Deutung einleuchtet, für aktuelles Handeln entbehrlich ist und zunächst keiner Prüfung bedarf. Die Situation ändert sich schlagartig, sobald man das Selbstverständliche in die Handlung einbezieht. Wie kommt man zum Rand der Erdscheibe? Was stützt die Himmelskuppel? Wie erleichtert man das Schwere so weit, dass es schwimmt, schwebt oder sogar aufsteigt? Gleich bröckelt die Selbstverständlichkeit und zwingt die wahre Bedeutung gewohnter Erscheinungen zu hinterfragen.
Was sind und wozu gibt es Bedürfnisse?
Bedürfnisse sind die Sehnsucht des Unerfüllbaren. In der wilden Natur gelten Bedürfnisse Merkmalen, die wegen Mangel oder Unbeständigkeit nicht dauerhaft gedeckt werden können und allein durch Spitzenleistungen zu gewinnen sind. Ausgerichtet auf das Unerreichbare dienen Bedürfnisse nicht so sehr ihrem Besitz, wie der eigenen Ertüchtigung.
Die Politökonomie ordnet die Warenproduktion den körperlichen Begierden unter. Anders als in der Natur, schafft es die moderne Industrie tatsächlich, alle biologischen Bedürfnisse zu stillen und behebt damit die zugrundeliegende Herausforderung. Von der Herausforderung losgelöst, verliert die Befriedigung körperlicher Bedürfnisse ihre ertüchtigende Wirkung. Die Sättigung lähmt den Willen, stumpft die Sinne ab und erstickt das Streben. Ein voller Bauch studiert schlecht. Überdruss ist auch in Politik, Wissenschaft, Kunst und Sport hinderlich. Die Verbrauchergesellschaft verliert ihre biologischen Antriebe schneller als sich neue herausbilden können. Dies ist heute deutlich wie nie. Der Durchschnittsamerikaner beansprucht bei gleichen Voraussetzungen dreimal so viele Kalorien wie ein Mensch in Entwicklungsländern. Das Gefälle ist noch gravierender beim Verbrauch von Energie, Wasser, Kleidung, Wohnraum. Doch, statt Energien zu wecken, erdrückt dieser Reichtum die unternehmerische Bereitschaft. In Ermangelung der Antriebe versucht die Moderne, Verbrauch durch Globalisierung anzukurbeln, Armenländer arbeiten zu lassen und zugleich Wünsche im übersättigten Sozius zu aktivieren, die bisher als abartig galten, jedoch noch nicht ausgereizt wurden. Vielleicht könnten diese noch als Triebfeder dienen: Glamour und Prahlsucht, Viagra für Männer und Frauen, Dekadenz jeder Art.
Bedarf
Die Auswüchse der Verbrauchergesellschaft sind unübersehbar, die Folgen für Umwelt und Mensch beklemmend. Kritische Stimmen werden laut, prangern den Konsum an, schüren Zukunftsängste und verlangen eine Kontrolle des Verbrauchs. Die 68er, der „Club of Rome“, die Grünen, die Piraten geben dem Wachstum Schuld, fordern institutionellen Verzicht. Ihre Rezepte greifen in die persönlichen Freiheiten ein, bevormunden und entrechten das Individuum. Die Ideen finden dennoch Verbreitung und Eingang in die Programme fast aller politischen Bewegungen.
Würde es gehen?
Nicht jede Alternative ist ein Gewinn. Die Verbrauchergesellschaft geriet in eine Sackgasse. Umdenken tut not. Gewiss! Wer sagt aber, dass der Ausweg im Umkehren liegt? Bietet die Beschneidung menschlicher Ansprüche eine Lösung? Wo bleibt man bei den Einschränkungen stehen? Streng bei dem Bedarf? Welchem? Wessen? Gibt es Präzedenzfälle?
Die Geschichte bietet genug Beispiele für Beschränkungen. Der freiwillige Asketismus wurde öffentlich gepriesen jedoch kaum befolgt und insgeheim belächelt. Die religiösen Verbote waren durchgreifender, jedoch fern jeder Logik für die Beteiligten außer: So muss es sein, da Gotteswille und Schluss! Angeblich sind wir heute besser dran. Die Wissenschaft könne den Bedarf berechnen und die Güterverteilung frei von Mystizismus regeln. Ist das so? Wohl kaum! Die sogenannte etablierte Wissenschaft steht heute für das eine, morgen für das andere, schwankt, zweifelt und hat abgesehen von den Geldgeberquellen keine eigene Durchsetzungsmacht. Das semitische Essverbot des Schweins und das Heiligsprechen der Kuh in Indien wirken dagegen bis in die Gegenwart. Alles wegen der Launen eines religiösen Starrsinns? Nein, - aus purer Berechnung! Die religiösen Verbote fassen die historische Weisheit der Gemeinschaft zusammen und setzen diese effektvoll um.
Ein Schwein kann, anders als Huftiere, nicht vom Gras leben. Es benötigt zum Wachstum die gleichen Lebensmittel wie der Mensch. Zu Notzeiten musste man, um einen Menschen mit Schweinefleisch zu versorgen, zwei anderen Menschen die Lebensgrundlage entziehen. Die Erklärung des Schweins als unrein und dessen Verbot schützt die Bevölkerungsmehrheit, ohne sich in Rechtfertigungen zu verwickeln. Die religiöse Dogmatisierung verleiht Stärke jenseits individueller Gründe, verhindert, dass der Inhalt zerredet und durch Ausnahmen ausgehebelt wird.
Ähnlich kam es zur Heiligsprechung der Kuh. Eine Kuh war für den indischen Bauern ein Heizofen, Traktor, Milchspender und vieles andere mehr. Der Verzehr von Rindfleisch durch die Reichen bedeutete für die Bauern, die ihre Kuh in Notzeiten verkauften mussten, qualvollen Hunger und Tod. Die Religion, die die Unantastbarkeit der Kuh allen sozialen Schichten aufzwang, schützte die Bevölkerung gegen Katastrophen und wurde von der Mehrheit vorgezogen, obwohl deren Gebote mit den Traditionen und der oberflächlichen Logik brachen.
Archäologische Funde und alte Schriften belegen, dass der Hinduismus bei seiner Entstehung bereitwillig die Kuh und das Kuhfleisch sowohl als Opfertier als auch zum Verzehr nutzte. Obwohl tief in der indischen Kulturgeschichte verwurzelt, wandten sich die Inder vom Kuhopfer ab, als die Bevölkerungsdichte wuchs. Nicht der Gott sprach die Kuh heilig. Es waren Menschen mit ihren Wertevorstellungen.
Die Kuh wurde in der Not zum zentralen Garanten des Wohlstands, ja des Überlebens. Menschen wählten eine Religion, die ihnen diese gewährten. Als der Hinduismus noch Kuhopfer billigte, musste diese archaische Religion schmerzliche Schläge einstecken. Zeitgemäßer Buddhismus und Islam breiteten sich in Indien rapide aus und verdrängten beinahe den Hinduismus. Doch mit dem Heiligsprechen der Kuh eroberte der Hinduismus seine einstigen Positionen zurück und behauptete sich gegenüber den konkurrierenden Religionen ohne andere Postulate wesentlich zu reformieren. Es ist ebenfalls hinreichend belegt, dass die semitischen Völker in den Anfängen ihrer Kultur Schweinezucht betrieben und diese erst mit dem Judaismus und dem Islam aufgaben.
Die Religionsgeschichte zeigt: Eine verordnete Mäßigung ist für Individuen, Gruppen (Kasten) und ganze Völker durchsetzbar. Allerdings stehen dahinter weder abstrakte Wünsche noch fromme Absichten. Der Sinn der Askese ist kein Verzicht, sondern eine maximale Gewährung von Lebensnotwendigem. In anhaltenden existenziellen Krisen bekommt die Sicherung des Bedarfs einen Vorrang und setzt sich vehement durch. Warum nicht gleich so?
Das liegt im biologischen Wesen des Bedarfs. Gebundener Stickstoff ist eine absolute Voraussetzung für die Lebensfähigkeit von Tieren und Pflanzen. Der Bedarf ist enorm. Das Verlangen danach fehlt allerdings, weil im Allgemeinen kein Mangel besteht. Die Verfügbarkeit ist vorausgesetzt. Dasselbe betrifft Luft, Wasser, Licht. Selbst die Sprache bezeugt die Neutralität des gesicherten Bedarfs. Es gibt zwar Durst, aber keinen gegenteiligen Ausdruck dafür. Es gibt das Wort Luftnot, aber kein Wort, das die Lust am Atmen beschreibt.
Der Bedarf erzeugt, im Gegensatz zu den Bedürfnissen, erst dann einen Antrieb, wenn es zu einem Mangel kommt. Dann ist dieser allerdings nicht zu bändigen. Bedürfnisse kann man wegstecken, den Bedarf nicht, da es an die Substanz geht. Mangel und Not sind aber nicht beständig, kommen, gehen und ändern mit der Zeit ihre Inhalte. Der Wegfall des Drucks macht die Beschränkungsgebote skurril. Was soll man von der neuzeitlichen Wiederbelebung der Verbotswünsche in welcher Form auch immer halten? Sie sind eine Aufforderung: Zurück in die Steinzeit! - sonst nichts.
Triebe
Das 19. bis 21. Jahrhundert sind ein einziger Siegeszug der Biologie über den Verstand. Alle Gebiete, geographisch wie geistig gesehen, sind betroffen und selbst die konservativsten Regionen wie Religionen einbezogen. Die Menschheit gab sich selbstvergessen ihren Trieben hin, lies sich von diesen leiten, ohne sich Gedanken darüber zu machen, was die Triebe sind, wohin diese führen und wie.
Bedarf und Bedürfnisse sind biologische Automatismen. Über angeborene Vorlieben und Reize animieren sie den Menschen dazu, den Weg seiner Vorfahren zu wiederholen in Allem was gut war. Wir folgen ihnen zunächst widerspruchslos: Ziehen bei Berührung der Mutterbrust saugend die Lippen zusammen, drehen uns auf den Bauch, wenn wir von Eltern auf den Rücken gelegt werden, zappeln mit Händchen und Beinchen, heben den Kopf, torkeln, laufen gegen Widerstände, führen Unbekanntes zum Mund, später zum Gehirn. Die Begegnungen mit der Wirklichkeit wecken Erinnerungen in unserem Körper an die Erfolge und Niederlagen unserer biologischen Entwicklungsgeschichte, bringen Freuden der Bestätigung oder Schmerzen der Ablehnung. Von Trieben angeführt, reagieren wir auf die Ereignisse und sammeln Erfahrungen. Dabei stimmen wir unsere Organe auf die Realität ein und machen die Wirklichkeit zur Fortsetzung unseres Selbst.
Die Bestimmtheit unserer Triebe hat zu der Vorstellung geführt, die Triebe wären zwanghaft und unkontrollierbar. Der Mensch handelt zwar, weiß aber nicht was ihn lenkt. Wozu Gedanken an das verschwenden, worauf man keinen Einfluss hat?
Man irrt sich. Triebe sind hörige Diener. Sie nötigen ihre Herren nur, wenn diese, aus Sicht der bisherigen Evolution, unangemessen handeln. Mit dem Erwachsenwerden emanzipieren wir uns von dem Zwang der Triebe. Das unbändige Begehren wird zur Selbstbeherrschung, die Unsicherheit zur Gelassenheit, die Lust zur Liebe. Das Reifen setzt nach und nach genetische Formeln der Evolution in eigene Fertigkeiten um. Der Verstand wird zum Bestimmer und bemächtigt sich der Triebe nach und nach. Doch wozu das Tauziehen? Wenn Triebe nur das Beste wollen und anstreben, ist der Verstand dann eine Art Überheblichkeit? Was hat man an den Trieben auszusetzen?
Einiges!
Die gesammelten Erfahrungen der Evolution sind gewaltig, von der Geburt bis zum Alter stehen sie dem Menschen helfend zur Seite. Vollkommen sind sie nicht. So wie die elterlichen Erfahrungen unzureichend für das Moderne ihrer Kinder sind, sind es auch die Erfahrungen der Evolution für die Herausforderungen der Gegenwart. Unser Körper kann keine Antworten auf Situationen bieten, die in der Evolution nicht vorkamen. Dort, wo der Vorrat an vorgefertigten Lösungen endet, muss das Individuelle in das Ungewisse blicken, widersprüchliche Signale empfangen, ad hoc handeln, Verluste erleiden und Störungen in Strukturen und Funktionen des Körpers ansammeln. Erwachsen sein bedeutet eine zunehmende Verwicklung in Auseinandersetzungen, die dem Körperlichen unbekannt sind und anders als erwünscht enden. Das Anhäufen unumkehrbarer Fehler, das Anwachsen der Verluste über die Gewinne auf dem Weg der Entfaltung nennt man altern. Das Altern beginnt nicht im Alter, sondern mit den ersten Schritten, bei denen Strukturen zerstört werden, für deren Erhalt die Evolution noch keine Lösung fand und für die der