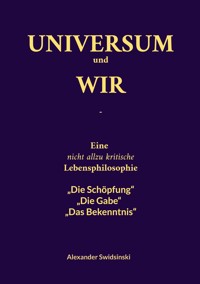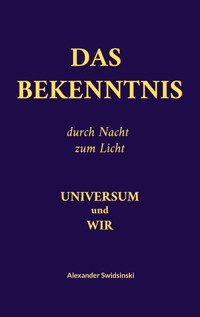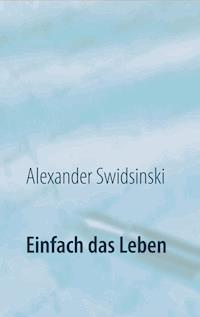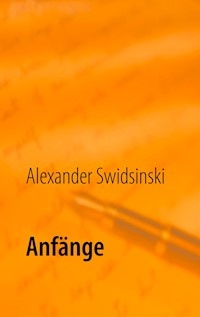
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Das Leben zu verstehen und das Verstandene im Leben umzusetzen, vor nichts zurückzuschrecken und keiner unangenehmen Frage aus dem Wege zu gehen ist das Anliegen dieses Manuskripts und der Leitfaden, der die einzelnen Abschnitte verbindet. Es sollte eine Brücke zwischen den Molekülen der Zelle und der Hochburg der menschlichen Seele schlagen, zeigen, dass hinter der Physik, Vernunft, Religion, Soziologie und Politik keine kalten Formeln, sondern durchgehend die Gesetze des Lebendigen stehen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 214
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt:
BUCH I
DAS LEBENDE
EVOLUTION
Uhr oder Stein?
Erklärungen der Evolution
Die Zweckmäßigkeit
Zufall und Überlebenskampf
Widersprüche
Verfehlungen
Schöpferische Werkzeuge der Evolution
Sexuelle Vermehrung
Fortpflanzungsgemeinschaft
Lebensraumgestaltung
Geburt
Entwicklung
Hingabe
Alterung
Lebensdauer
Tod
Territorien
Aggression
Grenzen
Glanz
Das Soziale
Schwarm, Schar, Rudel, Herde
Hierarchie
Parasitismus
Kooperation
Ehe
GESCHICHTE DES LEBENS
Ozean
Bakterien
Eukaryont
Mehrzeller
Trilobiten
Wirbeltiere
Landleben
Pflanzen
Insekten
Amphibien
Reptilien
Arbeitsweise der Evolution
Einstieg
Ausbreitung
Gigantomanie
Untergang
Miniaturisierung
Die Abfolge
BUCH II
DER VERSTAND
GENESIS
Autokatalyse
Lebenssicherung
Sinn
Entscheidungsfähigkeit
Unentschlossenheit
Der Wille
Triebe
Erfahrungsbildung
Gene
Linearer Ausbau
Vernetzter Ausbau
Außergenetische Erfahrung
Mitteilung und deren Deutung
Erziehung
Das Geistige
BUCH III
DAS DENKBARE
Reflex
Reiz und Reaktion
Bedingte und unbedingte Reflexe
Erfahrung
Organ
Instinkt
Das denkende Tier
Wahrnehmung
Vorstellung
Phantasie
Erkennen
DIE MENSCHLICHE SPRACHE
Inhalt und Begriffe
Gegebene und Nichtgegebene
Gewissheit
Erklärung
Verständigung
Einfalt des Faches
DIE WELT OHNE FACHGRENZEN
Raum und Materie
Dualer Charakter des Lichtes
Abstoßende „Anziehung“ der Schwerkraft
Antigravitation
Entropie
Zeit
Ursache
Sinn
BUCH IV
DAS SOZIALE
KULTUR
Staatlichkeit
Zwang, Tausch oder Ansporn
Das Recht
IDEOLOGIEN
Das Gutgemeinte
Wie ich dir…
Wissenschaftlichkeit
Verdinglichung
Allemunde
Die Ermahnenden
Natur
Die Kunst und das Künstliche
BUCH V
WIRTSCHAFT
Wert
Preis
Vermögen
Tauschwert
Bedarf
Markt
Eigentum
Die Finanzen
Geld
Gold
Kredit
Banken
Nationale Währungen
Die Konjunktur
Rezession
Beschäftigung
Grenzen des Wachstums
Mathematik der Entfaltung
BUCH VI
DAS MENSCHLICHE
Sinn des Lebens
Verblendung
Wahrheit?
Das Böse
Das beinah religiöse Erbe
Die Unsterblichkeit
Körperlichkeit
Innerlichkeit
Erfüllung
Nachwort
Es gab eine Zeit, da richteten sich die Menschen nach den Sternen. Zugewandt zum kristallklaren Nachthimmel träumten Bauern von üppigen Ernten, Jäger und Wanderer von verwegenen Routen, Abenteurer und Gelehrte von Schätzen unentdeckter Welten. Diese Sinneshaltung ist abhandengekommen. Die Erde ist längst vermessen und aufgeteilt. Grelle Lichterwerbung verdrängte Sterne aus der Wahrnehmung, füllte die Besinnlichkeit der Nacht mit aufdringlichen leiblichen Reizen. Schade, denn die eigentliche Entdeckungsreise ging noch gar nicht los!
Galaxien eines Superhaufens dehnen sich über unvorstellbare 300 bis 400 Millionen Lichtjahre aus. Allein der Durchmesser unserer heimatlichen Spiralgalaxie beträgt 100 000 Lichtjahre. Faszinierend finde ich allerdings nicht die Dimensionen, sondern den kommenden Menschen, der sich diesen Weiten gewachsen zeigt und sie bezwingen wird. Der nächstliegende Stern, Proxima Centauri ist von uns 4,3 Lichtjahre entfernt. Der Abstand zu lokalen Gruppen von Galaxien, wie dem Andromedanebel, beträgt etwa zwei Millionen Lichtjahre. Selbst diese nächsten Entfernungen sind mit der heutigen Lebensdauer nicht überwindbar, gleich welche technischen Erfindungen sich die Menschheit zulegt. Dennoch muss der Mensch aus dem Sonnensystem hinaus. Die Geborgenheit des irdischen Daseins täuscht. Die Uhr unseres Sonnensystems hat die meiste Zeit hinter sich und läuft unaufhaltsam ab. Der Mensch wird eines Tages die Erde verlassen und sich andere Welten aneignen müssen. Für diesen Sprung genügen Motoren und Raketen nicht. Eine Lebensdauer von 10 000 Jahren dürfte dagegen ein guter Anfang sein. Nur woher nehmen?
Die Industrie überschüttete den Menschen mit Gütern, machte jede Lage genehm. Besser wurde er dadurch nicht. Im Gegenteil! Zwischen der Arbeits- und Kaufstätte ist der Mensch fett und träge geworden. Von wegen mehr und länger leisten, er kann nur noch mühevoll das Geerbte verwalten. Verwundert betrachtet er die Werke seiner Vorfahren. Genervt überlässt er die Bedienung der Maschinen den Maschinen selbst. Wohin wird der Weg wohl führen? Es ist an der Zeit, sich zu entscheiden, was der Mensch eigentlich will: lebenslanges Sattsein mit gesichertem Platz im Pflegeheim, oder den Körper aus Stahl, Verstand und die Seele, die Funken sprühend nach den Sternen greifen. Ein anderer Mensch muss her! Ein Mensch, dem die jetzigen Wertvorstellungen – Vorzeigereichtum, Medienanerkennung, Zugehörigkeit zu einer „überlegenen“ Kultur, Rasse oder Stellung – wie Almosen eines Bettlerdaseins erscheinen, der sich statt am Hab und Gut an der eroberten Unendlichkeit des Raumes und der Zeit misst. Dieser Mensch wird enorme Energiemengen und Ressourcen für seine Unternehmungen beanspruchen. Vor allem aber wird die Lebenszeit dieses Menschen statt weniger Jahrzehnte Jahrtausende betragen müssen. Die Menschheit darf künftig nur so wachsen, dass jedes ihrer Kinder länger lebt, lernt und wirkt.
Phantasmen? Hirngespinste?
Ich stelle mir einen Menschen aus dem Jahre 1900 vor. Ich komme aus der Gegenwart, um mit ihm zu sprechen. Würde es mir je gelingen, ihn über das Jahr 1914, 1939 aufzuklären? Würde er mir glauben, wenn ich von Raketen, Atomkraft, Internet spreche? Wir stellen uns den morgigen Tag und den Tag des Jahres 2100 ähnlich dem heutigen Tag vor. Werden sie es sein? Wie wird die Zukunft aussehen, was wird sie dem Menschen bieten? Wachswaben menschlicher Häuser, Wälder und Flure zu Erholungsparks umgewandelt, in Reih und Glied aufgestellte Sportgeräte, Food Corner an jeder Ecke, endlose Strände als Bräunungsstudios unter einem UV Schutzdeckel – eine riesige Retorte, in der es von Menschenhefen wimmelt und gärt? Nein danke! Ich will woanders hin. Viel ist hierzu nicht nötig. Jeder Handgriff, der den Menschen klüger, stärker, langlebiger macht, bringt die Menschheit den Sternen näher.
BUCH I
DAS LEBENDE
Wolf, lass die Geißlein in Ruhe, nimm einen Kuchen.
Meine Tochter spielt neben dem Schreibtisch, während ich arbeite.
Wölfe essen keine Süßigkeiten, mische ich mich unbedacht ein.
Wolf, nimm eine Mohrrübe.
Wölfe mögen keine Mohrrüben.
Was kann man dem Wolf sonst anbieten?
Jetzt bin ich mit dem stutzig sein dran.
Hm? Bulette.
Wolf, nimm eine Bulette.
Die Tochter spielt weiter. Mir dagegen ist nicht mehr nach Arbeiten zumute.
Fragen können erheitern wie gelungene Witze und aufschrecken wie ein in der Stille gefallener Schuss. Sie führen ihr eigenes Leben, zeigen Ungehorsam, stören, drängeln, lärmen. Sie flüchten vor einer rüden Annäherung, wie scheue Tiere und folgen auf den Fersen, wenn man ihnen entkommen will. Ihre Körperlosigkeit täuscht. Viele Umwälzungen begannen mit arglosen Fragen. Wenn die Erde flach ist, warum sind die Schatten im Zenit je nach Ortslage verschieden lang? Ist die Erde etwa rund? Lässt sich aus den Längenunterschieden des Schattens, die ein Stock auf den Boden an verschiedenen Orten wirft, gar der Erdumfang berechnen?
Wenn das Schwere (eine Kanonenkugel) schneller als das Leichte (eine Feder) fällt, warum prallen dann zwei ungleich schwere Kanonenkugeln zeitgleich auf den Boden? Ist die Fallgeschwindigkeit etwa nicht von der Masse abhängig, sondern konstant?
Wenn man sterben muss, was haben Mühen für einen Sinn?
Die gewöhnlichen Dinge sind voller Rätsel. Die Geheimnisse schlummern unter der vertrauten Oberfläche, bis man auf den Widerspruch stößt. Die Dämonen der Zweifel werden wach. Die Gewissheit bröckelt. Die eingebildete Sicherheit ist dahin. Die Wirklichkeit selbst scheint sich mitunter aufzulösen. Beängstigt zieht der Mensch die Grenzen und Mauern der Bodenlosigkeit, Ausflüchte und Dogmen den Zweifeln vor.
Schade, denn Widersprüche sind weder Fluch noch Bürde, sondern wertvolle Funde. Zweifel sind Hebel der Wahrheit.
Die Menschheit hat sich damit abgefunden, dass die Erde rund und das Universum unendlich ist. Die verwegensten Hypothesen der Physik bringen Niemanden mehr aus dem Gleichgewicht. Anders, wenn es um das Leben geht. Ein Dickicht an Tabus und Selbstzensur umgibt dieses Thema. Wir wandern mit geschlossenen Augen an Abgründen des Sinnlosen vorbei, leben in und von selbstgefälligen Mythen und trauen der Wissenschaft nur, sofern diese die Illusion des ausgefüllten Alltags aufrecht hält.
Das Leben zu verstehen und das Verstandene im Leben umzusetzen, vor nichts zurückzuschrecken und keiner unangenehmen Frage aus dem Wege zu gehen ist das Anliegen dieses Manuskripts und der Leitfaden, der die einzelnen Abschnitte verbindet. Es sollte eine Brücke zwischen den Molekülen der Zelle und der Hochburg der menschlichen Seele schlagen, zeigen, dass hinter der Physik, Vernunft, Religion, Soziologie und Politik keine kalten Formeln, sondern durchgehend die Gesetze des Lebendigen stehen. Das Manuskript ist dementsprechend aufgebaut. Vieles von dem, was klar schien, wurde kurz angeschnitten oder nicht erwähnt. Ansichten, die dem Leben widersprechen, wurden hervorgehoben und bereinigt in Hoffnung, dass der Leser den Rest der Aufgabe selbst erledigt. Aus den Umständen der Entstehung resultiert ein stellenweiser polemischer und sprunghafter Stil. Die Widerspenstigkeit ist nicht gewollt. Es handelt sich eben um Anfänge.
EVOLUTION
Uhr oder Stein?
Betrachtet man den Querschnitt eines Steines und den einer Uhr, so fällt zunächst ein ähnlich komplizierter Aufbau auf. Dennoch ist eine Verwechslung ausgeschlossen. Der Stein verkörpert die Chronik der Umstände. Wer die fossile Sprache versteht, erkennt in gewundenen Linien der Sedimente die Entstehungsbedingungen, Gezeiten, wechselhafte Ereignisse der Vorzeit. Die Uhr ist ein Werk des Strebens. Ihr Schöpfer ist der Zweck. Die Zusammensetzung der Uhr ergibt sich nicht aus den naturgegebenen Umständen. Wenn man eine Stufenleiter von Umständen bis zum Zweck bildet, wo liegt das Leben auf einer Skala zwischen dem Stein und der Uhr?
Die erste Hilfestellung liefert uns der Sprachgebrauch. Der Begriff „organisch“ hebt das Besondere des Lebenden hervor und grenzt es von dem Unbelebten, dem „Anorganischen“ ab. Worin besteht aber der Gegensatz? Was macht das Lebende organisch?
Organ ist ein griechisches Wort für Instrument. Die Einbindung des Werkzeugs in die Sinngebung ist maßgeblich. Ohne diese im Hintergrund verliert das Wort seinen anschaulichen Inhalt. Polyethylen, Latex, Nylon und andere Erzeugnisse der „organischen“ Chemie sind unbelebt, organisch sind wiederum, die aus „anorganischem“ Calciumphosphat aufgebauten Schalen der Meerestiere. Der Stoff, aus dem das Leben ist, ist für die Definition nebensächlich. Entscheidend ist der Zweck. Das Organische muss dem Leben dienen, die Zusammensetzung und die Beschaffenheit ergeben sich daraus. Stehen wir demzufolge einer Uhr näher als einem Stein, dem Zweck näher als dem Zufall?
Die Entstehung des Steins ist inzwischen entschlüsselt. Wann aber kommt der Zweck in die Natur? Woraus besteht und woraus ergibt sich dieser? Wie kommt das Leben zu seinen Organen, warum werden diese Instrumente immer vollkommener? Kurz: Welche Kraft ist der Uhrmacher des Organischen?
Erklärungen der Evolution
Durch die Entdeckungen der Paläontologie, der Wissenschaft über das Erdalter, wissen wir, dass die Entwicklung des Lebens vom Einfachen zum Komplexen geschah. Wir wissen, dass aus einem Einzeller ein mehrzelliger Organismus entstand, dass dieser nach mehreren Entwicklungsschritten Mensch wurde. Mit den Erklärungen dieser Vorgänge beschäftigen sich die Theorien der Evolution.
Die Zweckmäßigkeit
Lamarck (1744-1829) leitete die Evolution aus dem Streben zum Besseren ab. Seiner Ansicht nach wuchs der Hals einer Giraffe, weil das Urtier nach immer höheren Zweigen langte. Mit der Vererbung erworbener Eigenschaften nahm die Halslänge von Generation zu Generation zu.
Die Erklärung Lamarcks hatte eine Schwachstelle aus Sicht seiner Zeitgenossen. Man stellte sich Vererbung erworbener Eigenschaften direkt von Eltern auf Nachkommen vor. Der Biologe Weismann amputierte Mäuseschwänze in mehreren aufeinander folgenden Generationen. Die Schwanzlänge neugeborener Mäuse blieb unverändert. Andere Forscher verwendeten aufwendigere Versuchsanordnungen. Sie erhielten bei mehrzelligen Organismen stets das gleiche Ergebnis. Die den Eltern beigebrachten Veränderungen waren bei den Kindern nicht zu entdecken. Das Gegenteil belegende Experimente wurden bis in das 20. Jahrhundert wiederholt, vergeblich, selbst bei positivem Ausgang erwiesen sie sich später als Selbsttäuschung oder Falsifikationen. Mehr noch, zu Beginn des 19. Jahrhunderts wurden Gene als informative Bausteine des Lebens erkannt und dem Zellkern zugeordnet. Mikroskopische Untersuchungen zeigten, dass ein mehrzelliger Organismus aus Tausenden von Zellen besteht. Kerne dieser Zellen enthalten eigene Gene. Körperzellen entstehen nicht neu, sondern knospen sich von den Vorgängerzellen nach einer Phase des Wachsens und Aufteilens ab. Gene werden dabei kopiert und von der Mutterzelle auf die Tochterzellen übertragen. Einige der Zellen werden nach fortgesetzten Teilungen zu spezialisierten körperlichen, die anderen zu Keimzellen. Den Vorgang nennt man Differenzierung. Neugeburt beginnt mit der Vereinigung von Keimzellen, gefolgt von deren Teilung, Vermehrung, Differenzierung, Entwicklung und Reifung. Ein Austausch der genetischen Substanz zwischen einzelnen spezialisierten Körperzellen und den Keimzellen ließ sich experimentell nicht belegen. Dieser Umstand schien gegen Lamark zu sprechen. Darwin zog Schlussfolgerungen daraus: Wenn die Veränderung einzelner Körperzellen keinen Einfluss weder auf die Nachbarzellen noch auf die Gene der Keimzellen hat, so dürfte auch das Streben des Tieres, keinen Einfluss auf Evolution und Artenbildung haben.
Zufall und Überlebenskampf
Der Darwinismus erhebt den Zufall in den Rang des Schöpfers der Evolution. Danach erfolgt die Evolution unabhängig von dem Verhalten, den Einstellungen und Bestrebungen der Lebewesen. Jede Köper- oder Verhaltensänderung bedarf einer Änderung der Gene. Gene bestimmen was der Organismus tut und wozu er wird. Die Veränderungen der Gene sind rein zufällig und vom Organismus nicht beeinflussbar. Unabsichtliche Abweichungen werden Mutationen genannt. Der Zufall ihres Auftretens lenkt die Evolution.
In seinen Werken beschreibt Darwin minuziös unzählige Variationen der Merkmale innerhalb einzelner Arten, die er auf Mutationen zurückführt. Die Gründlichkeit erdrückt, erklärt aber nicht wie die Mutation zu einem Zweck führt. Um den Widerspruch zu vertuschen führt Darwin den Überlebenskampf als Erklärung ein.
Jede Art hat danach eingeschränkte Ressourcen zum Leben. Eine Vermehrung der Population über das erträgliche Maß hinaus mündet im Überlebenskampf. Die Evolution findet statt, weil die „Schwächeren“ aussterben, die Besseren aber (gemeint sind die Übriggebliebenen) überleben. Mit anderen Worten – der Hals der Giraffe wurde länger, nicht weil ihre Vorfahren nach den saftigen Blättern langten, sondern: Weil ihr Hals länger wurde, konnte sie die höheren Zweige erreichen und überleben. Die Giraffe hatte einfach keine Wahl. Zwar bleibt bei dieser Annahme der Überlebenskampf selbst unerklärt, denn seine Unvermeidbarkeit, Richtung, Antriebskraft, etc. ergeben sich nicht aus dem Zufall und sind alles andere als vorbestimmt und selbstverständlich. Wer fragt jedoch nach der Begründung, wenn jeder am eigenen Leibe den Überlebenskampf spürt und zu verstehen glaubt.
Eine gleichermaßen einprägsame wie einfache Behauptung, die dem Sieger bessere Eigenschaften unterstellt und hiermit jedes Mittel rechtfertigt wurde salonfähig und fand Einzug in Politik, Wissenschaft und Kultur. Der Darwinismus wurde zum Treibstoff der Machtgier und fegte die überholten religiösen Dogmen und Entstehungsmythen fort. Darüber hinaus ist wenig Erfreuliches zuzufügen. Die unverhohlene Gewalt, Zügellosigkeit und das Geld wurden zu neuen Idolen. Die Götzendämmerung kam über die Menschheit.
Widersprüche
Der Darwinismus leitet die Evolution vom Zufall ab. Die Rechenschaft des Machbaren bleibt er schuldig. Schon eine einfache Schätzung führt die schöpferischen Möglichkeiten des Zufalls ad absurdum. Zwei, drei Würfe genügen, damit eine Münze auf die gewünschte Seite fällt. Bei einem Würfel sind mehrere Würfe erforderlich. Die Zahl missglückter Versuche explodiert, sollen vier, fünf oder sechs Würfel auf eine bestimmte Seite fallen. Folgt die Evolution des Lebens dem gleichen Prinzip, so müsste mit der wachsenden Komplexität ihrer Schöpfungen entweder die Zahl der Versuche und Aussonderungen hochschnellen oder, falls die Zahl der Würfe begrenzt ist, sich die Evolution verlangsamen. Beide Voraussagen treffen nicht zu. Die Evolution wird mit wachsender Komplexität von Organismen schneller, während die Zahl an Würfen bzw. Nachkommen abnimmt.
Knapp fünf Milliarden Jahre sind seit der Entstehung des Lebens vergangen. Am längsten verweilte das Leben auf der Stufe der einzelligen Organismen. Dann, in dem relativ kurzen Zeitraum der letzten 700 Millionen Jahre, überschlagen sich die Ereignisse. Dabei beträgt jeder nachfolgende Abschnitt vom Wirbellosen zum Wirbeltier, vom Fisch zum Amphibium und dem Säugetier, vom Säugetier zum Menschenaffen, vom Menschenaffen zur Zivilisation, vom Vorindustrie- zum Industriezeitalter nur einen Bruchteil der vorausgegangenen Etappe.
Der Darwinismus sieht Not und Aussonderung als Gestalter der Zweckmäßigkeit. Demnach müssten Organismen mit hohen Geburtenraten und Verlusten die größte Evolutionsgeschwindigkeit aufweisen. In Wirklichkeit ist es umgekehrt. Es gibt bei weitem mehr Mücken als Menschen. Trotz eines hohen Umsatzes an Einzelleben bleiben Insekten, kleine Fische oder Amphibien seit Millionen von Jahren auf den gleichen Stufen der Evolutionsleiter oder rutschten sogar ab. Der Hauptstrom der Evolution ist entgegengerichtet. Die Nachkommenzahl wird während der Erfolgsgeschichte reduziert. Ein höherer Intellekt, Größe, Widerstandskraft und Beharrlichkeit werden gefördert.
Kleine Fische werfen massenhaft Eier. Der Hai bringt stets einzelne Haie zur Welt. Ein Baby ist bei einer Elefantenkuh die Regel, bei einer Ratte nicht. Die Evolution hätschelt Arten, die behaglich im Überfluss schwelgen und meidet überfüllte Notunterkünfte. Nur Arten, die Gefahren schutzlos gegenüberstehen, die fressen und sich vermehren als einzige Strategie der Behauptung kennen, haben es mit der Fortpflanzung eilig. Im Gegensatz zu Darwins Behauptungen sind hohe Umsatzraten kein Schmelztiegel der Sieger, sondern ein blutiger Zoll der Verlierer. Die Steuer an die Umstände wächst mit der Ohnmacht gegenüber ihrer Willkür.
Nach Darwin müsste Übervölkerung die Evolution antreiben. Die Zeugnisse der Erdgeschichte sprechen vom Gegenteil. Als die Dinosaurier abdankten, rückten die Säugetiere in die leerstehenden Räume nach. Innerhalb der ersten zehn Millionen Jahre ihrer Ausbreitung entstanden aus rattenähnlichen Vorläufern solch unterschiedliche Geschöpfe wie Fledermäuse und Wale. Danach wurde nur noch an den schon bestehenden Modellen gefeilt.
Einige abgeschiedene Meeresinseln sind arm an Arten. Die Uhr der Evolution läuft dort langsam und bleibt oft stehen. Wenn der Zufall dann einer neuzeitlichen Art den Zugang zu einer unbewohnten Insel gewährt, überstürzen sich die Ereignisse. Die Eindringlinge finden weder Parasiten noch ihre natürlichen Konkurrenten vor, dafür aber reichlich Platz. Sie besetzen ohne Widerstand verschiedene Nischen und nehmen Gestalten an, die ihre weiterhin auf dem Kontinent in Bedrängnis lebenden Verwandten nicht in Ansätzen besitzen. Der Lauf der Evolution beginnt zu rasen. Aus einer einzigen Art entstehen innerhalb kürzester Zeit mannigfaltige Formen bis die letzte freistehende Nische ausgefüllt ist. Nach diesem flüchtigen Aufblühen stockt die Evolution und fällt zurück in den Schlaf.
Im krassen Widerspruch zu den Anmaßungen des Überlebenskampfs saust die Evolution, wenn es darum geht, freie Räume zu besiedeln und schleppt sich, sobald die Aufteilung vollbracht ist und alles erkämpft werden muss.
Der Darwinismus wird dem Anspruch einer Erklärung nicht gerecht, deutet alles erst im Nachhinein und nichts im Voraus. Wieso begeben sich einige Arten auf den langen Weg der Evolution und entfernen sich von ihren ursprünglichen Lebensbedingungen weit über die Erfordernisse der Anpassung hinaus? Warum räumen sie ihre alten Lebensnischen, obwohl diese weiterhin bestehen? Warum verharren andere Arten in ihrer Entwicklung Hunderte von Millionen Jahre und schauen teilnahmslos erdgeschichtlichen Umwälzungen zu? Warum nehmen sie schrumpfende Lebensräume in Kauf und zeigen keine Ambitionen diese zu wechseln? Streiften diese Arten keine Katastrophen? Standen sie unter einem geringeren Zwang? Waren ihre Baupläne solider? Sind Mutationen bei diesen Arten seltener? Sind die „lebenden Fossilien“ womöglich den Arten, welche die Evolution vorantreibt, überlegen, eben weil ihre Anlagen gediegener sind? Andererseits, wie lenken die Umstände die Evolution? Welche Mutationen oder Klimaänderungen können ein Huf- oder Raubtier dazu bewegen, seine Landlebensweise zugunsten des Lebens im Wasser aufzugeben, wann und wie erfolgte dieser Übergang vom Land ins Meer, der zur Entwicklung der Wale führte? Welche körperliche Missbildung kann eine solche Änderung der Lebensweise bewirken?
Das Austrocknen seichter Gewässer konnte Fische zum Leben auf dem Festland treiben. Die Not führt jedoch nicht notwendigerweise zu einem Frosch. Warum wird zwischen unzähligen Varianten ein einziger Bauplan vorgezogen? Die Insekten haben zum Beispiel alle möglichen Varianten der Fortbewegung und Metamorphose beim Übergang vom Wasser ans Land ausprobiert. Der Weg von den Fischen zu den Amphibien und Reptilien war dagegen geradlinig. Merkwürdig ist weiterhin der Umstand, dass der Übergang von Pflanzen, Insekten und Fischen vom Wasser zum Land in der gesamten Lebensgeschichte nur jeweils einmal stattfindet, wogegen das Austrocknen sich regelmäßig Tag für Tag wiederholt. Waren es wirklich Dürre, Not und Massensterben welche die Fische ans Land trieben, oder lockte sie die fette Beute eines von Insekten wimmelnden Kontinents, Entfaltungsmöglichkeiten, die ihnen das Wasser vorenthielt? Und gäbe es kein Austrocknen, hätten die Tiere dann nicht den Weg ans Land gefunden?
Überschwemmungen und Dürrezeiten treten gleichermaßen oft auf. Die Bewegungen von Lebewesen in der Evolution vom Wasser zum Land und umgekehrt richten sich nicht danach. Viele Landtiere kehren während der Evolution in mehreren Wellen ins Wasser zurück: Den Reptilien folgen die Dinosaurier, Vögel und zuletzt die Säugetiere. Jedoch bestimmen weder Dürre noch Sintflut diese Wellen der Wiederkehr, sondern die Wendungen der Evolutionsspirale, nach denen fortschrittlichere Baupläne hervortreten. Die Günstlinge der Stunde erobern spielend die einst von Ihnen verlassenen Lebensräume. Sie tun es frei von Druck aus Überschuss an Kraft. Als die Neuerungen sich vorwiegend im Wasser abspielten, gingen die Kolonisierungswellen vom Wasser auf das Land. Seitdem der Fortschritt vorwiegend das Landleben betrifft, wird umgekehrt das Wasser vom Festland aus erobert.
Der Darwinismus verneint die gestaltende Rolle des Strebens. Die Evolution ist jedoch unverständlich, lässt man Motive und Entscheidungen ihrer Akteure außer Acht.
Schlangen sind, schon ihrem Namen und der Gestalt nach, ein Ausdruck des Verhaltens, genauer gesagt einer bestimmten Fortbewegungsweise. Dabei stammen sie von vierbeinigen Reptilien ab. Die einzelnen Etappen ihrer Umwandlung lassen sich an Schleichen verfolgen, von Eidechsen über die Wühlechsen (Scincidae) mit vier sehr kleinen Extremitäten, die nur beschränkt benutzt werden, über den Scheltopusik (Ophisarius apodus), der nur noch die hinteren, zu Stummeln reduzierten Gliedmaßen hat, bis zu den Blindschleichen. Die Extremitäten des Walzenskinks im Mittelmeergebiet (Chalcides) sind kurz und unbeholfen. Beim langsamen Gehen bedienen sich diese Echsen ihrer Beine, bei schneller Bewegung legen sie diese an den Körper an und gehen zu einem schlängelnden Kriechen über. Spricht man dem Verhalten eine organgestaltende Rolle ab, muss man annehmen, dass Muskelschwäche in den Beinen Reptilien über die Schleichen in Schlangen verwandelte. Denn die allgemeine Verlängerung des Körpers und der Organe, Nerven und Eingeweide, die Umgestaltung der Hautbeschaffenheit und der Muskelanordnung erleichtern zwar das Kriechen in einer anderen Umwelt, auf dem Erdboden, in Bäumen oder im Wasser, erzwingen jedoch nicht das neue Verhalten und bieten Überlebensvorteile erst nachdem das Tier zum Kriechen übergegangen ist.
Der Darwinismus leitet das Vergangene aus dem Gegebenen ab und erklärt das Bestehende für das Bessere. Was aber, wenn das Gegebene eine Fehlentwicklung ist? Wie lässt sich das Zukunftsträchtige von dem Abschüssigen unterscheiden?
Eine Halsverlängerung bringt einer Giraffe erhebliche Unannehmlichkeiten wie Disproportionen des Wuchses, die Unfähigkeit, sich beim Hinlegen auszustrecken, sowie andere mit sich. Warum werden die fraglichen Neuerungen bevorzugt, die offensichtlichen Nachteile aber übersehen? – Weil sie nach Darwin Überlebensvorteile bieten müssten. Nun wird das Überleben durch Körperzunahme wie Abnahme, durch Ab- oder Aufrüstung, durch Kraft oder Geschwindigkeit, durch aufdringliches Werben oder lautloses Herumschleichen, durch starre Panzerung oder Geschmeidigkeit erreicht. Worin besteht nun der Fortschritt? Das Ausgestorbene muss unvollkommen gewesen sein. Was aber ist besser, was ist schlechter an den noch Lebenden? Kann man mit Bestimmtheit sagen, was gut oder schlecht ist? Muss man erst den Tod eines Tieres, womöglich das Aussterben eines Zweiges abwarten, um eine Lebensform auf- oder abzuwerten? Ist ein Pockenvirus der von ihm ausgerotteten Tierart überlegen?
Das Überleben ist kein Gradmesser des Fortschritts. Anderenfalls dürfte die Evolution sich zwar zu einer zunehmenden Vielfalt der Arten hinbewegen, doch nicht nach oben wie die gesamte Evolution es vorweist und nicht nach unten, wie man an Beispielen von Rudimenten sieht, sondern auseinander und im Gleichschritt. Im Grunde dürfte es Höheres und Niederes nicht geben. Alle zur gleichen Zeit existierenden Organismen sind unter den bestehenden Bedingungen gleichermaßen überlebens- und vermehrungsfähig, also gleichermaßen gut angepasst, und wären daher gleichwertig.
Die letzte Behauptung, obwohl widersinnig, wird vom Darwinismus ernsthaft vertreten, um nicht mit den Postulaten der Überlebenskraft in Widerspruch zu treten.
Nun, die Evolution hat eine Richtung und der Mensch ist einem Bakterium überlegen. Zwar ist Anpassung ein Nachlaufen der Notwendigkeit und eine Voraussetzung des Artbestandes, dennoch irrt der Darwinismus, wenn er das Leben auf die Anpassungsfähigkeit reduziert. Das Leben ist eine Wendigkeit im Umgang mit der Not, ein Erheben über nötigende Umstände, ein Vorstoß, ein Drang, ein Sieg. Nicht bloß eine „optimale“ Anpassung, sondern der Vorsprung, die errungene Freiheit und der Wirkungskreis bestimmen das Fortschrittliche einer Lebensform.
Der Darwinismus meidet unliebsame Tatsachen, statt dort anzusetzen, wo der Widerspruch offensichtlich ist. Die ersten Spuren lebender Organismen sind mindestens 3,5 Milliarden Jahre alt. Die ersten Lebewesen sind einzellig und vermehren sich durch Teilung. Die erworbenen Eigenschaften der Mutterzelle gehen auf die Tochterzellen über. Die überlegenen Organismen vermehren sich schneller, wodurch vorteilhafte Gene eine größere Ausbreitung finden. Der Zweck und die Absicht münden dabei direkt in einer besseren organischen und genetischen Form. Die direkte Vererbung erworbener Eigenschaften wurde erst mit dem Mehrzeller vor ca. 800 Millionen Jahren aufgegeben, nachdem ¾ der Evolutionsdauer abgeschlossen waren. Wieso? Weder der späte Zeitpunkt des Auftretens noch der Sinn der Änderung, noch die Mechanismen dahinter sind verständlich. Was bewegt eine Ameise dazu, auf ihre Fortpflanzung zu verzichten (der Kampf ums Überleben wohl kaum) und was hat ihr Leben für einen Sinn, wenn sie keine Nachkommen hinterlässt? Welcher Überlebenskampf gebietet Zellen mit gleichen Genen in einem Zellverband auf die eigene Vermehrung zu verzichten? Nach welchen Kriterien wird die Wahl zwischen den zum Sterben verurteilten Körperzellen und den sich weiter teilenden Keimzellen getroffen? Wie fällt die Entscheidung und warum unterwerfen sich Zellen dieser? Was bringt sie dazu? Die altruistische Einsicht? Der Kampf, der alle anders handelnden Zellen ausmerzt? Wann kommt es zu dieser Ausmerzung?
Innerhalb des Mehrzellers erfüllen alle Zellen geordnet ihre Aufgaben. Vom Überlebenskampf fehlt bei der Individualentwicklung jede Spur. Vielleicht wurden die Überlebenswettkämpfe früher ausgefochten und die Auslese vorteilhafter Mutationen unabänderlich im Genom verankert? Wo genau und wann?
Wäre die Evolution auf Mutationen wie auf Bausteinchen Ebene für Ebene aufgebaut, so müsste man den Beitrag der Mutationen zur Stammesgeschichte schrittweise nachvollziehen können. Die Lebewesen gliedern sich tatsächlich in Ordnungen, Klassen und Familien. Der Einteilung liegt jedoch weder eine Mutation noch eine hervorstechende Eigenschaft, sondern ein für das Überleben unter konkreten Umständen scheinbar neutraler Bauplan zugrunde.