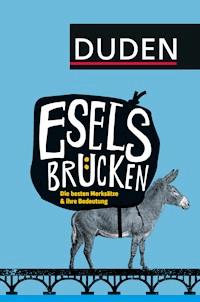Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Matthes & Seitz Berlin Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Fröhliche Wissenschaft
- Sprache: Deutsch
Je geschlossener die technische Zivilisation, desto größer das ›Begehren nach Natur‹. Es kann heute viele Gestalten annehmen, und somit auch das Schreiben darüber. Die dabei eingesetzten literarischen Formen fächern sich zwischen Traktat und Poesie mannigfach auf, die Inhalte partizipieren an akademischen Diskursen zwischen Wissenschaft und Philosophie ebenso wie an landläufigen Überzeugungen zwischen politischer Ökologie und Unbehagen im technischen Zeitalter. Hier Überblick zu gewinnen, ist schwierig. Doch bei genauerer Betrachtung zeigen sich Spuren und Umrisse : von Motivlagen und Brennpunkten, Begrenzungen und Aporien. Der Literaturwissenschaftler Wolfgang Riedel versucht, einige dominante Tendenzen, Ambitionen und Schwierigkeiten heutigen Schreibens und Nachdenkens über Natur zu einem vorläufigen Bild zu ordnen, vor allem aber auch einige Rahmenbedingungen in Erinnerung zu rufen, die unser prekäres Verhältnis zum großen Attraktor ›Natur‹ immer schon bestimmen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 125
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
DE NATURA IIHerausgegeben von Frank Fehrenbach
Wolfgang Riedel
Unort der Sehnsucht
Vom Schreiben über Natur
Ein Bericht
Inhalt
1.Pathische Existenz
2.Nature Writing, Ecocriticism und das Heterogene
3.Wider den Dualismus
4.Natur- und Tierfrieden – Ende der Gewalt?
5.Exzentrische Position und ästhetischer Animismus
Anmerkungen
1. Pathische Existenz
Nie lebten Menschen so sehr in einer künstlichen Eigenwelt wie heute. Selbst Naturgeschöpfe (Produkte der Evolution), betreiben sie eine konsequente Denaturierung nicht nur der eigenen Lebensräume, sondern des planetarischen Biotops im Ganzen. Urbanisierung, Technifizierung, Digitalisierung und Automatisierung erzeugen eine anthropogene, artifizielle Umwelt, hinter der die ältere ›natürliche‹ uns so fern rückt wie das Tier hinter dem Tiefkühlsteak. Gleichzeitig bleiben die Menschen jedoch als heterotrophe Lebewesen unverändert abhängig von der metabolischen Zirkulation der Biomasse, in der das Leben auf diesem Planeten sich durch konstanten Selbstverzehr erhält (künstliche Lebensmittelsynthese aus anorganischer Materie könnte das ändern, aber so weit sind wir nicht). Schon diese Tatsache relativiert die Rede von der Naturferne des technischen Zeitalters und seiner Bewohner erheblich. Die Angewiesenheit des Menschen auf das, was er nicht erschuf, entscheidet immer noch über sein Dasein. Sein Organismus ist wie jeder andere ein ›offenes System‹, und der zweite Hauptsatz der Thermodynamik unterwirft ihn dem Zwang zur permanenten Zuführung »negativer Entropie«1. Entgegen dem Selbstbild seines Geistes kann sein physisches Dasein also niemals und nirgends die Form der Souveränität annehmen, sondern ist grundsätzlich »pathisch«2 geprägt; von der Zeugung bis zum Tod muss es sich in durchgängiger Abhängigkeit von jenem »unmöglichen Realen«3behaupten, das allen Einsprüchen zum Trotz bis heute mit Grund ›Natur‹ heißt.4
Dennoch fällt es dem modernen Menschen schwer, seine wesentlich pathische Verfasstheit auch anzuerkennen. Dem Urmythos des »Macht euch die Erde untertan« folgend, definiert er sein Naturverhältnis im Gegenteil als eines der »Herrschaft«.5 Selbst die Sphäre seiner größten Abhängigkeit verkehrt ihm der Furor seines subicite terram! ins Gegenteil, erst recht in der Moderne. Die organische Produktivität der Pflanzen- und Tierwelt, die ihn am Leben erhält, ist ins Joch einer durchindustrialisierten Lebensmittelwirtschaft geschlossen; ihre Eingriffe in Land und Meer durchwirken und überformen die Erdoberfläche längst in derselben Massivität wie das Wachstum von Städten und Infrastrukturen, von Energie- und Rohstoffindustrien, von Güterproduktion und -zirkulation. Heideggers »Gestell«6 wächst unaufhaltsam, – und mit ihm der Anschein der Emanzipation des Menschen von der Natur. Aber eben nur der Anschein! Denn bis in ihre heutige Unerbittlichkeit hinein erweist die Ausbeutung von Flora und Fauna immer auch jenes unbedingte Angewiesensein; sie exprimiert also nicht nur das Offensichtliche, die technischen Reichweiten des Menschen, sondern ebenso das davon Verdeckte, das pathische Apriori, in dem er als biologische Lebensform unweigerlich hängt.
Auch nach innen zielt dieser Herrschaftswille. Die Heilerfolge der modernen Medizin, von Mikrochirurgie und Endoprothetik bis zur Transplantationstechnik, und fast mehr noch die Zukunftsprojektionen von Molekularbiologie und Gentechnologie nähren, trotz wiederkehrender Dämpfer der geweckten Erwartungen, die wachsende Hoffnung auf durchgreifende Supression von Krankheits- und Alterungsprozessen sowie auf erhebliche Lebensverlängerung. Der Kindertraum der Unsterblichkeit scheint buchstäblich in den Horizont des biotechnisch Erreichbaren gerückt, jedenfalls für die Euphoriker unter den Experten.7
Flankierend dazu wird die Optimierung des menschlichen Organismus durch technologische Applikationen betrieben. Geht es nach den Vorstellungen der Entwickler, werden diese mehr und mehr von außen nach innen dringen, sprich: das ›robotische Habitat‹, in dem wir heute schon zunehmend leben, den Individuen selbst introjizieren und es zum integralen Teil ihrer physiologischen und psychologischen ›Innenwelt‹ machen. Von Smartphone und biometrischem Armband über motorisierte Exoskelette und Chip-Implantate hin zu Digitaltuning des Kortex und Cloudsteuerung des zentralen Nervensystems geht hier der Pfad der Wünsche – der Cyborg ist zum role model des künftigen Homo sapiens avanciert.8
Auch dies scheint getrieben vom Unvermögen, Abhängigkeit von determinierenden Randbedingungen auszuhalten. Gemeint sind jene ›natürlichen‹ Bedingungen des Menschendaseins, die das klassische anthropologische Denken stets zur conditio humana/condition humaine gerechnet und darin als essentiell anerkannt hatte: Zufälligkeit und nur begrenzt beeinflussbare Wirkmächtigkeit von Begabung, physischer Konstitution und Geschlecht, Gebundenheit an den Lebenszyklus (Fesselung ans jeweilige Alter und seine Zeitfenster), Endlichkeit sowohl der Lebensdauer wie auch der vitalen und intellektuellen Kräfte (imbecillitas animi), Anfälligkeit für Krankheit, Verwundbarkeit und Schwäche, wiederkehrende Versklavung des Ich durch Affekte und Illusionen. Die Autonomie, die dagegen zu behaupten war, konnte daher immer nur eine ethische, eine der Haltung sein. Getragen war dieses Ethos vom Realitätsprinzip, vom Wissen, dass jene Grenzen uns nur sehr enge Spielräume lassen, und darum war es eine Haltung – bereit und fähig, das Leben unter Anerkennung seiner Unvollkommenheit, im Zustand des Mangels, und das hieß eben auch im Bewusstsein des Pathischen zu führen. All dies scheint heute anders. Das Optimierungsverlangen wird durch ganz andere Ideale getrieben, die freilich nach klassischer Auffassung gar keine sind, sondern reine Wunschbilder, die psychogenetisch archaischen idola9 der Souveränität, Macht und Perfektion.
Die Verzauberung der technischen Intelligenz durch diese Idole hat eine doppelte Wurzel, eine theologie- und eine technikgeschichtliche. Die Idee des Vollkommenen wurde ja im Nachdenken über das Göttliche entwickelt; doch kaum gewonnen, ging der spekulative Begriff von Gott als ens perfectum (Aseität und Allmacht, Alldauer und Allgegenwart, Allwissen und Allgüte) den Weg der Exoprojektion, auf dem er entstanden war, in Windeseile umgekehrt zurück, um als Endoprojektion von seinem Urheber Besitz zu ergreifen.10 Unheimliche ›Wiederkehr des Entäußerten‹! Was sich der Mensch als ein rein Intelligibles und ›ganz Anderes‹ (totaliter aliter) zum unerreichbaren Maß aller Dinge aus dem Wirklichen herausabstrahiert hatte, meint er nun als ›ganz Eigenes‹ faktisch erreichen und ›verwirklichen‹ zu sollen. Wie unter Zwang zieht er seiner fragilen Empirie die persona vors Gesicht, die er sich einst als trans-empirisches Ideal erfand. Mit dem fatalen Nebeneffekt, dass er, sobald diese Maske einmal aufgesetzt ist, nicht mehr sehen kann, dass sie ihm nicht passt.
Die zweite Wurzel hingegen entstammt der Realerfahrung, den Triumphen der menschlichen Poiesis im Reich des Anorganischen, und gelangt zu breitester Wirkung als Ästhetik technischer Oberflächen und Funktionalitäten. Im Rahmen ihrer Zwecksetzung konfrontieren uns Maschinen, und derzeit besonders die digitalen, ja mit einer geradezu überwältigenden Perfektionsanmutung, die unser eigenes, psychophysisches ›System‹ zu blamieren scheint.11 Auch in diesem Fall projiziert der Mensch ein als ein ›Anderes‹ aus sich Herausgesetztes, hier allerdings in die physische Wirklichkeit Hineingestelltes, auf sich zurück. Diese Rückwendung der technischen »Organprojektion«12 auf den Projizierenden hat für diesen wiederum zweifelhafte, jedenfalls stresserhöhende Effekte zur Folge, allen voran den, dass zum Maß menschlicher Schönheit ebenso wie menschlichen Leistens und Könnens nun die makellosen Oberflächen und unermüdlichen Betriebssysteme von technischen, also anorganischen Artefakten geworden sind.
In alledem spricht sich ein ebenso panischer wie realitätsferner Unwille aus, das Pathische des Daseins zu ertragen. Das Möchtegern der Souveränität bestimmt die Köpfe. Oder anderes gesagt, der Mensch von heute will kein »Mängelwesen«13mehr sein. Daher träumt er davon, ›die Natur‹ in sich zu überwinden, sprich: die evolutionsgeschichtlich eingespielten Limitationen biologischer Lebensformen zu ›transzendieren‹. Folgerichtig heißt die meistbeachtete Diesseitseschatologie der Gegenwart »Transhumanismus«.14 Selbsterlösung des Menschen mit Hilfe seiner maschinalen und digitalen Artefakte, so lautet das Heilsversprechen dieser neuesten Technoreligion. Der schwärmerische Habitus ist dabei noch ihr Sympathischeres; weniger harmlos ist ihre vigilanzfreie Bereitschaft zur soumission.15 Freilich, wo das Heil aus den Maschinen kommen soll, ist Bejahung ihrer Machtzuwächse Glaubenspflicht. Den möglichen – und möglicherweise unschönen – Rollenwechsel zwischen Herr und Knecht im künftigen Verhältnis von Mensch und Maschine kodiert der Transhumanismus daher nicht als Risiko.16
Futurismus als Flucht vor dem ›Realen‹! Die anthropologische Selbstverkennung des Menschen scheint heute keine geringere als zur Blütezeit der antiken Gnosis. Entsprechend fällt es selbst kritischen Perspektiven schwer, sich aus diesen Selbstbildern und damit vom mythischen Bann des dominium terrae zu befreien. Akutes Beispiel: das Konzept des »Anthropozäns«.17 Für Aufregung sorgt dieser Begriff seit seiner Lancierung schon deshalb, weil er geologische und historische Zeitrechnung, die sich eigentlich in völlig anderen Größenordnungen bewegen, erstmals synchron stellt und in ein und derselben Epochenkategorie zur Deckung bringt. Desungeachtet birgt er aber auch andere Probleme, so sehr die dahinterstehende Theorie von der Überdetermination der natürlichen Evolution durch den Menschen vielleicht oder wenigstens in Teilen zutreffen mag. Angesichts fortschreitender Digitalisierung und Automatisierung ist aber noch nicht einmal ausgemacht, ob das neu ausgerufene Erdzeitalter nicht schon in Kürze wieder umbenannt werden muss – etwa in ›Robozän‹. Vor allem aber zeigen die Therapievorschläge, die aus der Diagnose von der menschlichen Prädominanz im Faktorenspiel der Biotope und Atmosphären abgeleitet werden, allen voran die Forderungen nach universalen »Geoengineering«, nur noch einmal, wie wenig die rein technologische Phantasie imstande ist, sich vom Denkmuster der Herrschaft und Kontrolle (am besten durch eine zentrale Steuerungsinstanz) zu lösen.18 Dass ›Natur‹ und Evolution als azephale Systeme nicht nur nicht herrschaftsbedürftig, sondern womöglich gar nicht beherrschungsfähig sein könnten, fällt ihr schwer ins Kalkül zu ziehen. Man möchte es ihr dennoch raten. Denn was immer in der planetarischen Drift geschieht, mit menschlichem Überimpakt oder ohne, wir werden es erleiden, nicht steuern. Und es macht die Sache nicht besser, dass diese Sichtweise einem Denken, das sich der Flucht aus dem Pathischen verschrieben hat, nicht zusagen kann.
2. Nature Writing, Ecocriticism und das Heterogene
Die Luftschlösser des Zeitgeistes haben viele Wohnungen, darunter auch solche, in denen Motive, Diskurse und Szenarien wie die angesprochenen überhaupt nicht vorkommen. Das neuerdings auch hierzulande zu Breitenwirkung gelangte Phänomen des Nature Writing ist ein solcher Diskursraum, der gänzlich ohne Technoprojektionen und Digitalutopismus auskommt. In der seit 2013 erscheinenden Buchreihe Naturkunden ist von Vögeln und Fischen, Bergen und Wüsten die Rede, aber nicht von Algorithmen und Datenströmen, von autonomen Fahrzeugen oder vom Internet der Dinge.19 Den Durchbruch im Bestsellerbereich brachte 2015 Peter Wohllebens Geheimes Leben der Bäume, das die waldaffine deutsche Seele offenbar besonders ansprach.20 Damit war ein Trend im Sachbuchsektor da, und das aus dem Amerikanischen importierte Rubrum fand auch bei uns das passende Objektfeld (was ihm schnell zur Verwendung auch jenseits der Anglistik/Amerikanistik verhalf).21 Hier ist Natur nicht das zu Überwindende, sondern das Aufzusuchende, zu Bewahrende, ja zu Rettende. Und das Ich, das sich so zur Natur ins Verhältnis setzt, versteht sich damit von vornherein als ein – ob theologisch oder evolutionistisch aufgefasst – zu ihr Gehöriges und also sein Dasein je schon (auch ohne dass der Begriff selbst fiele) als pathisches. Man gerät hier in eine völlig andere Diskurswelt, doch gehört sie zur oben beschriebenen intrinsisch dazu. Das Tun des Einen ist auch hier das Tun des Anderen,22 sprich: ohne die moderne Naturbeherrschung gäbe es kein Nature Writing. Als Gegendiskurs zu allen technischen ist es zugleich deren mitgeborenes Geschwister, ihr feindliches Doppel.
Der Reihentitel Naturkunden ist für den englischen Ausdruck kein schlechtes Äquivalent im Deutschen. Denn das Spezifische des Sammelworts Nature Writing ist ja, dass es mehr und anderes umfasst als rein poetische Texte, wiewohl auch hier der Akzent auf eine gewisse, zum Beispiel autobiografische Subjektivität des Schreibens gelegt ist. Dennoch stellt es andere Zugehörigkeiten her als die in der deutschsprachigen Literaturwissenschaft gebräuchlichen Termini »Naturdichtung« und »Naturlyrik«.23 Und just diese Einbeziehung nichtpoetischer Textformen, die Anerkennung von Sach- und selbst Fachbuch als Schlüsselformen der ›Naturschriftstellerei‹ ist es, die den Begriff Nature Writing gegenwärtig an rein poetologischen vorbeiziehen und die Mitte des Diskurses besetzen lässt.
Dass Begriff und Sache aus Nordamerika kommen, hat zwei Gründe. Zum einen war ›Natur‹ auf diesem Kontinent, als dort ein solches Schreiben aufkam, im Unterschied zur gleichzeitigen Situation der Naturdichtung in Europa, überwiegend unerschlossene Natur, wilderness; und dies in schier unermesslicher Weite und Größe. Der Wildnisaspekt schob sich daher noch massiver ins Zentrum der Aufmerksamkeit als in der europäischen Ästhetik des »Erhabenen«.24 Zum anderen war das Buch, das bis heute der Prototyp des American Nature Writing geblieben ist, gerade kein poetisches, sondern ein essayistisches, ein Traktat aus naturphilosophischen und naturbeschreibenden, kulturkritischen und ethischpraktischen Betrachtungen über ein persönliches Experiment, die Konfrontation des Autors mit jener Wildnis: H. D. Thoreaus Walden; or, Life in the Woods aus dem Jahr 1854.25 Ebenso wichtig, auch im Hinblick auf die Wirkungsgeschichte des Buches: Thoreau war vom Stamme Emersons; seine Hintergrundsmetaphysik war der Transzendentalismus, und dieser ließ als Spielart des objektiven Idealismus keine rein ästhetische Kodierung des Interesses an Natur und Landschaft zu. Er begünstigte vielmehr Formen von Naturfrömmigkeit, wie sie zwar auch die europäische Romantik kannte, die aber im englischen Sprachraum dank der langen Wirksamkeit der Physikotheologie ein breiteres Echo fanden. Und wo Emersons Überzeugung von der Natur als Erscheinung und Organ (»apparition«, »great organ«) des höchsten Geistes (»universal spirit«, »Supreme Being«) gilt, ist auch die Wildnis göttlicher oikos und das angemessene Verhältnis des Menschen zu ihr das der Bewunderung und Verehrung.26 Hier liegt die Wurzel amerikanischer Naturemphasen bis heute. Sie erklärt zugleich, warum ein aus solcher Tradition kommendes Natu re Writing und ebenso eine diesbezügliche Literaturkritik nicht primär ästhetisch motiviert sind, sondern im weitesten Sinne ökologisch.
Unter der Fernwirkung des Transzendentalismus bringt so der in Nordamerika viel dramatischer als in Europa eskalierte Gegensatz von kleinräumiger, aber schnell expandierender Zivilisation (Kultur) und großräumiger, aber genauso schnell schwindender wilderness (Natur) einen ganz eigenen Blick auf die Natur hervor; und andere Maßnahmen. Wo Europas Städte im 19. Jahrhundert Ring- und Zentralparks bauen, gründet Amerika (das dies freilich auch tut) in seiner Wildnis Naturreservate; 1864 wird der Yosemite Grant, 1872 der Yellow Stone National Park eingerichtet. Diese folgen dem Arche-Konzept des Museums des 19. Jahrhunderts; sie konservieren die bedrohte Ursprungslandschaft und präsentieren sie dem Zivilisationspublikum als ›Naturerbe‹. Zugleich entkulturieren sie diese Stätten: als lieux de mémoire rechnen diese fortan zum Stolz der Nation. Kein Zufall also, dass einige der wichtigsten Autoren des American Nature Writing dem Nationalpark- und Naturschutzmilieu entstammen: John Muir (The Mountains of California, 1894), Aldo Leopold (Sand County Almanac, 1949), Edward Abbey (Desert Solitaire, 1968).27 Geradezu exemplarisch stehen sie für das spezifische Ineins aus wildnisfokussiertem Naturempfinden und ökologischem Engagement – bei steigender Militanz des Letzteren.28
Genau hier liegt allerdings auch das Problem, jedenfalls aus literaturwissenschaftlicher Perspektive. Die historische Bindung des Nature Writing-Begriffs an die Thoreau-Tradition ist im Blick auf poetische und speziell lyrische Werke seine Schwäche. Der durch ökologisch beseelte Prosatexte etablierte Erwartungshorizont ist für die Poesie viel zu eng und erstickt sie nur. Eklatant zutage tritt diese Beschränkung der ästhetischen Wahrnehmungs- und Urteilskraft im heutigen »Ecocriticism«, einem universitären Spätspross des American Nature Writing, vornehmlich an philosophischen Fakultäten. Aus moralisch-politischem Antrieb geboren, stellt er den jüngsten Versuch dar, die Literaturwissenschaften, aber auch die Literatur selbst, Mores zu lehren, diesmal ökologische. In der deutschen Academia ist er längst angekommen; gleich zwei Handbücher gibt es jetzt dazu, beide bestens recherchiert, aber auch beide ebenso geeignet, die Lust am Text zu verderben.29 Nachlesen zu können, wie jetzt sämtliche Traditionen der Naturpoesie ins ökologische Geschirr genommen werden (darauf hat Vergil gewartet, dass ihn einmal jemand auf sein »ökologisches Potenzial« hin prüft),30 ist eine recht sauertöpfische Form literaturwissenschaftlicher Belehrung. Noch größere Fluchtreflexe lösen die Theoriekapitel aus. Es liegt ja auf der Hand, dass eine derart von moralischen und politischen Intentionen getriebene Forschungsrichtung dazu tendieren muss, in agonale Unterfraktionen zu zerfallen, lehrbuchmäßig nach der Disjunktionslogik von »Freund und Feind«31; aber was zwingt eigentlich dazu, diese Spaltprodukte mit deutscher Gründlichkeit aufzusystematisieren?32
Ecocriticism