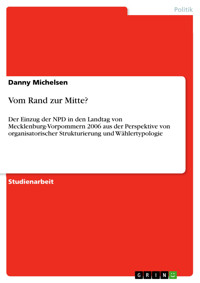17,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Die repräsentative Demokratie steckt in einer schweren Krise, angesichts von Ökonomisierung und privatistischen Tendenzen geht der Glaube an die politische Gestaltbarkeit der Gesellschaft verloren. Diverse Vorschläge stehen im Raum: deliberativ, transparent, »flüssig« und überhaupt weniger staatszentriert soll sie sein, die künftige Politik. Doch wie vielversprechend sind diese Therapien? Die Autoren wagen einen Rundumblick und zeigen, dass nicht nur Technokratie und neoliberaler Konsens, sondern auch viele der aufgebotenen Gegenrezepturen das Politische der Politik unterminieren.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 588
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Die repräsentative Demokratie steckt in einer schweren Krise, angesichts von Ökonomisierung und privatistischen Tendenzen geht der Glaube an die politische Gestaltbarkeit der Gesellschaft verloren. Diverse Vorschläge stehen im Raum: deliberativ, transparent, »flüssig« und überhaupt weniger staatszentriert soll sie sein, die künftige Politik. Doch wie vielversprechend sind diese Therapien? Die Autoren wagen einen Rundumblick und zeigen, dass nicht nur Technokratie und neoliberaler Konsens, sondern auch viele der aufgebotenen Gegenrezepturen das Politische der Politik unterminieren.
Danny Michelsen ist Mitarbeiter am Göttinger Institut für Demokratieforschung.
Franz Walter lehrt Politikwissenschaft an der Universität Göttingen und ist Direktor des Göttinger Instituts für Demokratieforschung.
Danny Michelsen/Franz Walter
Unpolitische Demokratie
Zur Krise der Repräsentation
Suhrkamp
eBook Suhrkamp Verlag Berlin 2013
edition suhrkamp 2668
Originalausgabe
© Suhrkamp Verlag Berlin 2013
Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das der Übersetzung, des öffentlichen Vortrags sowie der Übertragung durch Rundfunk und Fernsehen, auch einzelner Teile.
Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotografie, Mikrofilm oder andere Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Umschlag gestaltet nach einem Konzept von Willy Fleckhaus: Rolf Staudt
eISBN 978-3-518-73119-2
www.suhrkamp.de
Inhalt
1.
»Verschwinden« oder »Neuerfindung« der Politik?
2.
Erleben wir das Ende der liberalen Demokratie?
3.
Entparlamentarisierung und deliberative Surrogatdemokratie
4.
(Post-)Politik im Netz? Der (Alb-)Traum von der digitalen Demokratie
5.
Die Ratlosigkeit der Radikaldemokraten
6.
It’s representation, stupid!
7.
Die unpolitische Union
8.
Narrative Leere
Nachbemerkung
Literatur
1. »Verschwinden« oder »Neuerfindung« der Politik?
Wir leben wirklich in paradoxen Zeiten. Einerseits ist die neuzeitliche Geschichte im Wesentlichen eine der Re-Emanzipation der Politik von der Religion und sakral legitimierten Autoritäten, von der »Heiligkeit altüberkommener (›von jeher bestehender‹) Ordnungen und Herrengewalten«,1 in deren Verlauf öffentliche Handlungsräume sich nach und nach zu öffnen beginnen. Vorpolitische Begründungsressourcen gehen rasant zur Neige, es gibt schlichtweg keine öffentlichen Angelegenheiten mehr, die ohne breiten Diskurs allein auf der Grundlage transzendenter Prämissen entscheidbar wären. Der im Juli 2012 jäh verstorbene Politologe Michael Th. Greven hat den kontingenten Charakter dieser unserer »fundamentalpolitisierten« Gesellschaft ausführlich beschrieben. Demzufolge erleben wir augenblicklich den »Schlussstein« eines langen Politisierungsprozesses, der in der frühen europäischen Neuzeit zunächst von »oben« einsetzte, als allmählich sich herausbildende Zentralstaaten damit begannen, in die Wirtschaft einzugreifen, bis dann im 19. Jahrhundert expandierende Verwaltungsapparate die Nebenfolgen einer nunmehr kapitalistischen Produktionsweise durch wohlfahrtsstaatliche Inklusionsmaßnahmen zu entschärfen suchten und so immer tiefer in das gesellschaftliche Leben eindrangen.2 Damit waren zugleich die Samen gelegt für eine erst später einsetzende »Politisierung von unten«, in deren Verlauf Teile der unterprivilegierten Schichten begannen, sich als mündige Subjekte wahrzunehmen und soziale und politische Rechte einzufordern. In den Wohlstandsgesellschaften des ausgehenden 20. und des 21. Jahrhunderts schließlich richten zunehmend selbstbewusste Bürger gesteigerte Partizipationserwartungen an immer kritischer beäugte Regierungsinstitutionen. Der Niedergang traditioneller Hierarchien korrespondiert mit einem sukzessiven Zugewinn an individueller Entscheidungsfreiheit. Vielfältige Formen sozialen Protests, auch ziviler Ungehorsam, werden als Supplement zu tradierten Wegen der Einflussnahme qua Abstimmung von allen Seiten geschätzt. Essentialistisch definierte Gemeinwohlbegriffe und Argumente, die das Bestehende damit begründen wollen, dass es schon immer existierte, können nicht mehr überzeugen. Externe Kriterien stehen für die Bewertung von Geltungsgründen nicht zur Verfügung, die Gesellschaft muss sich aus sich selbst hervorbringen. Politik ist, kurz gesagt, die »einzige Quelle von Normierungen«, und alles ist politisch entscheidbar geworden.3
Zeitlebens hatte Greven diesen Punkt immer etwas überspannt, was vor allem seinem extensiven dezisionistischen Politikbegriff geschuldet war. Am Machtrealismus Max Webers geschult und in Abgrenzung zu einem strikt intersubjektiven handlungstheoretischen Ansatz, wie wir ihn zum Beispiel bei Hannah Arendt finden, sieht er das Politische im absolutistischen Fürstenstaat ebenso wie in der liberalen Demokratie verwirklicht und erst recht, in einem nie mehr erreichten Ausmaß, in der totalen Herrschaft (laut Arendt der Tod des Politischen) – überall dort, wo Kontingenz verfügbar ist, wo also etwas politisch wirksam, das heißt für größere Verbände autoritativ verbindlich, aber nicht notwendig entscheidbar ist. Nicht zu Unrecht wurde ihm deshalb vorgeworfen, einer »herrschaftskategorialen und gewaltnahen Konzeption des Politischen« das Wort zu reden, die, ganz weberianisch, die »zweckrationale Verwirklichung subjektiver Präferenzen« normativ nicht höher bewerte als ein antiinstrumentelles Verständnis politischen Handelns, als ein »acting in concert«, wie Arendt es mit Bezug auf Edmund Burke favorisierte, und somit nicht dem Anspruch eines explizit demokratischen Dezisionismus gerecht werde, da ein solcher, um auf eine moderne, pluralistische Gesellschaft anwendbar zu sein, obligatorisch mit einem egalitären Deliberationsideal verknüpft werden müsste.4 Wie immer man zu diesem Vorwurf stehen mag:5 Das im Kontingenzbegriff enthaltene Kriterium der Gestaltungsfreiheit, welches in beiden Deutungen des Politischen eine zentrale Rolle spielt, ist zweifellos eine konstitutive Bedingung, und ihr Verlust heute eine der größten Bedrohungen für demokratisches Regieren. Auf dieses Problem hat auch Greven stets hingewiesen, wenn er auf eine »immer tiefere Kluft zwischen der sich tendenziell radikalisierenden gesellschaftlichen Problemwahrnehmung und der Wahrnehmung der politischen Entscheidungsroutinen« aufmerksam machte, »die in der Paradoxie mündet, dass niemand mehr der Politik zutraut, was doch allein politisch gelöst werden könnte«.6
Damit kommen wir zur paradoxen Wendung der These von der politisierten Demokratie der Spätmoderne.7 Der einerseits durchaus plausible Befund einer von Politik durchdrungenen Gesellschaft wird nicht nur durch eine seit vielen Jahrzehnten mit großer Sorge beschriebene Ohnmacht der einst aus langen politischen Konflikten hervorgegangenen, politisch instituierten Verfassungsorgane kontrastiert. Da der (National-)Staat in der Berichterstattung noch immer als das eigentlich relevante politische Entscheidungszentrum und der Wettbewerb der um die Macht in dessen »Schaltzentralen« konkurrierenden Gruppen von den meisten Bürgern – ungeachtet der akademischen Trennungen zwischen Staat und Politik, Politik und dem Politischen – noch immer als der Kern dessen, was Politik ausmacht, betrachtet werden und weil auch die meisten »subpolitischen« Akteure außerhalb der tradierten staatlichen und korporatistischen Arrangements mit ihren Aktivitäten versuchen, ihre politischen Forderungen an die zumeist durch Wahl autorisierten national- oder suprastaatlichen Repräsentanten zu richten, stehen die politisierten Bürger, mit der plausiblen Diagnose vom »Ende der Handlungsfähigkeit des Staates« konfrontiert,8 dem zunehmend machtlosen Adressaten ihrer zahlreichen Anliegen rat- und politisch perspektivlos gegenüber.
Denn während die neuen Formen des politischen Engagements vor allem durch zwei Trends gekennzeichnet sind – Individualisierung und Distanzierung der Bürger von der »offiziellen Politik« –, nehmen die Erwartungen an die Regelungskapazitäten der staatlichen Institutionen keineswegs ab. Im Gegenteil: An der Einsicht, dass angesichts schmelzender Polkappen, globaler Armutsmigration und einer ernsthaft gestörten Beziehung zwischen Finanz- und Realökonomie »etwas getan werden muss«, fehlt es offensichtlich nicht. Die Ansprüche der Bürger an eine heute primär als Dienstleistungsunternehmen perzipierte Politik wachsen weiter an. Das »Könnens-Bewusstsein«, mit dem der Althistoriker Christian Meier den diesseitsorientierten Fortschrittsoptimismus der Griechen charakterisierte, politischen Wandel in gefestigten institutionellen Bahnen und ohne Bezugnahme auf transzendente Prämissen erreichen zu können,9 nimmt dagegen ab, weil der vermeintliche Kontingenzüberschuss nicht in die tradierten und konstitutionell vorgegebenen Verfahren übersetzt werden kann und insofern gar kein realer ist: In der Epoche der Kontingenz schafft die Befreiung von organisch legitimierten Herrschaftsnormen zwar ein Gefühl dafür, dass nicht nur in der Technik, sondern auch im politischen Raum prinzipiell nichts unmöglich ist (was nicht allein in den großen Revolutionen, sondern ebenso in den totalitären Katastrophen des 20. Jahrhunderts eine extreme Bestätigung fand). Jüngst aber schwebt über Europa eine Aura der Alternativlosigkeit: Angesichts »multipler Krisen«10 sind wir im öffentlichen Raum mit der Notwendigkeit einer wesentlich von den »Sachzwängen« des ökonomischen Sektors bestimmten Politik konfrontiert, die sich bei der Rechtfertigung ihrer Entscheidungen gern der sogenannten TINA-Rhetorik (»There is no alternative«) bedient. Dazu passt, dass das Wort »alternativlos« 2010 von der Gesellschaft für deutsche Sprache zum Unwort des Jahres gewählt wurde. Der Streit um fundamentale Ordnungsfragen ist längst einer Art Placebo-Politik gewichen, die diffuse, weil nur noch selten bipolar verlaufende Konflikte durch simulative Verfahren wie die Reaktivierung überkommener, auf nationalstaatliche Politikmuster rekurrierender Erzählungen aufzulösen versucht. Solche Erzählungen vermitteln zwar ein Gefühl von Wärme und Geborgenheit, zeichnen aber das fiktive Bild einer staatszentrierten Politik, die sich in Wirklichkeit längst in Auflösung befindet und in der globalen Welt schwerlich funktionieren kann. Staatlich-politische Institutionen, die ehemals nicht nur als ausführende Organe, sondern auch als Impulsgeber fungierten, verwandeln sich in »Zombie-Institutionen, die historisch längst tot sind, aber doch nicht sterben können«, die dem Modernisierungsprozess wankend hinterherschlurfen und gegenüber der ökonomischen Globalisierung immer mehr in Verzug geraten. Um die eigene Machtlosigkeit gegenüber den Dynamiken der Weltökonomie, aber auch um die hässlichen, machtzentrierten Seiten politischen Handelns in einem relativ herrschaftskritischen »Zeitalter des Misstrauens« zu überblenden, bedient sich die Politik harmonistischer Wohlfühlrhetorik und überschwänglicher Moralisierung. Sie überdeckt das graue Porträt der konsoziativen, durch die Dispersion politischer Verantwortlichkeiten geprägten Gegenwartsdemokratie mit den bunten Farben inhaltsleerer Ästhetisierung und einer dialogischen Drapierung des Alternativlosen, wodurch es ihr bislang tatsächlich gelingt, nach wie vor bestehende gesellschaftliche Konfliktpotenziale vorsorglich zu entschärfen.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!