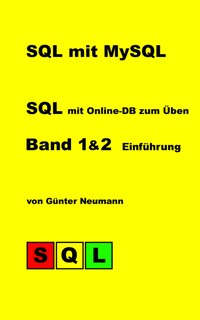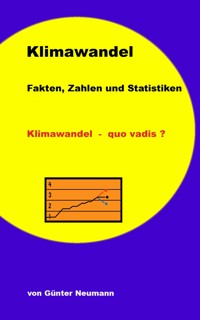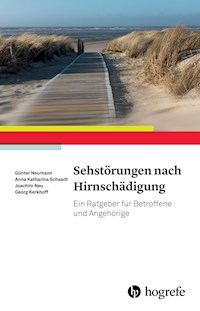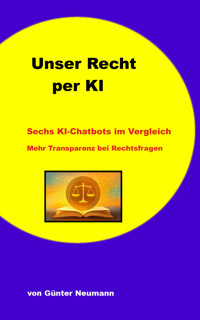
12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Können KI-Chatbots auch Recht? Das Buch "Unser Recht per KI" zeigt, dass die Künstliche Intelligenz von Auskunftssuchenden einfach und hilfreich für Rechtsfragen genutzt werden kann. Es werden sechs Chatbots in ihren Antworten miteinander verglichen: Le Chat, ChatGPT, MS-Copilot, Claude, Gemini und Manus. Im Fokus stehen bei dem Vergleich drei Fallanalysen, anhand derer die Chatbots ihre Arbeitsweisen, Eigenheiten und Leistungsfähigkeiten zeigen. In dem Buch gibt es zudem viele nützliche Informationen über Künstliche Intelligenz, Gesetzeswerke, Gerichtsurteile, Daten-Quellen, juristische Anwendugen und Prompt-Engineering.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Einleitung
Vorbei ist die Zeit gefühlt endloser Suche nach passenden Paragrafen in zahllosen Gesetzeswerken. Vorbei die Zeit der ebenso gefühlt endlosen Recherchen danach im Internet. Vorbei die Zeit der konventionellen juristischen Datenbanken, zu denen in den meisten Fällen nur Juristen oder die, die es noch werden wollen, einen bequemen Zugang haben.
Im November 2022 brach das Zeitalter der für alle unermüdlich dienstbereiten Künstlichen Intelligenz an. Diese KI ist nun dabei auch die Welt des Rechts und der Justiz grundlegend zu verändern - für Juristen und sogar für Nicht-Juristen. Das juristische Wissen und die juristischen Analyse-Künste der KI sind bereits jetzt schnell und unkompliziert für alle online verfügbar - einfach per Chatbot und Prompt.
So richtet sich das Buch an alle die häufiger mit Rechtsfragen befasst sind, aber auch an die, die nur in ihrer einen aktuellen Sache nach einer fundierten ersten Auskunft suchen: Im Privatbereich oder als Freiberufler, an Firmen, Unternehmen, Vereine und Organisationen - aber auch an Rechtsanwälte, Juristen und Steuerberater, die sich von Berufs wegen mit Rechtsfragen befassen und an dem Thema Künstliche Intelligenz im Kontext der Rechtsprechung interessiert sind.
Dieses Buch informiert im ersten Buch-Segment in kurzer Form über den Stand der Künstlichen Intelligenz und über die Chatbots, die für den Leistungsvergleich eingesetzt wurden sowie über die Strukturen und die Rechtsprechung der deutschen Justiz in Theorie und Praxis.
Im nachfolgenden Fokus-Segment werden acht Chatbots per einfachen Prompts auf Gesetze und gerichtliche Urteil zugreifen. Die gelieferten Ergebnisse werden abgebildet und verglichen. Sechs der acht Chatbots werden anschließend anhand von drei Fallanalysen ihre Leistungsfähigkeit in ihrem einfachen, kostenfreien Standard-Modus zeigen: Le Chat von Mistral (EU), ChatGPT von OpenAI (USA), Copilot von Microsoft (USA), Claude von Anthropic (USA), Gemini von Google (USA) und Manus von Monica (China).
Bei den drei Fallanalysen handelt es sich um drei Fälle, deren Fallbeschreibungen eng abgeleitet sind von drei realen gerichtlichen Streitfällen. So sind die Chatbot-Ergebnisse - in Form von Argumentation, Verweisen, Abschätzung von Erfolgschancen und mögliche Urteile - untereinander vergleichbar und können zudem mit den jeweiligen realen Gerichtsurteilen verglichen werden. Bei den drei Analysen handelt es sich um folgende Fallzusammenhänge:
- Arbeitsrecht und Kündigung
- Mietrecht und Eigenbedarfsklage
- Datenschutz und DSGVO
Insgesamt betrachtet ist festzustellen, dass alle sechs Chatbots sogar im kostenfreien Modus die an sie gestellten juristischen Aufgaben überraschend gut gelöst haben - formal und inhaltlich. Aus den Arbeitsweisen und Ergebnissen konnten einige Erkenntnisse gewonnen werden, die in den beiden letzten Kapiteln des Fokus-Segments dargestellt werden. Hierbei geht es um die Frage: Wie komme ich bei einem Streitfall mit Hilfe der KI-Chatbots zu einer möglichst guten Argumentation und sicheren Abschätzung der Erfolgschancen und des zu erwartenden Urteils.
Abschließend gibt es Hinweise auf die richterliche Urteilsfreiheit, Informationen über Legal Tech und Tools für die Rechtsprechung, über die Entwicklungen in der juristischen Ausbildung an den Universitäten und bei juristischen Fachverlagen.
Für ein besseres Prompten bei den Chatbots finden sich im Anhang in den beiden Kapiteln - Prompt-Engineering und Meta-Prompt-Engineering - eine große Anzahl Hinweise, um Prompts besser zu formulieren oder um in Prompts komplexe Aufforderungen so zu beschreiben, dass die KI damit etwas anfangen kann und die Prompts bei Bedarf flexibel wiederverwendet werden können.
Technischer Stand der Künstlichen Intelligenz
Seit der Veröffentlichung durch OpenAI im November 2022, eines weltweit ersten leistungsfähigen KI-Chatbots, hat die Künstliche Intelligenz beachtliche Fortschritte gemacht. Wie aus dem Nichts kommend hatte ChatGPT bereits vom ersten Tag an eine alles umfassende Leistungsfähigkeit, die zuvor kaum jemand in naher Zukunft für erreichbar hielt. Sie erstaunte und faszinierte die Menschen. Zugleich löste sie Ängste und Befürchtungen aus. Nun ist die Zeit der ungestümen Aufgeregtheit und des Hypes vorbei und so etwas wie Normalität im Umgang mit der KI hat sich auf allen gesellschaftlichen Ebenen etabliert. Aus jetziger Sicht können wir nach den ersten drei Jahren dynamischer Entwicklungen im KI-Zusammenhang sicherlich nur feststellen: Ein Anfang ist gemacht. Die KI wird in der Zukunft ganz gewiss den Alltag und die Berufswelt aller Menschen weiter zunehmend mehr oder weniger fundamental verändern.
Technischer Stand der KI (Herbst 2025):
- Denkende KI revolutioniert die KI. Sie ermöglicht menschenähnliche Arbeitsweisen
- KI kann große Datenmengen analysieren, Statistiken und Prognosen liefern - KI kann komplexe Zusammenhänge erkennen
- KI kann natürliche Sprache verstehen, generieren und in Echtzeit übersetzen - KI-Chatbots können menschenähnlich mit Menschen Gespräche führen
- Bilder, Kunstgemälde, Musik, Texte und Videos lassen sich per KI erzeugen
- die KI kann Bilder, Röntgenaufnahme und Video-Sequenzen analysieren
- die KI unterstützt autonome Systeme beim Fahren, Fliegen und Überwachen (Fahrzeuge, Drohnen, Logistik-Systeme, Roboter)
Was sind die nächsten Ziele? :
- Verbesserung der Antwortqualität, Stichwort: Halluzinationen
- Energie-Bedarf und -Kosten reduzieren - KI- und Roboter-Systeme schaffen, die dem Menschen ähnlich sind
- Die KI soll transparenter und nachvollziehbarer werden
- Standards in Datenschutz und Ethik sollen international vereinbart werden
- Frage ist zu klären: Wie ist die KI im Bildungswesen optimal einzusetzen?
Was ist der Stand der KI im Rechtswesen? :
- Einsatz der KI bei Recherchen und Bearbeitung von Dokumenten
- Einsatz bei juristischen Fall- und Vertragsanalysen
- KI übernimmt Standardbearbeitungen
- Erste Jura-Portale bieten ihre Dienste länderübergreifend an
- Erste dialogfähige KI-Chatbots sind in der Rechtsberatung tätig
Was sind die nächsten Ziele im Rechtswesen? :
- Verstärkte Nutzung der KI in der Praxis und juristischen Lehre
- Verstärkte Digitalisierung von Gerichtsentscheidungen
- Verbesserung der Verlässlichkeit und Auskunftsqualität
- Verbesserung der Rechtssicherheit und Regelungen bezüglich KI-Einsatz
Die KI hat das Potential mit Hilfe spezialisierter KI-Systeme die Verfahrensweisen und Bearbeitungseffizienz im Rechtswesen grundlegend zu verändern und zu verbessern. Sie kann zudem bereits jetzt mit Hilfe von KI-Chatbots die Gesetzeswerke und Rechtsprechung den Bürgern und Unternehmen deutlich zugänglicher und verständlicher machen.
Neue technologische Entwicklungen wie Legal Analytics, Predictive Analytics und Prescriptive Analytics führen die juristische Arbeit in die digitale Zukunft.
Links
Ludwig-Maximilians-Universität München. Was KI wirklich kann.
www.lmu.de/de/newsroom/newsuebersicht/news/was-ki-wirklich-kann.html
Max-Planck-Gesellschaft. Künstliche Intelligenz.
www.mpg.de/kuenstliche-intelligenz
Hübner F. (11.4.25). KI im Rechtsbereich? Die wichtigsten Tools & lukrativsten Geschäftsmodelle. t-academie. https://www.top.legal/wissen/ki-im-rechtsbereich-die-wichtigsten-tools-lukrativsten-geschaftsmodelle
Mindverse (22.7.25) KI für Anwälte 2025: Revolution in der Rechtspraxis in Deutschland.
https://www.mind-verse.de/post/ki-fuer-anwaelte-revolution-der-rechtspraxis
Transparenz und Demokratie
Transparenz und Demokratie ist kein Widerspruch. Diktatur und Transparenz ist allerdings ein Widerspruch. Daraus folgend sollte es Gegenstand und Ziel demokratischer Politik sein, die Transparenz in der Gesetzgebung, den Gesetzeswerken und der Rechtsprechung zu erhöhen, da das von zentraler Bedeutung für einen demokratischen Rechtsstaat und dessen Erhalt ist.
Die Künstliche Intelligenz kann die Institutionen demokratischer Staaten dabei unterstützen, Gesetze und Rechtsprechung für alle Bürger verfügbarer und verständlicher zu machen. Dadurch wird mehr Vertrauen in den Rechtsstaat und die Bereitschaft sich für den Erhalt des Rechtsstaats einzusetzen geschaffen. Zudem kann mehr Transparenz in der Rechtsprechung zu mehr Gerechtigkeit durch einen Vergleich des Strafmaßes führen. Damit wären die demokratischen Rechtsstaatprinzipen der Rechtssicherheit und der Gleichheit vor dem Gesetz einfacher erfüllbar und überprüfbar - für die Justiz, die Anwaltschaft und im Idealfall auch uneingeschränkt für alle Bürger.
Links
lpb, Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg. Was ist ein Rechtsstaat? Das Rechtsstaatprinzip.
https://www.lpb-bw.de/rechtsstaat
Struktur des Buches und eingesetzte KI-Chatbots
Die Kapitel des Buches sind folgenden Buch-Segmenten zugeordnet:
Vor-Fokus: Allgemeine Themen KI und Justiz.
Fokus: Zentrale Kapitel Chatbot-Vergleich.
Nach-Fokus: Spezielle Themen KI und Justiz.
Anhang: Sammlungen und ergänzende Themen.
Im Zentrum stehen die Fokus-Kapitel. Hier werden die ausgewählten Chatbots in ihrer Leistungsfähigkeit bezüglich juristischer Fragestellungen und Zugriffen auf Gesetzestexte sowie Gerichtsurteile getestet und verglichen.
Im Anhang befinden sich unter anderem zwei Kapitel zum Thema Prompt-Engineering. Darin werden auch Möglichkeiten erörtert, ob und wie Meta-Prompts sich als Prompt-Agenten für Inhalt und Stil einsetzen lassen.
Eingesetzte KI-Chatbots
Die beiden KI-Chatbots „Le Chat“ von Mistral (Frankreich) Version Medium 3.1 und ChatGPT Version 5 von OpenAI (USA) sind die eingesetzten Pivot-Chatbots, die vorrangig im Fokus der Betrachtungen und Vergleiche stehen.
Zudem werden die nachfolgend gelisteten KI-Chatbots in einem KO-Verfahren in einen ersten Vergleich genommen. Nur die Chatbots, die bei diesem Vergleich ein gutes Ergebnis liefern, werden in den nachfolgenden Kapiteln und Vergleichen weiterhin mit dabei sein.
Zusätzlich in den Vergleichen eingesetzte Chatbots:
- MS-Copilot von Microsoft (USA)
- Claude Sonnet 4 von Anthropic (USA)
- Gemini 2.5 von Google (USA)
- DeepSeek (China)
- Manus von Monica (China, Singapur)
- Qwen von Alibaba (China)
Links
Wikipedia. Liste von Chatbots.
https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_von_Chatbots
Hierarchien und Organisation der Gerichte in Deutschland
Bei allen Gerichtsentscheidungen und Erfolgsabschätzungen von Klagen ist es für Juristen und die Künstliche Intelligenz von großer Wichtigkeit zu Streitfällen mögliche Urteile oder Grundsatzurteile aus den oberen Instanzen zu kennen. Hier muss die KI hierarchisch zu gewichten. Ein kurzes einfaches Beispiel dazu sei: Bundesrecht bricht Landesrecht. Im Zusammenhang mit der Europäischen Union ist für die deutsche Rechtsprechung, so auch für alle anderen Länder der EU, der Europäische Gerichtshof in Luxemburg die allerhöchste Instanz.
In Deutschland sind die Gerichte in fünf Arten der Gerichtbarkeit organisiert. Am häufigsten frequentiert und allgemein bekannt ist die ordentliche Gerichtbarkeit mit nachfolgenden Hierarchie-Ebenen:
Ordentliche Gerichtsbarkeit:
- Amtsgericht (AG) - Landgericht (LG) in Berlin Kammergericht (KG)
- Oberlandesgericht (OLG)
- Bundesgerichtshof (BGH)
Zu den ordentlichen Gerichtbarkeiten zählen im Wesentlichen die Strafgerichte und Zivilgerichte. Als Sonderfall ist das Bundespatentgericht der ordentlichen Gerichtbarkeit zugeordnet.
Fachgerichtbarkeiten und ihre Instanzen
Arbeitsgerichtsbarkeit:
Arbeitsgericht (AG), Landesarbeitsgericht (LAG), Bundesarbeitsgericht (BAG)
Die Arbeitsgerichte sind für die Streitfälle zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber zuständig.
Verwaltungsgerichtsbarkeit:
Verwaltungsgericht (VG), Oberverwaltungsgericht (OVG) / Verwaltungsgerichthof (VGH), Bundesverwaltungsgericht (BVerwG)
Die Verwaltungsgerichte sind für öffentlich-rechtliche Streitfälle zwischen Bürgern und Verwaltung zuständig (z.B. Schul- und Polizeirecht). Als Sonderfall sind die Wehrgerichte der Verwaltungsgerichtbarkeit zugeordnet.
Finanzgerichtsbarkeit: Finanzgericht (FG), Bundesfinanzhof (BFH)
Die Finanzgerichte sind für Streitfälle bei Steuer- und Zoll-Angelegenheiten zuständig.
Sozialgerichtsbarkeit:
Sozialgericht (SG), Landessozialgericht (LSG), Bundessozialgericht (BSG)
Die Sozialgerichte sind zuständig für Streitfälle im sozialen Kontext wie: Rente, Krankenversicherung, staatliche Versorgungsleistungen.
Der lange Weg durch die Instanzen
Bei einem Rechtsstreit können häufig gegen die Gerichtsentscheidungen der unteren Gerichtsinstanzen Rechtmittel eingelegt werden. In diesen Fällen wird in der darüber liegenden zweiten Instanz, der Berufungsinstanz oder nachfolgend der dritten Instanz, der Revisionsinstanz, ein Streitfall neu verhandelt. Solche Rechtsprozesse durch drei Instanzen zu führen kann Jahre dauern.
Erste Instanz:
Auf der untersten Ebene der Gerichtshierarchie befinden sich die ersten Instanzen der ordentlichen Gerichtsbarkeit und der Fachgerichtbarkeiten, wie beispielsweise die Amtsgerichte oder Arbeitsgerichte.
Berufungsinstanz:
Soll ein Urteil der ersten Instanz angefochten werden, so sind dafür die Gerichte der Berufungsinstanz zuständig, wie zum Beispiel: Landgericht, Oberlandesgericht oder Landesarbeitsgericht.
Revisionsinstanz:
Soll ein Urteil der Berufungsinstanz angefochten werden, so sind dafür die Gerichte der Revisionsinstanz zuständig, wie beispielsweise: Bundesgerichtshof oder Bundesarbeitsgericht. In dieser Instanz sind jedoch nur Formfehler und Fehler in der Rechtsprechung anfechtbar (falsche oder lückenhafte Auslegung oder Anwendung von Gesetzen).
Verfassungsgerichte
Die Verfassungsgerichte sind keine Fachgerichte, sondern höchste Gerichte auf Bundesebene oder auf Landesebene bei den einzelnen Bundesländern.
Bundesverfassungsgericht (BVerfG):
Sitz in Karlsruhe. Es achtet auf die Einhaltung des Grundgesetzes auf Bundesebene. Das Gericht hat folgende wesentliche Aufgaben:
- Verfassungsbeschwerden: Bei Verdacht auf Verletzung der Grundrechte
- Normenkontrolle: Prüfung von Gesetzen auf Grundgesetz-Konformität
- Organstreitverfahren, z.B. Streitfälle zwischen Bundesregierung und Bundestag - Parteiverbotsverfahren
- Wahlprüfverfahren
- Bund-Länder-Streitverfahren
Landesverfassungsgerichte:Alle Bundesländer haben ein Landesverfassungsgericht. Diese Gerichte achten auf die Einhaltung der entsprechenden Landesverfassung. Wesentliche Aufgaben der Landesverfassungsgerichte sind:
- Normenkontrolle: Prüfung von Gesetzen auf Landesverfassung-Konformität
- Organstreitverfahren, z.B. Streitfälle zwischen Landesregierung und Landtag - Prüfung von Volksbegehren und Volksentscheiden
- Landesverfassungsbeschwerde (ist in einigen Bundesländern zugelassen)
Links
Wikipedia. Gerichtsorganisation. https://de.wikipedia.org/wiki/Gerichtsorganisation_in_Deutschland
Wikipedia. Gerichtsverfassungsgesetz (GVG). https://de.wikipedia.org/wiki/Gerichtsverfassungsgesetz
Bundesgerichtshof in Karlsruhe. Homepage.
www.bundesgerichtshof.de
Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe. Homepage.
www.bundesverfassungsgericht.de
Europäischer Gerichtshof (EuGH)
Der EuGH hat seinen Sitz in Luxemburg. Aufgabe dieses Gerichts ist es, zu überwachen, dass das EU-Recht in allen Mitgliedstaaten der Europäischen Union gilt und Vorrang vor nationalen Gesetzen hat. Das Wissen um Urteile des EuGH ist sowohl für Juristen als auch die Künstliche Intelligenz gegebenenfalls von entscheidendem Interesse. Schließlich ist der EuGH die allerhöchste Instanz auch für deutsche Gerichte und Behörden. Nachfolgend werden einige wesentliche Aufgaben des EuGHs benannt.
Vorabentscheidungsverfahren:
Bei Fragen zur Auslegung oder Gültigkeit von EU-Recht kann oder muss z.B. ein deutsches Gericht den EuGH um Klärung bitten. Die eigene gerichtliche Entscheidung kann erst nach Beantwortung durch das EuGH erfolgen.
EU-Recht hat Vorrang: - Das EU-Recht hat Vorrang nationalem Recht
- Steht ein deutsches Gesetz im Widerspruch zum EU-Recht, so ist es nicht anwendbar
- Es gibt bei der Anwendung von EU-Recht bezüglich des Grundgesetzes einige Ausnahmen in der Vorrangstellung
In welchen Bereichen ist das EU-Recht besonders häufig anzutreffen? :
- Wirtschaft und Handel - Verbraucherschutz - Datenschutz (DSGVO und AI Act) - Arbeitsrecht - Umweltschutz
Der Europäische Gerichtshof wurde 1952 gegründet und begann 1953 mit seiner Arbeit.
Links
Wikipedia. Europäischer Gerichtshof. https://de.wikipedia.org/wiki/Europ%C3%A4ischer_Gerichtshof
Europäischer Gerichtshof in Luxemburg. Homepage.
https://curia.europa.eu
Theorie und Praxis
Insbesondere in der Geisteswissenschaft ist eine Diskrepanz zwischen Theorie und Praxis scheinbar häufiger vermutet als in anderen wissenschaftlichen Disziplinen. Auch für die Rechtswissenschaft ist eine Diskrepanz-Vermutung erst einmal a priori gefühlt nicht abwegig. Jedoch können Justiz und Rechtswissenschaften besser als zwei Seiten einer Medaille betrachtet werden.
Zwei Seiten einer Medaille: Die juristische Theorie bildet das systematische Fundament, auf dem das Recht ausgelegt, reflektiert und weiterentwickelt wird. Die juristische Praxis ist das pragmatisch konkret angewandte Recht in Streitfällen, Verträgen, Verwaltungsverordnungen und vielen weiteren juristischen Zusammenhängen. Dabei öffnet die Praxis der Theorie ein Fenster zur Wirklichkeit. Die sich weiterentwickelnde Theorie bietet daraus folgend im Idealfall weiterhin ein kontinuierlich an der Wirklichkeit orientiertes Fundament für die Rechtsprechung.
Juristische Theorie
In der juristischen Theorie und Analyse der Rechtsprechung sind Systematik, juristische Logik, Widerspruchsfreiheit, Plausibilität und Analogie bedeutende Punkte in wissenschaftlicher Lehre und Arbeit. Der exakte Wortlaut ist hierbei von einer ganz besonderen Relevanz und Wertigkeit. Zudem müssen die Normen und Interpretationen stringent konform sein mit der Gesamtheit der Gesetzeswerke sowie insbesondere mit dem Verfassungs- und Europarecht.
In der Theorie sind die juristischen Kommentare von herausragender Bedeutung für die Auslegung von Gesetzestexten, deren Erläuterung und für die Argumentation. Sie geben zudem eine Übersicht über relevante Urteile und deren konkrete Auslegung bei Gericht. Eine bedeutende Rolle spielen zudem juristische Gutachten, die konkrete, komplexe Rechtsprobleme analysieren. Sind die Gutachten und Fachkommentare von Richtern der höchsten Instanzen oder von renommierten Professoren verfasst, so erhalten diese dadurch ein entsprechend hohes juristisches Gewicht bei der Verwendung in Theorie und Praxis.
Beispiele für Gesetzessammlungen mit Kommentierung sind:
Grüneberg alias Palandt (BGB), Münchener Kommentare, Habersack alias Schönfelder.
Juristische Praxis
Konkrete Gerichtsurteile sind von großem Wert für praxisorientierte Fallanalysen, für den Entwurf praxisorientierter Verteidigungsstrategien und für eine bessere Einschätzung der Chancen einen Prozess gewinnen zu können.
Mit Hilfe von Gerichtsurteilen, insbesondere falls diese aus einer Region oder punktgenau von dem betreffenden Gericht vorliegen, können Juristen durch diese Präzedenzfälle ähnliche Sachverhalte, juristische Bewertungen und Argumente finden und für ihre Zwecke verwenden. Sie geben zudem Hinweise auf mögliche Irrtümer oder Verfahrensfehler in der Vergangenheit. Verfahrensausgänge und Strafmaß lassen sich besser abschätzen. Hier werden auch die unterschiedlichen Bewertungen und Auslegungen in den verschiedenen Bundesländern schnell auswertbar und ersichtlich.
Seit dem ersten Einsatz von juristischen Online-Datenbanken ist die digitale Verfügbarkeit von Gerichtsentscheidungen eine unabdingbare Voraussetzung für Online-Zugriffe darauf und deren digitale Auswertungen. Mittels digitaler Anwendungen und Assistenten können Recherchen, Zusammenfassungen, Überblicke und Auswertungen maßgeschneidert vorgenommen werden. Dies gilt nun im angebrochenen Zeitalter der Künstlichen Intelligenz in einer ganz besonderen Art und Weise, die erahnen lässt, dass in Zukunft für Lehre, Wissenschaft und Praxis alles nicht nur denkbar, sondern auch möglich werden kann. In der deutschen Justiz ist es dafür notwendig, die Anzahl digital verfügbarer Gerichtsurteile, insbesondere in den unteren Instanzen, schnellst möglich zu erhöhen. Dies weiterhin dem Gutdünken der Gerichte und Richter zu überlassen ist eventuell kein zukunftsweisender Ansatz.
Hinweis: Siehe auch weiter hinten die Kapitel „Fokus: Veröffentlichte Gerichtsurteile in Deutschland und erste Zugriffe“, „Gerichtsurteile und Anonymisierung“ und „Richter und ihre Urteilsfreiheit“.
Nutzung von Chatbots bei Rechtsanwälten und Juristen
Für welche Anwendungsfälle werden Chatbots bei Rechtsanwälten und Juristen aktuell besonders gerne und häufig eingesetzt?
Im juristischen Alltag soll mit Hilfe von Chatbots oder spezialisierten digitalen Assistenten Routinearbeiten automatisiert und die Arbeitseffizienz gesteigert werden. Dabei werden in diesem Zusammenhang besonders häufig nachfolgende Einsatzbereiche und Themen genannt:
1) Kommunikation mit Mandanten.
Beantwortung häufig gestellter Fragen. Aufbereitung von relevanten Mandanten-Daten und Terminvereinbarungen.
2) Analyse und Prüfung von Verträgen und Dokumenten
Zusammenfassungen, sprachliche Umgestaltungen. Erkennen von problematischen Formulierungen oder fehlenden Inhalten. Versionsvergleiche.
3) Recherchen und Rechtsauskünfte
Durchsuchen oder filtern von Gesetzestexten, Gerichtentscheidungen und Kommentaren. Fallanalysen und Normenprüfungen.
4) Erstellung von Dokumenten
Automatische Erstellung von individuellen Schriftsätzen: Klageschriften, Gegendarstellungen, Mahnungen, Verträge und dergleichen.
5) Prüfung von Regelkonformität (Compliance) und Datenschutz
Überprüfen, ob interne oder externe Prozesse regelkonform sind. Automatisierte Bearbeitung von Auskunftsersuchen nach DSGVO.
6) Standardisierung
Abläufe und Schriftsätze.
7) Fortbildung
Chatbots bieten Möglichkeiten des interaktiven Lernens.
8) Ideengeber
Bei alledem wird die Künstliche Intelligenz auch als Ideengeber genutzt. Über den Einsatz von Ideen, beispielsweise in Streitfällen, entscheidet noch immer der Nutzer selbst.
Nach einer Studie von Goldman Sachs aus dem Jahr 2023 können 44 Prozent aller Arbeiten im juristischen Bereich durch KI automatisiert werden. Das hat seinen Grund auch darin, dass juristische Arbeit sehr viel mit der Verarbeitung von Sprache zu tun hat. Für die Verarbeitung von Sprache sind die KI-Chatbots per se prädestiniert.
Beispielsweise können für Text-Interaktionen betreffende Texte, die beispielsweise sprachlich variiert werden sollen, direkt im Prompt mitgesendet werden, falls diese nicht mehr als ein paar Hundert Worte umfassen. Ansonsten sind längere Texte in einer PDF zu hinterlegen und per Chatbot-Prompt hoch zu laden.
Das zielführende Prompten selbst ist eine kleine angewandte Wissenschaft für sich. Mit Übung, Neugier, Ausprobieren und Erfahrung lässt sich dabei allerdings einiges erreichen und verbessern. Bei komplexeren Anliegen ist jedoch in der Sache strukturiert und durchdacht zu agieren. Mehr zu dem Thema ist im Kapitel „Prompt-Engineering“ im Anhang zu finden.
Falschzitate und Halluzinationen
Bei der Künstlichen Intelligenz kann es vorkommen, dass die Antworten unwahre Inhalte enthalten, die sehr glaubwürdig daherkommen, zumal wenn diese sogar auf konkrete Zusammenhänge, Paragraphen oder Aktenzeichen verweisen, die jedoch in Wirklichkeit gar nicht existieren oder inhaltlich etwas ganz anderes thematisieren. Dieses Phänomen der KI wird als Halluzination bezeichnet und ist hinlänglich bekannt.
Nun sind insbesondere bei juristischen Themen und Schriften solche Falschzitate und Verweise nicht nur unschön, sondern geradezu verstörend und diskreditierend. Wichtig jedoch ist die Fragestellung:
„Ist es zulässig solche Falschzitate und fehlerhaften Verweise bei Gericht vorzulegen oder zu verwenden? Oder ist es gar verboten beispielsweise Schreiben einzureichen, bei denen jeder zweite Satz auf etwas Falsches oder gar ins Leere verweist?“
Die Antwort auf diese Frage ist: „Es ist prinzipiell NICHT verboten.“
Jedoch ist es sicherlich nicht förderlich für die eigene Rechtsposition und Reputation in der Sache. Und ganz gewiss ist es absolut kontraproduktiv für die eigene Abschätzung von Erfolgsaussichten bei Klagen oder Verteidigungen.
Jedenfalls besteht damit nicht die Gefahr gegen Verordnungen zu verstoßen, die einen Einsatz der Künstlichen Intelligenz in gerichtlichen Zusammenhängen stetig und zutiefst selbstgefährdend begleiten würde. Nun gut, ein Jetzt-aber-drauf-los, das ist sicherlich nicht die beste Schlussfolgerung aus dieser Tatsache für die Planung eines Einsatzes der KI in Rechtangelegenheiten.
Etwas anders liegt der Fall jedoch, falls Rechtsanwälte gezielt und mit Absicht Unwahrheiten verbreiten. Hierzu gibt es in der Bundesrechtsanwaltsverordnung (BRAO) folgende Verordnung.
§43a Abs. 3 BRAO:
„Der Rechtsanwalt darf sich bei seiner Berufsausübung nicht unsachlich verhalten. Unsachlich ist insbesondere ein Verhalten, bei dem es sich um die bewusste Verbreitung von Unwahrheiten oder solchen herabsetzenden Äußerungen handelt, zu denen andere Beteiligte oder der Verfahrensverlauf keinen Anlass gegeben haben.“
Ein Verstoß gegen diese Verordnung liegt also nur dann vor, falls ein Anwalt bei Gerichten, Behörden, Mandanten oder dergleichen wissentlich Unwahrheiten verbreitet. Hingegen liegt ein Verstoß nicht vor, falls ein Anwalt nachlässig arbeitet oder die von einer Künstlichen Intelligenz gelieferten Texte nicht auf den wahrheitsgemäßen Inhalt überprüft. Siehe in diesem Kontext auch auf den weiterführenden Link, hier unten, zu einem solchen Vorgang am Amtsgericht Köln im Juli 2025.
Links
Bundesministerium der Justiz. Bundesrechtsanwaltsverordnung.
https://www.gesetze-im-internet.de/brao/index.html
Prof. Dr. Römermann V. (24.7.25). AG Köln zu Berufspflichten. Anwalt reicht Schriftsatz mit Fehlern bei Gericht ein. LTO Legal Tribune Online. www.lto.de/recht/juristen/b/ag-koeln-familiengericht-312f130-25-schriftsatz-ki-anwalt-berufspflichten
Fokus: KI-Chatbots im Fokus
Für unsere Rechtsrecherchen und Erläuterungen durch digitale Helfer werden wir in den folgenden Fokus-Kapiteln vorrangig zwei KI-Chatbots verwenden:
1) ChatGPT von OpenAI 2) Le Chat von Mistral
Weswegen diese beiden und nicht andere Chatbots?
ChatGPT ist ein Generalist, sehr bekannt, sehr leistungsfähig und bietet einen spezialisierten Jura-Assistenten. Le Chat hat in seiner Leistungsfähigkeit sehr aufgeholt und hat durch seine französische Herkunft den Anspruch EU-konform zu sein bezüglich der Datenschutzverordnung DSGVO und dem AI Act.
ChatGPT:
Web: https://openai.com
ChatGPT ist weltweit der bekannteste und am häufigsten genutzte KI-Chatbot. Er ist ein Generalist und bietet den auf Rechtsfragen spezialisierten digitalen Assistenten „Jura Pro“.
Selbstdarstellung per Jura Pro:
Jura Pro - Recht, Gesetze, Analyse
By gptexpert.pro
Einzigartiger digitaler Assistent für Rechtswissenschaften, perfekt für Studierende und Fachleute. Ausgestattet mit umfassenden Gesetzesdaten und Analysen von Rechtsbeziehungen für tiefgreifende Einsichten.
Hinweis Digitale Assistenten und Agenten: Digitale Assistenten unterstützen Personen bei konkreten Aufgaben oder Fragen. Digitale Agenten hingegen agieren autonom. Sie haben eine eigenständige Zielverfolgung und eigene Entscheidungsstrategien (siehe auch im Anhang: „KI-Begriffe“).
Le Chat:
Web: https://openai.com
„Le Chat“ ist ein Chatbot von Mistal AI (Frankreich). Das KI-Unternehmen gilt als eines der erfolgreichsten europäischen KI-Unternehmen.
Als ein KI-Unternehmen mit Hauptsitz in der EU sind bei Mistral Datenschutz und DSGVO-konforme Anwendungen wichtige Aspekte und integrale Bestandteile der Mistral-KI. Der Chatbot Le Chat zeigt sich als sehr leistungsfähig und braucht einen internationalen Vergleich nicht mehr zu scheuen.
Insbesondere im Hinblick auf den Datenschutz und dem „AI Act“ könnte Mistral in der Zukunft, insbesondere bei juristischen Themen, eine wichtige Rolle einnehmen.
Einsatz weiterer Chatbots:
In den Fokus-Kapiteln werden sechs weitere leistungsstarke KI-Chatbots eingesetzt und gleich anfangs auf einfache Art in der Qualität ihrer Antworten getestet. Die Chatbots, die den Test bestehen, werden anschließend weiterhin bei den drauffolgenden Vergleichen beteiligt sein.
Es werden anfangs folgende Chatbots auf Weiterverwendung getestet:
- MS-Copilot von Microsoft (USA)
- Claude Sonnet 4 von Anthropic (USA)
- Gemini 2.5 von Google (USA)
- DeepSeek (China)
- Manus (China, Singapur)
- Qwen von Alibaba (China)
Profil-Informationen zu diesen Chatbots befinden sich im Anhang im Kapitel „Chatbots im Überblick“.
In den Fokus-Kapiteln werden durch die Antwort-Vergleiche der KI-Chatbots Stärken und noch bestehende Schwächen bei der Verwendung für Rechtsfragen und Fallanalysen erkennbar werden. Sicherlich wird sich dabei auch das Innovationspotential zeigen, das für das gesamte Rechtswesen in Zukunft zweifellos und unaufhaltsam wirksam werden wird.
Links
Wikipedia. Chatbot.
https://de.wikipedia.org/wiki/Chatbot
Wikipedia. Open AI.
https://de.wikipedia.org/wiki/OpenAI
Wikipedia. Mistral. AI
https://de.wikipedia.org/wiki/Mistral_AI
Fokus: Recht und Rechtsicherheit finden - Quellen der Chatbots
Wie und wo können wir Recht in Form von Gesetzen und Rechtsentscheidungen finden? Wie bringen wir beides so zusammen, dass wir danach besser über eine konkrete Rechtssituation informiert sind? Wie können Chatbots uns dabei unterstützen?
Diese Fragen werden fokussiert und konkret in den folgenden Fokus-Kapiteln anhand von Beispielen, Vergleichen und weiterführenden Hinweisen beantwortet.
Welche Quellen nutzen Chatbots?
Vorab schauen wir beispielhaft, auf welche Quellen im Kontext Rechtsprechung und Gesetz einige der von uns eingesetzten Chatbots zugreifen. Dies ist ja auch insofern interessant, als dass sich dadurch vorab eventuell eine vage Einschätzung der erhofften Auskunftsqualität ableiten lässt.
Um über die Quellen eine Auskunft zu erhalten, nutzen wir die Chatbots in einer Art Selbstauskunft, die wir ihnen per Prompt entlocken. Wir nutzen für alle befragten Chatbots denselben Prompt-Text und notieren nur die von den Chats bekanntgegebenen Quellen.
Quellen für Zugriff auf Gesetze
Prompt:
Bitte nenne mir fünf der wichtigsten Quellen (URLs), auf die du für Gesetzestexte zugreifst.
Le Chat Gesetze:
www.gesetze-im-internet.de BM Justiz
www.bgbl.de Bundesgesetzesblatt
eur-lex.europa.eu EUR-Lex (EU-Recht)
www.gesetze-bayern.de Beispiel für Landesrecht
www.rechtsprechung-im-internet.de DB, Rechtsprechung
ChatGPT Gesetze:
www.gesetze-im-internet.de Gesetze im Internet
www.recht.bund.de Bundesanzeiger
www.juris.de Rechtsportal
https://eur-lex.europa.eu EUR-Lex DB
www.landesrecht-bw.de Beispiel Landesrecht
MS-Copilot Gesetze (ohne bereits genannte)
www.justiz.de Justizportal Bund
www.anwalt.org/gesetze/ Anwalt.org
Claude Gesetze (ohne bereits genannte)
Ich keine fest vordefinierten Quellen für Rechtsprechung.
www.bverwg.de Bundesverwaltungsgerichts
Gemini Gesetze (ohne bereits genannte)
Da ich als KI keinen direkten Zugriff auf das Internet habe und meine Informationen aus einem statischen Datensatz stammen, kann ich keine "live" URLs nennen, auf die ich zugreife. Ich kann dir jedoch die wichtigsten und verlässlichsten offiziellen Quellen für deutsche Gesetzestexte nennen, die auch die Basis für viele meiner Informationen bilden.
Manus Gesetze (ohne bereits genannte)
Nur bereits genannte Adressen.
Quellen für Zugriff auf Gerichtsurteile
Prompt:
Bitte nenne mir fünf der wichtigsten Quellen (URLs), auf die du für Gerichtsurteile zugreifst.
Le Chat Urteile:
www.bundesgerichtshof.de Bundesgerichtshof
www.rechtsprechung-im-internet.de DB, Rechtsprechung
eur-lex.europa.eu Urteile EuGH
www.openjur.de OpenJur, kostenlose Datenbank
www.juris.de Juris Datenbank
ChatGPT Urteile:
www.bundesgerichtshof.de BGH
www.bundesverfassungsgericht.de/entscheidungen BVerfG
www.juris.de Rechtsportal
https://curia.europa.eu EuGH
https://openjur.de openJur
MS-Copilot Urteile (ohne bereits genannte)
www.justiz.de Justizportal Bund
https://dejure.org/gerichte Dejure
Claude Urteile (ohne bereits genannte)
Ich habe keine fest vordefinierten Quellen für Rechtsprechung.
Manus Urteile (ohne bereits genannte)
www.beck-online.de Beck online
Fokus: Deutsche Gesetzeswerke und Einzel-Zugriffe
In Deutschland gibt es eine große Vielzahl an Gesetzeswerken und Verordnungen. Eine Übersicht dazu befindet sich im Anhang dieses Buches unter: „Gesetzeswerke und Rechtsnormen im Anhang“.
In diesem Kapitel fokussieren wir uns beispielhaft auf die zivil- und handelsrechtliche Gesetze und damit auf das Bürgerliche Gesetzbuch (BGB), das Handelsgesetzbuch (HGB), das Grundgesetz (GG).
Wir erfahren, wo und wie auf diese Gesetze im Internet zugegriffen werden kann und wo neue Gesetze oder Gesetzesänderungen angekündigt werden.
Zudem greifen wir in diesem Kapitel in Varianten per Le Chat von Mistral (Frankreich) und ChatGPT (Jura-Assistent 5) von OpenAI (USA) auf einen einzelnen Paragrafen (§ 620 BGB) zu und schauen uns die einzelnen Ergebnisse an. In einer Art Vorschau werden die gesamten Ergebnisse im Absatz Quintessenz zusammengefasst vorgestellt.
Zusätzlich werden folgende Chatbots getestet:
- MS-Copilot von Microsoft (USA)
- Claude Sonnet 4 von Anthropic (USA)
- Gemini 2.5 von Google (USA)
- DeepSeek (China)
- Manus (China, Singapur)
- Qwen von Alibaba (China)
OK-Verfahren: Die Chatbots, die bei diesem Test gut abschneiden, werden in den folgenden Fokus-Kapiteln zusätzlich zu Le Chat und ChatGPT weiterhin eingesetzt.
Gesetze im Internet:
Gesetze und Urteile sind gemeinfrei (Siehe hier unten unter Hinweise). Die Gesetzeswerke und damit die Gesetzestexte sind beim Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz (BMJV) abrufbar.
Das Bundesamt für Justiz stellt interessierten Bürgerinnen und Bürgern nahezu das gesamte aktuelle Bundesrecht kostenlos im Internet bereit. Die Gesetzeswerke und Verordnungen sind sowohl im HTML-Format vorhanden als auch als PDF-Dokumente abrufbar (PDF öffnen per Klick auf PDF-Link).
BM-Justiz: www.bmjv.de
Gesetze im Internet (BMJV): www.gesetze-im-internet.de
Veröffentlicht werden neue Gesetze im Bundesanzeiger.
Bundesanzeiger: www.bundesanzeiger.de
Auf die Gesetzeswerke BGB, HGB und das Grundgesetz in der HTML-Version kann in den Prompts direkt verwiesen werden. Die Gesetzeswerke sind auch als PDF zur Ansicht, zum Hochladen oder anderer Verwendung verfügbar.
Direkte Links - BGB, HGB und GG: - BGB: www.gesetze-im-internet.de/bgb/
www.gesetze-im-internet.de/bgb/BGB.pdf
- HGB: www.gesetze-im-internet.de/hgb/
www.gesetze-im-internet.de/hgb/HGB.pdf
- GG: www.gesetze-im-internet.de/gg/
www.gesetze-im-internet.de/gg/GG.pdf
Quintessenz: Zugriff auf einen Paragrafen
Zusammenfassung der Prompt-Ergebnisse dieses Kapitels.
Quintessenz: Le Chat Liefert bei einfach formulierter Anforderung nur die ersten beiden Absätze des § 620 BGB korrekt. Der dritte Absatz ist inkorrekt, der vierte fehlt.
Die Anforderung mit Verweis auf die Quelle liefert die gleiche inkorrekte und unvollständige Antwort.
Im Research-Modus zitiert Le Chat den § 620 BGB korrekt. Zudem fügt Le Chat zusätzlich Metadaten, Quellenlink und Kommentare hinzu.
Mit hochgeladener BGB-Gesetze-PDF und einfachem Paragrafen-Text-Prompt wird der § 620 korrekt zitiert. Zudem sind Hinweise auf Änderungen des Paragrafen angehängt.
Quintessenz: ChatGPT – Jura-Assistent 5
Bei dem Zugriff auf § 620 BGB ist Ad 1 korrekt, Ad 2: Wortlaut abgewandelt. Ad 3 und 4 fehlen.
Auch bei Verweis auf den Gesetzestext im Prompt oder Zugriff auf hochgeladene BGB-Gesetze-PDF wird von ChatGPT das gleiche unvollständige Ergebnis geliefert. Der Verweis auf die Quelle bleibt also unwirksam.
Quintessenz: Chatbots MS-Copilot, Claude, Gemini, DeepSeek, Manus, Qwen
Folgende Chatbots liefern bereits bei einfach formulierten Prompt den Gesetzestext korrekt und geben als Quelle an: "Gesetze im Internet".
- MS-Copilot von Microsoft (USA)
- Claude Sonnet 4 von Anthropic (USA)
- Gemini 2.5 von Google (USA). Liefert zudem gut verwendbare Erläuterungen.
- Manus (China, Singapur)
Liefern fehlerhafte Ergebnisse: - DeepSeek (China) liefert fehlerhafte Ergebnisse. Halluziniert.
- Quen (China) liefert abwegigen Text. Halluziniert.
--- Ende Quintessenz ---
Beispiele eines Direkt-Zugriffes auf einen Paragrafen im BGB
Mit Hilfe des Chatbots Le Chat von Mistral und ChatGPT von OpenAI lassen wir uns den Text des § 620 BGB geben.
Original-Text § 620 BGB (Quelle: www.gesetze-im-internet.de/bgb/__620.html )
§ 620 Beendigung des Dienstverhältnisses
(1) Das Dienstverhältnis endigt mit dem Ablauf der Zeit, für die es eingegangen ist.
(2) Ist die Dauer des Dienstverhältnisses weder bestimmt noch aus der Beschaffenheit oder dem Zwecke der Dienste zu entnehmen, so kann jeder Teil das Dienstverhältnis nach Maßgabe der §§ 621 bis 623 kündigen.
(3) Für Arbeitsverträge, die auf bestimmte Zeit abgeschlossen werden, gilt das Teilzeit- und Befristungsgesetz.
(4) Ein Verbrauchervertrag über eine digitale Dienstleistung kann auch nach Maßgabe der §§ 327c, 327m und 327r Absatz 3 und 4 beendet werden.
--- Ende Original-Text ---
Wir starten mit Le Chat in mehreren Varianten und schauen uns die Antworten an.
Prompt an Le Chat: Bitte gebe mir in aktueller Fassung den Text vom Paragrafen § 620 BGB.
Antwort Le Chat: Hier ist der Wortlaut des § 620 BGB (Bürgerliches Gesetzbuch) in der aktuellen Fassung:
§ 620 Beendigung des Dienstverhältnisses
(1) Das Dienstverhältnis endigt mit dem Ablauf der Zeit, für die es eingegangen ist.
(2) Ist die Dauer des Dienstverhältnisses weder bestimmt noch aus der Beschäftigungsart zu entnehmen, so kann jeder Teil das Dienstverhältnis nach Maßgabe der §§ 621 bis 623 kündigen.
(3) Das Dienstverhältnis kann von jedem Teil aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist gekündigt werden, wenn Tatsachen vorliegen, auf Grund derer dem Kündigenden unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls und unter Abwägung der Interessen beider Vertragsteile die Fortsetzung des Dienstverhältnisses bis zum Ablauf der Kündigungsfrist oder bis zu der vereinbarten Beendigung des Dienstverhältnisses nicht zugemutet werden kann.
Quelle: § 620 BGB (Stand: 30.08.2025)
--- Ende Antwort ---
Fazit zur Antwort von Le Chat:
Le Chat hat § 620 teils nicht korrekt und zudem unvollständig zitiert.
Ad1 und ad2 sind korrekt zitiert. Ad3 ist NICHT korrekt zitiert. Ad4 fehlt.
Ergänzung - Prompt mit Verweis auf § 620 BGB
Für den Zugriff ergänzen wir den Prompt mit einem Verweis auf die Quelle.
Resultat: Wie zuvor zitiert Le Chat den § 602 BGB nicht korrekt und in gleicher Weise wie ohne den Zusatz (Verweis auf Quelle wirkungslos) oder bricht Zugriff ab.
Eingesetzte Zusätze:
Nutze für den Zugriff auf den Paragrafen folgende Quelle: www.gesetze-im-internet.de/bgb/
Oder in zweiter Variante mit:
Zitiere bitte wortwörtlich aus: www.gesetze-im-internet.de/bgb/__620.html
Neuer Prompt an Le Chat: Bitte gebe mir in aktueller Fassung den Text vom Paragrafen §620 BGB. Nutze für den Zugriff auf den Paragrafen folgende Quelle: www.gesetze-im-internet.de/bgb/__620.html
--- Ende Ergänzung ---
Research-Modus von Le Chat: Zugriff auf § 620:
Im Research-Modus zitiert Le Chat den § 620 BGB korrekt. Zudem fügt Le Chat zusätzlich Metadaten, Quellenlink und Kommentare hinzu.
Hinweise Research-Modus:
Um den Research-Modus bei Le Chat einzuschalten ist unterhalb des Prompt-Eingabe-Feldes auf den Research-Schalter zu klicken und gegebenenfalls ist nach ersten Meldungen noch auf den Research-Button zu klicken. Die Bearbeitung im Research-Modus kann durchaus einige Minuten Zeit beanspruchen.
Prompt an Le Chat:
Bitte gebe mir den Text vom Paragrafen § 620 BGB. Zitiere wortwörtlich aus: www.gesetze-im-internet.de/bgb/__620.html
Antwort Le Chat:
§ 620 BGB – Beendigung des Dienstverhältnisses …
Gesetzestext
(1) Das Dienstverhältnis endigt mit dem Ablauf der Zeit, für die es eingegangen ist.
(2) Ist die Dauer des Dienstverhältnisses weder bestimmt noch aus der Beschaffenheit oder dem Zwecke der Dienste zu entnehmen, so kann jeder Teil das Dienstverhältnis nach Maßgabe der §§ 621 bis 623 kündigen.
(3) Für Arbeitsverträge, die auf bestimmte Zeit abgeschlossen werden, gilt das Teilzeit- und Befristungsgesetz.
(4) Ein Verbrauchervertrag über eine digitale Dienstleistung kann auch nach Maßgabe der §§ 327c, 327m und 327r Absatz 3 und 4 beendet werden.
Metadaten
Aktuelle Fassung:
In Kraft getreten am 01.01.2022 aufgrund des Gesetzes zur Umsetzung der Richtlinie über bestimmte vertragsrechtliche Aspekte der Bereitstellung digitaler Inhalte und digitaler Dienstleistungen vom 25.06.2021 (BGBl. I S. 2123).
Vorherige Fassung:
01.01.2001: Gesetz über Teilzeitarbeit und befristete Arbeitsverträge und zur Änderung und Aufhebung arbeitsrechtlicher Bestimmungen (BGBl. I S. 1966).
Quellenlink
§ 620 BGB - Beendigung des Dienstverhältnisses - dejure.org
Kommentar
Der § 620 BGB regelt die Beendigung von Dienstverhältnissen und unterscheidet dabei zwischen befristeten und unbefristeten Verträgen. Absatz 1 legt fest, dass …
… Die aktuelle Fassung des § 620 BGB ist seit dem 01.01.2022 in Kraft und wurde durch das Gesetz vom 25.06.2021 (BGBl. I S. 2123) geändert, das die Umsetzung einer EU-Richtlinie zu digitalen Dienstleistungen zum Ziel hatte. Diese Änderung fügte insbesondere Absatz 4 hinzu, um den besonderen Anforderungen von Verbraucherverträgen im digitalen Bereich Rechnung zu tragen.
Diese Wiedergabe entspricht exakt dem aktuellen Wortlaut des § 620 BGB auf der offiziellen Quelle www.gesetze-im-internet.de/bgb/__620.html und enthält alle relevanten Metadaten sowie redaktionellen Hinweise.
--- Ende Antwort ---
Le Chat: Zugriff auf § 620 per hochgeladener PDF
Wir laden die aktuelle PDF mit den BGB-Gesetzen hoch:
www.gesetze-im-internet.de/bgb/BGB.pdf
und senden einen einfachen Prompt dazu.
Ergebnis: Le Chat zitiert den § 620 BGB korrekt und fügt sogar Metadaten hinzu.
Prompt an Le Chat:
Bitte gebe mir den Text vom Paragrafen §620 BGB aus der hochgeladenen PDF.
Antwort Le Chat: § 620 Beendigung des Dienstverhältnisses
(1) Das Dienstverhältnis endigt mit dem Ablauf der Zeit, für die es eingegangen ist.
(2) Ist die Dauer des Dienstverhältnisses weder bestimmt noch aus der Beschaffenheit oder dem Zwecke der Dienste zu entnehmen, so kann jeder Teil das Dienstverhältnis nach Maßgabe der §§ 621 bis 623 kündigen.
(3) Für Arbeitsverträge, die auf bestimmte Zeit abgeschlossen werden, gilt das Teilzeit- und Befristungsgesetz.
(4) Ein Verbrauchervertrag über eine digitale Dienstleistung kann auch nach Maßgabe der §§ 327c, 327m und 327r Absatz 3 und 4 beendet werden.
Metadaten
Aktuelle Fassung: In Kraft getreten am 01.01.2022.
Zuletzt geändert durch: Gesetz vom 25.06.2021 (BGBl. I S. 2123).
--- Ende Antwort ---
ChatGPT:
Zugriff mit dem Assistenten Jura Pro – Recht, Gesetze, Analyse 5
Wie zuvor greifen wir auf den § 620 BGB in mehreren Varianten zu und schauen, was uns ChatGPT liefert.
Prompt an ChatGPT: Bitte gebe mir den Text vom § 620 BGB.
Antwort ChatGPT: Natürlich – hier ist der Wortlaut von § 620 BGB aus dem Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB), Stand: 2025 (Quelle: gesetze-im-internet.de...)
§ 620 BGB – Beendigung des Dienstverhältnisses
(1) Ein Dienstverhältnis endet mit Ablauf der Zeit, für die es eingegangen ist.
(2) Ein Dienstverhältnis, dessen Dauer weder bestimmt noch aus der Beschaffenheit oder dem Zwecke der Dienste zu entnehmen ist, kann nach den Vorschriften der §§ 621 bis 623 gekündigt werden.
Möchtest du, dass ich auch gleich die anschließenden Kündigungsregelungen (§§ 621–623 BGB) mit aufliste, damit du die praktische Anwendung von § 620 BGB vollständig siehst?
--- Ende Antwort ---
Soll im Prompt der Zugriff auf einen Paragrafen auf eine bestimmte Quelle gelenkt werden, so kann der Prompt wie folgt ergänzt werden:
Prompt an ChatGPT: Bitte gebe mir den Text vom Paragrafen § 620 BGB. Zitiere wortwörtlich aus: www.gesetze-im-internet.de/bgb/
Antwort ChatGPT:
Hier der exakte Wortlaut von § 620 BGB direkt aus der amtlichen Seite gesetze-im-internet.de:
§ 620 BGB – Beendigung des Dienstverhältnisses
(1) Ein Dienstverhältnis endet mit Ablauf der Zeit, für die es eingegangen ist.
(2) Ein Dienstverhältnis, dessen Dauer weder bestimmt noch aus der Beschaffenheit oder dem Zwecke der Dienste zu entnehmen ist, kann nach den Vorschriften der §§ 621 bis 623 gekündigt werden.
--- Ende Antwort ---
Ergebnis: Ad 1 ist korrekt. Ad 2: Wortlaut ist abgewandelt. Ad 3 und 4 fehlen.
Jetzt mit Zugriff auf hochgeladene BGH-Gesetze-PDF.
Prompt an ChatGPT: Bitte gebe mir den Text vom § 620 BGB aus der hochgeladenen PDF.
Antwort ChatGPT:
Ich habe den gewünschten Paragraphen im hochgeladenen PDF gefunden.
Hier der exakte Wortlaut aus deiner Datei:
§ 620 Beendigung des Dienstverhältnisses
(1) Ein Dienstverhältnis endet mit Ablauf der Zeit, für die es eingegangen ist.
(2) Ein Dienstverhältnis, dessen Dauer weder bestimmt noch aus der Beschaffenheit oder dem Zwecke der Dienste zu entnehmen ist, kann nach den Vorschriften der §§ 621 bis 623 gekündigt werden.
--- Ende Antwort ---
Ergebnis: Wie im Zugriff zuvor: Ad 1 ist korrekt. Ad 2: Wortlaut ist abgewandelt. Ad 3 und 4 fehlen. Es erfolgt scheinbar kein Zugriff auf die hochgeladene PDF mit dem korrekten Paragrafen-Text.
Zugriff mit:
MS-Copilot, Claude, Gemini, DeepSeek, Manus und Qwen
Zum Ende dieses Kapitels testen wir noch folgende Chatbots:
- MS-Copilot von Microsoft (USA)
- Claude Sonnet 4 von Anthropic (USA)
- Gemini 2.5 von Google (USA)
- DeepSeek (China)
- Manus (China, Singapur)
- Qwen von Alibaba (China)
Ergebnisse vorab:
Liefern bereits mit einfachem Prompt den korrekten Gesetzestext und geben als Quelle an: "Gesetze im Internet".
- Claude Sonnet 4 von Anthropic
- Gemini 2.5 von Google. Liefert zudem gut verwendbare Erläuterungen.
- Manus (China)
Liefern fehlerhafte Ergebnisse: - DeepSeek (China) liefert fehlerhafte Ergebnisse. Halluziniert.
- Quen (China) liefert abwegigen Text. Halluziniert.
--- Ende Ergebnisse vorab ---
Es werden die beiden folgenden Prompts an die genannten Chatbots gesendet und die Ergebnisse kurz beschrieben.
Prompt 1: Bitte gebe mir in aktueller Fassung den Text vom Paragrafen § 620 BGB.
Prompt 2: Bitte gebe mir den Text vom Paragrafen § 620 BGB. Zitiere wortwörtlich aus: www.gesetze-im-internet.de/bgb/
Ergebnis MS-Copilot (bing.com):
MS-Copilot liefert bereits mit Prompt-1 den korrekten Text vom § 620 BGB und greift dazu auf die offizielle Quelle "Gesetze im Internet" zu.
Prompt-2: Nicht getestet, da Prompt-1 bereits erfolgreich.
Ergebnis Claude Sonnet 4 (claude.ai):
Der Chatbot Claude liefert bereits mit Prompt-1 den korrekten Text vom § 620 BGB und greift dazu auf die offizielle Quelle "Gesetze im Internet" zu.
Prompt-2: Nicht getestet, da Prompt-1 bereits erfolgreich.
Ergebnis Gemini (gemini.google.com):
Der Chatbot Gemini liefert bereits mit Prompt-1 den korrekten Text vom § 620 BGB und greift dazu auf die offizielle Quelle "Gesetze im Internet" zu.
Zugleich werden die Absätze 1 bis 4 abschließend noch gut verwendbar erläutert.
Prompt-2: Nicht getestet, da Prompt-1 bereits erfolgreich.
Ergebnis DeepSeek (deepseek.com):
Prompt-1: Der Chatbot DeepSeek liefert die Absätze ad 1 und ad 2 korrekt. Die Absätze ad 3 und ad 4 sind erfunden, sehen jedoch authentisch aus (Halluzinationen).
Prompt-2: Führt zum gleichen fehlerhaften Ergebnis wie Prompt-1.
Ergebnis Manus (manus.im):
Der Chatbot Manus liefert bereits mit Prompt-1 den korrekten Text vom § 620 BGB und greift dazu auf die offizielle Quelle "Gesetze im Internet" zu.
Prompt-2: Nicht getestet, da Prompt-1 bereits erfolgreich.
Ergebnis Qwen (qwen.ai):
Prompt-1: Falscher Text. Halluzination.
Prompt-2: Identisch falscher Text. Halluzination und kein Zugriff auf Quelle.
Hinweise
Hinweis: Gemeinfreiheit von Gesetzen und Urteilen
Es besteht kein Urheberrecht, daher ist keine Genehmigung oder Lizenz erforderlich. Gesetze und Urteile dürfen zitiert, veröffentlicht oder weiterverarbeitet werden. Sie können in Lehrmaterialien, Datenbanken, Webseiten oder Anwendungen eingebaut werden. Sie können bearbeitet, kommentiert und in eigenen Werken veröffentlicht werden.
Jedoch können beispielsweise juristische Fachkommentare urheberrechtlich geschützt sein.
Hinweis: Richter und ihre Urteilsfreiheit
Prinzipiell haben Richter in Deutschland eine hohe Unabhängigkeit und großen Ermessensspielraum. Jedoch dürfen Richter nicht bestehende Gesetze und Verordnungen ignorieren oder sich von ihnen in willkürlicher Weise entfernen. Ein wesentlicher Grundsatz hierbei ist: „Geltendes Recht ist anzuwenden und erkennbar auszulegen. Die Normen der Rechtsprechung sind einzuhalten.“
Siehe auch Kapitel weiter unten: Richter und ihre Urteilsfreiheit.
Links
Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz. Homepage.
www.bmjv.de