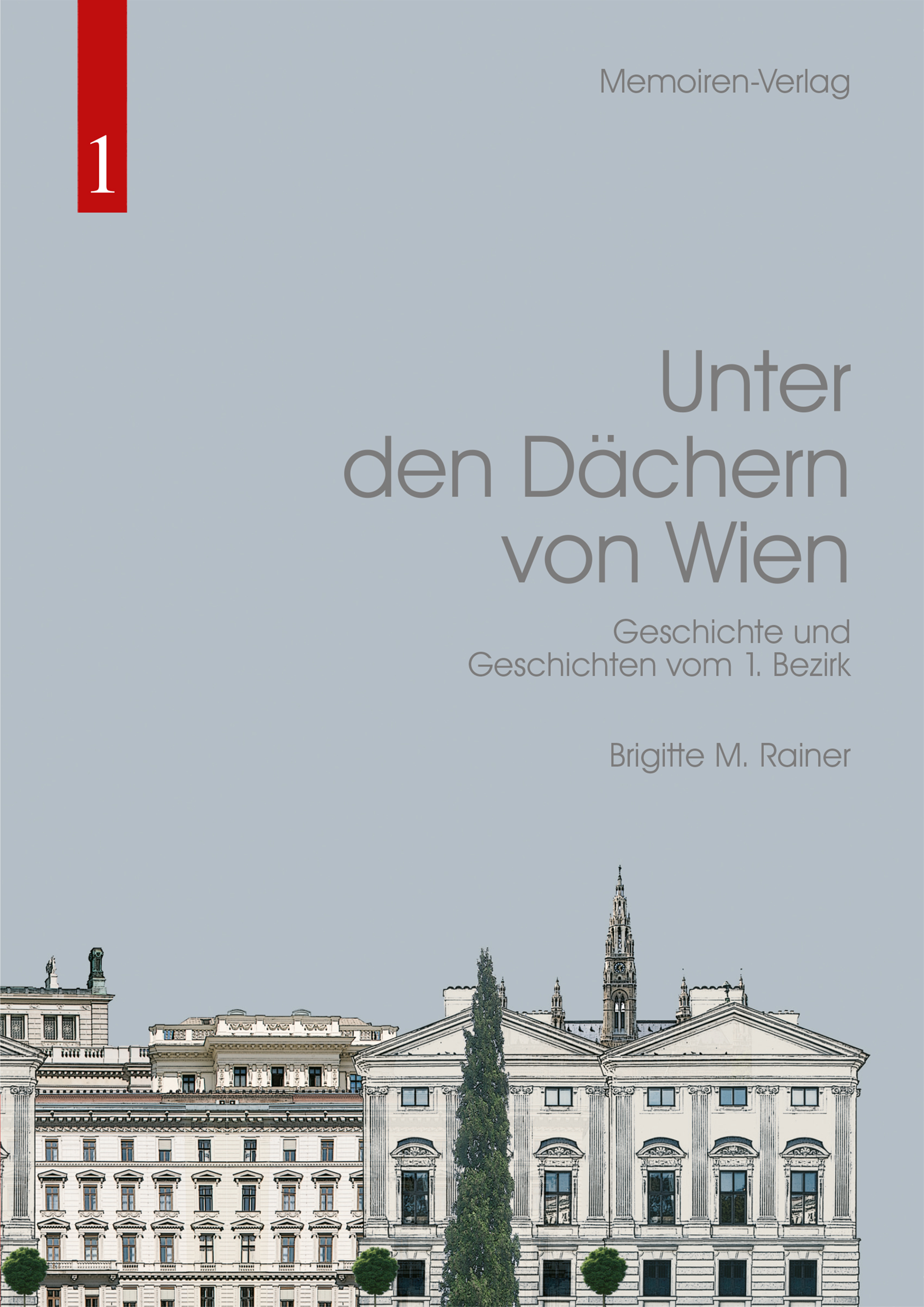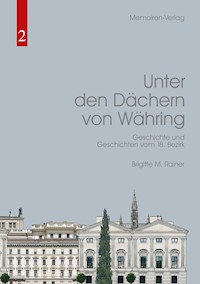
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Memoiren-Verlag Bauschke
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Unter den Dächern von Wien
- Sprache: Deutsch
Die Bewohner sprechen von einem angenehmen Lebensgefühl, die Autorin gar von einer Magie von Währing.Tauchen Sie ein in die Geschichte des 18. Wiener Gemeindebezirks. Brigitte M. Rainer führt Sie durch die einzelnen Bezirksteile und weiß viel über die Entstehung vom kleinen Dorf zum Wiener Bezirk zu berichten, der bis heute seinen Dorfcharakter behalten hat. Ein Buch wie eine Liebeserklärung.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 141
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Table of Contents
Vorwort
Geschichte der Entstehung von Währing
Die Gassen- und Straßennamen im Bezirksteil Währing
Geschichte der Entstehung von Weinhaus
Die Gassen- und Straßennamen im Bezirksteil Weinhaus
Geschichte der Entstehung von Gersthof
Die Gassen- und Straßennamen im Bezirksteil Gersthof
Geschichte der Entstehung von Pötzleinsdorf
Die Gassen- und Straßennamen im Bezirksteil Pötzleinsdorf
Geschichte der Entstehung des Cottage
Die Gassen- und Straßennamen im Bezirksteil Cottage
Kutschkermarkt einst und heute
Die Währinger Straße, eine Einkaufsstraße
Die Magie von Währing
Hinweis
Impressum
Vorwort
Im Zuge meiner Serie „Unter den Dächern von Wien“ entstand dieses Buch über den 18. Bezirk. Neben einem kurzen geschichtlichen Abriss versuchte ich, das Bild des Entstehens vom kleinen Dorf zum Wiener Bezirk zu erzählen. Wenn man sich vor Augen hält, wie alles begonnen hat, kann man diesen „Dorfcharakter“, den der Bezirk ausstrahlt, verstehen, der sich aus Urzeiten herüber in unsere schnelllebige Welt gerettet hat. Deshalb haben auch viele Bewohner, mit denen ich gesprochen habe, von diesem angenehmen Lebensgefühl gesprochen. Natürlich war es mir nicht möglich, alle Geschichten, die sich in dem Bezirk zugetragen haben, zu finden, doch ich denke, ich habe einen informativen Ausschnitt über das Leben im Lauf der Zeit zusammengestellt. Im Kapitel „Die Magie von Währing“ finden Sie, liebe Leserin, lieber Leser, einige Impressionen dieses Wohngefühls.
Geschichte der Entstehung von Währing
Als „warich“ fand das Dorf erstmals im Jahre 1170 anlässlich eines Rechtsstreites zwischen dem Abt Walter vom Stift Michelbeuren und einem Goldschmid Namens Bruno urkundliche Erwähnung. Der alte Ortskern erstreckte sich um die heutige Währingerstraße und Gentzgasse, damals eine Kapelle und ein Berghof. Ursprünglich entwickelte sich der Ort entlang des Währing Baches. Die Bewohner lebten von Viehzucht, Ackerbau und Weinbau.
Der ungarische König Mathias Corvinus setzte 1485 Währing schwer zu, als er Wien belagerte. Angeblich soll das Lager des Königs an der Stelle gestanden haben, wo sich die heutige Gaststätte Zum wilden Mann befindet. Der „Hof zu Währing“, ein Freihof und die Kapelle zur heiligen Gertrud, sie wurde 1226 erstmals erwähnt, sind die ältesten Bauwerke.
Sowohl während der ersten als auch der zweiten Türkenbelagerung wurde Währing dem Erdboden gleichgemacht und die Weinkulturen zerstört. Auch wurde die 1529 erstmals erwähnte Schule zerstört. Viele Einwohner wurden getötet oder als Sklaven verschleppt. Erst 1750 konnte wieder eine Schule aufgebaut werden.
Im 16. und 17. Jahrhundert forderte die Pest ihre Opfer; trotzdem entwickelte sich der Ort stets weiter und 1582 gab es bereits 42 Häuser. Erst im Jahr 1651 scheint erstmals die Schreibweise Währing auf. Von da an vergrößerte sich der Ort, ca. 80 Jahre später zählte man schon 150 Häuser mit 2.578 Bewohnern. Aufgrund der Verschmutzung des Währing-Baches und der fehlenden Kanalisation kam es 1831 zum Ausbruch der Cholera.
Im 19. Jahrhundert entdeckte die wohlhabende Wiener Bürgerschicht Währing als Sommerfrische. Nutzgärten wurden zu Ziergärten und die Häuser wurden erweitert und so änderte sich auch der Charakter des Dorfes.
Nach der Eingemeindung der Vorstädte 1850 begann eine Diskussion, auch die Vororte einzugemeinden. Der Währinger Anwalt Dr. Leopold Florian Meißner richtete an den niederösterreichischen Landesausschuss eine Petition. Der Vorschlag war, nahezu alle Vororte einzugliedern und ein „Groß Wien“ zu bilden. 1892 war es soweit und Währing, Gersthof, Pötzleinsdorf, Weinhaus, Neustift am Walde und Salmansdorf wurden zum 18. Wiener Gemeindebezirk. Im Oktober 1938 nach dem Anschluss an das Deutsche Reich wurde Neustift am Walde und Salmansdorf von Währing getrennt und dem 19. Bezirk, Grinzing, zugeordnet.
Die Gassen- und Straßennamen im Bezirksteil Währing
Abt-Karl-Gasse
Anna-Figl-Weg
Anna-Frauer-Gasse
Antonigasse
Argauergasse
Aumannplatz
Bäckerbründlgasse
Canongasse
Chamissogasse
Dänenstraße
Dempschergasse
Dittesgasse
Edelhofgasse
Feistmantelstraße
Gertrudplatz
Haitzingergasse
Hans-Sachs-Gasse
Hofstattgasse
Innocenz-Lang-Gasse
Johann-Nepomuk-Vogl-Platz
Joseph-Kainz-Platz
Karlweisgasse
Klostergasse
Kreuzgasse
Kutschkergasse
Lazaristengasse
Leitermayergasse
Leopold-Ernst-Gasse
Leo-Slezak-Gasse
Littrowgasse
Marsanogasse
Martinstraße
Max-Emanuel-Straße
Michaelerstraße
Mollgasse
Plenergasse
Ranftlgasse
Richard-Kralik-Platz
Riglergasse
Rimplergasse
Scherffenberggasse
Schopenhauerstraße
Schrottenbachgasse
Schuhmanngasse
Semperstraße
Severin-Schreiber-Gasse
Sommarugagasse
Teschnergasse
Vinzenzgasse
Währinger Straße
Waldeckgasse
Weinhauser Gasse
Weitlofgasse
Abt-Karl-Gasse
1887 nach dem Benediktiner Mönch Alexander Karl (1824–1909) benannt. Er war Abt des Stiftes Melk und Mitglied der liberalen Verfassungspartei im Herrenhaus und des niederösterreichischen Landtages und Gründungsmitglied des Vereines zum Schutz des österreichischen Weinbaus. Als die Reblaus erstmals auftrat, ließ er die Weingüter in Gumpoldskirchen und Baden mit veredelten amerikanischen Reben bepflanzen.
Haus Nr. 21, hier wohnte die Schriftstellerin Marie Eugenie delle Grazie (1864–1931). Die in Ungarisch-Weißenkirchen Geborene verglich man mit der Dichterin Marie Ebner-Eschenbach. Ihre Werke wurden in Russisch, Tschechisch, Polnisch und Schwedisch übersetzt.
Anna-Figl-Weg
2008 benannt nach der Friseurin und Telefonisten Anna Figl (1926–2005), die auch ÖVP Bezirksrätin in Währing war und sich ehrenamtlich im Bezirksmuseum Währing engagierte.
Anna-Frauer-Gasse
1894 nach der Wohltäterin Anna Frauer (1765–1848) benannt. Die Großhändlers- und Hoflieferantenwitwe unterstützte die Schule in Weinhaus und trug zur Erhaltung und Verschönerung des ehemaligen Währinger Friedhofs (heute Währinger Park) bei. Außerdem errichtete sie mehrere Stiftungen zur Unterstützung der Armen.
Antonigasse
1894 möglicherweise nach Anton Kletthofer (1815–1897) benannt, der insgesamt 21 Jahre Bürgermeister von Währing war. Eine zweite Version bezieht sich auf eine Statue des Hl. Antonius von Padua.
Argauergasse
1895 nach Karl Argauer (1817–1890) benannt. Der Kaufmann war 25 Jahre Mitglied des Gemeindeausschusses und war als „Armenvater“ bekannt.
Haus Nr. 3 In diesem Haus wurde der österreichische Komponist Ernst Krenek (1900–1991) geboren. Er besuchte von 1911 bis 1919 das Wiener Gymnasium in der Klostergasse und begann schon mit 16 Jahren sein Kompositionsstudium bei dem österreichischen Komponisten Franz Schreker. Im Jahr 1923 ging er auf zwei Jahre in die Schweiz, dann nach Paris. Er heiratete Anna Mahler, die Tochter Gustav Mahlers, doch das Paar trennte sich noch im gleichen Jahr. Strawinski und der französische Neoklassizismus hatten starken Einfluss auf Kreneks Kompositionsstil; er wurde eingängiger und unterhaltsamer. Sein größter Publikumserfolg war die am 10. Februar 1927 im Opernhaus Leipzig uraufgeführte, sogenannte Jazz-Oper „Jonny spielt auf“. Nach der Scheidung von seiner ersten Frau heiratete Krenek die bekannte Schauspielerin Berta Hermann und kehrte nach Wien zurück. Wieder wandelte sich sein Kompositionsstil: Nach einer intensiven Beschäftigung mit der Musik Schuberts begann seine neoromantische Phase, die ihren Höhepunkt in der Oper „Das Leben des Orest“ und dem Liederzyklus „Reisebuch aus den österreichischen Alpen“ 1929 fand. Doch schon im gleichen Jahr begann seine Auseinandersetzung mit der Zwölftontechnik Arnold Schönbergs, die in den folgenden Jahren sein Schaffen bestimmte.
Aumannplatz
1913 nach dem Währinger Pfarrer Ignaz Aumann (1816–1896) benannt. Der in Kirchberg am Wechsel Geborene hinterließ ein Vermögen von 40.000 Kronen für den Bau einer neuen Kirche. Doch durch die Wirren des 1. Weltkrieges wurde das Projekt nicht verwirklicht. Zu Lebzeiten war es dem Pfarrer, der im Pfarrhof Kutschkergasse 35 lebte, ein großes Anliegen, die Musik der Kirche St. Gertrud auf ein hohes Niveau zu bringen.
Bäckerbründlgasse
1911 nach einer 1880 versiegten Quelle auch Bründl genannt. Einer Sage nach soll hier ein Bäckerlehrling beim Trinken in den Brunnen gefallen und ertrunken sein.
Canongasse
1894 nach Hans von Canon (1829–1885) benannt. Sein richtiger Name war Strásripka. Er nahm als Genre- und Porträtmaler einen Künstlernamen an. Er absolvierte ein Studium bei Ferdinand Georg Waldmüller und war Zeitgenosse von Hans Makart. Canon orientierte sich an den alten Meistern, besonders an Peter Paul Rubens und Tizian. Er schuf zahlreiche Monumentalbilder für öffentliche Gebäude der Ringstraßenzeit. Im Wiener Naturhistorischen Museum kann man z.B. sein Deckengemälde „Kreislauf des Lebens“ sehen. Sein Denkmal steht im Stadtpark.
Chamissogasse
1927 nach dem Dichter Adelbert von Chamisso (1781–1838) benannt, ursprünglich hieß er Louis Charles Adelaide Chamissot de Boncourt. Obwohl seine Muttersprache Französisch war, gelangen ihm zahlreiche Ballade und Märchennovellen in Deutsch, wie z. B. „Peter Schlemihl“ und das Gedicht „Das Riesenspielzeug“. Als Naturforscher beschäftigte er sich vor allem mit Botanik. Sein offizielles botanisches Autorenkürzel lautete CHAM. Nach ihm sind 150 Pflanzenarten und auch einige Tierarten benannt. Er unternahm auch eine Weltumsegelung. Eine Insel im nördlichen Bereich der Beringsee trägt seinen Namen.
Haus Nr. 26, Hier befindet sich eine Gedenktafel für den Freiheitskämpfer Franz Pfannenstiel (1902–1945). Er war Eisengießer und Angehöriger des Republikanischen Schutzbundes. 1939 wurde er in das KZ Dachau eingeliefert. Der Pfannenstielhof, eine städtische Wohnhausanlage, wurde 1924 errichtet.
Dänenstraße
Seit 1930 zur Erinnerung an die Hilfsbereitschaft des Königreichs Dänemark, das dem hungernden Wien in den Nachkriegsjahren 1918–1921 geholfen hat.
Haus Nr. 32 1873 errichtete die Baukanzlei des Wiener Cottage Vereins diese Villa. Der erste Besitzer Johann Ritter von Pusswald mauerte eine Flasche mit einer launigen Chronik mit dem Datum 24.8.1874, einem Foto und einem Kreuzer im Keller der Villa ein. Bei Umbauarbeiten, die der Textilfabrikant Otto Wolfrum 1935 veranlasste, fand man die Flasche. Er legte einen Zusatz zur Chronik und ein Zweigroschenstück bei und mauerte die Fasche wieder ein.
Dempschergasse
1894 nach dem Pfarrer von Währing Johann Baptist Dempscher benannt. Er ließ 1729 den Pfarrhof seiner Kirche auf eigene Kosten erbauen.
Haus Nr. 15, Hier befindet sich die Marmorskulptur „Drei Eulen“ von Franz Barwig dem Jüngeren, geschaffen im Jahr 1966. Nach Franz Barwig ist die Barwiggasse in Pötzleinsdorf benannt.
Dittesgasse
1894 nach dem Pädagogen Dr. Friedrich Dittes (1829–1896) benannt. Er reformierte das Schulwesen, setzte sich für eine freisinnige Gestaltung des Schulwesens ein und versuchte den Einfluss des Klerus auf die Schulen zurückzudrängen. Der im Vogtland Geborene studierte in Leipzig und kam um 1870 nach Wien, wo er 1896 verstarb.
Haus Nr. 11 Hier befindet sich seit 1907 ein Fachgeschäft für Insektenkunde. Der Gründer des Geschäftes war ein begeisterter Entomologe. Siehe auch „Die Magie von Währing“.
Edelhofgasse
Seit 1864 nach dem ehemaligen Adelssitz „Edelhof“ in der heutigen Gentzgasse. 1482 stiftete Agnes von Pottendorf dem Michaeler Orden den Grundbesitz. 1302 wird in der Edelhofgasse eine Badstube genannt, die bis 1728 nachgewiesen werden kann.
Haus Nr. 6 Hier befindet sich in 3. Generation eine Ballettschuherzeugung. Siehe auch „Die Magie von Währing“.
Feistmantelstraße
1897 nach Rudolf Ritter von Feistmantel (1805–1871) benannt. Er war der Schöpfer des Österreichischen Forstgesetzes und Professor an der Hochschule für Bodenkultur. Durch die Verleihung des Österreichischen kaiserlichen Leopold-Ordens wurde er 1864 in den Ritterstand erhoben.
Gertrudplatz
1894 nach der Währinger Pfarrkirche „Zu den heiligen Laurenz und Gertrud“ benannt. Erbaut wurde die Kirche 1753 und ist dem heiligen Laurentius von Rom und der Gertrud von Nivelles geweiht. Eine Legende erzählt, dass Schiffsreisende mitten auf dem Meer von einem Meeresungeheuer bedroht wurden, und als sie die hl. Gertrud um Hilfe anflehten, verschwand das Ungeheuer. So wurde sie Schutzpatronin der Reisenden und Pilger.
Durch den Niveauunterschied auf dem Platz entstand eine Unterkirche. Im Kircheninneren befindet sich ein barockes Gemälde von Peter Strudel, das den hl. Laurentius darstellt. Der Währinger Baumeister Johann Höhne schuf 1885 den westlichen Turmaufbau.
An den hier befindlichen Friedhof, der im Jahr 1796 endgültig aufgelassenen wurde, erinnern nur noch einige in die Kirchenwand eingelassene Grabsteine sowie das hölzerne Kruzifix, das 1745 von Maria Sidoni Raison von Klöckenfeld für den Friedhof gespendet wurde. 1934 erfolgte eine Erweiterung der Gertrudkirche durch einen Anbau an die Barockkirche.
Haitzingergasse
1894 nach Amalie Haitzinger (1800–1884) benannt. Die in Karlsruhe geborene Schauspielerin nahm 1846 ein Engagement am Wiener Burgtheater an, wo sie bis zu ihrem Tod unter anderem im Rollenfach „komische Alte“ wirkte. Nach ihr wurde auch das in dieser Straße befindliche Gymnasium benannt. Der berühmte Maler Josef Kriehuber schuf zwei Gemälde von ihr, eines 1830 als junge Künstlerin und 1852 in einer ihrer Paraderollen als ältere Mimin.
Haus Nr. 26 Hier lebte Ludwig Boltzmann (1844–1906) die letzten vier Jahre seines Lebens. Die 1877 erbaute Villa bezog die Familie Boltzmann im Jahr 1902. Die Villa wurde im Herbst 1944 durch Brandbomben zerstört.
Haus Nr. 29 Das war die letzte Wiener Adresse des Publizisten und Begründers des modernen politischen Zionismus Theodor Herzl (1860–1904). Mit 18 Jahren zog Herzl mit seinen Eltern von Budapest nach Wien, wo er Rechtswissenschaften studierte. Er verstarb in Edlach an der Rax, wurde aber in dieser Villa aufgebahrt.
Hans-Sachs-Gasse
1894 nach dem Meistersinger Hans Sachs (1494–1576) benannt. Sachs, der in Nürnberg lebende Meistersinger, war sicher der talentierteste und berühmteste der Meistersinger. Er verfasste 6000 Stücke unterschiedlichster Natur und mehr als 4000 Meistergesänge. Durch Richard Wagners Oper „Die Meistersinger von Nürnberg“ erlangte er anhaltende Berühmtheit.
Hofstattgasse
1892 nach der historischen Bezeichnung Hofstatt, im Mittelalter im weiteren Sinn mit Parzelle gleichbedeutend.
Haus Nr. 14 Dieses schlösschenähnliche Haus wurde 1903 erbaut.
Haus Nr. 15, Augustenhof. Dieses Wohnhaus wurde von Franz Xaver Rohleder für den Bauherren Leopold Goldschmid 1904 errichtet.
Haus Nr. 17 Hier wohnte bis zu seinem Tod der Schriftsteller Adam Müller-Guttenbrunn (1852–1923). Die Tafel an dem Haus widmete der Verein der Banater Schwaben in Wien ihrem Heimatdichter.
Innocenz-Lang-Gasse
1907 nach dem Pädagogen Innocenz Lang (1752–1835) benannt. Er hatte starken Einfluss auf die Weiterentwicklung des höheren Schulwesens und machte sich für die Einführung des Fachlehrer-Systems stark. Er war auch Rektor der Universität Wien.
Johann-Nepomuk-Vogl-Platz
1894 nach dem Beamten Johann Nepomuk Vogl (1802–1866) benannt. Er war der Sohn eines wohlhabenden Kaufmanns und konnte es sich leisten, als Schriftsteller zu arbeiten. Er verfasste zahlreiche Balladen und Gedichte, die inventarisierten gehen in die Hunderte. Zahlreiche davon wurden von Carl Loewe, Franz von Suppé und Franz Schubert vertont. Außerdem begründete er den österreichischen Volkskalender.
Seit dem Mittelalter befindet sich auf dem Platz ein Markt. Als im 1. Weltkrieg die Lebensmittel rar wurden, mussten viele Marktstände in Ermangelung von Waren schließen. Im 2. Weltkrieg wurde 1945 bei schweren Bombenangriffen der Markt schwer in Mitleidenschaft gezogen. Heute erblüht der Markt wieder und fungiert mit seinen neun Marktständen als Nahversorger und mit seinem gemütlichen Park als Ruhepol am Rande der Kreuzgasse.
Joseph-Kainz-Platz
1931 nach Joseph Kainz (1858–1910) benannt. Er war einer der berühmtesten Charakterdarsteller des deutschsprachigen Theaters. Von 1883–88 am Deutschen Theater in Berlin und ab 1899 am Wiener Burgtheater. Hier übernahm er als k. u. k. Hofschauspieler 28 Rollen, die ihn unsterblich machten. Ihm zu Ehren wurde von 1958 bis 1999 jedes Jahr die Kainz-Medaille verliehen. Seit 2000 gibt es den Nestroy-Theaterpreis. Die letzten Jahre seines Lebens wohnte er im Hotel Sacher.
Karlweisgasse
1919 nach dem Beamten Carl Karlweis (1850–1901) benannt. Er war Direktor der Südbahngesellschaft. Als Feuilletonist schrieb er für die Neue freie Presse, das Neue Wiener Tagblatt und die Gartenlaube. Gemeinsam mit Hermann Bahr verfasste er das Volksstück „Aus der Vorstadt“.
Klostergasse
1868 nach Kloster und Kirche des Lazaristen-Ordens benannt. Der katholische Männerorden wurde 1625 vom heiligen Vinzenz von Paul für den Dienst an den Armen in Paris gegründet. Die Kirche wurde 1876 vom Architekten Friedrich von Schmid erbaut.
Kreuzgasse
Datum der Benennung unbekannt. Hier stand auf freiem Feld ein rotes Kreuz mit einem eisernen Christus.
Haus Nr. 72–76 Hier befand sich die 1883 von der privaten Wiener Tramway-Gesellschaft errichtete Remise für die Pferdebahnlinie. Die Strecke führte von der Währinger Straße über Schulgasse, Semperstraße, Schopenhauerstraße, Staudgasse und Kutschkergasse zum zentrumsseitigen Anfang der Kreuzgasse beim Währinger Gürtel. Die Remise wurde 1993 aufgelassen und heute befindet sich darin ein Supermarkt.
Kutschkergasse
1894 nach dem Priester Johann Rudolf Kutschker (1800–1881) benannt. Der in Schlesien Geborene kam mit 18 Jahren nach Wien, wo er Theologie studierte. 1852 wurde er zum k. u. k Hof- und Burgpfarrer ernannt. Von 1857–1876 war er Ministerialrat im Ministerium für Cultus und Unterricht. Die Bischofsweihe empfing er von Erzbischof Joseph Othmar von Rauscher, dem er nach seinem Tod nachfolgte. Im Jahr 1877 wurde er zum Kardinal ernannt. Er liegt in der Bischofsgruft des Wiener Stephansdoms begraben.
Haus Nr. 35 Hier lebte der in Kirchberg am Wechsel geborene Pfarrer Ignaz Aumann (1816–1896). Er hinterließ ein Vermögen von 40.000 Kronen für den Bau einer neuen Kirche. Doch durch die Wirren des 1. Weltkrieges wurde das Projekt nicht verwirklicht. Zu Lebzeiten war es dem Pfarrer ein großes Anliegen, die Musik der Kirche St. Gertrud auf ein hohes Niveau zu bringen.
Haus Nr. 44 Hier im Garten eines der ältesten Währinger Wirtshäuser Zum Biersack komponierte Franz Schubert (1797–1828) im Juli 1826 das Ständchen „Horch! Horch! Die Lerch’ im Ätherblau“.
In der Gasse befindet sich seit 1885 der Kutschker Markt, der sich in den letzten Jahren zu einer Genussoase entwickelt hat. Im unteren Teil stehen die fixen Buden, während oberhalb ab der Schulgasse an Freitagen und Samstagen Bauernmarkt ist. Siehe auch „Kutschkermarkt gestern und heute“.
Lazaristengasse
Seit 1894 nach dem Lazaristen-Orden benannt. 1878 wurden Kirche und Kloster von der Kongregation der Missionsbrüder des hl. Vinzenz v. Paul errichtet. Die Lazaristen widmeten sich der Jugenderziehung, der Armen- und der Altenpflege.
Haus Nr. 10 und 12 Diese Häuser errichtete der Maurermeister Johann Kazda (1869–1931) im Jahr 1899 und 1900. Er baute vorwiegend Gebäude in Währing.
Haus Nr. 14 Hier befindet sich eine Gedenktafel für Alfred Cossmann (1870–1951). Der in Graz geborene Grafiker und Kupferstecher wohnte hier ab 1913. Neben zahlreichen Ehrungen war er auch Beirat der Albertina.
Leitermayergasse
1894 nach dem Musiker Michael Leitermayer (1799–1867) benannt. Er war Organist der Lichtentaler Kirche und ein Mitschüler Franz Schuberts, mit dem ihn eine Freundschaft verband. Zahlreiche Werke Schuberts kirchlichen Schaffens brachte Leitermayer zur Uraufführung. Er war auf zahlreichen Musikinstrumenten ausgebildet und auch Sänger und hatte die Stelle als Singmeister im Theater in der Josefstadt.
Leopold-Ernst-Gasse
1894 nach dem Architekten Leopold Ernst (1808– 1962) benannt. Ab 1853 war er Dombaumeister von St. Stefan. Außerdem gestaltete er das Palais Niederösterreich und das Schloss Grafenegg, so wie wir es heute kennen.
Leo-Slezak-Gasse