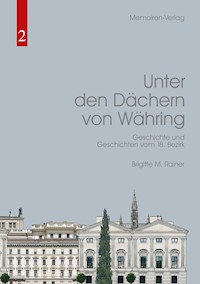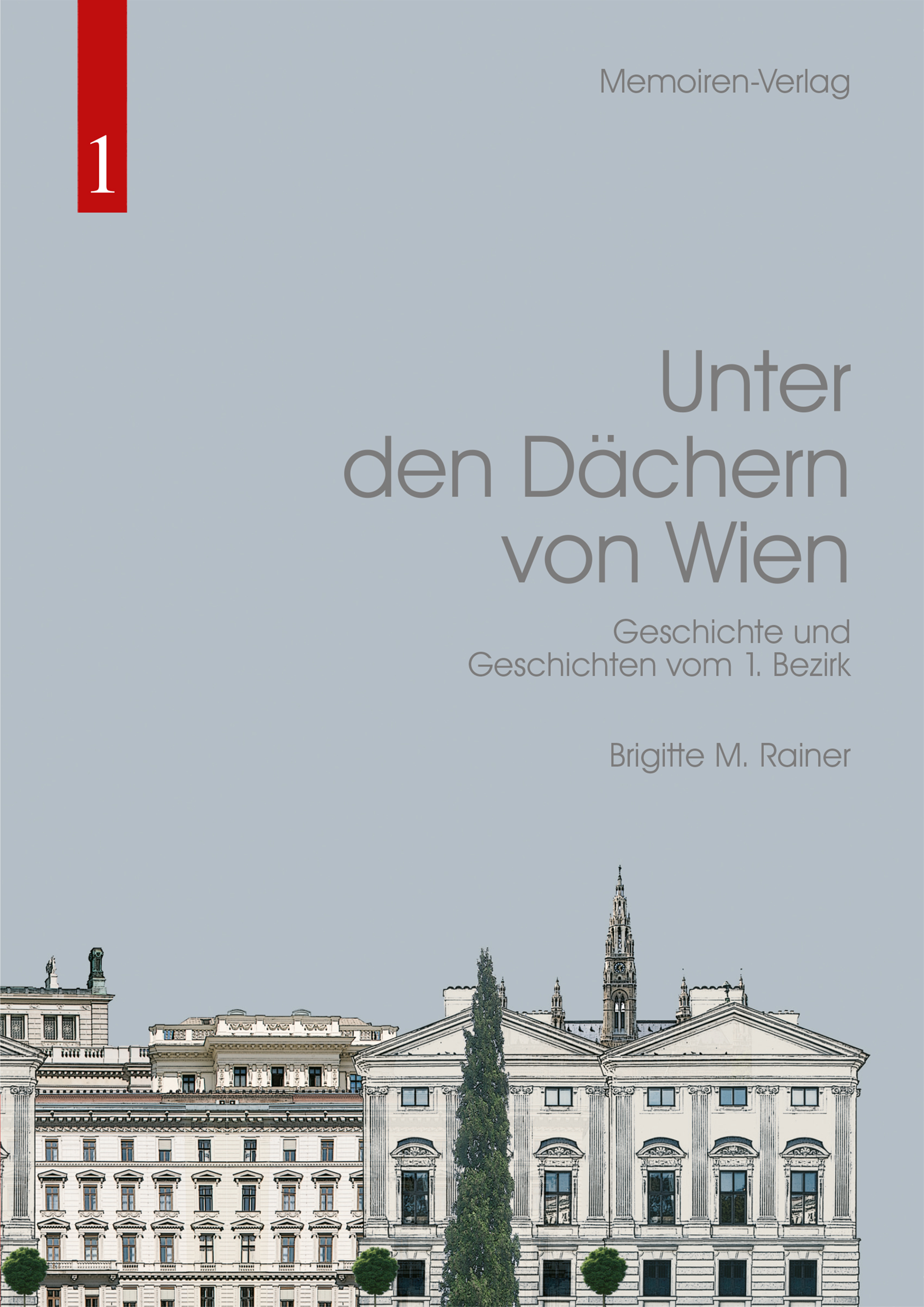
6,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Memoiren-Verlag Bauschke
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Was hat die Wiener Innenstadt nicht schon alles erlebt? Wenn Sie jemals mit offenen Augen durch die Straßen des 1. Wiener Gemeindebezirks geschlendert sind und sich diese Frage gestellt haben, bekommen Sie hier die Antwort.Autorin Brigitte M. Rainer führt Sie von der Akademiestraße bis in die Zedlitzgasse und erzählt viele historische Details zu ausgewählten Straßen und Gebäuden. Ein Muss für jeden Wien-Fan!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Table of Contents
Vorwort
Akademiestraße
Am Gestade
Am Hof
Annagasse
Augustinerstraße
Bäckerstraße
Ballgasse
Bankgasse
Bauernmarkt
Beethovenplatz
Blutgasse
Bognergasse
Bösendorferstraße
Brandstätte
Bräunerstraße
Domgasse
Dorotheergasse
Dr. Karl Lueger Ring
Dr. Karl Renner Ring
Ebendorferstraße
Eschenbachgasse
Fleischmarkt
Franziskanerplatz
Freyung
Friedrich Schmidt Platz
Friedrichstraße
Georg Coch Platz
Goethegasse
Graben
Griechengasse
Grünangergasse
Habsburgergasse
Herrengasse
Himmelpfortgasse
Hoher Markt
Johannesgasse
Josefsplatz
Judenplatz
Karlsplatz
Kärntner Ring
Kärntnerstraße
Kohlmarkt
Kurrentgasse
Lobkowitzplatz
Lugeck
Michaelerplatz
Minoritenplatz
Mölkerbastei
Naglergasse
Neuer Markt
Oppolzergasse
Parkring
Petersplatz
Postgasse
Rauhensteingasse
Renngasse
Reichsratstraße
Riemergasse
Rotenturmstraße
Ruprechtsplatz
Schillerplatz
Schönlaterngasse
Schottengasse
Schottenring
Schreyvogelgasse
Schulhof
Schulerstraße
Schultergasse
Schwarzenbergplatz
Seilergasse
Seilerstätte
Seitenstettengasse
Singerstraße
Sonnenfelsgasse
Spiegelgasse
Stephansplatz
Stock-im-Eisen-Platz
Strauchgasse
Stubenring
Tuchlauben
Uraniastraße
Wallnerstraße
Weihburggasse
Wildpretmarkt
Wipplingerstraße
Wollzeile
Zedlitzgasse
Quellennachweis
Hinweis
Impressum
Vorwort
Liebe Leserin, lieber Leser!
Nach 15 Jahren fern von Wien hatte ich plötzlich die unbändige Lust, mich mit meiner Heimatstadt näher zu beschäftigen. Was also lag näher für eine Schriftstellerin und Journalistin, als die beiden Berufe und die angeborene Neugierde zu vereinen und ein ganz besonderes Wien-Buch zu schreiben. Schnell wurde die Idee konkret, und als ich in einer Galerie eine Fotokomposition von Helmut Rabel Fürstenfeld sah, hatte ich auch den Titel und das Foto für das Cover gefunden. Die Gestaltung übernahm wie schon bei einem meiner letzten Bücher mein Sohn. Nun musste ich „nur“ noch interessante Geschichten finden. Da kam mir mein Beruf wieder sehr zugute und ich recherchierte. Bald kam eines zum anderen, und noch bevor ich mich wieder einmal zu einem Umzug entschloss, war der erste Teil der Reihe „Unter den Dächern von Wien“ fertig. Übrigens zog es mich wieder näher zu meiner Heimatstadt auf den Semmering.
Und was meinen Sie, geschätzte Leser, mache ich hier? Genau, ich recherchiere und schreibe mein nächstes Buch „Aufgespürt am Semmering“. Aber vorerst hoffe ich, Sie haben genauso viel Spaß mit diesem Buch wie ich und es darf Sie auf Ihren Entdeckungsreisen durch den ersten Bezirk begleiten.
Das wünscht sich Ihre
Brigitte M. Rainer
Akademiestraße
Nach der 1860 erbauten Handelsakademie.
Akademiestraße 2a
Moulin Rouge
Nach Plänen des österreichischen Architekten Ludwig Tischler wurde 1884 das Wohnhaus errichtet. Tischler war einer der produktivsten Architekten seiner Zeit. Allein in Wien errichtete er 250 Mietshäuser und öffentliche Gebäude, darunter so verschiedene Projekte wie das Hotel Kummer auf der Mariahilferstraße, das Palais Abensperg-Traun und den Erweiterungsbau des St. Anna Kinderspitals.
Im angrenzenden Pavillon wurde im Jahr 1884 das Moulin Rouge eröffnet. Damit hatte Wien fünf Jahre vor Paris sein Moulin Rouge. In der Zeit zwischen den beiden Weltkriegen wechselte das Etablissement seinen Namen, da hieß es „Schiefe Laterne“. Nachdem 1934 Carl Witzmann (1883-1952), ein Innenraumgestalter und Bühnenbildner, das Lokal umgestaltet hatte, nahm man wieder den ursprünglichen Namen Moulin Rouge an.
Akademiestraße 12
Handelsakademie
Die von Friedrich Fellner 1860 erbaute Handelsakademie für die Wiener Kaufmannschaft im spät-romantischen Historismus war das erste öffentliche Gebäude der Ringstraßenzone. Das Eingangstor wird von den Statuen des Schotten Adam Smith, Begründer der klassischen Nationalökonomie, und Christoph Kolumbus eingerahmt.
Akademiestraße 13
Künstlerhaus
Die 1861 gegründete Genossenschaft der bildenden Künstler Wien beauftragte August Werber mit dem Bau des Künstlerhauses, das 1868 fertiggestellt wurde. Der linke Seitenpavillion wurde 1947 von Alfons Hetmanek zu einem Kinosaal umgebaut.
Am Gestade
Der Name leitet sich von der ehemaligen Lage am Hochgestade, einem Arm der damals noch unregulierten Donau ab.
Maria am Gestade
Die Kirche ist eine der ältesten und bedeutendsten Wiens. Im Jahr 1397 dürfte sie die letzte Arbeit des Baumeister Michael Knab (1340?-1399) gewesen sein. Meister Micheal, wie er sich auch nannte, war auch beim Bau des Stephansdomes tätig. Bauherr war niemand Geringerer als Herzog Albrecht III. Das Besondere an der Kirche ist der durchbrochene, mit gotischem Rankwerk verzierte Helmturm aus dem Jahr 1420.
An der Stelle der heutigen Kirche stand schon um 880 ein hölzernes Kirchlein, das die Donauschiffer erbaut hatten. Lange Zeit blieb es die Kirche der Schiffer. Auch der ursprüngliche Name „Unsere Liebe Frau auf der G´stetten“ sagt, dass die Kirche damals in unverbautem Gebiet stand.
1786 wurde das Gotteshaus entweiht und verfiel, es wurde als Magazin und Pferdestall benützt. Nur die hohen Abbruchkosten bewahrten die Kirche davor, abgebrochen zu werden. Als die gotische Kirche 1812 vom Redemptoristenorden übernommen wurde, musste sie neu geweiht werden. Der Name des Ordens entwickelte sich vom lat. Redemptor, was so viel wie Erlöser heißt.
Der Schutzpatron von Wien, Klemens Maria Hofbauer (1751 -1820), ist hier begraben. Er starb nur einen Monat, bevor der Orden die Kirche wieder übernehmen konnte. Sein Grab befindet sich seit November 1862 hier, nachdem seine sterblichen Überreste vom Mödlinger Friedhof hierher überführt worden waren.
Klemens Maria Hofbauer wurde in Südmähren geboren und ist nach einer Bäckerlehre in Znaim zu einem Bäcker nach Wien gegangen. Anlässlich einer Wallfahrt nach Rom gestattete ihm der Bischof von Tivoli, der spätere Papst Pius VII., den Namen Clemens Maria anzunehmen, den er bis zu seinem Tod führte. Wieder in Wien, wurde er als Religionserneuerer und Gegner der Aufklärung bespitzelt. Von der katholischen Kirche wird er seit 1909 als Heiliger verehrt. 1820 übergab Kaiser Franz I. die Kirche wieder an den Redemptoristenorden. Zuvor wurden die gotischen Chorfenster nach Laxenburg gebracht und in die damals eben entstandene Franzensburg eingebaut. Die noch erhaltenen Scheiben sind aber wieder nach vielen Jahren an ihren Platz zurückgebracht worden.
Im Zuge eines Architektenwettbewerbes 1937 wurde von Hubert Matuschek eine steile Stiege, die zur Kirche führt, gebaut. Daher wird die Kirche auch Maria Stiegen genannt. Der Hannakenbrunnen von Rudolf Schmidt wurde Bestandteil des Stiegenaufganges. Der Gestalter nahm die Sage vom sogenannten Hannakenkönig auf. Von den Hannaken, einer Volksgruppe aus Mähren, stammte ein Bader ab, der hier im Dunkeln der Nacht Personen zu Fall gebracht haben soll, um anschließend an ihrer Behandlung zu verdienen.
Am Gestade 7
Barock Bürgerhaus
An der Fassade befindet sich eine barocke Steinstatue die Maria Immaculata darstellend. Im Innenhof sind noch Reste der Stadtmauer aus der Babenbergerzeit erhalten.
Am Hof
Der Platz war Teil des römischen Heerlagers Vindobona. Hier lag zwischen 1155 und etwa 1280 der Hof der Babenberger. Herzog Heinrich Jasomirgott ließ 1155 hier seine Residenz erbauen. Der Platz vor dem Hof war dann Turnier- und später Marktplatz. Hier fand der Minnegesangswettstreit von Reinmar von Hagenau mit seinem Schüler Walther von der Vogelweide statt.
Ursprünglich war der Platz von der Freyung durch Häuser getrennt, es gab nur eine schmale Verbindungsgasse.
Mariensäule
Sie wurde 1645 von Kaiser Ferdinand III zum Dank für die Rettung Wiens vor den Schweden gestiftete. Carlo Canevale schuf die in der Mitte des Platzes stehende Säule, deren Sockel ist mit Putti verziert. Diese kämpfen gegen Drachen, Löwen, Schlangen und Basilisken. Gekrönt ist die Säule von einer Bronzefigur die die Maria Immaculata darstellt.
Am Hof 1
Kirche am Hof
Anstelle einer romanischen Hofkapelle erbauten die Karmeliter1386-1403 eine gotische Hallenkirche, die auch den Namen „Kirche zu den neun Chören der Engel“ trägt. Die barocke Fassade schuf 1662 Carlo Antonio Carlone im Auftrag von Eleonore von Gonzaga mit der bemerkenswerten Altane. Von hier spendete Papst Pius VI. 1782 den Ostersegen.
Am Hof 5
Haus „Zum Hahnenbeiss“
Das spätklassizistische Wohnhaus wurde an Stelle des „Käsehauses“ 1818 erbaut. Hier war ab 1683 die erste Käsehandlung Wiens untergebracht. Es gab auch eine Abgabestelle für Lampenöl, das man brauchte, um die 1637 eingeführte abendliche Straßenbeleuchtung zu befüllen.
Am Hof 7
Märkleinsche Haus
Johann Lucas von Hildebrandt errichtete 1727 dieses Haus für Christof von Märklein. Zuvor stand hier das Haus „Zum Schwarzen Rössl“, das dem Wiener Bürgermeister Andreas von Liebenberg gehörte. Seine Töchter erbten das Haus. Eine der beiden war mit dem kaiserlichen Hofkriegsrat Christoph von Märklein verheiratet.
Seit 1935 befindet sich das Gebäude im Besitz der Wiener Feuerwehr und hier ist auch das Feuerwehrmuseum untergebracht.
Am Hof 8
Renaissance Bürgerhaus
1566 für den kaiserlichen Herold Wilhelm von Pellenstraß. Der dreigeschossige Keller geht auf die Bauzeit zurück In diesem Haus befindet sich auch eine Turmtreppe, sie ist die einzige in Wien erhaltene.
Am Hof 9
Wiener Feuerwehr
Hier wurde 1686 eine der ältesten Berufsfeuerwehren der Welt gegründet. Das ehemalige Unterkammeramtsgebäude, welches für das Löschwesen zuständig war, wurde 1944 durch einen Bombentreffer zerstört. 1953 wurde die heutige Zentralfeuerwache erbaut, an deren Fassade sich Engelfiguren aus dem Jahr 1748 befinden.
Das kleine, im16. Jh. errichtete Zeughaus trägt auf dem Dach eine Weltkugel die von den Figuren Beharrlichkeit und Stärke getragen wird
Am Hof 12
Urbanihaus
In diesem im Jahre 1630 erbauten Haus mit einer spätmittelalterlichen Kelleranlage eröffnete 1906 Humbert Walcher von Molthein (1865-1926) ein Weinlokal – den Urbanikeller. Fritz von Herzmanovsky-Orlando, der für einige Zeit sein Mitarbeiter war, war an den Entwürfen der Innenausstattung beteiligt. Der freischaffende Architekt hatte im selben Jahr auch die Bauleitung der Burg Kreuzenstein inne.
Am Hof 13
Palais Collato
Bis Anfang des 15. Jahrhunderts befand sich an der Stelle des späteren Palais der Garten des Wiener Gettos. 1560 erwarb Kaiser Ferdinand I. das Haus und ließ es erweitern und eine streng katholische Landschaftsschule unterbringen, die aber nur fünf Jahre einen Schulbetrieb aufrecht erhalten konnte. Der Ungarische Palatin Graf Imre Thurzo erwarb dieses Haus und das angrenzende in der Parisergasse und ließ es aufstocken. Dann erwarb es der Generalleutnant Rambaldo XIII. Graf Collato. Die Familie hielt sich aber nur selten in Wien auf. 1762 gab hier der sechsjährige Mozart für die Familie Collato ein Konzert. 1842 war in diesem Haus eine Trafik untergebracht, sein Besitzer Johann Karl Sothen. Durch das Promessenspiels, einer Art Lotterie, und verschiedenen Transaktionen, bei denen er sich unlauterer Methoden bediente, kam er zu großem Reichtum. Er erwarb unter anderem auch das Schloss Cobenzl.
Annagasse
Zu Zeiten Friedrichs des Schönen öffnete eine fromme Wienerin ihr Haus Pilgern. Sie richtete neben einem Spital auch eine Kirche ein, die sie der hl. Mutter Anna widmete. Nach der Anna Kirche ist die Straße benannt.
Annagasse 3
Annahof
Die seit dem 18. Jh. hier bestehende Schule St. Anna besuchten sowohl Franz Schubert als auch Franz Grillparzer. 1894 wurde der Annahof von dem auf Theaterbauten spezialisierten Architektenduo Fellner und Helmer neu gebaut. Das mehrstöckige Revuetheater Tabarin wurde in den Bau integriert. Es besaß einen Ballsaal nach Pariser Vorbild. 1910 eröffnete das Theater Max & Moritz hier seine Pforten. Der damals noch unbekannte Hans Moser trat hier auf. Bis in die 1950er Jahre schlugen sich diverse Theaterdirektoren mit Bühnen mit wechselnden Namen so recht und schlecht durch. Dann wurden die Räume als Bar genutzt. In der Melodie Bar traten Max Böhm, Hugo Wiener und Cissy Kranner auf. Später wurde es die Adebar, ein Treffpunkt für Jazzfreunde. 1955 eröffnete Fatty Georg sein Lokal im ehemaligen Tabarin. Die Bambis nannten das Tabarin in Tenne um und spielten hier jeden Abend ihre Erfolge in den Charts.
Die Gedenktafel am Gebäude besagt, dass der berühmte Fußballer Matthias Sindelar hier 1939 gestorben ist. Er war der Mittelstürmer und Kapitän des legendären Wunderteams. Nach seinem Ausscheiden aus dem Fußballteam erwarb er das hier befindliche Café Annahof und schuf damit ein neues Standbein. Sein Selbstmord gab zahlreiche Rätsel auf.
Annagasse 5
Kleinmariazellerhof
Das Kloster Klein Mariazell, welches das Haus im 15. Jh. in Besitz nahm, gab ihm auch den Namen. Im 1730 von Lucas von Hildebrandt erbauten Haus fand 1786 nach vielen Umzügen die Akademie der bildenden Künste endlich eine Heimstätte, die sie bis 1877 beibehielt. Fünf Jahre zuvor erhielt die Akademie den Hochschulstatus. Ursprünglich wurde die Akademie der bildenden Künste von dem Maler Peter Strudel gegründet. Zu Beginn war sie auch in seinem Hause in Lichtental untergebrachte. Nach seinem Tod war die Akademie einige Jahre verwaist, bis Jakob van Schuppen diese ebenfalls in seiner Wohnung in der Kärntnerstraße wieder aufleben ließ. Er erarbeitet auch neue Statuten. Am 1. April 1877 konnte man endlich in ein eigenes Haus ziehen. Am Schillerplatz, dem ehemaligen Kalkmarkt, wurde nach den Plänen von Theophil Hansen die noch heute dort bestehende Akademie errichtet. Hansen war auch einige Zeit Leiter der Sparte Architektur an der Akademie.
Annagasse 6
Herzogenburgerhof
Hier befand sich der 1600 erbaute Stadthof des Stiftes Herzogenburg. 1112 wurde das Stift in St. Georgen an der Traisen von Ulrich von Passau gegründet und wurde 1244 wegen häufiger Überschwemmungen nach Herzogenburg übersiedelt.
Annagasse 7
Mailbergerhof
Das spätere Barockpalais wurde im 14. Jh. erstmals erbaut. Heute befindet sich hier ein Hotel.
Annagasse 8
Täubelhof
Besitzer dieses Hauses sind bis ins 14. Jh. nachweisbar. Der Name geht auf Anna Seiss zurück, die als verehelichte Teubl hier in 17. Jh. wohnte. Das Haus in seiner heutigen Gestalt geht auf das Errichtungsjahr 1730 zurück und wird Lukas von Hildebrandt zugeschrieben. Im Stiegenhaus befinden sich wie damals in Bürgerhäusern beliebt Nischen für Heiligenfiguren.
Annagasse 10
Nádasdysches Haus
Das um 1800 erbaute Haus war im Besitz der Familie Batthyány. Lajos Batthyány, ungarischer Ministerpräsident, wurde während der ungarischen Revolution 1848 hingerichtet. Seine Mutter soll daher einen Fluch über das Kaiserhaus ausgestoßen haben, der zur Folge gehabt haben soll, dass sich Kronprinz Rudolf erschossen hatte und Kaiserin Elisabeth ermordet wurde. So die Legende laut einer Köchin, die in diesem Haus gediente hatte.
Annagasse 14
Zum blauen Karpfen ehemals Zum Dampfschiff
In diesem Haus befand sich um 1700 ein barockes Wirtshaus, dessen Besitzer Georg Kärpf hieß.
Annagasse 20
Palais Erzherzog Carl
Hier befand sich im 16 Jh. die kaiserliche Gießerei.1801 ließ Erzherzog Carl das Palais von Franz Anton Pilgram umgestalten und lebte hier mit Henriette Friederike Prinzessin zu Nassau-Weilburg, die er 1815 heiratete. Von 1841 bis 47 bewohnte der Komponist und Hofkapellmeister Otto Nikolai das Palais. Eines seiner berühmtesten Werke war die Oper „Die lustigen Weiber von Windsor“.
Ab 1841 war Otto Nikolai Erster Kapellmeister der Wiener Hofoper und begründete die Wiener Philharmoniker. Ein Gedenkraum erinnert noch heute an sein Schaffen. Das Haus der Musik, welches seit dem Jahr 2000 hier seinen Platz gefunden hat, gewährt seinen Besuchern unter anderem einen spielerischen Einblick auf die wissenschaftliche Sicht der Musik.
Augustinerstraße
Ab 1547 Augustinergasse nach dem hier befindlichen Augustinerkloster, seit 1862 wurde sie zur Augustinerstraße.
Augustinerstraße 1
Palais Erzherzog Albrecht
Heute ist das Palais Erzherzog Albrecht als Albertina bekannt. Ursprünglich war hier das Hofbauamt untergebracht. Kaiserin Maria Theresia verwendete das Gebäude als Gästehaus. Um 1795 erwarb es Herzog Albert von Sachsen-Teschen und ließ es erweitern. Die Familie besaß das Palais bis zum Ende der österreichisch-ungarischen Monarchie, dann ging es in den Besitz der Republik Österreich über. Im Zweiten Weltkrieg wurde das Gebäude schwer beschädigt und danach leider nur in sehr reduzierter Form wiederhergestellt. Das große Reiterstandbild am Ende der Augustiner Bastei, das 1899 von Caspar Zumbusch erschaffen wurde, stellt Erzherzog Albrecht dar. Heute beherbergt die Albertina die größten und bedeutendsten grafischen Sammlungen der Welt. Bis zur Einführung des Euro war die Albertina auf der Rückseite der 20 Schilling Note abgebildet.
Augustinerstraße 12
Harnisch Haus
Hier lebte an der Wende vom 16. Jh. zum 17. Jh. eine sadistische Frau, die Blutgräfin genannt wurde. Elisabeth Báthory, eine Nichte des polnischen König Stefan, wurde 1560 geboren und wuchs umgeben von zahlreichen psychopathischen Verwandten in einem Karpatenschloss auf. Schon dass ihre Heimat Transilvanien gewesen sein soll, veranlasste die Wiener zu schaurigen Legenden über sie. Mit fünfzehn Jahren wird sie mit dem einflussreichen Grafen Nárdasdy verheiratet. Fallweise residiert das Ehepaar auch hier in ihrem Wiener Stadtpalais, das auch ungarisches Haus genannt wurde. Nach dem Tod des Gatten lebt die Gräfin sehr zurückgezogen, was sich auch bei den Wienaufenthalten nicht änderte. Ihren Leiblakeien Ficzkü, ein verkrüppelter Zwerg, schickt sie immer wieder aus, um junge Dienstmädchen zu finden, die gewillt waren, seine Herrin auf ihren zahlreichen Reisen zu begleiten. Da der Lohn überdurchschnittlich hoch war, meldeten sich viele Mädchen. In der Augustinergasse kam es in der Nacht immer wieder vor, dass man laute Wehschreie aus dem Haus hörte. Erst als die Gräfin und ihre Bediensteten wieder abreisten, kehrte Ruhe ein. Beim nächsten Wienbesuch erzählte der Lakai, den Mädchen habe es auf dem Familienschloss so gut gefallen, dass sie dort geblieben sind. Im ungarischen Haus wurden viele Jahre später grässlich verstümmelte Mädchenleichen gefunden. In Ungarn wurde der Gräfin der Prozess gemacht; ihre Strafe: Sie wurde lebendig eingemauert. Der Lakai wurde enthauptet.
Bäckerstraße
Trägt seit 1862 diesen Namen, der daher kommt, dass seit dem 14. Jh. hier Bäcker ihr Gewerbe ausübten.
Bäckerstraße 7
Haus Stampa
Der Kern dieses Hauses geht auf das 13. Jh. zurück und wurde vermutlich zwischen 1368 und 1373 durch seinen damaligen Besitzer Jakob von Tirna zum Wohnturm aufgestockt. Der Graubündner Großkaufmann Antonio von Stampa, der das Haus von 1561 bis 1565 besaß, gab ihm seinen Namen. Der Prachtvolle Innenhof stammt aus dieser Zeit. Die wunderschönen schmiedeeisernen Balkongitter stammen aus der Sammlung des Biedermeiermalers Friedrich Amerling (1803-1887). Er studierte an der Akademie der bildenden Künste in Wien. Dann ging er nach Prag, London und Paris, wo er sich bei diversen Malern weiterbildete. Zurück in Wien, erhielt er zahlreiche Aufträge des österreichischen Kaiserhauses und war ein beliebter Porträtmaler; er soll über 1000 Werke geschaffen haben. Den viermal Verheirateten zog es auch in späteren Jahren immer wieder in die Fremde – Italien, Niederlande, Spanien, Skandinavien, Ägypten und Palästina waren seine Ziele. In den Arkadenbögen des Hauses fanden früher Pferde ihren Unterstand.
Bäckerstraße 8
Palais Seitner
Die Geschichte des Gebäudes geht ins 14. Jh. zurück, es soll dem Ratsherrn von Klosterneuburg Wisent auf dem Anger gehört haben. Einer der nächsten Besitzer war Herbort auf der Säule, der einer bedeutenden Wiener Familie angehörte. Drei Jahrhunderte waren vom ständigen Besitzerwechsel geprägt, bis um 1700 Johann Bernhard von Fünfkirchen die Liegenschaft erwarb und 1722 ein adeliges Palais erbauen ließ. Aber auch dieser Besitzer musste bald verkaufen. Kurz darauf erwarb der niederösterreichische Regimentsrat Franz Karl von Seitner das Palais. Die zirka 50 Jahre, die es in seinem Besitz verblieb, prägte auch den Namen des Palais. Die Namen der weiteren Besitzer: 1775 Johann Wilhelm Edler von Rittersburg, 1795 Edler von Ahornfeld, 1806 Carl Graf von Esterhazy. Die französische Schriftstellerin Germain Baronin von Staël verbrachte den Winter 1807/08 hier in diesem Haus. Die Tochter des französischen Finanzministers Necker war mit dem schwedischen Gesandten Baron Staël verheiratet. Die sehr exzentrische Künstlerin, die in Frankreich für zahlreiche Skandale sorgte, sammelte hier in Wien Informationen und Anregungen für ihr meistgelesenes Buch „Über Deutschland“. Von 1820 bis 1941 gehörte das Palais der Familie von Menninger, in dieser Zeit erhielt der barocke Bau auch ein viertes Stockwerk. Heute ist im Erdgeschoß die Buchhandlung Morawa untergebracht.
Bäckerstraße 9
Windhagsches Stiftungshaus
Im Volksmund Huckepackhaus
Nach der Zerstörung durch eine Bombe wurde hier ein modernes Wohnhaus errichtet. Nur das Portal aus 1559 ist noch intakt. Mitte des 16. Jhs. war das Haus im Besitz des Wiener Bürgermeisters Hans von Thaw. Die Windhagsche Stiftung wurde erst 1678 gegründet.
Eine Baronin Windhaag soll hier gelebt haben, die der Sage nach Seelen zwecks Erlösung „huckepack“ trug.
Café Alt Wien