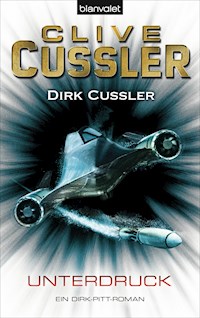
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Die Dirk-Pitt-Abenteuer
- Sprache: Deutsch
Die Sea Arrow ist bei Weitem das schnellste U-Boot, das jemals entwickelt wurde. Doch nun ist ein Schlüsselelement des Prototypen gestohlen worden, und der Entwickler ist tot. Zur selben Zeit verschwinden im Atlantik mehrere Schiffe. Die meisten werden niemals wiedergefunden. Aber wenn doch, befinden sich an Bord grausam verbrannte Leichen. Nur Dirk Pitt, der Direktor der NUMA, ist in der Lage, die Zusammenhänge aufzuklären. Wenn er versagt, bedeutet das das Ende der Welt, wie wir sie kennen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 653
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
CLIVE CUSSLER
&
Dirk Cussler
UNTERDRUCK
Ein Dirk-Pitt-Roman
Deutsch von Michael Kubiak
PROLOGBARBARIGO
OKTOBER 1943INDISCHER OZEAN
Von der wogenden See reflektiert, erschien das Licht des Halbmondes wie ein Streifen brennenden Quecksilbers. Leutnant Alberto Conti erinnerten die funkelnden Wellen an ein Aquarell von Monet, ausgestellt in einem dunklen Raum. Die silbrige Gischt warf das Mondlicht zum Himmel zurück und erhellte weit im Norden eine Wolkenbank. Es waren die Vorboten eines Unwetters, das sich gut fünfzig Meilen entfernt über der fruchtbaren Küste Südafrikas entlud.
Indem er sein Kinn vor der feuchten Brise einzog, die ihm ins Gesicht wehte, wandte er sich zu einem jungen Seemann um, der neben ihm im Kommandoturm des italienischen Unterseebootes Barbarigo stand.
»Romantischer Abend, nicht wahr, Catalano?«
Der Seemann sah ihn fragend an. »Das Wetter ist sehr angenehm, Tenente, wenn Sie das meinen.« Obgleich ebenso erschöpft wie die restliche Mannschaft, bewahrte der Seemann in der Anwesenheit von Offizieren eine stramme Haltung. Es war ein Ausdruck jugendlicher Ehrfurcht, dachte Conti, die sich im Laufe der Zeit gewiss verflüchtigen würde.
»Nein, den Mondschein«, sagte Conti. »Ich wette, er strahlt heute Nacht auch über Neapel und bringt das Kopfsteinpflaster der Gassen zum Glänzen. Es würde mich nicht wundern, wenn in diesem Moment ein attraktiver Offizier der Wehrmacht mit Ihrer Verlobten über die Piazza del Plebiscito flaniert.«
Der junge Seemann spuckte über den Rand des Kommandoturms, dann sah er den Offizier mit glühenden Augen an.
»Meine Lisetta würde eher von der Gaiola-Brücke springen, als sich mit einem deutschen Schwein einlassen. Wegen ihr mache ich mir keine Sorgen, denn sie hat, solange ich weg bin, immer einen Totschläger in der Handtasche. Und sie weiß auch, wie man damit umgeht.«
Conti lachte herzhaft. »Wenn wir alle unsere Frauen auf diese Art und Weise bewaffneten, würden weder die Deutschen noch die Alliierten es wagen, auch nur einen Fuß in unser Land zu setzen.«
Nach Wochen auf See und nach Monaten fern seiner Heimat konnte Catalano über diese Bemerkung nicht lachen. Er suchte den Horizont ab, dann deutete er mit einem Kopfnicken auf den dunklen aufgetauchten Bug, mit dem das Unterseeboot durch die Wellen pflügte.
»Tenente, weshalb sind wir dazu verdonnert worden, für die Deutschen Transportdienste zu übernehmen, anstatt Handelsschiffe zu jagen, wofür die Barbarigo doch eigentlich gebaut wurde?«
»Wir sind zurzeit allesamt Marionetten des Führers, fürchte ich«, erwiderte Conti und schüttelte den Kopf. Wie die meisten seiner Landsleute hatte er keine Ahnung, dass in Rom Kräfte am Werk waren, die in wenigen Tagen Mussolini aus dem Amt jagen und mit den Alliierten einen Waffenstillstand schließen würden. »Kaum zu glauben, dass wir 1939 eine größere U-Boot-Flotte hatten als die Deutschen und jetzt unsere Einsatzbefehle von der deutschen Kriegsmarine erhalten«, fügte er hinzu. »Manchmal fällt es wirklich schwer, die Welt zu verstehen.«
»Ich finde das nicht richtig.«
Conti ließ den Blick über das großflächige Vorderdeck des Unterseeboots gleiten. »Ich vermute, dass die Barbarigo für die jüngsten bewaffneten Konvois zu langsam ist, darum taugen wir nur noch für den Frachtdienst. Zumindest können wir uns damit trösten, dass dieses Schiff aus der Zeit vor seiner neuen Verwendung eine stolze Abschussquote vorweisen kann.«
1938 vom Stapel gelaufen, hatte die Barbarigo zu Beginn des Krieges ein halbes Dutzend Schiffe der Alliierten im Atlantik versenkt. Mit ihrer Wasserverdrängung von über eintausend Tonnen war sie viel größer als die gefürchteten Typ-VII-U-Boote der deutschen Verbände, die in Rudeltaktik operierten. Als die Verluste an deutschen Oberwasserschiffen jedoch zunahmen, verfügte Admiral Dönitz, dass mehrere der großen italienischen sommergibili zu Frachtschiffen umgebaut wurden. Nachdem ihre Torpedos, das Deckgeschütz und sogar eine der Toiletten entfernt worden waren, hatte man die Barbarigo als Frachtschiff nach Singapur geschickt, beladen mit Quecksilber, Stahl und 20-mm-Geschützen für die Japaner.
»Unsere Rückfracht wird als höchst kriegswichtig eingestuft, aus diesem Grund muss jemand das Maultier spielen, nehme ich an«, sagte Conti. Aber tief in seinem Innern ärgerte er sich über den Frachtdienst. Wie in jedem U-Boot-Fahrer steckte auch in ihm ein Jäger, beseelt von dem Wunsch, den Feind zu belauern. Nun jedoch bedeutete jede Feindberührung für die Barbarigo den sicheren Tod. Ihrer Waffen beraubt und sich mit lediglich zwölf Knoten dahinschleppend, war das Unterseeboot eher eine lahme Ente als ein gefürchteter Angreifer.
Als eine schaumgekrönte Welle gegen den Bug schwappte, warf Conti einen Blick auf das Leuchtzifferblatt seiner Armbanduhr.
»Sonnenaufgang in weniger als einer Stunde.«
Indem er den unausgesprochenen Befehl ausführte, setzte Catalano ein Fernglas an die Augen und suchte den Horizont nach anderen Schiffen ab. Der Leutnant folgte seinem Beispiel, ließ den Blick rund um den Kommandoturm wandern und kontrollierte den Ozean und den Luftraum über ihnen. Seine Gedanken wanderten nach Casoria, einer kleinen Stadt nördlich von Neapel, wo seine Frau und sein kleiner Sohn auf ihn warteten. Ein Weingarten gedieh hinter ihrem bescheidenen Bauernhaus, und plötzlich sehnte er sich nach den verträumten Sommernachmittagen, an denen er mit seinem Sohn zwischen den Rebstöcken Fangen gespielt hatte.
Dann hörte er es.
Über dem Dröhnen der beiden Dieselmotoren des U-Boots nahm er noch ein anderes Geräusch wahr. Eine Art höherfrequentes Summen. Er straffte sich und vergeudete keine Zeit mit der Suche nach seiner Herkunft.
»Die Luke schließen!«, rief er.
Sofort ließ er die Turmleiter ins Boot hinab. Das Alarmtauchsignal ertönte einen kurzen Moment später und trieb die Angehörigen der Mannschaft eilends auf ihre jeweiligen Positionen. Im Maschinenraum rastete eine wuchtige Kupplung ein, stoppte die Dieselmotoren und schaltete auf den Antrieb durch eine Reihe batteriebetriebener Elektromotoren um. Meerwasser spülte bereits über das Vorderdeck, während Catalano die Luke des Kommandoturms verschloss und dann in die Zentrale hinabstieg.
Normalerweise vollendete eine gut ausgebildete U-Boot-Crew ein Alarmtauchmanöver in weniger als einer Minute. Aber da dieses Boot als Frachtschiff unterwegs und bis unters Dach beladen war, gab es nur wenig, was dieses Exemplar der italienischen U-Boot-Flotte schnell zustande brachte. Mit quälender Trägheit tauchend, befand es sich fast zwei Minuten, nachdem Conti das sich nähernde Flugzeug entdeckt hatte, endlich vollständig unterhalb der Meeresoberfläche.
Catalanos Stiefel klapperten und klirrten auf der Stahlleiter, während er sich geradezu in den Kontrollraum fallen ließ. Dort suchte er sofort seine während des Alarmtauchmanövers vorgeschriebene Position auf. Das Rattern der Dieselmotoren war verstummt, als sich der elektrische Antrieb einschaltete, und die Mannschaft bewahrte die herrschende Stille, indem sich die Männer nur noch im Flüsterton miteinander verständigten. Der Steuermann der Barbarigo, ein Mann mit rundem Engelsgesicht namens De Julio, rieb sich den Schlaf aus den Augen, während er Conti fragte, ob sie gesichtet worden seien.
»Das konnte ich nicht feststellen. Ich habe das Flugzeug gar nicht gesehen. Aber der Mond steht am Himmel, und die See ist relativ ruhig. Ich bin davon überzeugt, dass wir zu sehen sind.«
»Wir werden es sicher bald erfahren.«
Der Kapitän trat ans Steuer und warf einen Blick auf den Tiefenmesser. »Bringen Sie uns auf zwanzig Meter runter und geben Sie volles rechtes Seitenruder.«
Der Erste Steuermann des U-Boots nickte, während er den Befehl wiederholte, konzentrierte sich auf die Anzeigeinstrumente und packte das große stählerne Steuerrad mit festem Griff. Stille senkte sich auf den Kontrollraum herab, während die Männer darauf warteten, was das Schicksal für sie bereithielt.
Gut dreihundert Meter über ihnen warf ein schwerfälliges englisches Flugboot vom Typ Consolidated PBY »Catalina« zwei Wasserbomben ab, die rotierend wie ein Paar Kreisel ins Meer stürzten. Die Maschine war noch nicht mit Radar ausgerüstet, vielmehr war es der Heckschütze des RAF-Flugzeugs gewesen, der die weiße Heckwelle der Barbarigo auf der kabbeligen Wasseroberfläche entdeckt hatte. Begeistert über seinen Fund, drückte er die Nase gegen das Plexiglasfenster und verfolgte mit großen Augen, wie die beiden Bomben ins Meer eintauchten. Sekunden später schossen zwei Wassersäulen senkrecht in die Luft.
»Ein wenig zu spät«, sagte der Copilot.
»Hatte ich mir schon gedacht.« Der Pilot, ein hochgewachsener Londoner mit einem sorgfältig gestutzten Schnurrbart, legte die Catalina so lässig in eine scharfe Kurve, als schenke er sich eine Tasse Tee ein.
Das Abwerfen der Bomben hatte etwas von einem Ratespiel, da das Unterseeboot bereits außer Sicht verschwunden und nur noch seine Heckwelle zu sehen war. Das Flugzeug musste also schnellstens zuschlagen. Die aus der Luft abgeworfenen Sprengladungen explodierten in einer vorher festgelegten Wassertiefe von nur fünfundzwanzig Fuß. Wenn dem U-Boot genug Zeit geblieben war, wäre es längst tiefer abgesunken.
Der Pilot startete einen weiteren Anflug und orientierte sich nun an einer Markierungsboje, die sie vor dem ersten Angriff abgeworfen hatten. Während er sich nach den Resten der verlaufenden Heckwelle des U-Boots richtete, berechnete er im Kopf seinen weiteren unsichtbaren Kurs, dann lenkte er die dickbäuchige Catalina dicht an der Boje vorbei.
»Wir nähern uns«, meldete er dem Bombenschützen. »Klink aus, wenn du ein Ziel siehst.«
Der Bombenschütze der achtköpfigen Flugzeugbesatzung sichtete das Unterseeboot, legte einen Schalter um und gab das zweite Paar Wasserbomben frei, das unter den Tragflächen der Catalina befestigt war.
»Wasserbomben ausgeklinkt. Diesmal genau im Ziel, würde ich meinen, Captain.«
»Wir sollten zur Sicherheit noch einen dritten Versuch machen und dann zusehen, ob wir irgendwo in der Nähe ein Oberwasserschiff anfunken können«, erwiderte der Pilot und legte die Maschine bereits für eine scharfe Wende auf die Seite.
Beide Explosionen ließen die Schotten der Barbarigo vibrieren. Die Deckenbeleuchtung flackerte, und der Druckkörper ächzte, aber kein Wasserschwall ergoss sich ins Innere. Für einen kurzen Moment schien der betäubende Explosionsknall, der in den Ohren jedes Besatzungsmitglieds ähnlich nachhallte wie die Glocken des Petersdoms, die einzige Folge des Angriffs zu sein. Doch dann wurde das Glockenläuten von einem metallischen Klirren übertönt, das vom Heck ausging und von einem schrillen Jaulen abgelöst wurde.
Der Kapitän spürte, wie sich die Trimmung des U-Boots leicht veränderte. »Irgendwelche Schäden an Bug und Heck oder am Rumpf?«, rief er. »Aktuelle Tauchtiefe?«
»Zwölf Meter, Tenente«, antwortete der Steuermann.
Niemand im Kontrollraum sagte ein Wort. Eine Kakophonie von Zisch- und Knarrlauten lief durch das Schiffsinnere, während das U-Boot tiefer sank. Doch es war das Geräusch, das sie nicht hörten, das in ihren Ohren nachhallte – das laute Klatschen und Klicken eines Wasserbombenpaars, das direkt neben dem getauchten U-Boot explodierte.
Die Catalina hatte es beim letzten Überflug aus weiterer Entfernung abgeworfen, da der Pilot einen nördlichen Kurs angenommen hatte, während die Barbarigo nach Süden abgeschwenkt war. Die letzten dumpfen Explosionen hatten das Unterseeboot kaum erschüttert, während es tiefer sank und außer Reichweite der Wasserbomben gelangte. Die Anspannung entlud sich in einem kollektiven Aufatmen, als die Mannschaftsangehörigen feststellten, dass sie vorläufig in Sicherheit waren. Die einzige Gefahr, die ihnen jetzt noch drohte, wäre ein Oberwasserschiff der Alliierten, das Kurs auf ihre gegenwärtige Position nahm, um sie erneut anzugreifen.
Ihre Erleichterung erhielt jedoch durch einen lauten Ruf des Steuermanns einen abrupten Dämpfer.
»Capitano, wir verlieren an Geschwindigkeit!«
Conti kam heran und kontrollierte eine Batterie von Anzeigeinstrumenten in der Nähe des Steuerstandes.
»Die Elektromotoren sind unversehrt und in Betrieb«, meldete der junge Seemann stirnrunzelnd. »Aber die Antriebswelle dreht sich nicht.«
»Sala soll sich sofort bei mir melden.«
»Jawohl, Capitano.« Ein Seemann in der Nähe des Periskops machte Anstalten, den Chefingenieur der Barbarigo zu holen. Er war gerade zwei Schritte weit gekommen, als der Offizier im Verbindungsgang zum Schiffsheck erschien.
Wie ein Bulldozer schob Chefingenieur Eduardo Sala seine massige Gestalt mit stampfenden Schritten vorwärts. Er kam auf den Kapitän zu und starrte ihn aus harten dunklen Augen an.
»Gut, dass Sie schon da sind«, sagte der Kapitän. »Wie ist unser derzeitiger Betriebszustand?«
»Der Druckkörper ist unversehrt, Signore. Wir haben ein Leck an der Dichtung der Hauptantriebswelle, das wir zurzeit verschließen, zumindest so gut es geht. Außerdem muss ich einen Verletzten melden – Ingenieur Parma ist bei dem Bombenangriff gestürzt und hat sich das Handgelenk gebrochen.«
»Zur Kenntnis genommen, aber was ist mit dem Antrieb? Sind die Elektromotoren außer Betrieb?«
»Nein, Signore. Ich habe die Hauptmotoren stillgelegt.«
»Sind Sie verrückt, Sala? Wir werden angegriffen, und Sie schalten die Motoren aus?«
»Sie sind jetzt bedeutungslos«, sagte der Chefingenieur ruhig.
»Was soll das heißen?«, fragte Conti und wunderte sich, dass der Ingenieur ausweichend antwortete.
»Es ist die Schraube«, sagte Sala. »Ein Flügel wurde durch die Wasserbombe verbogen oder verdreht. Sie ist gegen den Rumpf geschlagen und abgebrochen.«
»Einer der Flügel?«, fragte Conti.
»Nein … die ganze Schraube.«
Die Worte hingen in der Luft wie der Klang einer Totenglocke. Ohne ihren einzigen Propeller würde die Barbarigo von den Wellen hin und her geworfen werden – wie ein Korken. Ihr Heimathafen Bordeaux schien plötzlich genauso weit entfernt zu sein wie der Mond.
»Was können wir tun?«, wollte der Kapitän wissen.
Der vierschrötige Ingenieur schüttelte den Kopf.
»Nichts anderes als beten«, sagte er leise. »Beten, dass die See uns gnädig ist.«
TEIL IPOSEIDON’S ARROW
1
JUNI 2014MOJAVE-WÜSTE, KALIFORNIEN
Es war ein Mythos, entschied der Mann, nichts als ein Ammenmärchen. Oft hatte er gehört, dass die kochende Tageshitze in der Wüste nachts in eisige Kälte umschlug. Das traf jedoch, wie er bezeugen konnte, nicht auf die hochgelegene Wüste von Südkalifornien zu. Schweiß tränkte die Ärmel seines dünnen schwarzen Pullovers und sammelte sich in einer kleinen Pfütze auf seinem Steißbein. Die Temperatur bewegte sich noch immer bei mindestens dreißig Grad Celsius. Er warf einen Blick auf das Leuchtzifferblatt seiner Uhr und holte sich die Bestätigung, dass es in der Tat zwei Uhr morgens war.
Im Grunde machte ihm die Hitze nichts aus. Er war in Mittelamerika geboren worden und hatte sein ganzes Leben lang in den Dschungeln dieser Region gelebt und als Guerillero gekämpft. Aber die Wüste war etwas Neues für ihn, und mit einer solchen nächtlichen Hitze hatte er nicht gerechnet.
Er blickte über das staubige Gelände auf eine Ansammlung leuchtender Straßenlampen. Sie markierten die Einfahrt zu einem ausgedehnten Bergwerksgelände, das sich über die ganze Hügellandschaft vor ihnen erstreckte.
»Eduardo müsste die Position gegenüber dem Wachhaus bald erreicht haben«, sagte er zu dem bärtigen Mann, der neben ihm lag – ausgestreckt in einer Sandkuhle.
Er war von seinen Kampfstiefeln bis hinauf zu der dünnen Mütze, die er sich tief in die Stirn gezogen hatte, ebenfalls ganz in Schwarz gekleidet. Schweiß glänzte auf seinem Gesicht, als er den Kopf hob und aus einer Wasserflasche trank.
»Ich wünschte, er würde sich beeilen. Hier gibt es Klapperschlangen.«
Eine Minute später meldete sich das tragbare Sprechfunkgerät an seinem Gürtel mit einem zweifachen kurzen Rauschen.
»Das ist er. Los geht’s.«
Die Männer erhoben sich und luden sich leichte Rucksäcke auf die Schultern. Lichter der Bergwerksgebäude verteilten sich auf dem Berghang vor ihnen und erhellten die Wüste mit ihrem fahlen Schein. Sie marschierten ein kurzes Stück bis zu einem Maschendrahtzaun, der den gesamten Komplex umgab. Der größere Mann ging auf die Knie hinunter und suchte in seinem Rucksack nach einer Drahtzange.
»Pablo, ich glaube, wir kommen auch ohne Werkzeug auf die andere Seite«, flüsterte sein Partner und deutete auf ein ausgetrocknetes Bachbett, das unter dem Zaun verlief.
Der sandige Untergrund war in der Mitte des Bachbettes noch nicht festgebacken, also konnte er einiges von dem losen Geröll mit dem Fuß beiseiteschieben. Pablo half ihm, indem auch er Sand und Geröll aus dem Weg räumte, bis sie ein kleines Loch unter dem Zaun gegraben hatten. Sie schoben die Rucksäcke hindurch und folgten ihnen.
Eine Kombination leiser rumpelnder Geräusche – das mechanische Getöse eines Tagebaus, der rund um die Uhr in Betrieb war – erfüllte die Luft. Die beiden Männer hielten ausreichend Distanz zu dem Wachhaus, das rechts von ihnen stand, und bewegten sich über den sanft geneigten Berghang hinauf, und zwar in Richtung der eigentlichen Grube. Nach einem Fußmarsch von zehn Minuten erreichten sie eine Gruppe älterer Gebäude, zwischen denen kreuz und quer lange Förderbänder verliefen. Ein Schaufelbagger am hinteren Ende lud haufenweise Erz auf eines der Förderbänder, das einen auf Stelzen ruhenden Sammel- und Einfülltrichter belieferte.
Das Ziel der beiden Männer war eine zweite Gebäudegruppe etwas weiter oben auf dem Berghang. Die Fördergrube versperrte ihnen den Weg und zwang sie, in den Verarbeitungsbereich auszuweichen, wo das Erz zertrümmert und zermahlen wurde. Sie hielten sich im Schatten und huschten an der Eingrenzung entlang, dann nutzten sie die Deckung eines großen Lagerhauses, an dessen Rückseite sie weiterschlichen. Sie erreichten eine ungeschützte Fläche zwischen den Bauten, überquerten sie eilig und liefen geduckt an einem halb im Sand vergrabenen Bunker zu ihrer Linken vorbei. Plötzlich wurde in der Mitte des Gebäudes vor ihnen eine Tür aufgestoßen. Die beiden Männer trennten sich. Juan wich seitlich aus und suchte hinter dem Bunker Deckung, während Pablo zur Gebäudeseite hinüberspurtete.
Er schaffte es nicht.
Ein hellgelber Lichtstrahl flammte auf und blendete ihn.
»Keine Bewegung, oder du bedauerst, noch einen Schritt gemacht zu haben«, sagte eine tiefe, raue Stimme.
Pablo stoppte sofort. Er tat es jedoch auf eine übertriebene Weise, zog gleichzeitig eine kleine Automatic aus dem Halfter an seiner linken Hüfte und versteckte sie in seiner behandschuhten Hand.
Der übergewichtige Wachmann kam langsam näher und hielt seine Taschenlampe auf Pablos Augen gerichtet. Der Wächter konnte erkennen, dass der Eindringling groß – über einen Meter achtzig – und athletisch gebaut war. Seine kaffeefarbene Haut war glatt und weich im Gegensatz zu den schwarzen Augen, die heimtückisch glühten. Ein hellerer Hautstreifen zog sich von seinem Kinn über seinen linken Unterkiefer, das vernarbte Andenken an ein früheres Messerduell.
Der Wachmann sah genug, um zu begreifen, dass er keineswegs einen zufällig eingedrungenen Störenfried vor sich hatte, und blieb in sicherer Entfernung stehen, eine .357er Magnum in der Hand.
»Wie wäre es, wenn du jetzt die Hände auf deinen Kopf legst und mir verrätst, wohin dein Freund verschwunden ist?«
Das Rumpeln eines Förderbandes in der Nähe übertönte Juans Schritte, als er vom Bunker herübersprintete und ein Messer in die Nierengegend des Wachmanns stieß. Das Gesicht des Wächters erstarrte für einen kurzen Moment im Schock, ehe sich sein gesamter Körper anspannte. Reflexartig gab er noch einen Schuss ab, und eine Kugel pfiff hoch über Pablos Kopf hinweg in die Nacht. Dann brach der Wachmann zusammen, wobei sein Körper, als er auf dem sandigen Boden aufschlug, eine Staubwolke hochwirbeln ließ.
Pablo brachte in Erwartung weiterer Wächter, die ihrem Kollegen vielleicht zu Hilfe kamen, seine Pistole in Anschlag, aber nichts geschah. Der Schuss war im Rumpeln der Förderbänder und Stampfen des Gesteinsbrechers untergegangen. Ein kurzer Funkkontakt mit Eduardo bestätigte, dass sich am Vordereingang ebenfalls nichts rührte. Niemand in der gesamten Anlage hatte etwas von ihrer Anwesenheit bemerkt.
Juan wischte das Messer am Hemd des Toten ab. »Wie hat er uns entdeckt?«
Pablo schaute zum Bunker. Zum ersten Mal bemerkte er das rotweiße Schild mit der Aufschrift ACHTUNG: EXPLOSIONSGEFÄHRLICHE STOFFE. »In dem Bunker wird der Sprengstoff gelagert. Offenbar stand er unter besonderer Bewachung.«
Verdammtes Pech, fluchte er halblaut. Das Sprengstofflager war auf seiner Karte nicht eingezeichnet. Nun war ihre gesamte Operation gefährdet.
»Sollen wir ihn in die Luft jagen?«, fragte Juan.
Sie hatten den Auftrag, die Anlage außer Betrieb zu setzen und es wie einen Unfall aussehen zu lassen. Das war jedoch plötzlich unmöglich geworden. Der Sprengstoff im Bunker könnte durchaus nützlich sein, aber vom eigentlichen Ziel war er zu weit entfernt.
»Das lassen wir.«
»Soll der Wachmann hier liegen bleiben?«, wollte Juan wissen.
Pablo schüttelte den Kopf. Er schnallte das Halfter des Mannes ab, dann zog er ihm die Schuhe aus. Nun filzte er die Kleidung des Wächters und förderte seine Brieftasche und eine halbvolle Zigarettenpackung zu Tage. Er verstaute alles zusammen mit der .357er Magnum in seinem Rucksack. Eine langsam größer werdende Pfütze Blut tränkte den Untergrund um seine Füße. Er kickte lockeren Sand über das Blut, dann ergriff er einen Arm des Wächters. Juan bückte sich nach dem anderen Arm, und sie schleiften die Leiche des Wachmanns in die Dunkelheit.
Nach dreißig Metern erreichten sie ein erhöhtes, auf Stelzen ruhendes Förderband, auf dem melonengroße Gesteinsbrocken vorbeiwirbelten. Mit vereinten Kräften hievten sie den Toten mühsam auf das Förderband. Pablo verfolgte, wie der Tote von dem Band mitgenommen und in die Höhe transportiert wurde und in einen großen stählernen Trichter stürzte.
Das Erz, ein gemischtes Fluorcarbonat, bekannt als Bastnäsit, hatte bereits den ersten Gesteinsbrecher und die Sortieranlage durchlaufen. Die Leiche des Wächters geriet in die zweite Phase der Pulverisierung, in deren Verlauf das Erz in baseballgroße Stücke zerschlagen wurde. Eine dritte Zerkleinerungsphase zerstampfte die Steine zu feinem Grieß. Wenn jemand das grobe braune Pulver, das sich auf dem letzten Förderband auftürmte, eingehender untersucht hätte, hätte er einen seltsamen rötlichen Schimmer wahrgenommen, der auf die sterblichen Überreste des Wächters hinwies.
Obgleich das Zertrümmern und Zermahlen wichtige Abschnitte im Produktionsablauf des Tagebaus darstellten, waren sie weniger bedeutsam als das, was im zweiten Gebäudekomplex ein Stück bergauf geschah. Pablo blickte zu den Lichtern der Gebäudegruppe in der Ferne, wo das zermahlene Erz mit Laugen versetzt wurde, die es in die Mineralien aufspaltete, die in ihm enthalten waren. Da sie in diesem Bereich keine Fahrzeuge in Bewegung beobachten konnten, machten er und Juan sich mit zügigem Tempo auf den Weg.
Die Männer mussten die offene Grube an ihrem östlichen Rand passieren und suchten durch einen Sprung in einem offenen Kanal Deckung, als ein Kipplaster vorbeigerumpelt kam. Kurz darauf meldete sich Eduardo per Funk und warnte sie, dass sich ein Sicherheitswächter mit einem Pick-up-Truck auf Kontrollfahrt über das Gelände befand. Sie suchten den Schutz einer Abraumhalde auf und verharrten dort reglos fast zwanzig Minuten lang, bis sich die Rücklichter des Pick-ups in Richtung Haupttor entfernten.
Sie hielten auf die beiden größten Gebäude des oberen Komplexes zu, dann schwenkten sie nach rechts und näherten sich einem kleinen Schuppen, der vor einem hoch aufragenden Propangastank stand. Juan holte die Drahtzange hervor und schnitt eine Öffnung in den Maschendrahtzaun, der den Tank und den Schuppen sicherte. Pablo schlüpfte hindurch, umkreiste den massigen Tank und ging vor seinem Einfüllventil auf die Knie hinunter. Nachdem er eine kleine Plastiksprengstoffladung aus dem Rucksack geangelt hatte, drückte er eine Zündkapsel hinein und klebte die Ladung unter das Ventil. Er stellte den Zeitzünder auf zwanzig Minuten, aktivierte ihn und schlängelte sich durch den Zaun wieder nach draußen.
In ein paar Schritten Entfernung verstreute Pablo die Schuhe, die Pistole und das Halfter des Wächters auf dem Boden. Dann folgte die Brieftasche, immer noch mit seinem Geld gefüllt, dann die zerknautschte Zigarettenpackung. Es hatte zwar wenig Aussicht auf Erfolg, aber eine oberflächliche Überprüfung führte vielleicht zu dem Ergebnis, dass der Wächter in der Nähe eines undichten Gastanks mit offenem Feuer hantiert hatte – und durch die Explosion regelrecht verdampft worden war.
Die beiden Männer huschten zum nächsten Gebäude, einer Wellblechhalle, in der Dutzende von mechanisch betriebenen und mit Auswaschlaugen gefüllte Wannen standen. Eine kleine Gruppe von Arbeitern, die als Nachtwache eingeteilt waren, beaufsichtigten die Wannen.
Die beiden Eindringlinge unternahmen keinen Versuch, in das Gebäude einzudringen; stattdessen galt ihr Interesse einem geräumigen Schuppen an einer Seitenwand der Halle, in der chemische Grundstoffe gelagert wurden. In weniger als einer Minute brachte Pablo eine zweite mit Zeitzünder versehene Sprengladung an einer Palette voller Fässer mit der Aufschrift SCHWEFELSÄURE an und verschwand gleich darauf wieder in der Dunkelheit.
Sie gelangten zu einer zweiten Extraktionshalle etwa einhundert Meter entfernt und warteten, während die Zeitzünder die Sekunden vertickten. Auf der Rückseite der Halle fand Pablo den Absperrhahn der Hauptwasserleitung. Er verfolgte auf seiner Armbanduhr den Lauf des Sekundenzeigers bis kurz vor der Zündung der Sprengladungen, drehte den Absperrhahn zu und unterbrach die Wasserversorgung des Gebäudes.
Ein paar Sekunden später explodierte der Propangastank mit einem Donnern, das von den umliegenden Hügeln widerhallte. Die Nacht wurde zum Tag, als der blaue Explosionsblitz die Landschaft erhellte. Der obere Teil des Gastanks hob wie eine Atlas-Rakete ab und stieg senkrecht in den Himmel, ehe er als Feuerball in die offene Fördergrube in der Nähe stürzte. Brennende Trümmer flogen in alle Richtungen und prasselten auf Gebäude, Fahrzeuge und Produktionsanlagen in einem Umkreis von einhundert Metern herab.
Der Trümmerregen fiel noch hernieder, als die zweite Sprengladung einen Berg mit Schwefelsäure gefüllter Fässer in die erste Extraktionshalle wuchtete. Schreiende Arbeiter ergriffen die Flucht, als die einzelnen Fässer wie Mörsergranaten die Laugenwannen zertrümmerten und einen Tsunami aus giftigen Chemikalien entfesselten. Qualm wallte auf, als die Türen aus den Rahmen gesprengt wurden und die Männer herausgetaumelt kamen.
Juan und Pablo lagen in einem Graben nicht weit von dem zweiten Gebäude und wichen so gut es ging den vereinzelten Trümmern aus, die sich bis zu ihnen verirrten. Dabei beobachteten sie eine Tür. Beim Dröhnen der Explosionen streckten ein paar neugierige Arbeiter die Köpfe heraus, um nachzuschauen, was der Lärm zu bedeuten hatte. Als sie die Rauchwolken und die Flammen im Bereich der Extraktionsanlage erblickten, alarmierten sie ihre Kollegen und rannten dann zu dem anderen Gebäude hinüber, um zu helfen. Pablo zählte sechs Personen, die nacheinander herauskamen, erhob sich und startete in Richtung Tür.
»Bleib hier und gib mir Deckung.«
Während er die Hand nach der Türklinke ausstreckte, wurde sie auf der anderen Seite heruntergedrückt. Er wich mit einem Satz zurück, als eine Frau im Laborkittel herausstürmte. Den Blick auf die nahen Qualmwolken gerichtet, bemerkte sie ihn gar nicht hinter der Tür, während sie in heller Aufregung ihren Kollegen folgte.
Pablo schlüpfte durch die Tür und kam in einen hell erleuchteten Raum, in dem ebenfalls Dutzende weiterer Extraktionswannen standen. Er wandte sich nach links und ging zum hinteren Ende des Gebäudes, dessen Wand von einer Reihe unterschiedlich hoher Vorratstanks verdeckt wurde. Er studierte die Schilder, die Auskunft über ihren jeweiligen Inhalt gaben, und näherte sich dann einem der größeren Behälter. KEROSIN verkündete dessen Schild. Er zog den Ablassschlauch von seinem Messingabsperrhahn ab und öffnete den Hahn. Ein sprudelnder Strahl der feuergefährlichen Flüssigkeit ergoss sich auf den Fußboden und füllte die Halle schnell mit ihren Verdunstungsgasen.
Pablo riss einige Laborkittel von einer Garderobenstange und eilte dann im Gebäude hin und her, um sämtliche Abflussgitter im Fußboden zu verstopfen. Das dünnflüssige Benzin breitete sich schnell aus und bedeckte schon bald den gesamten Hallenboden. Der Brandstifter kehrte zur Tür zurück, dann holte er ein Feuerzeug aus der Hosentasche. Als ein Kerosinrinnsal seine Füße beinahe schon erreicht hatte, bückte er sich, zündete es an und verließ eilends die Halle.
Dank eines niedrigen Verdunstungsgrades und eines hohen Flammpunkts explodierte das Kerosin nicht, sondern entzündete sich zu einem Flammenmeer. Als Brandmelder überall in der Halle reagierten, wurden die Sprinklerdüsen an der Hallendecke aktiviert – aber nur für eine Sekunde, da die Wasserleitungen trocken blieben. Ungehindert breitete sich das Feuer aus.
Pablo drehte sich nicht um, als er zu seinem Partner im Abflussgraben zurückkehrte.
Juan schaute hoch und schüttelte den Kopf. »Eduardo meldet, dass der Wächter vom Haupttor hierher unterwegs ist.«
Sirenen heulten, und Alarmsignale hallten über das Gelände. Aber noch hatte niemand den Rauch bemerkt, der vom Dach des benachbarten Gebäudes aufstieg. Um drei Uhr nachts war niemand darauf vorbereitet, mehrere Brände gleichzeitig bekämpfen zu müssen, und die nächste städtische Berufsfeuerwehr war dreißig Meilen weit entfernt.
Pablo vergeudete keine Zeit damit, das Feuer zu beobachten. Er nickte seinem Partner zu, dann nahm er im Laufschritt Kurs nach Osten. Juan hatte Mühe, sein Tempo zu halten. Sie überquerten die Schotterstraße zum Haupttor, kurz bevor sich von dort ein Fahrzeug näherte. Das Gelände jenseits der Straße war hügelig und ging dann in eine ebene Wüste über. Sie mussten sich in den Sand werfen, als der erste Wagen des Sicherheitsdienstes vorbeiröhrte. Nach einem kurzen Sprint wurden sie von einem weiteren Maschendrahtzaun gestoppt. Sie schnitten eine Öffnung hinein, die gerade groß genug war, um einen von ihnen hindurchschlüpfen zu lassen, während der andere das Drahtgeflecht hochhielt.
Nach einem zügigen Marsch von vierzig Minuten, in denen sie eine Strecke von zwei Meilen überwanden und ihren gesamten Wasservorrat aufbrauchten, erreichten sie den Highway. Parallel dazu bewegten sie sich ein kurzes Stück nach Osten, bis sie einen schwarzen viertürigen Pick-up-Truck sichteten, der unweit eines Durchlasses parkte und für einen flüchtigen Beobachter nicht zu erkennen war. Eduardo, der Dritte in ihrem Bunde, der hinter dem Lenkrad saß, trug im Gegensatz zu ihnen ein verwaschenes Polohemd und rauchte eine Zigarette.
Die beiden Männer nahmen die Rucksäcke von den Schultern, zogen die schwarzen Mützen und Pullover aus und ersetzten sie durch T-Shirts und Baseballmützen.
Jetzt drehte sich Pablo zum ersten Mal um und blickte zum Bergwerksgelände zurück. Wallende Qualmwolken standen über dem Komplex und wurden von den lodernden orangefarbenen Flammen mehrerer Brandherde erleuchtet. Die Feuerlöschausrüstung des Bergwerks war beklagenswert unzureichend und konnte gegen die zahlreichen Brände nur wenig ausrichten. Allem Anschein nach breitete sich die Feuersbrunst immer weiter aus.
Pablo gestattete sich ein zufriedenes Grinsen. Abgesehen von dem plötzlichen Auftauchen des Wachmanns, war alles nach Plan verlaufen. Von den beiden wichtigsten Extraktionsanlagen, dem Herz des gesamten Komplexes, wäre bald nur noch ein Haufen Brandschutt übrig. Da er kein Erz mehr verarbeiten konnte, wäre der Betrieb für mindestens ein Jahr, wenn nicht gar zwei, stillgelegt. Und wenn sie Glück hatten, würde die Katastrophe als unglücklicher Unfall betrachtet werden.
Juan folgte seinem Blick und betrachtete das lodernde Inferno mit sichtlicher Genugtuung. »Sieht fast so aus, als hätten wir den gesamten Bundesstaat angezündet.«
Die fernen Flammen flackerten in den Augen des großen Mannes, als er sich zu Juan umwandte.
»Nein, mein Freund«, sagte er mit einem gemeinen Grinsen. »Wir haben sogar die ganze Welt in Brand gesetzt.«
2
Schweiß perlte am Hals des Präsidenten hinab und tränkte den Kragen seines gestärkten weißen Oberhemdes. Die Quecksilbersäule erreichte beinahe tropische Werte, was für einen Juni in Connecticut ungewöhnlich war. Ein leichter Wind, der vom Block Island Sound herüberwehte, schaffte es nicht, die feuchte Schwüle zu mindern, so dass die Flusswerft einem Treibhaus glich. In Gebäude 260, einer riesigen grünen Konstruktionshalle, kämpfte die Klimaanlage vergebens gegen die Nachmittagshitze.
Die Electric Boat Company hatte an ihrem Standort am Thames River 1910 mit dem Bau von Dieselschiffsmotoren begonnen, doch letztlich wurden die Konstruktion und der Bau von Unterseebooten zum Haupterwerbszweig der Firma. Die Werft in Groton lieferte ihr erstes U-Boot im Jahr 1934 an die Navy aus und war seitdem maßgeblich an der Konstruktion und dem Bau jeder weiteren wichtigen Klasse amerikanischer Unterwasserkriegsschiffe beteiligt. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt wartete in der grünen Montagehalle der imposante Rohbau der North Dakota, das jüngste Jagd-U-Boot der Virginia-Klasse, auf seine endgültige Fertigstellung.
Schwerfällig und mit einem missgelaunten Knurren stieg der Präsident von einer Gerüsttreppe, die vom Kommandoturm der North Dakota herabführte, auf den Zementboden der Halle. Als überdurchschnittlich große Person, die enge Räume hasste, dankte er seinem Schicksal, dass der Rundgang durch das Schiffsinnere beendet war. Wenigstens war es innerhalb des Boots kühler gewesen. Angesichts der Tatsache, dass die Wirtschaft darbte und der Kongress es nicht schaffte, tragfähige Beschlüsse zu fassen, erschien der Besuch einer Schiffswerft als unwichtigster Punkt auf seiner Tagesordnung. Aber er hatte dem Marineminister versprochen, dass er seinen Teil dazu beitragen wolle, die Moral der Werftarbeiter anzuheben. Während eine kleine Delegation eilig auf ihn zukam, unterdrückte er sein Missfallen, indem er sich bewundernd über die Dimensionen des U-Boots äußerte.
»Eine wirklich erstaunliche Konstruktion.«
»Ja, Sir«, sagte ein blonder Mann in einem Maßanzug, der an der Seite des Präsidenten klebte, als sei er durch eine unsichtbare Fessel mit ihm verbunden. »Sie ist wirklich ein technisches Wunderwerk.« Assistant Chief of Staff Tom Cerny hatte sich während seiner Tätigkeit auf dem Capitol Hill auf Verteidigungsfragen spezialisiert, ehe er in die Administration gewechselt war.
»Sie ist ein wenig länger als die Boote der Seawolf-Klasse, aber verglichen mit einem Trident geradezu winzig«, sagte der Fremdenführer, ein jungenhafter leitender Ingenieur von Electric Boat. »Die meisten Menschen sind daran gewöhnt, diese Schiffe im Wasser zu sehen, wo zwei Drittel ihrer Masse untergetaucht und daher unsichtbar sind.«
Der Präsident nickte. Das U-Boot, das auf mächtigen Stützblöcken ruhte, erdrückte sie fast mit seinem mehr als einhundertzwanzig Meter langen Rumpf.
»Sie wird unser Waffenarsenal entscheidend verstärken. Ich danke Ihnen, dass Sie mir ermöglicht haben, unsere neueste Errungenschaft aus der Nähe betrachten zu können.«
Admiral Winter, ein Mann mit einem Gesicht, das wie aus Granit gemeißelt schien, trat vor.
»Mr. President, sosehr wir uns gefreut haben, Ihnen einen ersten Blick auf die North Dakota zu gestatten, sie war doch nicht der wahre Grund, weshalb wir Sie hierher eingeladen haben.«
Der Präsident nahm einen weißen Schutzhelm ab, auf dem das Präsidentensiegel klebte, und wischte sich etwas Schweiß von der Stirn.
»Wenn am Ende ein eisgekühlter Drink und eine bessere Klimaanlage auf mich warten, machen Sie ruhig weiter.«
Er wurde durch die Halle zu einer kleinen Tür geführt, die von einem Sicherheitsmann in Uniform bewacht wurde. Die Tür wurde aufgeschlossen, und der Präsident und seine Begleitung traten ein. Dabei wurden ihre Gesichter von einer Videokamera über der Tür aufgezeichnet.
Der Admiral schaltete mehrere Deckenlampen ein, die ein Montagegerüst von gut einhundertdreißig Metern Länge beleuchteten. Der Präsident sah ein weiteres U-Boot, das sich offenbar kurz vor seiner Fertigstellung befand, aber dieses Schiff machte einen völlig anderen Eindruck als alles, was er je gesehen hatte.
Es war etwa halb so groß wie die North Dakota und hatte ein vollkommen anderes Aussehen. Sein ungewöhnlich schlanker jettschwarzer Rumpf lief zum Bug spitz zu. Ein niedriger, eiförmiger Kommandoturm erhob sich nur wenige Meter über das Oberdeck. Zwei große stromlinienförmige Behälter saßen dicht vor dem Heck und verliehen ihm Ähnlichkeit mit dem Schwanz eines Delphins. Aber das ungewöhnlichste Merkmal war ein Paar einziehbarer Stabilisatoren, geformt wie dreieckige Flossen, die auf beiden Seiten aus dem Bootsrumpf ragten. An ihren Unterseiten hingen vier große röhrenförmige Kanister.
Die Form erinnerte den Präsidenten an einen riesigen Teufelsrochen, den er einmal bei einem Angelausflug vor Baja California gesehen hatte.
»Was um Himmels willen ist denn das?«, fragte er. »Ich habe gar nicht gewusst, dass wir auch noch etwas anderes bauen als Boote der Virginia-Klasse.«
»Sir, das ist die Sea Arrow«, sagte der Admiral. »Sie ist ein Prototyp und wurde im Rahmen eines geheimen Forschungs- und Entwicklungsprogramms gebaut, um hochentwickelte Technologien zu testen.«
Cerny wandte sich an den Admiral. »Weshalb wurde der Präsident über dieses Programm nicht informiert? Ich würde gern erfahren, wie es finanziert wurde.«
Der Admiral musterte den Assistenten mit der Herzlichkeit eines verhungernden Pitbulls. »Die Sea Arrow wurde mit finanzieller Unterstützung der Defense Advanced Research Projects Agency und des Office of Naval Research entwickelt und gebaut. Gerade in diesem Moment wird der Präsident von seiner Existenz in Kenntnis gesetzt.«
Der Präsident ignorierte die beiden Männer, ging am Schiff entlang und betrachtete die seltsamen Anhängsel am Rumpf. Er studierte die in einem konzentrischen Kreis angeordneten Röhren, die aus dem Bug herausragten, dann schlenderte er zum Heck des U-Boots weiter und stellte fest, dass es keine Schrauben besaß. Fragend sah er Winters an.
»Okay, Admiral, Sie haben meine Neugier geweckt. Erzählen Sie mir von der Sea Arrow.«
»Mr. President, ich gebe Ihre Bitte an Joe Eberson weiter, der dieses Projekt leitet. Sie haben Joe bereits kennengelernt. Er ist der für die Abteilung Sea Platforms Technology zuständige Direktor der DARPA.«
Ein bärtiger Mann mit gelehrtem Blick drängte sich in die vordere Reihe der Gruppe. Als er in gemessenem Tonfall zu sprechen begann, war ein leichter Tennessee-Akzent nicht zu überhören.
»Sir, der Bau der Sea Arrow stellte – oder stellt – einen mehrere Generationen überwindenden Sprung in der U-Boot-Technik dar. Wir umgehen den traditionellen Entwicklungsprozess, indem wir einen ganzen Katalog spitzentechnologischer Errungenschaften und zukunftsweisender Theorien in die Konstruktion des Schiffes integrieren. Angefangen haben wir mit einer genau abgestimmten Anzahl technischer Einrichtungen, die sich zum damaligen Zeitpunkt noch im Entwicklungsstadium befanden. Dank der intensiven Anstrengungen zahlreicher unabhängiger Ingenieurteams darf ich zu meiner großen Freude melden, dass wir dicht davor stehen, das höchstentwickelte Jagd-U-Boot aller Zeiten ins Rennen zu schicken.«
Der Präsident nickte. »Dann erzählen Sie mir mal etwas über all diese seltsamen Auswüchse oder Anhängsel, wie immer man es nennen will. Das Schiff ähnelt damit eher einer Flugechse oder einem Saurier aus grauer Vorzeit.«
»Fangen wir am Heck an. Sie bemerken sicher, dass die Sea Arrow keinen Propeller hat.« Eberson deutete auf die abgerundeten Aufsätze dicht vor dem Schwanzende. »Dafür sind diese beiden Außenbehälter da. Die Sea Arrow verfügt über ein wellenloses Strahlantriebssystem. Wie Sie vorhin gesehen haben, kommt in der North Dakota ein Atomreaktor zum Einsatz, der eine herkömmliche Dampfturbine mit Energie versorgt, die ihrerseits eine Welle mit Schiffsschraube antreibt. Bei der Sea Arrow haben wir uns für ein externes Antriebssystem entschieden, das seine Energie direkt vom Reaktor bezieht. Jeder dieser ausgestellten Behälter soll einen Motor beherbergen, der von einem Hochleistungspermanentmagneten angetrieben wird und ein Wasserstrahlpump-Antriebssystem steuert.« Eberson lächelte. »Abgesehen davon, dass dieses System erheblich leiser arbeitet, zeichnet es sich durch einen weitaus geringeren Platzbedarf aus, so dass wir die Größe des Schiffes enorm verringern konnten.«
»Was muss ich unter Hochleistungspermanentmagnet-Motoren verstehen?«
»Sie stellen einen evolutionären, wenn nicht gar revolutionären Fortschritt in der Entwicklung von Elektromotoren dar, ermöglicht durch jüngste Durchbrüche in der Materialforschung. Aus einem Mix von Metallen Seltener Erden werden extrem starke Magneten hergestellt, die dann in Hochleistungsgleichstrommotoren Verwendung finden. Wir haben umfangreiche Forschungen betrieben, um diese Motoren zu perfektionieren – und sind überzeugt, dass sie, was den Antrieb unserer zukünftigen Kriegsschiffe betrifft, eine vollkommen neue Ära einläuten.«
Der Präsident blickte durch die Schlitze eines Leitblechs an einem der Motorengehäuse und sah von oben Licht hereinfallen.
»Sieht aus, als sei das Gehäuse leer.«
»Die Motoren wurden noch nicht geliefert und eingebaut. Der erste soll nächste Woche vom Entwicklungslabor der Navy in Chesapeake, Maryland, herübergeschickt werden.«
»Sind Sie sicher, dass er funktioniert?«
»Wir haben zwar noch nie Motoren von dieser Größe eingesetzt, aber wir wissen aus den Labortests, dass sie die erwartete Leistung bringen werden.«
Der Präsident bückte sich, als er unter einem der ausgefahrenen Stabilisatoren hindurchging, und warf dann einen Blick zu zwei tonnenförmigen Erhebungen vor und hinter dem Kommandoturm hinauf.
Eberson folgte ihm und setzte seinen Vortrag fort.
»Die flügelähnlichen Gebilde sind ein- und ausfahrbare Stabilisatoren für Hochgeschwindigkeitsmanöver. Sie werden automatisch eingefahren, wenn die Geschwindigkeit des Bootes unter zehn Knoten absinkt. Die Zylinder unter den Stabilisatoren sind Torpedo-Magazine, die jeweils vier Torpedos fassen. Die Magazine können in kürzester Zeit nachgeladen werden, nachdem die Stabilisatoren eingefahren wurden.«
Eberson deutete auf die beiden tonnenförmigen Objekte über ihnen. »Das sind Unterwasser-Gatling-Kanonen. Sie ähneln den Kanonen auf Oberwasserschiffen, die im Schnellfeuermodus Uranmunition verschießen und der Raketenabwehr dienen. Unsere Versionen wurden für den Unterwassereinsatz modifiziert, arbeiten mit Druckluft und sollen vor Torpedos schützen. Natürlich vertrauen wir darauf, dass die meisten feindlichen Torpedos gar nicht erst in unsere Nähe kommen.«
Er folgte dem Präsidenten, der den Blick jetzt über den gesamten Rumpf schweifen ließ.
»Wie Sie sehen, ist der Kommandoturm stromlinienförmig gehalten, um hohe Geschwindigkeiten zu ermöglichen.«
»Ich kann nirgendwo ein Periskop sehen.«
»Die Sea Arrow verfügt auch über kein Periskop, zumindest über keins im traditionellen Sinn«, sagte Eberson. »Sie verwendet eine Art ferngesteuerte Videokamera, die an einem Glasfaserkabel hängt. Sie kann in einer Tiefe von knapp dreihundert Metern herausgelassen werden und liefert der Mannschaft ein HD-Bild von allem, was sich über dem Wasserspiegel ereignet.«
Der Präsident ging zu dem spitz zulaufenden Bug weiter und streckte die Hand aus, um eine der schlanken Röhren zu streicheln, die wie eine dünne Lanze nach vorn gerichtet war. »Und was ist das?«
»Das ist das entscheidende Element, das die Sea Arrow ihrem Namen gerecht werden lässt«, sagte Eberson. »Dabei handelt es sich um eine weiterführende Verbesserung, die wir hoffentlich zur Anwendung bringen können. Sie basiert auf einer bahnbrechenden technischen Entwicklung eines unserer Vertragspartner in Kalifornien …«
Admiral Winters unterbrach ihn. »Mr. President, vielleicht sollten wir jetzt einfach zu einer schnellen Besichtigung an Bord gehen. Anschließend haben wir eine kurze Präsentation vorbereitet, die all Ihre Fragen beantworten dürfte.«
»Na schön, Admiral. Auch wenn ich noch immer auf meinen Drink warte.«
Der Admiral veranstaltete mit der Gruppe eine kurze Führung durch das Schiff, dessen stromlinienförmiges Innere mit seinem modernen schnittigen Design und der hohen Anzahl automatisierter Systeme in einem scharfen Kontrast zur North Dakota stand. Der Commander in Chief blieb schweigsam, während er das hochtechnisierte Kommandozentrum, die wenigen üppig ausgestatteten Mannschaftsunterkünfte und die eigentümlich anmutenden und mit Sicherheitsgurten ausgestatteten Polstersessel, die im gesamten Schiff verteilt waren, betrachtete.
Nach dem Rundgang wurde der Präsident in einen abhörsicheren Konferenzraum geleitet, wo er endlich auch seinen eisgekühlten Drink erhielt. Sein gewöhnlich freundliches Auftreten hatte einer härteren, strengeren Haltung Platz gemacht, die auch von seinem Assistenten Cerny übernommen wurde.
»Also gut, Gentlemen«, polterte der Präsident nun los. »Was genau geht hier vor? Ich sehe viel mehr als eine Testanlage für neue Technologien. Dies ist ein seetüchtiges Schiff kurz vor dem Stapellauf.«
»Sir«, sagte der Admiral und räusperte sich. »Was uns da in Gestalt der Sea Arrow zur Verfügung steht, dürfte die Spielregeln von Grund auf ändern. Wie Sie wissen, sehen sich unsere Seestreitkräfte seit Neuestem einer verstärkten Herausforderung gegenüber. Die Iraner haben von den Russen ein ganzes Bündel neuer Unterwassertechnologien erhalten und arbeiten mit Hochdruck daran, ihre Flotte aus U-Booten der Kilo-Klasse zu vergrößern. Die Russen selbst haben mit Hilfe der Gewinne aus dem Ölgeschäft ihre schiffbaulichen Aktivitäten gesteigert, um ihre veraltete Flotte zu ersetzen. Und dann sind da natürlich auch noch die Chinesen. Während sie weiterhin behaupten, ihre Aufrüstungsbemühungen gelten nur der Verteidigung, ist es kein Geheimnis, dass sie ihre Hochseeflotte ständig vergrößern. Wie wir aus zuverlässigen Quellen wissen, ist damit zu rechnen, dass ihr Atom-U-Boot vom Typ 097 jederzeit seinen Dienst aufnehmen wird. Das alles steigert die Bedrohung im Pazifik, im Atlantik und im Persischen Golf.«
Der Admiral sah dem Präsidenten in die Augen und lächelte grimmig. »Wir hingegen verfügen über eine stetig schrumpfende Flotte, da die Kosten für jedes neue Schiff in astronomische Höhen steigen. Bei einem Stückpreis von zwei Milliarden wissen wir alle, dass bei einem Etat, der ständig neuen Kürzungen unterworfen ist, nur eine begrenzte Anzahl von U-Booten der Virginia-Klasse fertiggestellt werden können.«
»Die Staatsverschuldung ist immer noch völlig außer Kontrolle«, sagte der Präsident, »daher muss auch die Navy ihre bittere Medizin schlucken – wie jeder andere.«
»Genau, Sir. Womit wir bei der Sea Arrow sind. Da wir den langwierigen Prozess der Forschung bis zur Produktionsreife schlicht ausschalten und uns aus Gründen der Wirtschaftlichkeit aus dem Virginia-Programm bedienen konnten, gelang es uns, sie zu einem Bruchteil der Kosten zu konstruieren, die für die North Dakota zu Buche schlugen. Wie Sie sehen, erfolgte der Bau unter höchster Geheimhaltung. Wir haben mit Absicht parallel zur Dakota an ihr gearbeitet, um die Aufmerksamkeit von ihr abzulenken und die Anlieferung von wichtigen Komponenten zu ermöglichen, ohne Aufsehen zu erregen. Wir hoffen, sie unbemerkt zu Probefahrten auslaufen lassen zu können, während die North Dakota offiziell in Dienst gestellt wird.«
Der Präsident runzelte die Stirn. »Sie haben es auf hervorragende Art und Weise geschafft, ihre Existenz bis zum jetzigen Zeitpunkt geheim zu halten.«
»Vielen Dank, Sir. Wie Dr. Eberson bereits hervorhob, sehen Sie das technisch höchstentwickelte Unterseeboot vor sich, das je gebaut wurde. Der wellenlose Strahlantrieb, die außen liegenden Torpedorohre und das Torpedo-Abwehrsystem entsprechen dem neuesten Stand der Technik. Doch es gibt noch ein zusätzliches Konstruktionselement, das die Sea Arrow zu etwas ganz Besonderem macht.«
Eberson hatte bereits eine DVD eingelegt und einen Beamer angeschaltet.
Auf einem Whiteboard erschienen Bilder vom offenen Heck eines kleinen Bootes, das auf den Wellen eines Bergsees schaukelte. Zwei Männer hoben einen hellgelben torpedoförmigen Gegenstand vom Deck und über den Bootsrand. Der Präsident konnte an seinen flügelförmigen Auswüchsen erkennen, dass es sich um die mittels einer Fernbedienung gesteuerte Nachbildung der Sea Arrow handelte.
»Das ist ein maßstabsgetreues Modell«, erklärte Eberson. »Es wurde in allen Details nachgebaut und mit dem gleichen Antriebssystem ausgerüstet.«
Während das Modell zu Wasser gelassen wurde, erschien auf dem Whiteboard das von einer Bordkamera übertragene Bild. Eine Reihe von Zahlen am unteren Rand des Bildes lieferte Informationen über Geschwindigkeit, Tiefe, Schwimmlage und Schlingerbewegung des Modells.
Es sank ein Stück ins grün schillernde Wasser und begann zu beschleunigen. Schwebeteilchen im Wasser des Sees tanzten an der Kameraoptik vorbei, während das kleine Tauchboot Geschwindigkeit aufnahm. Plötzlich bestand das Bild auf dem Whiteboard nur noch aus einem dichten Wirbel von kleinen Bläschen. Das dichte Schneegestöber dauerte an, während das Modell weiterhin sein Tempo steigerte. Der Mund des Präsidenten klappte auf, als die Geschwindigkeitsangabe am Rand des Bildes in den dreistelligen Bereich gelangte. Schließlich wurde das Modell langsamer und tauchte zur Wasseroberfläche auf, von wo es geborgen wurde, ehe die Videoaufnahme endete.
Für einen Moment füllte vollkommene Stille den Raum, ehe der Präsident mit leiser Stimme das Wort ergriff. »Soll ich das, was ich soeben gesehen habe, so verstehen, dass dieses Modell unter Wasser eine Geschwindigkeit von einhundertfünfzig Meilen pro Stunde erreicht hat?«
»Nein, Sir«, erwiderte Eberson lächelnd. »Es erreichte eine Geschwindigkeit von einhundertfünfzig Knoten, was etwa einhundertfünfundsiebzig Meilen in der Stunde entspricht.«
»Das ist unmöglich. Soweit ich weiß, sind selbst mit der ausgefeiltesten Antriebstechnologie nicht mehr als siebzig oder achtzig Knoten zu erreichen. Selbst die North Dakota schafft nur fünfunddreißig.«
»Haben die Russen nicht einen Torpedo entwickelt, der schneller ist als einhundert Knoten?«, fragte Cerny.
»Ja, sie haben den Shkval«, bestätigte Eberson, »einen raketengetriebenen Hochgeschwindigkeitstorpedo. Ein ähnliches Prinzip wird auch bei der Sea Arrow angewendet. Nicht der Antrieb als solcher ermöglicht diese hohe Geschwindigkeit, sondern die Superkavitation.«
»Haben Sie Nachsicht mit meinem Mangel an technischem Wissen«, erwiderte der Präsident, »aber hat Superkavitation nicht etwas mit Turbulenzen im Wasser zu tun?«
»Ja. In diesem Fall geht es darum, eine Gasblase um ein Objekt zu schaffen, das sich unter Wasser bewegt. Die Blase verringert den Widerstand des Wassers und ermöglicht höhere Geschwindigkeiten. Die Röhrenbündel am Bug der Sea Arrow sind Teil des Superkavitationssystems, das wir installieren wollen. In Kombination mit den Hochleistungsmagnetmotoren erwarten wir, diese Geschwindigkeiten zu erreichen – ohne die Leistungsbeschränkungen, mit denen die Russen bei ihren Raketentorpedos kämpfen müssen.«
»Vielleicht klappt es ja«, sagte Cerny, »aber es besteht doch wohl ein erheblicher Unterschied zwischen einem Torpedo und einem siebzig Meter langen Unterseeboot.«
»Der Unterschied macht sich im Wesentlichen erst dann bemerkbar, wenn es um die Kontrolle bei hohen Geschwindigkeiten geht«, sagte Eberson. »Die Saurierflügel der Sea Arrow, wie der Präsident sie genannt hat, tragen dazu bei, dem Schiff die notwendige Stabilität zu verleihen. Das Superkavitationssystem selbst wird direkt auf die Kontrolle des Schiffes einwirken können, indem es Größe und Form der Gasblase bestimmt. Das Ganze ist bei einem Schiff von diesen Dimensionen zurzeit noch graue Theorie, aber unser Lieferant des Systems ist von seinen Fähigkeiten überzeugt. Ich selbst werde in der nächsten Woche einem abschließenden Praxistest des Modells beiwohnen.«
Der Präsident setzte sich und massierte sein Kinn. Schließlich sah er den Admiral mit einem vielsagenden Blick an. »Admiral, wenn die Sea Arrow tatsächlich so funktioniert wie angekündigt, was genau bedeutet das?«
»Mit der Sea Arrow gewinnen wir einen Vorsprung von etwa zwanzig Jahren vor unseren nächsten Feinden. Der von den Chinesen, Russen und Iranern ausgeübte Druck wird wirksam neutralisiert. Wir verfügen über eine Waffe, die nahezu unverwundbar ist. Und mit nur einer Handvoll Sea Arrows könnten wir an jedem Punkt der Erde so gut wie augenblicklich zuschlagen. Tatsächlich bedeutet dies, Sir, dass wir uns nicht mehr ständig den Kopf über die Sicherheit auf den Weltmeeren zerbrechen müssen.«
Der Präsident nickte. Die Hitze und die Luftfeuchtigkeit schienen sich aus dem Raum zu verflüchtigen, und zum ersten Mal an diesem Tag lächelte er.
3
Die für Südkalifornien typische frühmorgendliche Düsternis mit ihrer von Nebelnässe schweren Luft hing über dem Jachthafen. Joe Eberson stemmte sich aus dem Fahrersitz eines Mietwagens und ließ den Blick prüfend über den Parkplatz wandern, dann ging er zum Kofferraum und holte einen Köderkasten und eine Angelrute heraus. Beides hatte er am Vortag gekauft, kurz nachdem seine Maschine von der Ostküste auf dem Lindbergh Field in San Diego gelandet war. Er stülpte sich einen Anglerhut auf den Kopf und spazierte in den ausgedehnten Bootshafen von Shelter Island.
Eberson ignorierte das Summen eines E-2-Hawkeye-Luftraumüberwachungs-Flugzeugs, das soeben von der Coronado Naval Air Station auf der anderen Seite des Hafens aufstieg, während er an Dutzenden von kleinen Segelbooten und Motorjachten vorbeischlenderte. Wie Eberson richtig vermutete, waren sie die Spielgeräte von Freizeitkapitänen, und die meisten von ihnen verließen ihre Liegeplätze eher selten. Als er einen etwa dreizehn Meter langen Kabinenkreuzer mit breitem offenem Achterdeck entdeckte, steuerte er darauf zu. Das Boot hatte sicherlich seine fünfzig Jahre auf dem Buckel, aber sein strahlend weißer Rumpf und seine auf Hochglanz polierten Verzierungen verrieten einen Besitzer, der ihm stets eine liebevolle Pflege hatte angedeihen lassen. Ein Blubbern am Heck deutete darauf hin, dass der Motor bereits warm lief.
»Joe, da sind Sie ja«, sagte ein Mann, der aus der Kabine heraustrat. »Wir waren schon fast so weit, ohne Sie abzulegen.«
Mit seiner schmächtigen Gestalt, der dicken Brille und dem weißen auf Bürstenlänge gestutzten Haar war Dr. Carl Heiland fast so etwas wie der Prototyp des Elektroingenieurs. Seine Augen funkelten, und um seine Lippen spielte ständig ein Lächeln und verkündete, dass er sogar bereits um sechs Uhr morgens unter Hochspannung stand.
Unausgeschlafen und erschöpft von seinem Kontinentalflug, vermittelte Eberson den genau entgegengesetzten Eindruck. Vorsichtig kletterte er an Bord und schüttelte dem Bootseigner die Hand.
»Tut mir leid, dass ich mich verspätet habe«, sagte Eberson und unterdrückte ein Gähnen. »Nachdem ich das Hotel verlassen hatte, habe ich wohl die falsche Richtung eingeschlagen und es erst bemerkt, als ich plötzlich vor Sea World stand. Ich glaube, selbst Shamu, der Orca vom Dienst, hat noch geschlafen.«
»Dadurch hatte ich genug Zeit, alles an Bord zu schaffen.« Heiland deutete mit einem Kopfnicken auf eine gemischte Kollektion von Kisten, die mit Gurten an der Reling befestigt waren. »Kommen Sie, wir stellen Ihre Ausrüstung zu unserem Angelzeug.« Er griff nach Ebersons Angelrute, wobei ihm dessen Kopfbedeckung ins Auge fiel. Dann brach er in schallendes Gelächter aus.
»Wollen Sie heute Bachforellen fangen?«
Eberson nahm den Hut ab und inspizierte die abgenutzte Krone. Ein unregelmäßiges Band bunter Süßwasserfliegen umgab sie. »Sie haben doch gesagt, ich solle als Angler herkommen.«
»Ich bezweifle, dass das irgendjemand anders aufgefallen ist«, prustete Heiland, dann wandte er sich zum Kabineneingang um. »Manny, du kannst starten.«
Ein dunkelhäutiger Mann in einer Jeans mit abgeschnittenen Beinen erschien und machte die Leinen los. Sekunden später stand er bereits hinter dem Ruder und lenkte das Boot in den Hafen von San Diego, der wie ein Hufeisen geformt war. Sie wichen einem hereinkommenden Amphibienschiff der Navy aus, ehe sie den Kanal verließen und in den Pazifik gelangten. Manny schob den Gashebel auf volle Kraft, nahm Kurs nach Südwesten und pflügte durch eine leichte Dünung, die durch eine Seebrise erzeugt wurde. Schon bald machte sich bei Eberson ein Anflug von Unwohlsein bemerkbar, und er schlängelte sich an Manny vorbei, um sich in der Hauptkabine einen gemütlichen Sitzplatz zu suchen.
Heiland schenkte ihm eine Tasse Kaffee ein und leistete ihm am Tisch in der Kombüse Gesellschaft. »Dann erzählen Sie mal, Joe, wie stehen in Arlington die Aktien?«
»Wie Sie wissen, haben wir dem Präsidenten soeben reinen Wein eingeschenkt. Nichtsdestoweniger stehen wir unter dem üblichen Druck, trotz geringerer Mittel mehr zu leisten. Ich fürchte, es wäre reines Glück, wenn wir im nächsten Jahr eine schmerzhafte Etatkürzung vermeiden könnten.«
»Ich dachte mir schon, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis auch wir mit der Sparaxt Bekanntschaft machen. Ich bin nur froh, dass ich noch für fünf Jahre Arbeit habe, die vertraglich abgesichert ist.«
»Sie brauchen sich keine Sorgen zu machen, Carl. Die Arbeit Ihrer Firma ist von höchster Bedeutung. Ich habe sogar rückwirkend die Genehmigung erhalten, mit den für Block Zwei vorgesehenen Verbesserungen fortzufahren – wenn Sie einen eindeutigen Nachweis über die Einsatzfähigkeit liefern können. Ich nehme an, dass dies auch der Grund ist, weshalb Sie mich kurzfristig hierher eingeladen haben.«
Heiland musterte ihn argwöhnisch. »Es ist ein gewagtes Spiel, auf das Sie sich da einlassen. Sie haben ja noch nicht einmal das Block-Eins-System in einem normalen Einsatz getestet.«
Eberson verdrängte einen Anfall von Übelkeit, um Heilands Lächeln zu erwidern. »Carl, wir wissen beide, dass es funktionieren wird.«
»Haben Sie die Elemente des Antriebssystems schon erhalten?«
»Ja, allerdings müssen wir noch einige Materialfragen klären.« Eberson sah Heiland erwartungsvoll an. »Aber wir interessieren uns mehr für die Block-Zwei-Modifikationen.«
»Auch dort gab es Probleme, aber ich glaube, wir haben den Durchbruch geschafft, an dem wir die ganze Zeit gearbeitet haben.«
Eberson lachte zufrieden. »Deshalb habe ich ja gleich die erste Maschine genommen, die in Washington gestartet ist. Ich weiß, dass Sie jeden Aufwand scheuen und am liebsten völlig unauffällig arbeiten.«
»Angesichts der Geheimhaltungsstufe möchte ich möglichst keine Aufmerksamkeit auf unsere Praxistests lenken. Was Block Eins betrifft, da hat es anscheinend funktioniert, also unternehmen wir heute lediglich einen kleinen Angelausflug.« Erneut warf er einen Blick auf Ebersons Hut und lächelte.
»Wir haben uns alle Mühe gegeben, alles so gut es ging unter Verschluss zu halten. Andererseits haben Sie uns ja auch nicht gerade mit technischen Daten verwöhnt.«
»Je weniger Augen uns ins Visier nehmen, desto besser.«
Eberson trank einen Schluck von seinem Kaffee, dann lehnte er sich über den Tisch.
»Meinen Sie denn, dass wir die theoretisch errechneten Leistungswerte erreichen werden?«
Heiland nickte mit glänzenden Augen. »Das werden wir schon in Kürze erfahren.«
Ein paar Minuten später schaltete Manny den Motor aus und gab ihnen ein Zeichen, dass sie ihr Testgebiet erreicht hatten. Sie befanden sich in mexikanischen Gewässern, fast zwanzig Meilen von der Küste entfernt und in ausreichendem Abstand zu den bevorzugt benutzten Wasserstraßen der Hobbysegler aus San Diego. Das Meer war in dieser Region zu tief, um den Anker zu werfen, daher trieb das Boot mit dem Wind, während sich Heiland an die Arbeit machte.
Er ignorierte einen langen rechteckigen Kasten, der an der Reling vertäut war, und öffnete zuerst mehrere kleinere Kisten, die zwei Laptops sowie ein Gewirr von Kabeln und Anschlussschnüren und entsprechende Verbindungsmodule enthielten. Er stellte die Computer auf eine niedrige Bank und begann sie zu konfigurieren.
Manny reckte den Kopf aus dem Steuerhaus. »Doc, ein Frachter kommt auf uns zu.«
Heiland blickte über die Schulter. »Der hat uns längst passiert, wenn wir so weit sind anzufangen.« Er wandte sich wieder den Laptops zu.
Eberson ließ sich auf die große Kiste sinken und verfolgte, wie sich das Schiff näherte. Es war ein mittelgroßer Frachter und noch ziemlich neu mit einer schnittigen Silhouette und ohne Rost erkennen konnte. Außerdem war das Schiff dunkelgrau und sah aus, als gehörte es zur Navy. Eberson fielen vor allem die Fenster der Kommandobrücke auf. Sie waren schwarz getönt und wirkten fast bedrohlich.
Ein paar Mannschaftsangehörige arbeiteten auf dem Hauptdeck hinter einem großen Container. Während das Schiff näher kam, konnte Eberson erkennen, dass sie sich an einem ausladenden schüsselförmigen Objekt zu schaffen machten, das mittschiffs auf eine Plattform montiert war. Die Schüssel hatte eine matte grau-grüne Farbe, ragte einige Meter in die Höhe wie ein starres Segel und war aufs Meer gerichtet. Nach einiger Zeit verschwanden die Männer vom Deck, und Eberson glaubte erkennen zu können, dass das Schiff seine Fahrt verlangsamte.
»Carl, ich weiß nicht, was ich von dem Schiff da halten soll.« Er erhob sich mit einem unbehaglichen Gefühl.
»Wir haben nichts, was ihre Neugier wecken könnte«, sagte Heiland. »Nehmen Sie doch eine Angel und tun Sie so, als wollten Sie einen Thunfisch fangen.«
Eberson holte eine der Angelruten aus einem Gestell und schleuderte einen mit einem Bleigewicht beschwerten Haken ins Wasser. Dabei verzichtete er darauf, ihn mit einem Köder zu versehen, damit er nicht tatsächlich noch mit einer geschuppten Bestie aus den Tiefen des Ozeans kämpfen musste. Während der Frachter in kurzer Entfernung an ihnen vorbeizog, winkte er freundlich zu den geschwärzten Fenstern der Kommandobrücke hinüber.
Ein brennender Schmerz schoss durch die Hand in den Arm und drang in seinen Oberkörper ein. Er ließ den Arm sinken und schüttelte ihn, aber das seltsame Gefühl breitete sich bereits in seinem gesamten Körper aus. Innerhalb von Sekunden kam es ihm vor, als wühlten sich tausend Feuerameisen durch sein Fleisch. Die Hitze zuckte in seinen Kopf hoch und schien die Augen in ihren Höhlen zum Sieden zu bringen.
»Carl …«, rief er. Die Worte kamen als raues Krächzen über seine Lippen.
Heiland spürte das gleiche Brennen auf dem Rücken. Er wirbelte herum und nahm zwei Vorgänge zugleich wahr. Der eine war der Tod Joe Ebersons, der immer noch die Angelrute umklammerte, während er auf dem Deck zusammenbrach, wobei seine Haut glühend rot leuchtete. Der andere war das schildähnliche Gerät auf dem Frachter, das in wenigen Metern Entfernung auf ihn gerichtet war.
Indem er die Woge brennenden Schmerzes, die durch seinen Körper raste, ignorierte, stolperte er in Richtung Kabine. Manny befand sich bereits an Deck, wo er ein letztes Mal ächzend ausatmete, während Blut aus seiner Nase und seinen Ohren sickerte. Heiland stieg über seinen alten Freund hinweg und kämpfte gegen die unerträglichen Qualen an. Sein gesamter Körper fühlte sich an, als stünde er in Flammen. Irgendwo in einem letzten noch intakten Winkel seines Bewusstseins fragte er sich, warum ihm die Haut und das Fleisch nicht in Stücken von den Knochen fielen. Ein einziger Gedanke trieb ihn vorwärts zum Sitz des Steuermanns. Er glaubte, sein Kopf würde jeden Moment explodieren, als er unter das Armaturenbrett griff und seine brennenden Finger ein Paar versteckt angebrachter Schalter fanden. Er legte beide um, schaffte es jedoch nicht mehr, seine Lunge noch einmal mit Luft zu füllen.
4
»Hast du keine Lust, mit mir zu tauchen?«
Verblüfft musterte Loren Smith-Pitt ihren Mann. Erst vor wenigen Sekunden, so schien es jedenfalls, hatte er sich vom Steuersitz erhoben und einen Anker über den Rand ihres gemieteten Schnellboots ins Wasser geworfen. Aber jetzt saß er bereits auf dem Heckbalken, bekleidet mit einem Nasstauchanzug und ausgerüstet mit einem Atemgerät, und konnte es kaum erwarten, in die Tiefen des Ozeans unter ihnen vorzustoßen. Loren musste immer wieder darüber staunen, dass die See wie ein Magnet auf diesen Mann wirkte und ihn mit unsichtbarer Kraft ständig in ihrem Bann hielt.
»Ich denke, ich bleibe lieber hier und genieße den Sonnenschein und diesen klaren chilenischen Himmel«, erwiderte sie. »Da der Kongress schon am Montag zu seiner nächsten Sitzung zusammentritt, kann ich eine reichliche Dosis frische Luft gut vertragen.«
»Für den Capitol Hill wären Ohrenstöpsel vielleicht eine bessere Wahl.«
Loren ging auf den Spott ihres Mannes gar nicht erst ein. Als Kongressabgeordnete aus Colorado war sie froh, dem Parteiengezänk in Washington entfliehen zu können, auch wenn es nur für ein paar Tage geschah. Von den Anforderungen ihrer Arbeit und den allzu aufdringlichen Medienvertretern befreit, konnte sie sich in einem fremden Land um einiges gründlicher entspannen. Bekleidet mit einem knappen Bikini, den sie zu Hause niemals tragen würde, kostete sie es aus, ihren wohlgeformten Körper, den sie mit Yoga und täglichen Dauerläufen auf einem Laufband in Form hielt, unkommentiert zur Schau stellen zu können.
Indem sie sich auf der Sitzbank streckte, schwang sie ein Bein über den Bootsrand und tauchte die Zehen ins Wasser. »Du lieber Himmel! Das Wasser ist eiskalt. Da ziehe ich die Wärme und die Trockenheit hier oben vor, vielen Dank.«
»Ich bleibe nicht lange unten.« Ihr Mann klemmte sich den Atemregler zwischen die Zähne, schickte seiner Frau zum Abschied einen bewundernden Blick und ließ sich rückwärts in den blauen Pazifik fallen. Übermütig schlug er mit einer Schwimmflosse aufs Wasser und bespritzte seine Frau mit einem Wasserschwall, ehe er abtauchte.
Während sie sich mit einem Badetuch abtrocknete, verfolgte Loren für einige Minuten die Spur der Luftbläschen, die den Unterwasserkurs ihres Mannes markierten, dann blickte sie zum Horizont. Es war kurz nach Mittag, die Luft war kristallklar, und der saphirblaue Himmel hatte die Farbe des Ozeans. Sie ankerten mit ihrem roten Motorboot etwa eine halbe Meile vor der chilenischen Küste gegenüber einem kleinen Strandabschnitt namens Playa Caleta Abarca.





























