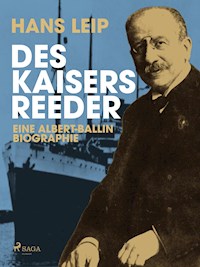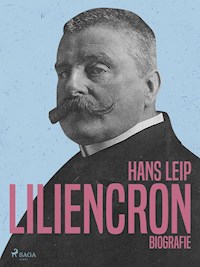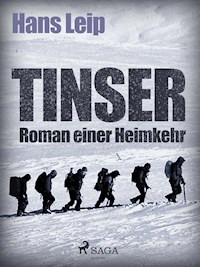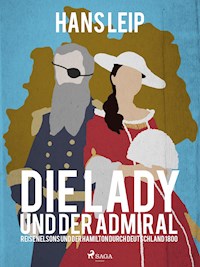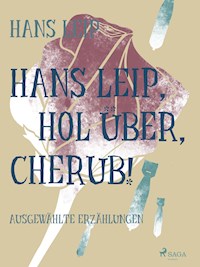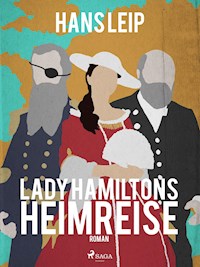Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
"Der Untergang der Juno" ist die Geschichte des alten Großseglers Juno und des Steuermanns William Mackay, der, indem er sein Kapitänspatent erringt, zugleich seine große Liebe verliert. Inspiriert wurde Leip von einem alten Band, der ihm im Britischen Museum in London in die Hände fiel, mit dem Titel: "Geschichte vom Schiffbruch der Juno an der Küste von Arracan in Ostindien und wundersame Erhaltung von vierzehn Personen auf dem Wrack ohne Lebensmittel während dreiundzwanzig Tagen, nebst deren schließlicher Rettung, von William Mackay, Leutnant des Schiffes, in einem Schreiben an seinen Vater zu London, 1798." Die zeitlose Faszination des Meeres und all seiner Bedrohungen wird wohl in kaum einem anderen Werk Leips so konkret greifbar wie in "Der Untergang der Juno"!-
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 181
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Hans Leip
Untergang der Juno
Eine Geschichteaus der Zeit der Ostindischen KompanieUnter Einbeziehung des Berichtes desenglischen SchiffsleutnantsWilliam Mackay
Saga
Ebook Kolophon
Hans Leip: Untergang der Juno. © 1930 Hans Leip. Alle Rechte der Ebookausgabe: © 2015 SAGA Egmont, an imprint of Lindhardt og Ringhof A/S Copenhagen 2015. All rights reserved.
ISBN: 9788711467589
1. Ebook-Auflage, 2016
Format: EPUB 3.0
Dieses Buch ist urheberrechtlich geschützt. Kopieren für andere als persönliche Nutzung ist nur nach Absprache mit Lindhardt und Ringhof und Autors nicht gestattet.
SAGA Egmont www.saga-books.com - a part of Egmont, www.egmont.com.
Vorbemerkung
Seit frühester Kindheit ist meine Phantasie mit allem, was Seefahrt heisst, beschäftigt gewesen. Aufgewachsen in Hamburg, früh vom Allerzonenduft des Hafens gelockt, das Ohr den Reden der Jantjes zugewandt, war es mein sehnlichster Wunsch, selber Seemann zu werden. Zwar bin ich später viel in der Welt umhergekommen und habe manches von der See, von den Schiffen und von fernen Küsten gesehen; dass ich aber selber als Matrose gefahren sei, ist eine Legende, nichts als ein bitteres Möchtewohl, das sich aus mancherlei und im Grunde belanglosen Ursachen nicht erfüllte. Vielleicht gerade deshalb gehört mein Herz mehr dem Meere und seinen Abenteuern, als wenn es sich daran genugsam in der Wirklichkeit hätte sättigen dürfen. Das Sinnbild des Ewigen, die Brücke zwischen dem Sichtbaren und seiner Deutung, die wandelbare Grenze zwischen Freude und Leid, Liebe und Selbstsucht, Mut und Angst, Vertrauen und Gottverlassenheit, das Ungeheuerliche irdischer himmelsüberwölbter Landschaft und die Sonderbarkeit jener Kapsel Mensch, die in sich ein Gehirn und ein Herz trägt, das alles ist für mich ohne den Untergrund der grossen Gewässer und Meere auf dieser schwebenden Kugel weniger reizvoll. Unsere technischen Fortschritte tragen dazu bei, dass die Welt nahe zusammenrückt, dass uns die Fremde nicht mehr so fremd ist und das Reisen wer weiss wohin nicht unbedingt ein grosser Abschied. Die Raschheit der Verkehrsentwicklung hat viele von uns zu Snobs gemacht, denen jeder Schauer vor Entfernungen fehlt, denen die Unendlichkeit der Meere durchaus weder unendlich noch wunderbar ist. Aber das hat seine Zeit.
Auch das Technische, das uns ein wenig das Gemüt verdunkelt hat, werden wir verdauen, und der ungelösten Fragen und Abenteuerlichkeiten wird es auch dann noch genug geben, die, nahe besehen, doch nur die alten sind. Denn der Mensch hat sich in seinen innersten Möglichkeiten und Bedürfnissen nicht geändert, das steht fest. Und als mir im Britischen Museum ein schmaler Prosaband in die Hand fiel, der übersetzt den Titel hat: „Geschichte vom Schiffbruch der Juno an der Küste von Arracan in Ostindien und wundersame Erhaltung von vierzehn Personen auf dem Wrack ohne Lebensmittel während dreiundzwanzig Tagen, nebst deren schliesslicher Rettung, von William Mackay, Leutnant des Schiffes, in einem Schreiben an seinen Vater zu London, 1798“, da fand ich in diesem kleinen erschütternden Bericht Gesagtes bestätigt. Mich beschäftigte der Vorgang, ich begann ihn in mir zu verknüpfen mit anderen aus derselben Zeit, die mir bekannt geworden waren, zumal der englische Herausgeber in seinem Vorwort bemerkt, dass Herr Mackay nach jenem Unfall von Kalkutta auf einem anderen Schiffe der Ostindischen Kompanie nach Europa anmusterte, von wo es mit Truppen nach Westindien ging. Und als ich aufzuschreiben begann, was mich drängte, sah ich vieles sich verdeutlichen, was vorher nur dem, der sich mit jenen verklungenen Tagen beschäftigt hat, zwischen den Zeilen bildhaft werden konnte. Somit wage ich zu hoffen, es möge lesbar geworden sein auch für den Menschen von heute, der ja dem von damals in seinem ungewissen Schweben zwischen Zeit und Überzeitlichkeit, also im Grunde seiner eigenen See und Seele gleich geblieben ist.
Hans Leip
1
Die Juno, die Weltlage und ein Truppentransport
Fernes Land, o Wunderland,
Fremdes süsses Unbekannt!
Lasst uns wie die Knaben träumen
Von den Mammutzauberbäumen!
Die „Juno“, die neue Juno, um es vorweg zu sagen, war eine schmucke, schlanke Brigg, vor knapp einem Jahre zu Kalkutta erbaut. Nur die Galionsfigur, eine rundliche, rosa und gold gestrichene Meerjungfrau, war von der alten Juno gerettet und übernommen worden (wovon Schiffsleutnant Mackay noch erzählen wird). Die neue Juno nun war auf erster, grösserer, glücklicher Fahrt frisch von Bengalen um Afrika herum, Biskaya, Kanal und Nordsee durch und elbaufwärts nach Hamburg gekommen, hatte im Jonashafen ihre Ladung aus Baumwolle, Tabak, Tiekholz und Seidenschals gelöscht (dazu eine kleine Kassette Diamanten) und war dann ein wenig stromab unter dem hohen Ufer bei Nienstedten vor Anker gegangen.
Es war September, und man schrieb das Jahr siebzehnhundertsechsundneunzig.
Auch eine Passagierin war auf der Juno gewesen, ein deutsches Hausfräulein namens Emma Sanders, das von London, wo es in Stellung war, einem Aufruf in der „Times“ nach sich in Rangun hatte verheiraten wollen, was aber misslungen war. Die junge Dame — denn als solche war Fräulein Sanders durchaus zu betrachten — war danach bei dem schrecklichen Schiffbruch der alten Juno dabeigewesen, wie Leutnant Mackay und der Junge Jack Hint (nunmehr Leichtmatrose). Sie hatte alle Leiden bewundernswert überstanden und war zu ihrem Onkel nach Hamburg zurückgekehrt.
Leutnant Mackay war jetzt Erster Steuermann auf der neuen Juno.
Neben der Juno lagen vier weitere tüchtige Seilschiffe, teils unter dänischer, teils unter Hamburger Flagge. Alle waren sie von dem Hamburger Handelshause Parish gechartert worden, auch die Juno, wie dem Kapitän vom hansischen Agenten der Ostindischen Kompanie, zu deren Flotte sie gehörte, mitgeteilt wurde. Die Fracht sollte diesmal in Menschen bestehen. Kurs: Westindien.
Denn in Westindien war der Teufel los. Frankreich hatte die Trikolore auf Haiti gehisst. Die Nigger brüllten Aufstand über alle Inseln. Englands Vormundschaft zu vernichten in der fetten Tropenpfründe des Kaffees und des Zuckers, das war das Ziel. Aber Old England liess sich nicht bange machen. Krieg mit Frankreich und Krieg mit Frankreichs Unterlegenen Holland und Spanien: es war ein Abwaschen. Noch war es Zeit, noch hatten die jungen Vereinigten Staaten von Nordamerika genug mit sich selber zu tun. Und was je die in Vergangenheit gross gewesenen Seemächte Europas an Kolonien zusammengeraubt, jetzt war Gelegenheit für Grossbritannien, reinen Tisch zu machen auf der Karte der Welt und sie gründlich zuzudecken mit der viermal blutdurchstrichenen Flagge. In Ostindien war es schon gelungen, auch Ceylon, Malakka, die Molukken und die neuerforschte Südsee waren so gut wie Englands, das Kap der Guten Hoffnung ging wie ein Symbol den Holländern verloren, Gibraltar lag fest in britischer Faust, einen Finger schon legte es auf Malta. Wohl hatte General Napoleon gewagt, Genua, Neapel, Livorno den englischen Kauffahrern und Fregatten zu verschliessen. Aber vor Livorno lauerte Kapitän Nelson und sann schon über die Schlachtpläne nach, die später bei Abukir und Trafalgar den letzten Traum einer westeuropäischen Seemacht neben England vernichteten.
In Westindien jedoch stand es wackelig. Barbados, Portoriko, Jamaika, Tabago, Martinique, Essequebo, Demerary, Curaçao, Surinam: kostbare Begriffe des Handels, der Schönheit und der Strategie. Auch Trinidad war da vielleicht zu erben und womöglich das unerhörte Kuba!
England warb Truppen zusammen aus aller Welt, charterte Schiffe für den Transport unter jeglichem Wimpel, der Lust hatte, Pfunde zu verdienen.
Und auch im derzeit englischen Lande Hannover erging Marschbefehl an alles, was an Besatzung trotz drohender französischer Verletzung der norddeutschen Neutralität entbehrlich war. Und somit rückte eines heiteren Spätsommermorgens auch das Regiment Löwenstein aus, marschierte unter Trommelschlag und Hörnerklang nach Harburg, bootete sich dort in Gemüseewer ein, trieb mit der Ebbe die Süderelbe hinunter, kam hinterm Nesshaken um Finkenwärder herum in die Strombreite und strebte, eine gemächliche, ausgedehnte Flottille unter niedrigen braunen Luggerlappen bei flauem Winde dem holsteinischen Ufer und den wartenden Überseeschiffen zu. Die roten Uniformen leuchteten in der milden Sonne wie reife Tomaten.
Finkenwärdersche Fischer, Bauern vom Alten Lande, ja auch Leute aus Harburg, Hamburg und Altona umkränzten den in dieser Gegend ungewöhnlichen Aufzug mit unterschiedlichen Kähnen.
„England wird sie alle fressen mit seinem unverschämten Rachen, die armen Luder!“ sagte ein Bas vom Grasbrook, dem die Briten eine Tjalk vor Neuwerk gekapert hatten, weil sie einen Stoss nagelneuer Lafettenräder nach Scheveningen zu liefern gedachte.
Der Erste Steuermann auf der Juno, William Mackay, liess den Blauen Peter ins Schau steigen. Die ganzen Kapitäne der fünf Transporter sassen nämlich noch alle oben an Land auf der Uferböschung in dem hübschen Wirtshause von Jacob, kauderwelschten Englisch, Plattdeutsch und Dänisch durcheinander und prosteten oft und gern auf eine gesegnete Reise. Reeder Parish hatte sie zu einem runden Abschiedsfrühstück eingeladen. War ihre Fracht erst an Bord, dann würde keine Zeit mehr sein, dann sollte es möglichst gleich losgehen. Sie kannten das grösstenteils von einem bisschen Sklavenhandel der Elfenbeinküste und auch Westindien selber her. Da brauchte Herr Parish nicht erst längliche Orders anzuweisen. Herr Parish erhob sich, sprach vom Geschäft. Und es würde ein guter Anteil Kapplaken für seine lieben Kapitäne dabei über sein. Die grossbritannische Krone lasse sich so wenig lumpen wie er. Und er brachte einen kräftigen Toast und Bumper auf die Angelegenheit aus. Der englische Regierungsvertreter, vom König herüberbefohlen, Sir Popham, derselbe, der den Signalkode für die Marine erfunden hatte, lächelte verbindlich in die Beifall lärmende Runde.
Aber der Quartiermeister des Regiments Löwenstein blieb ingrimmig sitzen. Er war schon in aller Frühe mit zwei Schreibern auf einem Moorburger Kutter eingetroffen und durchaus nicht zufrieden.
2
Frachtraum und Soldatenehre
Dreimal hipp das schöne Landserleben
Und die königliche Kompanie,
Die vor keinem Freund und Feind erbeben
Tut, drum ausgespielt, ihr Musici!
Draussen erkrachte ein Böllerschuss, gefolgt von vier anderen. Die Transportschiffe begrüssten ihre nahende Fracht. Man sprang ans Fenster. Sie kommen! Sie kommen! Hob die Gläser in die Weite, die diesig war und nach lauen Wiesen roch wie im Frühling. Dort in der glitzernden Elbbreite hinter den Fetzen des Pulverdampfes und den erschreckten Möwen, drüben unter den bräunlichen Strichen der Inseln und Vorländer, unter den dünnblauen Zügen der Heidehügel, dort tauchten sie fern auf wie ein Schub Stockenten.
Prosit! Prosit allzumal! Auf ein glückliches Indien!
Dünn erschollen von weither die Hörner. Nicht lauter als der Klang der Gläser hier.
Der Transportagent, ein kleiner, lebhafter jüdischer Makler, mit dem Hause Parish befreundet, tupfte sich den Rotspon von den Lippen, seine Hand zitterte. Er drückte sich hinaus, er ahnte Unheil von dem kriegerischen, langen und hübschen hannöverschen Offizier. Und der war auch schon hinter ihm her, tippte ihm energisch auf den Kragen seines mausgrauen Fracks.
„Wo bleiben die anderen Schiffe, Herr Agent?“ schrie er ihn an. „Diese fünf reichen für die Katz!“
„Wir haben nicht mehr!“ wand sich der Makler mit aufgehobenen Handflächen. „Däs Regiment Löwenstein is mech lieb wie ä eigenes Kind! Esu, es gibt kein Schiff in der ganzen graussen Welt nich aufzutreiben, glauben Herr Oberstleutnant mech, ich schwöre!“
Herr Parish trat dazwischen, ruhig, elegant, in der würdigen Fülle seines Alters und des in seinem Leben Erreichten. Er lächelte in strahlender Freundlichkeit dem Offizier in die erzürnten Augen und sagte dabei: „Wir sind den netten und ordentlichen militärischen Ton gar nicht gewohnt in Hamburg, wie Herr Baron belieben tun! Unser Agent hat ja auch recht, Schiffsraum ist knapper als bar Geld heutzutage. Und irgendwohin müssen wir ja auch die vielen teuren Lebensmittel hinstauen, die sie mitkriegen. Denn: was wird bewilligt, was gebilligt, was ist die Möglichkeit? Nehmen Sie, mein Herr von Plato, doch meinswegen die ganze Juno für Ihren geliebten Stab. Denn müssen die anderen eben ein büschen zusammenrücken.“
Das Gesicht des straffen Offiziers lief scharlachen an wie sein Waffenrock. Doch beherrschte er sich und sagte gedämpft: „Zusammenrücken? Zwölfhundert Mann? Ich bitte, zu erinnern, dass — es ist hier doch von Geschäft die Rede — anno einundachtzig die Kosten gerade durch schlechte Unterbringung sich unmasslich erhöhten.“
„Für die Regierung, nicht für den Reeder!“ lächelte der grosse Handelsherr.
Der Ton des von Plato wurde nun doch erregt: „Ich stehe hier für mein Regiment! Hannöversche Soldaten wurden damals wie Heringe verfrachtet. Krankheit brach aus, schon in der Nordsee. Man musste Portsmouth anlaufen. Dreihundert blieben im Lazarett. Ein Drittel davon starb. Ein weiteres Drittel kam auf dem Wege um, ohne einen Hauch von Indien gespürt zu haben. Ein Vetter von mir war darunter.“
„Gott hab’ ihm selig, oder wie sagt man auf deutsch?“ lächelte Herr Parish. Er fand, dass ein trübes Gefühl des Mitleidens, das ihn ankam, an falschem Platze sei. Er wandte sich den anderen Herren zu: „Es war nach Ostindien, ist glatt Geschäft der Kompanie selber, nicht meins. Wir gehen nur zu die West, das geht schneller und hat weniger Risiko.“
Der Agent wagte hier zu bemerken, geschützt durch den breiten Rücken des Reeders, die Soldaten kämen doch bald in ein wärmeres Klima, laut der Geographie, und dürften dann wohl froh sein, an Deck zu kampieren.
Der Offizier, ihn nicht beachtend, blitzte Herrn Parish an, als habe der die Frechheit gestottert. Parish war es selber peinlich, aber peinlicher war ihm dieses redende „Frachtstück“, so gutmütig, weitgereist und selbsterzogen er auch sein mochte. Rang und Anblick des Soldatischen allerdings machte wenig Eindruck auf ihn, dazu war er zu sehr Hamburger geworden. „Mein Himmel“, sagte er einlenkend munter, „Herr Oberstleutnant wollen mich doch wohl nicht fordern? Ich hab’ weder gedient noch studiert, bin auch nicht adlig, sondern bloss englischer Schiffsjunge gewesen und dann Kaufmann. Ich kenne meine Schiffe. Bei Stade liegen an vierzig weitere, aber alles kleinen Zeugs für die anderen Regimenter, die dort einbooten. Diese Riesen hier unten, die allerbesten, die ich habe, sind extra für die Löwensteiner. Und da tut der Herr noch quesen?“
Freiherr von Plato hatte es nun satt. Er meinte Spott aus aller Mienen zu lesen. „Ich verbitte mir! Ich verlange —!“ brauste er auf. Sein Degengehenk, seine Sporen klirrten. Puder stäubte von seiner untadeligen Perücke.
„Bitte!“ sagte Herr Parish erstaunt. „Ihr direkten Vorgesetzten King Georges der Dritte ist der Herr da.“
Er wies verbindlich auf Sir Popham, der, in der einfachen Uniform eines Fregattenkapitäns, gelangweilt dabeigestanden hatte, da er kein Deutsch verstand. John Parish setzte ihn nun in dem ihm ebenfalls geläufigeren Englisch, seiner eigentlichen Muttersprache, die Wünsche des Hannoveraners auseinander. Sir Popham zuckte die Achselstücke, berief sich auf das längst hergestellte Einvernehmen mit der Regierung zu London wie mit dem hannöverschen Hauptquartier und verliess mit kurzem Gruss den Raum, gefolgt von Parish und dem Agenten.
Hatte er nicht auch noch verlautet, dass es sich um hergelaufene Söldner, angeworbene, erpresste und erschacherte Dutzendware aus aller Herren Deutschgauen handle, die den Namen hannöverscher oder gar britannischer Soldaten erst zu verdienen hätten? Gröber, anmassender und nichtswürdiger hätte solches nicht gesagt werden können.
„Verflucht! Das gibt Tumult!“ knirschte der Oberstleutnant und fügte in bestem Schulenglisch hinzu: „Was ahnt das Hauptquartier von der Grösse eines Segelschiffes!“
Er hatte eine stramme Haltung angenommen.
Gäste drängten ins Lokal, zu den Fenstern. Draussen polterten Wagen, erhob sich fröhliches Gelärme. Sie kommen! Die Kapitäne stürzten ein letztes Glas hinunter, stürmten an dem unschlüssig finsteren Offizier vorbei und hinaus.