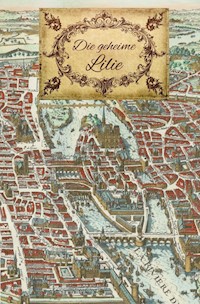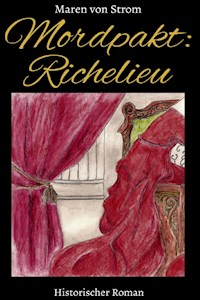Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Frankreich 1644 Kardinal Mazarin regiert als Statthalter des jungen Ludwig XIV. in Paris mit harter Hand. Das Volk ächzt unter den Kriegen und Abgaben, in den Schatten formiert sich Widerstand. Aufständische Frondeure drängen das Land an den Rand eines Bürgerkrieges! Im drohenden Chaos ereilt die drei Musketiere Athos, Porthos und Aramis der Ruf nach den Waffen. Die unzertrennlichen Gefährten von einst müssen wieder zusammenfinden, um Frankreichs Krone vor dem Untergang zu retten. Sie ahnen nicht, dass sich ihnen ausgerechnet Leutnant d'Artagnan von der Garde des Kardinals in den Weg stellen wird.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 481
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Un/zertrennlich
by
Maren von Strom
Aus der Reihe »Die Geheime Lilie«
Bd.3
Impressum
Texte:© Copyright by Maren von Strom
Umschlag: © Copyright by Maren von Strom
unter Verwendung eines Bildes von Maurice Leloir
Verlag: Maren von Strom
Otto-Bock-Straße 2
42349 Wuppertal
1. Auflage 2025
Prolog
Paris, 1643- Pont Neuf
Heinrich IV. saß hoch zu Ross, in voller Rüstung. Sein Haupt war mit Lorbeer umkränzt, er hielt ein Zepter fest in der Hand. Der Blick des alten Königs schweifte kühn und entschlossen über die nächtliche Stadt und Paris beugte sich der herrlichen Gestalt, dem bronzenen Reiterstandbild zu Ehren des verblichenen Herrschers.
Allein sein Enkel, Ludwig XIV., sollte Heinrichs Ruhm dereinst übertreffen. Indes, der Kindkönig war in diesem Jahre 1643 gerade erst vier Jahre alt und seine Regentschaft bereits überschattet von den zahlreichen Intrigen der Mächtigen am Hof.
Ein Opfer dieser hinterhältigen Machenschaften lehnte keuchend am Sockel des Reiterstandbilds. Ein Mann in dunkler Kleidung, der tiefen Nacht angepasst. Er war gerannt, um den Häschern Kardinal Mazarins zu entkommen. Er hörte ihre Rufe in der Dunkelheit, sah die zuckenden Lichtpunkte ihrer Laternen. Sie kamen rasch näher. Sie würden ihn finden, hier auf der Pont Neuf.
Sein letztes Stündlein hatte geschlagen.
Rochefort lächelte verzerrt. Der Meisterspion, der größte Ränkeschmied von allen - er hatte sich selbst überschätzt. Er hatte sich zu wichtig genommen, sich für mehr als einen einfachen Läufer auf diesem großen Schachbrett gehalten, was sie die Welt nannten. Er war nur ein Bauer, und seine Königin wollte ihn opfern.
Ihm fehlte der Atem für eine weitere Flucht. Rochefort stieß die Luft zwischen den Zähnen aus. Eine Wunde klaffte in seiner Seite, knapp unter den Rippen. Ein Streifschuss. Er presste eine Hand auf das brennende Fleisch und befahl seinem Verstand, sich nicht der Panik und den Schmerzen hinzugeben.
Sein Blick glitt zum träge dahinfließenden Fluss. Das Mondlicht glitzerte auf dem tiefschwarzen Wasser wie abertausende Sterne. Die Seine wirkte friedlich; so unergründlich und geheimnisvoll, ein verführerisches Weib, das ihre grausamen Untiefen mit einem dichten Schleier aus Nebel verhüllte; ihre Umarmung war eiskalt und tödlich.
Rochefort stieß sich vom Sockel ab. Mit letzter Kraft erklomm er das Brückengeländer und sah in den dunklen Abgrund. Wenn er schon sterben musste, in dieser Nacht, dann wollte er seinen Tod selbst wählen.
Er wandte den Kopf und sah die vorauseilenden Schatten seiner Verfolger. Sie rannten, die Stiefel hallten laut auf dem Pflaster, ihre Uniformen schienen blutrot im fahlen Licht der Laternen; Mazarin hatte die Garde ausgesandt, um Rochefort zu verhaften.
Fast hatten sie ihn erreicht, fast konnten sie ihn packen! Er ließ sich fallen und tauchte in den unbarmherzigen Schoß der Seine. Sie brüllte auf, sie krallte sich an ihn, sie heulte im Triumph. Sie hielt ihn gepackt und zerrte ihn gierig mit sich. Sie warf ihn umher, sie riss an seinen Gliedern, sie schmetterte ihn gegen Steine, Äste und Unrat, bis seine Knochen und seine Gedanken barsten.
Sie toste, sie wütete, sie schrie. Sie fetzte den letzten Willen und Lebensfunken aus seinem Leib und dann-!
Stille.
1 - Der Graf von la Fère
Ein Jahr später, 1644
Entlang der Loire reihen sich die Schlösser und Anwesen wie an einer schimmernden Perlenschnur auf. Nur wenige Meilen von der Stadt Blois und ihren mächtigen Wehrmauern entfernt, hoch oben auf einem von Maulbeerfeigenbäumen beschatteten Hügel, thront ein prächtiges Herrenhaus mit Schieferdach.
Ein gewundener, von alten Pappeln gesäumter Pfad führt dort hinauf. Er endet vor einem kunstvoll verzierten Tor, dahinter weist eine Allee den Weg zum geräumigen Hof des Châteaus Bragelonne. Ein Küchengarten liegt direkt am Haus, man hört in der Ferne eine Jagdhundemeute bellen und Pferde in ihren Stallungen wiehern.
Das Gesinde lebt in bescheidenen Unterkünften auf den zwanzig Morgen Land, die zum Anwesen gehören. Der sorgfältig gepflegte Park rund um das Herrenhaus reicht bis an den Fluss hinunter. Ein Wäldchen mit Wild darin markiert die Grenze zu den Nachbarn auf Schloss la Vallière.
An diesem Frühjahrsmorgen kroch die Sonne gerade erst über den Horizont, aber die Fensterläden des Studierzimmers im oberen Stockwerk waren schon weit geöffnet. Licht fiel hinein und erregte Wortfetzen drangen hinaus. Ein Wortgefecht war dort im Gange, zwischen dem Hausherrn und einem frühen Gast.
Monsieur de Payen wischte sich mit einem Taschentuch über die schwitzige, fettige Stirn. Sein Gesicht war rot und zornverzerrt, von hässlicher Boshaftigkeit. Er quiekte gellend wie ein Schwein, das am Trog zu kurz gekommen war. »Ihr wagt es, einem königlichen Erlass nicht Folge zu leisten?«
»Der Erlass mag das Siegel Seiner Majestät tragen«, erwiderte der Graf de la Fère, den wir als Athos kennen, mit ruhiger Stimme. »Die Schrift und die Worte sind jedoch Mazarins.«
»Seine Eminenz handelt auf Wunsch und Willen des Königs!«
»Dem Willen eines fünfjährigen Knaben, der meine Bauern mit neuen Steuern und Abgaben in den Staub drücken will? Erwuchs dieser Wunsch in ihm, während er sich im Palastgarten beim Tollen mit den Pagen und Zofen die Knie aufgeschürft hat?« So gelassen Athos' Erwiderung wirkte, so gefährlich war das Funkeln in seinen Augen. Er hatte nichts von seiner überragenden Ausstrahlung eingebüßt, seit seine Tage als Musketier vorbei waren.
Im Gegenteil, er hatte noch an Lebenskraft gewonnen. Obgleich er inzwischen 48 Jahre zählte, war sein schwarzes, schulterlanges Haar von keinem grauen Glanz durchsetzt und sein früher oft melancholisches Antlitz wirkte sogar verjüngt, schmaler und nicht aufgedunsen von jenen Nächten, in denen er dem Alkohol kräftig zugesprochen hatte. Die Schwermut, die ihn niedergedrückt hatte, war von ihm abgefallen, er wirkte schlanker als früher und zugleich stärker, von schöner und ansehnlicher Gestalt.
Olivier Comte de la Fère war dem Abgesandten des Kardinals in jeder Hinsicht überlegen. Ein Schreibtisch trennte beide Männer voneinander und bot sicheren Abstand zwischen ihnen.
Payen schnappte empört nach Luft und stopfte sein Taschentuch zurück in den Hemdsärmel von feinster Spitze. »Ihr sprecht wie ein Aufständischer, Ihr seid gar einer!«
Athos' Miene verdunkelte sich. »Ihr werdet in diesem Hause niemanden finden, der nicht dem König und der Krone tief ergeben wäre. Wenn Ihr mich des Verrats beschuldigt und das dem Kardinal mitteilen wollt, muss ich meine Ehre verteidigen.« Sein Blick glitt wie zufällig zum Kamin, über dem zwei gekreuzte Degen hingen. Es waren keine Zierwaffen, sie hatten viele Schlachten gesehen und zahlreiche Feinde niedergestreckt.
Payen schwitzte stärker. »Ihr zwingt mich, von Eurer Weigerung und Eurem Ungehorsam nach meiner Rückkehr zu berichten! Ich bin nur der Bote Seiner Exzellenz!«
»Den Boten tötet man nicht, ja. Er sollte jedoch die Wahrheit berichten und dazu gehört, dass nicht der Kardinal mein König ist! Mazarin lässt meine Bauern und das Land ausbluten, um die Kriege der Vergangenheit und Zukunft zu bezahlen. Ich habe in diesen Kriegen gekämpft, ich habe mein Blut für den König und für Frankreich vergossen. Mein Zoll und Tribut sind erbracht!«
»Ist das Euer letztes Wort?«
»Hofft, dass es das ist. Empfehlt mich in Paris Seiner Eminenz und der Königinmutter. Anna von Österreich wird sich meiner steten, aufrechten Treue in Tat und Wort lebhaft erinnern.«
»Eine Empfehlung zu Eurer Person werde ich geben, Graf! Mit dem höchsten Vergnügen werde ich das!«
»Gut, dann steht Eurer zeitigen Abreise nichts mehr entgegen, es ist alles besprochen.« Athos lächelte dünn und sah aus dem Fenster in den Hof hinab. »Mein Hofmeister wird Euch zu Eurer Kutsche geleiten, die Pferdeknechte halten sie schon bereit.«
»Ich breche auf, erwartet baldige Antwort und Konsequenzen!« Payen starrte sein Gegenüber an und fand in dessen Gesicht nicht die erhoffte Reaktion, kein Zurückweichen, keine Reue und keine Furcht. Athos stand unerschütterlich wie ein Fels und nickte über Payens Kopf hinweg seinem Diener Grimaud, seinem Hofmeister, zu, der an der Tür zur Schreibstube gestanden und gewartet hatte.
Stumm wie je verneigte sich Grimaud und begleitete Monsieur de Payen in den Hof hinaus. Athos beobachtete vom Fenster aus, wie kurz darauf Mazarins Abgesandter die Kutsche bestieg, der Kutscher mit der Zunge schnalzte und den Pferden die Peitsche gab. Das Gefährt holperte die Allee entlang, durch das Tor hinunter zur Straße nach Blois und erst da wandte sich Athos ab.
Er setzte sich an den Schreibtisch, auf dem der Erlass aus Paris offen lag, gesiegelt vom König, unterschrieben in seinem Namen von der Königinmutter, eingeflüstert von Kardinal Mazarin.
Die Staatskassen waren geplündert und leer, Richelieus Kriege hatten Frankreichs Schulden in unbezahlbare Höhen getrieben. Sein Nachfolger wusste keinen anderen Ausweg, als die Steuern zu erhöhen und die Rechte des Adels an ihrem eigenen Land, ihren eigenen Leuten, zu beschneiden.
Mazarin regierte nach Notwendigkeit und über den Willen des Parlaments hinweg. Er schirmte die Königinmutter und den jungen König von der Außenwelt ab, von der wahren Stimmung im Volk und im Adel. Es brodelte in Paris, Widerstand formierte sich in den Schatten.
Athos seufzte und lehnte sich im Sessel zurück. Er schloss für Momente die Augen und lauschte auf die vertrauten Geräusche im Haus. Für lange Zeit hatte sich niemand am Hof für die Provinz interessiert, das Leben hier war herrlich ruhig und beschaulich, fern aller Intrigen und Kriege.
Doch Ruhe und Glück auf Schloss Bragelonne schienen sich dem Ende zu neigen. Ein anderer Brief auf dem Schreibtisch war der Vorbote von düsteren Zeiten.
Athos hatte ihn vor einigen Tagen erhalten und erst mit freudiger Überraschung, dann mit harter Miene gelesen. Der Abbé d'Herblay von Noisy hatte ihm geschrieben. Aber unterzeichnet hatte er mit »Aramis«, als sei der Abt wieder ein Musketier und bäte um Hilfe seines einstigen Kameraden. Athos zog diesen Brief jetzt aus einem Stapel ähnlicher Schriftstücke und las ihn erneut.
Ein Ersuch um ein Treffen war es, eine Einladung, und obwohl Aramis völlig unverfängliche Worte gewählt hatte, verstand Athos die Botschaft zwischen den Zeilen. Es war dringend, der Rat eines Waffenbruders, eines alten Freundes wurde benötigt.
Athos‘ Sorge wuchs.
»Was bekümmert dich, Liebster?«
Der Graf sah auf und seine eben noch harten Züge glätteten sich sofort beim Anblick seiner hübschen Frau. »Pardon, ich habe dich nicht bemerkt. Was führt dich zu mir?«
Catherine de la Fère stemmte die Hände in die Hüften, ein herausforderndes Funkeln in den dunklen Augen. Sie legte den Kopf schief, sodass einige ihrer braunen Locken über ihre Schulter fielen und keck auf ihrem Dekolleté auflagen. »Muss ich mich meinem Gatten ab sofort melden lassen, wenn ich ihn sehen will? Euer Hochwohlgeboren hätten wohl bitte die Güte und Gnade mich zu empfangen. Knicks.«
Athos schmunzelte. Seine Frau nahm nie ein Blatt vor den Mund und vertrat offen und mutig ihre Meinung. Eines der vielen Dinge, die er an ihr liebte. »Du hast laut 'Knicks' gesagt.«
»Das habe ich, denn du wirst mich nie dabei sehen, wie ich mich tatsächlich beugen würde!«
»Am Tag, wenn es doch geschieht, wird uns der Himmel auf den Kopf fallen! Gott bewahre uns davor, ich will noch viele Jahre mit dir verbringen, als dein ergebener Ehemann.« Und er verneigte sich vor seiner Holden, die es mit einem Auflachen zur Kenntnis nahm.
»Das hätte ich mir vor zwanzig Jahren nicht träumen lassen, dass einst der stolze Athos vor seiner Hauswirtin das Haupt neigt und ihr seiner ganzen Zuneigung und Liebe versichert.«
»Du hast davon geträumt, heimlich und verstohlen.«, erwiderte der Graf und küsste Catherine zärtlich die Fingerspitzen. »Es hat einige Jahre gebraucht, bis ich mir dessen gewahr wurde. Verzeih mir, es nicht eher bemerkt zu haben, als das man mich mit der Nase darauf gestoßen hat.«
Catherine errötete lächelnd. »Dafür werde ich d'Artagnan ewig dankbar sein müssen. Sie hat dich kräftig zu mir geschubst und du hast mich endlich gesehen. Auch, wenn ich keine sehr feine Gräfin abgebe. Noch nicht einmal so gewählt sprechen kann ich!«
Sie befreite sich aus seiner Umarmung und tippte ihm mit einem Finger auf die Brust. »So wie du nämlich. Du klingst heute Morgen fürchterlich gestelzt und ernst. Ist unser werter Gast schuld daran, dass ich mir ganz klein und unbedeutend, wieder wie eine einfache Bürgerin von Paris vorkommen muss?«
»Du bist niemals klein und unbedeutend! Monsieur de Payen hat größten Respekt vor dir. Er wird ihn dir nicht mehr zollen können, er hat uns vor wenigen Minuten verlassen.«
»Dann habe ich richtig gehört, und seine Kutsche ist vorhin vom Hof gefahren. Du siehst drein, als hättest du ihn persönlich davongejagt.«
»Vielleicht habe ich das.« Wieder seufzte Athos und horchte auf, als neuer Lärm zum Fenster hinauf drang. Ein Stallknecht führte eines der Pferde auf den Hof, Augenblicke später schwang sich ein Jüngling von vierzehn Jahren mit einer geschmeidigen Bewegung in den Sattel. Er hatte das gleiche schwarze Haar wie der Graf und ein entschlossenes Gemüt wie die Gräfin. Er gab dem Pferd die Sporen und preschte davon, ohne Blick zurück zum Haus.
Catherine kicherte, als sie das beobachtete. »Mein kleiner Raoul jagt seinen schwärmerischen Träumen nach. Du wirst es ihm nicht verbieten, Olivier!«
»Wie käme ich dazu?« Athos hob beschwichtigend die Hände. »Er hat sein Herz an die kleine la Vallière verloren. Es brennt für sie, das Feuer faucht und zischt so laut, dass er ohnedies weder Rat noch Mahnung hören könnte.«
»Du bist ein Romantiker, tief in dir, selbst voller Leidenschaft.« Catherine lächelte liebevoll und stellte sich auf die Zehenspitzen, um ihrem Mann einen Kuss zu geben. »Vergiss diesen Payen und welchen Ärger er bedeuten könnte. Frühstücke stattdessen mit mir! Das Licht fällt in den Salon, ich habe den Tisch gedeckt.«
Obwohl sie seit 15 Jahren Madame de la Fère und eine Gräfin war, kümmerte sich Catherine um solche kleinen Handgriffe im Haushalt selbst, als wohnte sie noch in ihrem bescheidenen Haus in Paris, in der Rue Fèrou, und der Musketier Athos sei noch immer ihr Untermieter.
Er nickte. »Ich komme sofort nach, ich muss mich nur noch um eine Angelegenheit vorher kümmern.«
»Das kann nicht noch eine Stunde warten?« Catherine las an der angespannten Miene ihres Mannes, dass diese 'Angelegenheit' von größter Wichtigkeit war; und dass Olivier ihr nicht sagen würde, worum es sich dabei handelte.
Eingeschnappt und mit den Worten, »Ich erwarte dich!«, verließ sie die Schreibstube.
Der Hauch eines zarten Damenparfüms blieb bei Athos zurück. Es war ein vertrauter, geliebter Duft. Er schwand zum Fenster hin und Athos beobachtete einen jungen Reiter in der Ferne. Er folgte der Loire, sein Ziel war das Schloss la Vallière.
Raoul, sein Sohn. Catherine, seine Frau. Er täte alles, um sie zu beschützen!
So glückliche Tage verlebten sie hier auf Bragelonne, doch am Horizont dräuten dunkle Wolken. Sie hingen schwer über Paris und würden sich in einem Sturm über der Stadt entladen. Der Unmut des Adels, die Wut der Bürger und die Angst der Bauern. Einmal entfacht, würde das Unwetter aus Hass und Gewalt schließlich auch die Provinzen erfassen, sie blieben hier nicht unberührt davon. Ein Bürgerkrieg drohte, wie er in England schon blutig tobte.
Der Graf de la Fère traf eine Entscheidung. Kardinal Mazarin war die Wurzel allen Übels und auch wenn Athos sich in diesem politischen Konflikt stets neutral verhalten hatte, so zwang ihn der Auftritt Payens dazu, Partei zu ergreifen.
Er schrieb eine Antwort an den Abbé d'Herblay, unterzeichnete mit Athos und sandte Grimaud mit dem Brief nach Noisy.
Ein Sturm zog auf und die Musketiere mussten erneut die Krone beschützen.
2 - Ein konspiratives Treffen
Das Kloster zu Noisy war ein Ort der Ruhe und inneren Einkehr. Es lag am Ende des Dorfs, nur ein paar Häuser und der Marktplatz trennten es vom Schloss des Erzbischofs von Paris.
Lästerliche Zungen behaupteten, dass der Abt des Klosters vor allem wegen der schönen und klugen Herzogin von Longueville, der Nichte des Erzbischofs, sehr häufig zu Gast im Schloss sei.
Das war natürlich gelogen! Der Abt war ein frommer Jesuit und die Gestalt, die manchmal nachts aus einem Fenster des Klosters kletterte, um sich heimlich ins Schloss zu schleichen, musste ein Schuft in Mönchskutte sein.
Wir kennen diesen Schuft sehr gut, er nennt sich tagsüber René d'Herblay und nachts Aramis. Er ist ein Musketier, wenn er gerade kein Abbé ist und in diesen Momenten hangelte er sich aus einem Lindenbaum zu Boden, der zufällig unter dem Fenster der Frau von Longueville wuchs.
Aramis ließ sich vom letzten Ast fallen und kam leichtfüßig auf dem Pflaster auf. Er lauschte in die Dunkelheit, ob er allein und unbeobachtet war. Dann klopfte er sich die Knie ab, versicherte sich über den vollständigen Inhalt seiner Manteltaschen und zupfte sich den Spitzenkragen zurecht.
Man konnte ihn trotz seiner 39 Jahre noch für den jugendlichen Galan halten, der er vor zwanzig Jahren bereits gewesen war. Die Zeit schien spurlos an ihm vorübergezogen zu sein, sein Gesicht war glatt und faltenlos, seine Hände zart und feingliedrig wie die eines Poeten, sein Verstand so scharf wie seine Klinge.
Als sei es das Gewöhnlichste auf der Welt, nahm er nun den nächtlichen Spaziergang zurück zum Kloster auf. Niemand folgte ihm und deshalb machte er sich auch nicht die Mühe, sich in den tiefen Schatten der Klostermauer zu verbergen. Er stieß unterhalb eines Fensters einen kurzen Pfiff aus und eine Strickleiter wurde herabgelassen. Er kletterte behände daran hoch und stand Momente später in einer eleganten Stube.
»Habt Ihr es?«
Eine Stimme aus dem Lehnsessel beim Kamin nahm den Abbé in Empfang. Sie klang rau, gepresst wie unter einer Anstrengung. Der Sprecher hielt sich mit knorrigen Händen an den Lehnen fest, als müsse er sich davon abhalten, ungeduldig aufzuspringen. Sein Gesicht lag im Dunkeln, aber im zuckenden Feuerschein war eine hagere, in sich gesunkene Gestalt zu erahnen, deren frühere Kraft wie aufgezehrt wirkte.
»Gemach, gemach, mein lieber Graf.« erwiderte Aramis milde lächelnd und schenkte sich aus einer Karaffe Wein ein. »Ihr nehmt die Dinge zu gern selbst in die Hand. Es muss schrecklich für Euch sein, sich auf andere verlassen zu müssen und nicht jeden Schritt persönlich überwachen zu können.«
Ein abfälliges Schnauben war die Antwort. Aramis wandte sich einer dritten Person im Raum zu, die inzwischen die Strickleiter wieder eingeholt hatte und das Fenster schloss.
Athos versicherte sich mit einem letzten Blick in die Nacht, dass wirklich niemand ihr geheimes Treffen beobachtete, dann musterte er Aramis fragend und mit einem gewissen Unmut.
»Es ist alles wie erhofft verlaufen«, sagte der Abt, »ich trage den Brief bei mir.«
Athos verschränkte die Arme und rührte sich nicht von seinem Platz am Fenster. »Vielleicht erklärst du mir nun auch endlich, was das alles zu bedeuten hat. Deine Einladung war recht geheimnisvoll und mit ihm in deiner Gesellschaft hätte ich zuletzt gerechnet.«
Dabei deutete er zum Sessel, von wo aus eine spöttische Antwort kam. »Keiner von uns hätte das noch bis vor einem Jahr. Aber der Herr Abbé hat ein weiches Herz und mich nicht im Fluss ersaufen lassen, als ich zu seinen Füßen angespült wurde.«
»Schmeichelt mir nicht zu sehr, Rochefort.« Aramis stellte seinen Becher zurück auf den Tisch zwischen ihnen. »Es war nicht mehr als Zufall, dass ich dort war und Euch aus der Seine zog.«
»Wie zufällig Ihr Euch nachts auf der Straße zum erzbischöflichen Anwesen herumtreibt, wissen wir.«
Obwohl der Graf de Rochefort um Jahre vor seiner Zeit gealtert wirkte, sein Körper ausgemergelt, sein Haar ergraut, war sein Geist so klar und wach wie je. Die Wunde von dem Streifschuss in jener Nacht hatte ihm eine Narbe eingehandelt, die sein Herz mehr als sein Fleisch versengt hatte. Sie war bis heute nicht verheilt, sie nagte an ihm und verzehrte ihn Stück für Stück. Er ließ sich nach außen nichts anmerken und versteckte das Brennen in seiner Seele hinter scharfem Spott.
Aramis überhörte jede unfeine Andeutung, die ihm mehr als ein freundschaftliches Verhältnis zur schönen Nichte des Erzbischofs unterstellen wollte. Stattdessen bedeutete er Athos, ebenfalls Platz zu nehmen. »Ich danke dir, dass du meiner Einladung gefolgt bist.«
»Es klang sehr dringend und ich beginne zu ahnen, was vor sich geht.« Athos zog sich einen Stuhl heran und beäugte Rochefort misstrauisch. »Ihr seid abtrünnig geworden. Ausgerechnet Ihr, eine Kreatur des Kardinals!«
»Eines anderen Kardinals, nicht dieses Pfaffen auf dem Thron.«
»Was ist geschehen?«
»Ich bin in Ungnade gefallen.« Die Last der Ironie biss sich mit der Leichtigkeit, mit dem Rochefort diese Worte über die Lippen kamen. »Vor einem Jahr rief die Königinmutter nach mir, um mich in einer Angelegenheit nach Köln zu senden. Ich musste ablehnen, denn es hätten mich einige Unannehmlichkeiten erwartet. Ein paar alte Bekannte, die mir nicht wohlgesinnt sind.«
»Verstehe, Ihr habt eine unappetitliche Vergangenheit in Köln?«
Rochefort ging nur halb darauf ein. »Der Friedenskongress 1637 zwischen Spanien, Frankreich und dem Kaiserreich verlief nicht reibungslos, letztlich war er ein reiner Misserfolg. Einerlei wie es zu diesem völligen Fehlschlag kam, die Königinmutter hat meine Ablehnung als Affront aufgefasst. Für Mazarin war es eine gute Gelegenheit, auch mich, kurze Zeit nach der Verhaftung des Herzogs von Beaufort, ebenfalls verschwinden zu lassen.«
»Beaufort, ein Enkel Heinrichs IV.! Ja, die Nachricht von seiner Verhaftung erreichte noch die hinterste Provinz.« Athos musterte Rochefort kritisch und ließ sich nichts vormachen. »Ich nehme an, Ihr wisst nicht nur alles über die Cabale des Importants, wie man die gescheiterte Verschwörung gegen Mazarin bei fliegendem Wort nennt, sondern seid ein Teil von ihr gewesen.«
Rocheforts Miene war unergründlich. »Glaubt, was Ihr wollt. Ein Sprung in die Seine rettete mich.«
»Er war halbtot, als ich ihn fand.«, ergänzte Aramis.
»Ich lebe.« Ein tiefer Groll blitzte in Rocheforts Augen auf und verschwand sofort wieder hinter einer undurchschaubaren Maske. »Aber man hält mich für tot. Beste Voraussetzungen.«
»Für was?« Athos winkte gleich darauf ab und beantwortete sich seine Frage selbst. »Rache.«
»Viel zu profan.« Rochefort wirkte belustigt. »Ihr könntet mir, dem einstigen Meisterspion Richelieus, ruhig tiefere Beweggründe und höhere Ziele zutrauen.«
»Ich traue Euch alles zu.« Athos sah zu Aramis und musterte ihn kritisch. »Aber dir? Gemeinsame Sache mit Rochefort und mich lädst du auch dazu ein? Sag endlich, worum es wirklich geht!«
»Um Mazarins Absetzung.« Der Abbé klang sehr fröhlich, dafür dass er gerade ganz offen Hochverrat angekündigt hatte. »Er regiert Frankreich als sei er der König selbst. Du spürst die Auswirkungen sogar bis in die Provinz. Ist es nicht so?«
Athos nickte widerwillig und schüttelte gleich darauf den Kopf. »Ihr wagt zu viel.«
»Mitnichten, wir sind nicht allein.« Aramis schlug jetzt ernstere Töne an. »Es formiert sich längst Widerstand. In Paris schlagen sie die Fenster von Mazarins Anhängern mit Steinschleudern ein und nennen sich deswegen Frondeure. Der Unmut wächst, wir haben zahlreiche Verbündete, um dem Kardinal Einhalt zu gebieten.«
»Die Aufständischen revoltieren nicht nur gegen den Kardinal, sie bekämpfen die Monarchie!«, rief Athos aus. »Niemals werdet ihr mich für deren Sache gewinnen können!«
»In der Tat.« Rochefort rieb sich über das stoppelige Kinn, als sei er in einem Gedanken bestätigt worden. Den ehrbaren Graf von la Fère zu einem Frondeur zu machen, war aussichtslos. Aber man konnte den Musketier Athos überzeugen, Land und Leute zu retten. »Wir wollen einen Bürgerkrieg, wie er in England tobt, verhindern. Wir werden Mazarin durch unsere überlegenen Kräfte, der schieren Anzahl unserer Verbündeten, zum Abdanken zwingen und Ludwig XIV. als rechtmäßigen Herrscher einsetzen.«
»Der König ist noch ein Knabe, seine Mutter regiert für ihn.«
»Und durch sie Mazarin, ihr engster Vertrauter und Berater. Anna von Österreich wird neuen Rat brauchen, sobald der Kardinal nicht mehr ist.«
Athos musterte Aramis scharf. »Einen anderen Mann der Kirche, einen Abbé von Noisy vielleicht, der ihr künftig mit weisen Worten zur Seite stehen wird?«
»Nicht unwahrscheinlich.« Aramis schaute unschuldig zurück. »Du gewinnst in dieser Sache Frieden für deine Familie und deine Bauern, ich gewinne ein Amt am Hof, und Rochefort...«
»...mein Leben zurück und, zugegeben, auch die Genugtuung, am Ende zuletzt gelacht zu haben.«
»Nichtigkeiten.« Athos rümpfte zwar die Nase, aber er musste eingestehen, schon halb überzeugt zu sein. Payens Besuch hallte nach; der Gedanke, das Übel an der Wurzel packen zu müssen. »Ihr wollt Paris belagern, sollen das eure 'überlegenen Kräfte' sein?«
»Ich sagte bereits, wir wollen einen Bürgerkrieg verhindern. Mit Truppen aufzumarschieren, nur um dem Parlament den Rücken zu stärken und die Frondeure kühne Träume wagen zu lassen, wäre das Gegenteil davon.«
»Was ist also der eigentliche Plan?«
»Wir ziehen die mächtigsten und einflussreichsten Personen des Landes auf unsere Seite und mit ihnen deren militärische Schlagkraft. Schon diese Drohkulisse wird Mazarin zur Flucht zwingen, er hat nicht genug Armeen der unseren entgegenzustellen. Seine Niederlage wäre gewiss. Dann ist Frankreich diese Geißel los.«
»Ihr werdet mit diesen 'mächtigen Personen' und ihren Truppen kaum mich, meine zwanzig Morgen Land und die paar Bauernhöfe auf ihm meinen.«
»Nein, wir reden von den Herzögen und Markgrafen.«, erwiderte Rochefort. »Beaufort ist zwar aus dem Spiel genommen, aber die Dame von Longueville ist uns zugeneigt, ähnlich die Herzogin von Chevreuse.«
Aramis besaß den Anstand, bei dieser Bemerkung verlegen dreinzusehen und sich zu räuspern. Seine Liebschaften von damals und heute zahlten sich aus. Mit sanfter Stimme wandte er sich an Athos. »Du verfügst zwar nicht über ein Söldnerheer, aber über etwas anderes, wertvolles für unsere Sache; über einen tadellosen Ruf als Edelmann, einen bedeutsamen Adelstitel, der dir Gehör bei anderen Noblen verschafft, und über Kontakte nach England.«
Athos runzelte die Stirn. »Lord Winter, sprecht ihr von ihm? Das ist beinahe zwanzig Jahre her!«
»Ihn und uns verbindet für immer eine Nacht an der Lys.«
Athos' Lippen bildeten einen dünnen Strich. »Und wir werden für immer darüber schweigen.«
Rochefort lachte heiser. »Nur keine Scheu, Messieurs! Sprecht es offen aus, denn ich war dort und kenne euer kleines Geheimnis. Der Mord an Milady de Winter, ihre Hinrichtung. In der Tat, Lord Winter und ihr seid im Verbrechen vereint auf ewig!«
»Ihr wisst gar nichts, Rochefort!« Athos wischte die Erinnerung an jene Nacht mit einer knappen Geste beiseite. »Erklärt mir Euren Plan! Was hat Aramis von seinem Ausflug mitgebracht, was hat England mit alledem zu tun und was soll meine Rolle sein?«
Rochefort lehnte sich zufrieden zurück. Wie er es vorausgesehen hatte, Graf de la Fère hing so sehr an einem antiquierten Ehrbegriff, er war so halsstarrig in seinen Auffassungen, dass es ein Leichtes war, den Musketier Athos auf ihre Seite zu ziehen. Seine Fragen waren ein uneingestandenes Bündnisversprechen.
La Fère kämpfte für seine Privilegien, für die Ehre und seine Familie. Der Abbé d'Herblay folgte dem eigenen Profitstreben, der Aussicht auf mehr Macht und Einfluss für sich und seinen Orden. Rochefort war zufrieden mit seinen neuen Verbündeten, nachdem ihn die alten ertrunken glaubten.
»Im vergangenen Jahr hat sich die Lage für Charles I. in England dramatisch verschlechtert.«, erklärte er. »Der abtrünnige Cromwell und seine Männer rücken auf London vor. Mazarin schwankt und zögert noch mit der Entscheidung, auf welche Seite sich Frankreich stellen sollte oder sich besser ganz heraushalten.«
Athos' Miene verfinsterte sich noch einen Deut mehr. Er behielt seine Gedanken für sich, aber sie waren offenkundig. Der Kardinal war ein ehrloser, feiger Hund, bereit, ein befreundetes Königreich mit Kalkül zu verraten. Richelieu hätte sofort Truppen gesandt, um Charles I. zu unterstützen! Wann würde dieser italienische Pfaffe Frankreich und dessen Krone feige verraten?
Rochefort neigte den Kopf, als würde er diesen stillen Gedanken zustimmen. »Wir werden Abgesandte nach London schicken und König Charles einen Vorschlag unterbreiten; auf Einladung Anna von Österreichs soll ihre Schwägerin, Königin Henrietta, nach Frankreich reisen und hier Zuflucht und Schutz finden, bis der Bürgerkrieg entschieden ist.«
»Ihr wollte diese Einladung fälschen, nehme ich an.«
»Nicht doch! Sie ist echt, von Hand der Königinmutter verfasst. Zeigt sie ihm, Aramis!«
Der Abt lächelte und zog aus der Innentasche seines Mantels den erwähnten Brief, den er heimlich beschafft hatte.
»Die Herzogin von Longueville ist zwar gegen Mazarin, aber für die Königinmutter. Sie ist eine der Hofdamen und engste Vertraute. Sie hat Anna ins Gewissen geredet, den Hilferuf ihrer Schwägerin nicht länger ignorieren zu dürfen.«
Athos erkannte das Siegel und die Unterschrift auf dem Brief. Falls es doch eine Fälschung war, dann war sie täuschend echt.
»Anna von Österreich weiß von unseren Plänen?«
»Nein, sie ist nur davon überzeugt worden, eine andere Königin nicht dem Schrecken und Entsetzen eines Bürgerkriegs ausliefern zu dürfen. Auch gegen den Willen und Rat des Kardinals.«
»Henrietta wird die Einladung annehmen.«, ergänzte Rochefort »Es ist eine hervorragende Gelegenheit für sie, um nicht untätig abzuwarten, sondern hier dafür zu werben, dass Frankreich und alle anderen Nationen in den Konflikt eingreifen.«
»Schön und gut. Was nützt uns das alles gegen Mazarin?«
»Gar nichts.« Rocheforts Lächeln hatte etwas sehr Finsteres an sich. »Es ist nichts als ein Ablenkungsmanöver. Unser eigentliches Ziel soll es sein, euch beide nach dieser diplomatischen Reise als Abgesandte von Königin Henrietta nach Frankreich zurückkehren zu lassen. Mit neuem-« Rochefort hustete plötzlich und fasste sich an die Seite. Aramis übernahm das Reden und erklärte den weiteren Plan.
»Mit neuem Status als Diplomaten, der uns Zugang zur höheren Gesellschaft erlaubt. Du, Athos, kannst uns über Lord Winter eine Audienz bei König Charles verschaffen, bei der wir den Brief übergeben. Aber dein Titel reicht nicht aus, auch bei den eigenen Landsleuten Gehör zu finden.« Aramis seufzte. »Wie immer in solch politischen Konflikten verhält sich der Hochadel abwartend und neutral. Wir brauchen den Vorwand, unseren Status als Königin Henriettas offizielle Emissäre, um schlussendlich an die Mächtigen im eigenen Land appellieren zu können.«
»Ich verstehe.« Athos schwirrte der Kopf, aber er sah auch den Sinn in diesem Plan. »Es ist keine Angelegenheit von Tagen, eher von Monaten, bis die Sache für uns aufgeht. Falls sie aufgeht.«
»Das wird sie.« Rochefort hatte sich am Wein gestärkt und seine Stimme wiedergefunden. »Es ist sogar viel einfacher, als es klingt. Ich war in diesem verfluchten Jahr nicht untätig, ich hatte und habe noch Zugang zu Richelieus' Archiven in Paris. Dort sind Freund und Feind verzeichnet, ihre Namen und Aufenthaltsorte. Dort habe ich das entscheidende Zünglein an der Waage gefunden, damit sie sich zu unseren Gunsten neigt.«
Rochefort genoss den Moment, in dem Athos skeptisch und Aramis neugierig dreinsah, auf wen die Wahl gefallen war. Er spannte die Herren nicht länger auf die Folter. »Unser erstes Ziel ist ein Bund mit dem Markgrafen von Levis.«
Athos nickte langsam. »Der Marquis de Levis, ich verstehe, einer der mächtigsten und einflussreichsten Männer im Land. Es liegt nahe, aber ist es nicht so, dass er Kardinal Richelieu stets enger verbunden als dem König gewesen ist?«
»So ist es, und auch mit Mazarin verhält sich Levis' Loyalität nicht anders. Uns erwartet ein Umweg zu einem Bündnis mit ihm. Er führt uns über seinen Sohn, dem Vicomte von Ventadour, und mehr noch, über dessen Ehefrau.« Ein seltsames Lächeln lag auf Rocheforts Lippen und verschwand sofort wieder. »Gewinnen wir die Vicomtesse für uns, gewinnen wir das Haus Ventadour, gewinnen wir den Markgrafen von Levis, der seinen Sohn sehr liebt und ihm keine Bitte abschlagen wird.«
»Warum lassen wir den Teil mit Königin Henrietta nicht fallen und wenden uns stattdessen ohne Umschweife an die Vicomtesse?« Als er so fragte, lag in Aramis‘ Augen ein gewisses Funkeln, als wäre er bereit, jede weibliche Herausforderung anzunehmen und zu triumphieren.
»Weil auch die Ventadours dem Kardinal durch Eid näherstehen als dem König.«, winkte Rochefort ab. »Diese Tatsache werden wir nur mit List überwinden können. Ich muss es am besten wissen, denn vor meinem 'Tod' waren die Vicomtesse und ich...« Rochefort brach mit einem stillen Seufzer ab, ehe er sich fing und fortfuhr. »Hier beginnt die eigentliche, diplomatische Mission, nämlich die Freundschaft mit der Vicomtesse aufleben zu lassen.«
Aramis hielt das für eine eigenartige Formulierung, aber weil Rochefort sehr häufig vom 'Sterben', dem 'Tod' und dem 'Leben' sprach, tat er es als eine Eigenart ab. Stattdessen lächelte der Abt d'Herblay bescheiden und der Musketier Aramis selbstgefällig.
»Das sollte nicht schwierig sein, überlasst es nur mir. Mit derlei Formen der Diplomatie kenne ich mich aus, sobald man mir einen Vorwand verschafft, mich der Vicomtesse zu nähern ohne ihren Gatten sofort gegen mich aufzubringen.«
Es zuckte verdächtig in Rocheforts Mundwinkeln. »Großspurige Ankündigungen! Ich freue mich darauf, Euch scheitern zu sehen. Zum Henker, das wird ein Spaß!«
Aramis schmollte darauf beleidigt. Es schien nicht das erste Mal zu sein, dass Rochefort ihn bei seiner Tauglichkeit als Diplomat in Liebesdingen packte und verspottete.
Athos konnte nichts Amüsantes daran finden. »Euer Spaß ist unser Scheitern. Seid also vorsichtig mit Euren Wünschen.«
»Ihr gönnt anderen nicht die kleinsten Freuden!«, rief Rochefort aus und winkte ab. »Sei es drum, die Herren werden erfolgreich sein, mir gleich auf welche Weise. Reist nach England, überbringt den Brief. Kehrt mit der Antwort zurück nach Paris, anschließend trefft den Vicomte de Ventadour. Er steht selbst im diplomatischen Dienst, früher für Richelieu, heute für Mazarin. Nachrichten aus England werden ihn interessieren. Überzeugt dann nur noch seine Ehefrau, sich uns anzuschließen, mit der Wahrheit, mit einer Lüge, mit Schmeichelei, was immer nützlicher erscheint. Sie überzeugt ihren Gatten, er seinen Vater. Wir erhalten eine Streitmacht und mit ihr Levis‘ politischen Einfluss. Dann sind wir dem Ziel, Mazarin abzusetzen, sehr nah.«
»Das nennt Ihr viel einfacher, als es klingt.«, murmelte Aramis und meinte zu Athos: »Ich reise schon morgen nach Calais, um von dort überzusetzen. Schließt du dich mir an?«
Der Graf de la Fère nickte ohne zu zögern. »Ich halte nichts von Rocheforts Intrigenspielchen, aber wenn wir die englische Krone verteidigen und dafür nur einen Brief überbringen müssen, retten wir auch die französische. Das ist unser gemeinsames Ziel.«
»Danke, mein Freund.« Aramis drückte ihm erleichtert die Hand. »Ich zeige dir dein Zimmer für die Nacht und treffe anschließend die letzten Vorbereitungen für unsere Abreise.«
»So sei es.« Athos ließ ihm den Vortritt und traf an der Tür mit Rochefort zusammen, der sich mühsam aus dem Sessel gekämpft hatte. Ruhig, aber mit einer deutlichen Warnung in der Stimme, stellte Athos fest: »Ihr verschweigt uns etwas, Herr Meisterspion.«
»Das tue ich, es ist meine Natur.« Rochefort lächelte unheilvoll wie ein Teufel. »Aber es soll nicht zu Eurem Schaden sein, wenn Ihr nicht alles wisst. Im Gegenteil! Vielmehr beschütze ich Euch.«
»Wovor?«
»Eurem Gewissen.« erwiderte Rochefort trocken und Athos sagte nichts mehr darauf.
3 - Ein Schiff in den Wogen
Eine aufgebrachte Menge belagerte die Kutsche von Monsieur de Payen, schon seit sie durch das Stadttor in Paris eingetaucht war.
Die Straßen waren überlaufen, kaum mehr als schmale Gassen, durch die sich die Kutsche einen Weg bahnen musste. Selbst die breiten Prachtalleen und Brücken waren verstopft von Fuhrwerken, Sänften und Passanten, und der Kutscher musste den Pferden und dem Volk die Peitsche geben, damit es vorwärts ging.
Die Bürger von Paris hatten schnell bemerkt, dass der oberste Steuereintreiber Frankreichs in der Kutsche saß und ihre Wut zog sich wie ein Unwetter über ihm zusammen. Ob Handwerksgeselle, Marktweib oder ehrbarer Händler, alles Volk drängte zur Kutsche, um seinen Zorn über Payen zu entladen.
Das Geschrei und der Lärm waren unerträglich. Man forderte ein Ende der hohen Abgaben und mancher Tollkühne sogar den Tod Mazarins und seiner Lakaien.
Payen schwitzte und grunzte vor Angst wie ein Schwein auf dem Weg zum Schlachthof. Er krallte seine wurstigen Finger in das Polster, seine Lippen bebten. Die Vorhänge vor den Fenstern waren zugezogen, aber das Wogen der Menge draußen und das stockende Vorwärtskommen ließen sich nicht aussperren, nur etwas dämpfen.
Payen wischte sich mit einem Taschentuch über die fettige Stirn. »Tollwütiges Pack, wie können sie es wagen!«
Mit ihm in der Kutsche saß ein Offizier der Kardinalsgarde, Oberleutnant d'Artagnan höchstselbst, die trotz der bedrohlichen Raserei auf den Straßen keine Miene verzog. »Beunruhigt Euch ein ganz normaler Tag in Paris?«
Payen gingen bei der dreisten Frage fast die Augen über, aber er verschluckte sich an seiner Empörung und hustete unterdrückt.
D'Artagnan seufzte innerlich. Dieser Mann war ihr durch und durch unangenehm, aber sie war schon zu lange ein Soldat, um eine eigene Meinung zu haben. Ihr Befehl lautete, Payen unversehrt zum Palais Royal zu eskortieren und keine Revolte, kein feiger Angriff aus dem Hinterhalt, würde sie und ihre Männer draußen zu Pferd von der Pflicht abhalten.
Der Abgesandte Mazarins quiekte mit rotem Gesicht: »Haltet den Pöbel fern von der Kutsche, Ihr unnütze-«
»Beendet den Satz und mir fällt ein, dass die Garde am anderen Ende der Stadt gebraucht wird.«
Payen verstummte unter dem stählernen Blick, der mit diesen Worten einherging. Wenn d'Artagnan eine lässige Anmerkung wie eine Drohung klingen ließ, schwieg auch jemand wie Payen und hoffte, sich Madame la lieutenante, wie man sie am Hof hinter vorgehaltener Hand nannte, nicht zum Feind gemacht zu haben.
Die Fronten zwischen ihnen waren geklärt und d'Artagnan schob den Vorhang ein Stück beiseite, um hinauszuspähen. Nach zwanzig Jahren im Dienst waren ihre Augen hart, ihr Körper gezeichnet von Narben aus zahlreichen Schlachten, ihr dunkles Haar zeigte erste, graue Ansätze; ihr Gesicht zierte nur selten ein Lächeln.
Wenn sie die rote Uniform trug, war sie nicht von den Männern zu unterscheiden und trotzdem wusste Payen, dass sein Schutz in den Händen einer Frau lag. Er war nicht glücklich damit.
»Die Meute draußen geifert blutrünstig, man will mich lynchen! Und Mazarin schickt Euch! Nur Euch! Weh mir, der Kardinal hat mich verlassen!«
D'Artagnan ignorierte das Jammern und Wehklagen, welches sie ertragen musste, seit sie kurz hinter dem Stadttor der Kutsche zugestiegen war. Sie runzelte die Stirn und ließ den Vorhang zurückfallen. »Wir werden langsamer.«
»Es ist aus! Ich bin verloren!« Payen kauerte sich noch tiefer ins Polster und zuckte zusammen, als etwas dumpf gegen den Wagenschlag prallte. Jemand hatte den ersten Stein geworfen.
In Sekunden brach draußen ein Tumult los. Menschen schrien, Pferde wieherten und die Eskorte drängte mit Tritten und Schlägen das Volk zurück. Ein Ruck ging durch die Kutsche, als sie anfuhr und vorwärts preschte. Ein zweiter Ruck, als sie ebenso plötzlich wieder stehenblieb. Payen fiel gegen d'Artagnan, sie stieß ihn grob zurück auf die Sitzbank.
»Rührt Euch nicht, keinen Mucks!«, zischte sie und tastete nach ihrer Pistole. Ihre Finger berührten den Griff, sie stieß mit dem Fuß die Kutschentür auf und sprang behände hinaus, um ihren Männern beizustehen. Instinkt leitete sie und drängte alle anderen Verantwortungen in ihrem Leben beiseite. Hier und jetzt war sie Leutnant d'Artagnan, nicht Ehefrau, nicht Mutter. Sie erfasste die Situation, sofort bereit zum Angriff oder zur Verteidigung.
Die Kutsche hatte vor einer Mauer aus Menschen Halt gemacht, die Pferde stiegen in Panik und schlugen aus, ihre wirbelnden Hufe hielten den wütenden Mob auf Abstand. Der Kutscher fluchte beim Versuch, die Tiere unter Kontrolle zu halten. Ein berittener Gardist sprang ihm bei, packte das Gespann bei den Halftern und beruhigte mit Mühe sein eigenes, tänzelndes Pferd. Er allein stand zwischen der aufgebrachten Menge und einer Katastrophe, falls die Gäule endgültig durchgingen.
»Biscarat!«, rief d'Artagnan ihm über den Aufruhr hinweg zu und drängte nach vorn. Die Kutsche war von allen Seiten belagert, die Eskorte hielt dem Angriff noch ohne Waffen stand. Jeder Schuss, jede blanke Klinge würde Panik auslösen, eine kopflose Flucht, bei der ein verängstigter Mob alles in seinem Weg niedertrampeln und zerquetschen würde.
Biscarat reagierte nicht auf ihren Ruf, er hatte ihn nicht gehört oder war zu beschäftigt damit, sich nicht den Arm von den wilden Kutschpferden brechen zu lassen. Er war ein vorzüglicher Reiter, aber allein konnte er die Pferde nicht mehr lange bändigen. Der Kutscher war keine Hilfe, er drosch mit der Peitsche auf das Gespann ein und brüllte sinnlose Befehle.
Mehr Steine flogen, jeder ein gefährliches, tödliches Geschoss. Frondeure! Sie trafen die Kutsche, die Eskorte. Die Gardisten duckten sich tief über die Hälse der Pferde, um dem Steinhagel zu entgehen. Der Kutscher ließ die Zügel fahren und sprang Schutz suchend von seinem Bock.
D'Artagnan tastete sich geduckt voran, und trotzdem wischte ihr ein gezielter Schuss beinahe den Hut vom Kopf. Er zerzauste nur ihre Feder und ein zweiter Stein hätte sie an der Schläfe getroffen, aber eine lebende Deckung stand plötzlich dazwischen.
Bernajoux' zähes und tapferes Schlachtross nahm den Treffer in die Flanke mit einem wütenden Schnauben hin. Bernajoux hielt die Stellung, bot seinem Leutnant Schutz und erwiderte d'Artagnans dankbares Nicken mit einer stummen Frage nach ihren Befehlen.
»Nur verteidigen, schützt Payen und euch! Nicht schießen! Die haben Kinder dabei, diese Bastarde!« D'Artagnan verfluchte die Frondeure, Familien zu diesem Sturm auf die Kutsche aufgewiegelt zu haben. Wenn den Frauen nur ein Haar gekrümmt würde, nur ein Kind weinte, wäre die Mär von einer erbarmungslos vorgehenden Garde perfekt. Sie deutete zum verwaisten Kutschbock. »Ich muss da rauf!«
»Hältst dich wohl für das bessere Ziel?« Ein Grinsen verzerrte das narbige Gesicht von Bernajoux, aber es war kein belustigtes.
D'Artagnan verschwendete keine Zeit mit Erklärungen, sondern erteilte ihm Befehle. »Hilf Biscarat, er kann die Pferde nicht länger halten! Wir sind eingekesselt, Meunier und Forgeron decken unsere Flanken, Cahusac den Rücken! Wir müssen verhandeln!«
»Das ist verrückt, du bist verrückt.«, brummte Bernajoux, aber er trieb sein Ross gehorsam vor die Kutsche.
Biscarat dachte kurz darauf nicht anders darüber als der Hüne.
»Sie muss verrückt geworden sein!«
Das Gespann war mit Bernajoux' Hilfe gezähmt und drohte nicht mehr, durchzugehen und alles in seinem Weg zu Tode zu trampeln. Vorne bellte die zornige Meute Verwünschungen gegen Mazarin, aber den Frondeuren waren die Steine oder der Mut ausgegangen, nachdem sich die Garde weder vertreiben noch zu einer blutigen Schlacht gegen wehrlose Bürger hinreißen ließ.
Eine Pattsituation. Für die Kutsche ging es nicht vorwärts, für das Volk nicht zurück. Sie waren in diesem Hexenkessel gefangen und Biscarat musste brüllen, damit Bernajoux ihn noch verstehen konnte. »Sorel bringt uns um, wenn seiner werten Frau Gemahlin etwas zustößt!«
»Sind also so gut wie tot.«
»Was hat sie vor?!«
Bernajoux deutete auf die Menschenmenge. Ein Raunen huschte dort plötzlich von Ohr zu Ohr, wie ein leises Vibrieren. Geflüsterte Worte, die eher gespürt als wirklich gehört wurden. Die zornigen Rufe ebbten ab, sie wurden gedämpft ohne ganz zu verstummen. Alle Blicke richteten sich auf einen Punkt.
Ein Gardist war auf den Kutschbock geklettert und stand dort vor der Menge. Man erkannte d'Artagnan, man erinnerte sich an den Leutnant, an die Geschichten über sie. Sie war eine von ihnen, eine vom Volk. Sie hatte es wieder und wieder bewiesen, auf den Straßen, in Auseinandersetzungen mit dem Kardinal.
Jetzt machte sie sich freiwillig zum Ziel. Es wäre ein Leichtes gewesen, den Oberleutnant der Garde vom Bock zu schießen. Die Frondeure hätten sich rühmen können, einem von Mazarins ranghöchsten Offizieren den Garaus gemacht zu haben.
Aber die Schleudern blieben in den Taschen, weil die Stimmung kippte, von blinder Wut hin zu ratloser Verwirrung und gespannter Neugier. D'Artagnan war beliebt, ihr guter Ruf eilte ihr voraus. Sie zu töten wäre Selbstmord für die Fronde gewesen.
Biscarat sog scharf die Luft ein, als er d'Artagnans Idee begriff.
»Sie liefert sich aus, damit Payen und wir entkommen können?«
Bernajoux nickte. »Sorel wird uns umbringen.«
»Das spielt keine Rolle mehr, weil Jussac uns vorher den Kopf abreißt!« rief Biscarat. »Der Hauptmann hat bald keine Haare mehr zum Raufen übrig.«
»Gibt schöne Perücken.«
»Bürger von Paris!«, schallte es vom Kutschbock, ehe Biscarat dem Freund noch einen schiefen Blick für dessen seltsamen Humor zuwerfen konnte. D‘Artagnan hatte das Wort ergriffen.
»Lasst die Kutsche passieren!«
Neuer Lärm brandete auf, Johlen und Hohnrufe. Eine einzelne Stimme erhob sich über die anderen hinweg und machte sich zum Rädelsführer. »Niemals! Nieder mit Mazarin!«
D'Artagnans Blick schnellte dorthin. Ein rothaariger Bursche, dem kaum der erste Flaum ums Kinn spross, dafür sprenkelten umso mehr Sommersprossen seine Nase. Er fühlte sich stark in der Menge und forderte: »Gebt uns Payen!«
D'Artagnan lächelte grimmig. Einst war sie Kardinal Richelieu entgegengetreten und hatte ihm die Stirn geboten. Wer war dieser kleine Frondeur im Vergleich zu Seiner Eminenz? Ein Bengel, der Revolution spielen wollte. »Ich mache euch ein anderes Angebot.« Ihr Blick bohrte sich in die Augen des Rädelsführers. Er blinzelte unsicher, auf was sie hinauswollte. Ihr Angebot hätte eine Drohung mit Verstärkung sein können, Verhaftung und Prozess für jeden, der heute den Aufstand gewagt hatte. Sie hätte mit dem Schießbefehl spielen können und die Verhandlungsmasse wäre gewesen, die Leute und ihre Kinder friedlich abziehen zu lassen.
Aber sie war kein normaler Offizier; und sie war mit Grégoire verheiratet, der geduldig und besonnen war, wo Charlotte wütend und hitzköpfig handelte. Er war ihre bessere Hälfte in so vielerlei Hinsicht und sie sagte, was er gesagt hätte.
»Ich bleibe, ich höre zu! Ich werde persönlich mit dem König und der Königinmutter über eure Anliegen sprechen! Das ist mein Angebot!«
Der Rädelsführer verschränkte trotzig die Arme, aber er war in die Defensive gedrängt und verlor an Rückhalt. Nichts anderes als dieses Versprechen wollte das Volk haben. Es wollte Gehör finden, es wollte in seinen Nöten gesehen und verstanden werden. Es war zufrieden mit diesem Angebot, aber die Frondeure nicht, denen die Kontrolle über die Bürger entglitt.
»Das ist wertlos! Euer Wort bedeutet nichts, wir wollen Payen!«
»Und ich biete euch stattdessen Hoffnung.«
D'Artagnan klaute Grégoire schamlos die Worte von den Lippen, die er einst in Köln am Verhandlungstisch gesagt hatte. Aus seinem Mund klangen sie indes ehrlicher, weil er wirklich an sie glaubte. D'Artagnan hingegen setzte dem Frondeur die Pistole auf die Brust, um die Sache zu entscheiden. »Nehmt das Angebot an oder tragt die Verantwortung! Diese Kutsche wirdweiterfahren!«
Dem Frondeur schien allmählich zu dämmern, dass er einem schweren Doppelspanner und einer bis an die Zähne bewaffneten Eskorte im Weg stand; und dass sich der Leutnant der Garde sein Gesicht gut eingeprägt hatte. Wenn jetzt nur ein einziger, weiterer Stein flog, wenn die Antwort der Eskorte darauf Vergeltung wäre, wenn Frauen und Kinder in der Massenpanik zu Tode kämen - die Frondeure würden schuld daran sein. D'Artagnan hatte den Spieß erfolgreich umgedreht.
Unruhe machte sich breit, der Mob begann an den Rändern zu zerfasern. Aber die Aufwiegler in der Menge kämpften gegen ihre Niederlage an und hielten die Masse zusammen, indem sie die Wut neu entfachten. Wüste Beschimpfungen gingen über die Garde und Payen nieder, Drohungen flogen und Fäuste wurden geschüttelt.
Die aufgepeitschte Atmosphäre kehrte die Stimmung noch einmal um. Plötzlich kam Bewegung in den Mob, er drängte in alle Richtungen in einem Aufbäumen und gleichzeitigem Ausweichen. Unvorhersehbar, unkontrollierbar wie eine schlingende Bestie.
Biscarat und Bernajoux griffen instinktiv zu den Degen, zu den Pistolen. Die Pferde stampften unruhig mit den Hufen, sie tänzelten schlachterprobt und waren bereit, Brustkörbe zu zerschmettern und Leiber zu zertrampeln.
Aber d'Artagnan brüllte keinen Angriffsbefehl und die Männer behielten die Nerven. Das Vertrauen in ihren Leutnant war absolut, und so standen sie in geschlossener Verteidigungslinie zusammen.
Eine unsichtbare Welle schien sich durch den Mob zu wälzen; und dann riss plötzlich eine Lücke in der Menschenwand auf, sie wuchs und formte eine Gasse. Hufschlag ertönte, eine Reiterstaffel teilte die Menge - Verstärkung für die Garde, Rettung!
Die Frondeure, die eben noch einen blutigen Aufstand anzetteln wollten, änderten plötzlich ihre Gesinnung, um ungeschoren davon zu kommen. Sie schoben Menschen beiseite und herrschten sie an, Platz für die Männer des Königs zu machen.
Von dem Rädelsführer war nichts mehr zu sehen. Untergetaucht.
D'Artagnan zog die Brauen zusammen. Der Mob teilte sich und spuckte berittene Soldaten unmittelbar vor der Kutsche aus. Sie trugen Uniformen mit silbergestickter Lilie auf blauem Grund und Flammenzungen im Wappen. Musketiere.
D'Artagnan hätte erleichtert aufatmen sollen, aber sie barg ihre Gedanken zu diesem heroischen Auftritt hinter einer steinernen Miene. Biscarat tätschelte sein Pferd, während Bernajoux sich hoch im Sattel aufrichtete.
Keine dieser Gesten täuschte darüber hinweg, was allen bewusst war: Das Ende des Aufstands, die Flucht der Frondeure in einen Seitenwechsel, war nicht dem Mut der Garde und ihrer Anführerin zu verdanken, sondern den Musketieren. Sie hatten den Respekt der Bürger, sie musste keine Beschimpfungen und Steinwürfe ertragen. Man wich ihnen freiwillig aus und beugte sich ihnen.
Vorneweg ritt Leutnant de Jumonville. Er führte seine Männer gelassen, ohne Überheblichkeit an. Er hatte sich um seinen Posten mit Erfahrung, nicht mit Arroganz verdient gemacht. Er sparte sich jede überflüssige Bemerkung gegen d'Artagnan und nickte ihr nur einen knappen Gruß zu. Einst hatten sie gemeinsam gedient, einst hatte er ihren Befehlen gehorcht, bevor er diesen Posten von ihr übernommen hatte; ihn übernehmen musste, weil sie zur Garde des Kardinals übergelaufen war.
Es gab keinen Grund für Groll zwischen ihnen, aber manche Dinge waren auch nach Jahren noch nicht in Vergessenheit geraten. Als die Musketiere sich jetzt der Garde zur Seite stellten, wurde die Verstärkung auf beiden Seiten nur widerwillig akzeptiert.
Jumonville stieg vom Pferd und d'Artagnan sprang vom Kutschbock. Die Offiziere trafen sich auf neutralem Grund, während ihre Männer sich gegenseitig misstrauisch beäugten und das Volk sich in alle Winde zerstreute, um nicht zwischen die Fronten zu geraten.
D'Artagnan konnte in Jumonvilles Gesichtsausdruck weder Spott noch Herausforderung lesen. Trotzdem war seine Anwesenheit ein Affront gegen ihre Autorität, und sie forderte von ihm: »Bericht!«
»Seine Majestät war sehr besorgt, als er von den Unruhen in der Stadt erfuhr.«
»Ist das so?«
Jumonville war nicht dumm, im Gegenteil. Er schob d'Artagnans Zorn über die unangeforderte Verstärkung für die Gardisten an den nächsten Verantwortlichen weiter. »Kommandant de Tréville hielt Unterstützung für angebracht.«
»Was angebracht ist und was nicht, muss er mit Hauptmann de Jussac aushandeln. Monsieur de Payen ist unversehrt, wir werden die Eskorte zum Palais Royalfortsetzen. Einwände?«
»Keine.« Jumonville sah über d'Artagnans Schulter zur Kutsche. Ein paar Kerben und Schrammen hatte der Zusammenstoß mit den Frondeuren in der Karosserie hinterlassen. »Ich werde zusteigen. Mit Eurer Erlaubnis, Mad-- mon lieutenant.«
»Erteilt.«
D'Artagnan hätte beleidigt sein müssen, dass Jumonville sie auf ihrem Posten ablösen wollte, weil er sich für die bessere Leibwache hielt. Er hatte keine Ahnung, auf welche Gesellschaft er sich damit einließ, die Strafe für diese Ehrverletzung war ihm vergönnt! Und dafür, dass er sie beinahe 'Madame' genannt hatte. Mochte ihr Geheimnis auch inzwischen ein offenes und akzeptiertes sein, im Dienst hatte sie einen offiziellen Rang und Namen!
Jumonville winkte einem der Musketiere, sein Pferd am Zügel mitzuführen. D'Artagnan ließ sich vom alten Cahusac ihren Peur zurückgeben, der brav der Herde gefolgt war, selbst als seine Zügel im Aufruhr freigekommen waren. Vielleicht wurde er langsam alt und so stur wie ein Esel, der sich von nichts beeindrucken ließ.
D'Artagnan tätschelte dem grauen Wallach kräftig den Hals, saß auf und übernahm die Führung der kleinen Prozession. Gardisten und Musketiere hörten gleichermaßen auf ihr Kommando, als sie den Abmarsch befahl.
4 - Alte und neue Freundschaften
Der Aufstand war vorbei, die Kutsche konnte ihren Weg endlich fortsetzen. Zwar standen am Straßenrand noch einige Schreihälse, die nicht wussten wann sie besser nach Hause gehen sollten. Aber auch die gaben Fersengeld, sobald ihnen die Eskorte näher rückte.
D'Artagnan ritt vorneweg und sie spürte geradezu die Blicke der Passanten an ihr vorbei zu den Musketieren im Gefolge gehen. Als ob die Bürger nur deshalb still hielten und Platz machten, weil sie den Männern in den blauen Uniformen Respekt zollten; als ob sie glaubten, die Musketiere würden gar nicht die Kutsche beschützen, sondern die Gardisten des Kardinals überwachen. Bah!
Nach Richelieus Tod war seine Leibgarde den Haustruppen des Königs zugeteilt worden. Tréville war über Nacht und ungefragt zum Kommandanten über zwei rivalisierende Lager im selben Regiment geworden. Die einen schmückten sich mit der Lilie, die anderen mit dem Kreuz; zwei Einheiten, eine für den König und eine für den Kardinal.
Das Schicksal hatte schon einen seltsamen Humor! Durch die Zusammenlegung der Kompanien war d'Artagnan nun gleichzeitig Musketier und Gardist. Sie war Hauptmann Jussacs Stellvertreterin und Kommandant Trévilles Oberleutnant; es war wieder vereint, was einst auseinandergerissen worden war - aber es würde nie mehr richtig zusammenwachsen.
Die Kutsche fuhr über die Pont Neuf, unter der sich die Seine träge und stinkend durch Paris wand. Der Fluss wirkte ruhig und harmlos. Doch unter der braunen Oberfläche lauerte eine reißende Strömung, verhängnisvoll und tödlich für alles, was in ihre kalte Umarmung geriet. Eine eisige Hand tastete nach d'Artagnans Herz als das Reiterstandbild Heinrichs IV. in Sichtweite kam. Der König bewachte ein nasses Grab. Eine Wunde, so schmerzhaft wie frisch geschlagen.
D'Artagnan zwang sich, nicht feige den Blick abzuwenden, die Erinnerung an jene Nacht nicht zu verdrängen. So viel schuldete sie Rochefort, seinen Tod und ihre Schuld daran sehenden Auges zu ertragen. Wenn sie ihn nur rechtzeitig hätte warnen können! Wenn sie nicht dort gewesen wäre, in seinen letzten Momenten, wenn er sich nicht verraten und von allen Freunden verlassen gefühlt hätte! Vielleicht würde er noch leben.
Ihre steife Haltung und ihr Schaudern blieben nicht unbemerkt. Bernajoux und Biscarat schlossen auf, bis sie neben ihr ritten. Sie passierten schweigend die Statue. In Gegenwart ihrer Kameraden, ihrer Freunde, entspannte sich d'Artagnan wieder. Sie brauchte ihre Dankbarkeit für die beiden nicht offen sagen. Ein Aufatmen genügte und sie verstanden sich ohne Worte.
Biscarat musterte seinen Leutnant aus klugen, dunklen Augen. Sie war ein offenes Buch für diesen Menschenkenner, nicht nur weil sie seit Jahren beste Freunde waren und keine Geheimnisse voreinander hatten. Biscarat hatte einen scharfen Verstand und keine Angst, ihn auch gegen einen Vorgesetzten zu benutzen. Wie jetzt, als er seine Kritik an ihren Befehlen in eine scherzhafte Frage kleidete. »Wirst du je aufhören, die Heldin zu spielen?«
»Sobald ihr aufhört, eine zu brauchen.«
»Wir?« Biscarat schmunzelte. »Wir kommen zurecht, auch ohne Jussac Rede und Antwort stehen zu müssen, warum du dich zur Zielscheibe für einen wütenden Mob gemacht hast.«
Bernajoux brummte zustimmend. »Das war lebensmüde.«
»Unsinn!« D'Artagnan winkte harsch ab. Gleichzeitig wusste sie, dass die Freunde recht hatten. Sie hatte aus einem Impuls heraus gehandelt und sie hatte Glück gehabt, dass es so und nicht anders ausgegangen war. Trotzdem wollte sie es nicht zugeben. »Das Ziel war Monsieur de Payen. Ihnen ein anderes zu bieten, hat sie lange genug verwirrt bis Verstärkung eintraf.«
»Das konntest du nicht wissen.« Biscarat sah über die Schulter zur Kutsche und senkte die Stimme. »Payen ist ein quiekender Feigling, aber er hätte jederzeit aus dem Fenster rufen können, dass wir die Frondeure niedermachen sollen.«
»Ohne meinen Befehl hättet ihr das niemals getan. Ihr seid die wahren Helden hier, standgehalten zu haben.« D'Artagnan meinte es ernst, es gab nichts zu beschönigen. »Es wäre der Beginn eines Bürgerkriegs gewesen. Niemand wird sich daran erinnern, dass die Männer der Roten Garde es mit Besonnenheit abgewendet haben. So ist das Heldenleben.«
»So ist unser Leben. Du solltest inzwischen ein anderes führen.« Biscarat nahm sich viel heraus, aber d'Artagnans Stirnrunzeln hielt ihn nicht davon ab, seine Gedanken offen zu sagen. »Hast du vorhin wenigstens eine Sekunde an Sorel und die Kinder gedacht? Wie sie sich fühlen beim Gedanken an die Todesgefahr, in die du dich rücksichtslos wirfst?«
»Wenn ihr Grégoire nichts erzählt, erzähle ich nichts Madeleine und Josepha. Wie gefährlich es für euch beide heute geworden ist, beinahe von einem Mob gelyncht! Und dass ihr das Soldatenleben aus Rücksicht auf eure Frauen aufgeben solltet.«
In d'Artagnans Stimme lag ein deutlich warnender Unterton. Die Diskussion, ob sie den Posten als Oberleutnant niederlegen sollte, ging niemanden außer sie und Grégoire etwas an! Als ob sich Jussac jemals diese Frage von seinen besten Freunden gefallen lassen müsste. Er war genauso ein Vater, Ehemann und Soldat, aber niemand machte ihm daraus einen Vorwurf.
»Madeleine ist schwanger.«
D'Artagnan blinzelte überrascht und sah zu Bernajoux. »Ach?«
Der Hüne nickte und die Narben in seinem Gesicht formten ein glückliches Lächeln. Es verschwand gleich wieder und er schüttelte den Kopf. »Sollte das Soldatenleben vielleicht aufgeben. Für sie, für unser Kind.«
»Willst du das denn?«
»Habe nie etwas anderes gekannt. Es wäre... schwer.«
D'Artagnan kaute auf ihrer Unterlippe. Beschämt, weil ihr erster Gedanke über die freudige Neuigkeit kein herzlicher Glückwunsch gewesen war, sondern die Befürchtung, dass Bernajoux den Dienst quittieren könnte; dass er mit Madeleine Paris verlassen könnte und sie sich nie wiedersahen würden.
Sie schüttelte ihre befremdliche Selbstsucht ab, die Gefühle und Erinnerungen aus alten Tagen, und sagte zuversichtlich: »Welchen Entschluss auch immer Madeleine und du fasst, es wird die richtige Entscheidung sein. Ich freue mich für euch! Wann ist es soweit?«
»Dauert noch ein paar Monate.«
»Die sind bald um! Wie geht es Madeleine? Ist alles vorbereitet? Habt ihr eine gute Hebamme gefunden? Ein Zimmer eingerichtet? Ihr habt keine Ausstattung, ich sehe es dir an, du hast noch gar keinen Gedanken daran verschwendet! Alles bleibt an Madeleine hängen, das hätte ich mir gleich denken können. Männer! Ich muss mich dringend mit ihr treffen, ja, ich werde sie besuchen und ihr etwas unter die Arme greifen. Mir fällt ein, ich habe einige Dinge aussortiert, aus denen die Kinder hinausgewachsen sind. Bestimmt kann sie noch vieles davon gebrauchen!«
D'Artagnan bemerkte gar nicht, dass sie in plötzlich entfachtem, vorfreudigem Eifer dem armen Bernajoux keine Gelegenheit zum Antworten ließ.
Genauso wenig bemerkte sie Biscarats breites Grinsen, mit dem er anmerkte: »Diese Dinge behältst du besser selbst.«
»Hu? Warum?«
Biscarat tat unschuldig. »Wer weiß, ist nur so eine Vermutung.«
Sein Blick streifte d'Artagnan nur flüchtig, aber blieb dabei etwas zu lange an ihrem Bauch haften, um noch irgendeinen Zweifel an seinen Andeutungen zu lassen. Sie wehrte sofort alle Vermutungen ab. »Ich bin nicht schwanger!«
»Natürlich, natürlich.« Biscarat ließ das Thema fallen und nickte Bernajoux zu. »Heute Abend, im Tannenzapfen? Josepha wird uns die besten Plätze freihalten, wir besaufen dein neues Glück, bis du nicht mehr davor wegrennen kannst!«
Bernajoux brummte zustimmend und ertrug den freundlichen Spott noch bis hinter die Tore des Palais Royal. Die Eskorte war von ihren Pflichten entbunden und d‘Artagnan sandte Gardisten und Musketiere zurück auf ihre Posten. Sie selbst schlug, nach einem Umweg zu Magister Travert, dem Wundarzt der Garde, um eine Erkenntnis reicher den Weg in die Gärten des Palasts ein.
*~*~*~*~*
Sie nannten das Palais Cardinal seit zwei Jahren Palais Royal. Der gewaltige Palast war nach Richelieus Tod in den Besitz der Königsfamilie übergegangen.
Der Louvre war ein niemals vollendetes Bauprojekt, ständiger Erweiterung und Veränderung unterworfen. Es mangelte ihm an Luxus und nötiger Ruhe und so war die Königinmutter kurzerhand mit ihren Söhnen in ein anderes Domizil von noch viel größerer Pracht und Strahlkraft umgezogen.
Böse Zungen behaupteten, die Entscheidung sei auf Betreiben Kardinal Mazarins hin geschehen, damit er größte Kontrolle über die Königsfamilie ausüben könne. Er war Pate und Erzieher des Kindkönigs, noch dazu unterstellte man ihm eine heimliche Liebschaft mit Anna von Österreich. Sie sei dem verführerischen Aussehen und einnehmenden Wesen von Jules Mazarin, Giulio Mazzarino, verfallen.