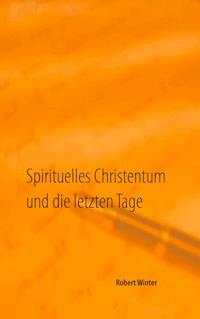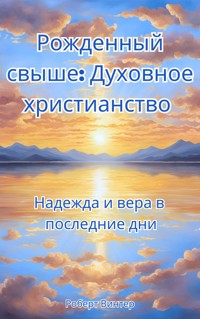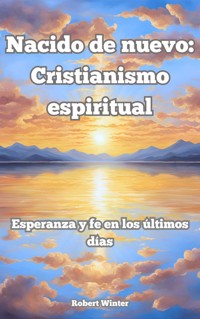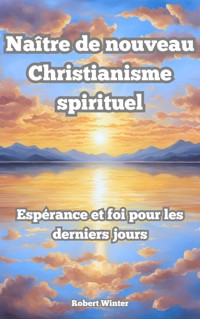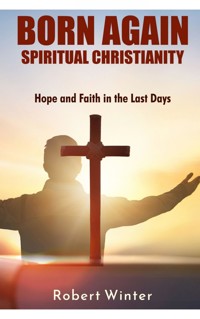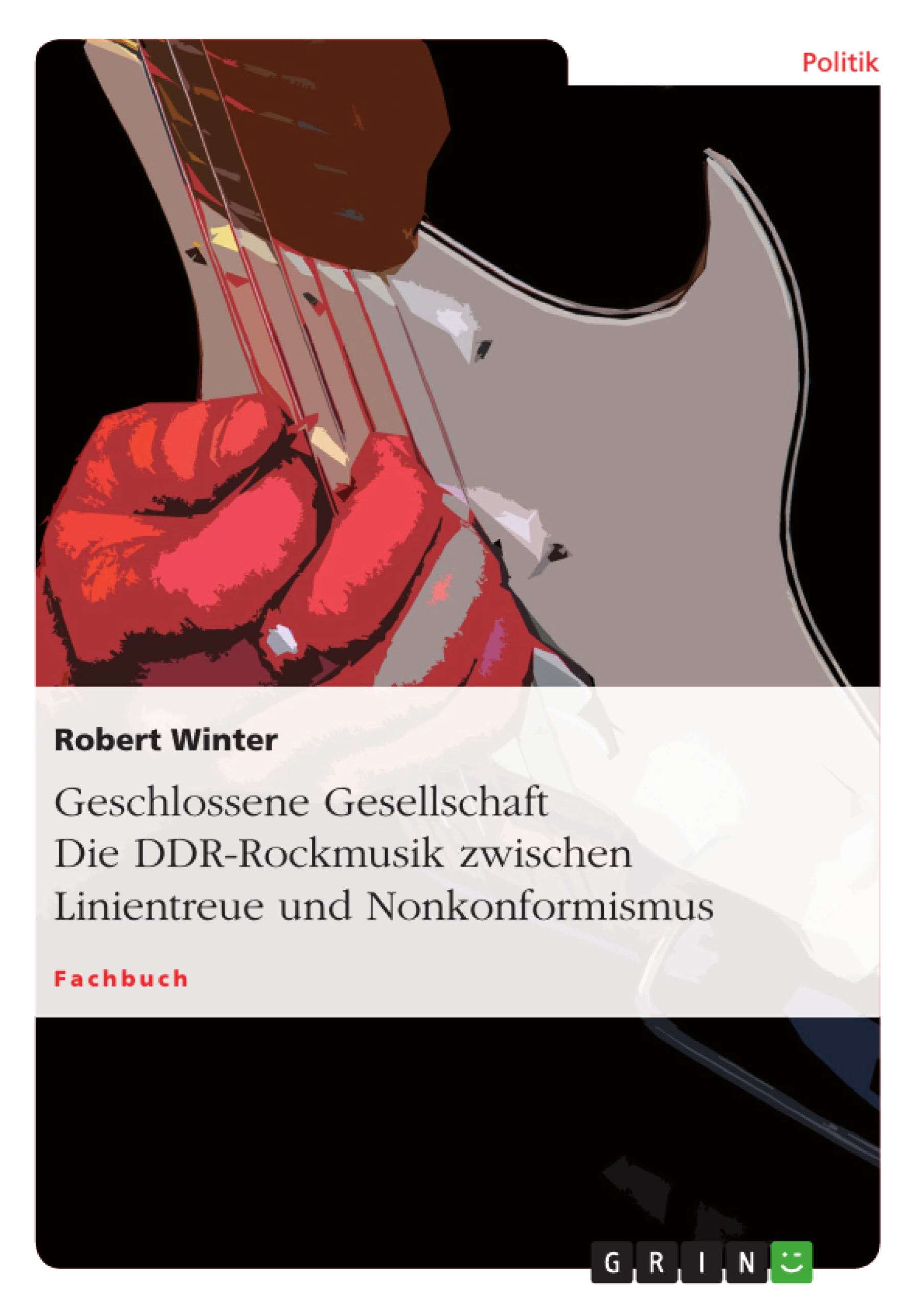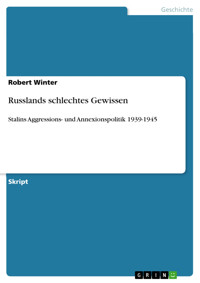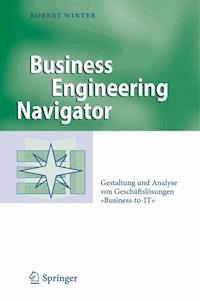9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Durch den Tod meines eigenen Kindes habe ich die Verlustangst, die aus meiner Kindheit entstanden ist, durch Zufall verloren. Diese Traumabewältigung habe ich versucht, im Einzelnen zu verstehen, um eine Hilfestellung für andere anzubieten, damit sie sich selbst analysieren können und um (un-) erkannte Traumata zu verstehen und zu beheben.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 410
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Urvertrauen
Die eigene Handlungsunfähigkeit überwinden
Robert Winter
Urvertrauen – Die eigene Handlungsunfähigkeit überwinden
1. Auflage 2025
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar.
Website: www.robertwinter.net
Veröffentlichungsbegleitung, Cover & Buchsatz: Tanja Giese, www.im-selbstverlag.de, in Kooperation mit www.buchcoverdesign.online
Druck und Distribution im Auftrag der Autorin: tredition GmbH, Heinz-Beusen-Stieg 5, 22926 Ahrensburg, Germany
Softcover: ISBN 978-3-384-52872-8
Hardcover: ISBN 978-3-384-52873-5
E-Book: ISBN 978-3-384-52874-2
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Für die Inhalte ist der Autor verantwortlich. Jede Verwertung ist ohne seine Zustimmung unzulässig. Die Publikation und Verbreitung erfolgen im Auftrag des Autors, zu erreichen unter: tredition GmbH, Abteilung „Impressumservice“, Heinz-Beusen-Stieg 5, 22926 Ahrensburg, Deutschland.
Kontaktadresse nach EU-Produktsicherheitsverordnung: [email protected]
Inhaltsverzeichnis
Danksagung
1. Vorwort
2. Einleitung
3. Meine Grundlagen für das Selbststudium
3.1 Bert Hellingers Familienkonstellationstheorie
3.2 Epigenetik
3.3 Verantwortung und Verantwortungsgefühl
3.4 Fremde Schicksale
3.5 Maslowsche Bedürfnispyramide
4. Die Rolle der Gene: Aus der Ohnmacht zurück ins Urvertrauen
4.1 Urvertrauen
4.2 Handlungsohnmacht
4.3 Vermeidungsstrategie
4.4 Überwindungsbedürfnis
4.5 Seelischer Halt
4.6 Urvertrauen zurückgewinnen
4.7 Epigenetik
4.8 Einfühlungsvermögen
5. Grundvoraussetzungen
5.1 Lunge (Atmen)
5.2 Sinnesorgane (Körpertemperaturregulierung)
5.3 Schlaf
5.4 Saugreflex (Nahrungsaufnahme)
5.5 Immunsystem
5.6 Mutter
5.7 Vater
5.8 Mein Start ins Leben und meine Grundvoraussetzungen
5.9. Resümee zu den Personen Mutter und Vater
6. Sicherheitsbedürfnisse
6.1 Die Eltern
6.2 Die Mutter als „Krankenhaus“
6.3 Der Vater als „Polizeistation“
6.4 Wodurch zerrüttet die Paarbeziehung?
6.4.1 Das Geben-und-Nehmen-Prinzip in Harmonie
6.4.2 Das Geben-und-Nehmen-Prinzip wird zum Konflikt
6.5 Die Trennung der Eltern
6.6 Ein Teil meines Urvertrauens zerbrach unter der Trennung der Eltern
6.7 Resümee zur Mutter- und Vaterliebe
7. Soziale Bedürfnisse
7.1 Stufenmodell nach Piaget
7.2 Erziehung
7.3 Die Familie
7.4 Die Organisation des sozialen Lebens
7.5 Freundschaften
7.6 Vergleiche
7.7 Ausgleich
7.8 Mit dem Aufbau von Resilienz dem Ohnmachtsgefühl vorbeugen
7.9. Meine sozialen Kontakte mit der Außenwelt
7.10 Resümee des Halts im Leben
8. Individuelle Bedürfnisse
8.1 Mögliche Auswirkungen eines Schuldverhältnisses vom Elternteil zum Kind
8.2 Die Wortwahl unserer Sprache
8.3 Das Topf-Deckel-Prinzip
8.4 Hindernisse zur Erfüllung individueller Bedürfnisse
8.5. Meine eigenen individuellen Bedürfnisse
8.6 Resümee der individuellen Bedürfnisse
9. Selbstverwirklichung
9.1 Die Bedeutung des sozialen Gefüges für die Gesundheit
9.2 Wodurch entsteht in erster Linie Verlustangst?
9.3 Max-Leonard, meine Selbstverwirklichung
9.4 Resümee zur Selbstverwirklichung
10. Die Verantwortungsverschiebung hilft dem Überwindungsbedürfnis
10.1 Die Hilfsmittel für das Überwindungsbedürfnis
10.1.1 Indizien für eigene Probleme
10.1.2 Sich des richtigen Problems bewusst werden
10.1.3 Die Max-Leonard-Pyramide
10.1.4 Saatkörner
10.1.5 Training
10.2 Auswirkung von Belehrungen bei einer aufgebauten Vermeidungsstrategie
10.3 Beispiel für die Anwendung der Max-Leonard-Pyramide
10.4 Das Saatkorn „Halt der Eltern“
10.5 Das Saatkorn „Den Auftrag beenden“
10.6 Das Saatkorn „Ja-oder-Nein-Frage“
10.7 Das Saatkorn „Verantwortungsverschiebung“
10.8 Das Abtrainieren der Vermeidungsstrategie
10.9 Stressauflösung durch Zufall
10.10 Meine wiedergewonnene Selbstverantwortung:
10.11 Wie entwickelte sich mein Leben mit Selbstverantwortung
Situation A: Jeder nimmt Erlebnisse anders wahr.
Situation B: Die Schuldzuweisung kam nicht bei mir an
Situation C: Auch wenn keine Schuld besteht, so bleibt es eine Tatsache
Situation D: Die Magie
Situation E: Meine Erfahrung weitergeben, da sie wertvoll ist
Situation G: Der vermutliche Grund des Immundefekts meines Sohnes
Situation H: Was wurde aus der großen Liebe Greta?
Situation I: Eine neue Beziehung
Situation J: Das große Hinterfragen
Situation K: Was macht eigentlich die wahre Liebe Wally?
Situation L: Mein Ausgleich für den Tod meines Kindes
Situation M: Eine Tatsache ist schwer zu reparieren
Situation N: Meine Verantwortungsverschiebung
Ich komme zu meiner Pyramide zurück.
11. Der Ausgleich
11.1 Verzeihen, Vergeben, Verstehen und Verbessern
11.2 Der Ausgleich von Julia
11.3 Meine Lebensaufgabe und neue Selbstverwirklichung
11.4 Resümee meiner Erkenntnisse
12. Quellenangabe
Danksagung
Ich danke Marlies Schmidt und Dr. Mario Hubatsch für die Unterstützung in vielen Stunden unentgeltlichen Austauschs in den vergangenen vier Jahren.Wie sehr ihre Unterstützung dieses Buch geprägt hat, erzähle ich auf meiner Webseite www.robertwinter.net.Mein Dank gilt auch allen weiteren Menschen, die auf unterschiedlichste Weise zur Entstehung dieses Buches beigetragen haben.
1. Vorwort
Ich möchte Ihnen gerne einen Ausschnitt aus meinem Leben erzählen, der für meinen Weg zur inneren Ruhe maßgeblich war.
Im Alter von fünf Jahren trennten sich meine Eltern. Das löste in mir eine prägende Verlustangst aus, die mich im Unterbewusstsein lange gehandicapt hat. Solch eine Verlustangst unterbricht nämlich die Hinbewegung zu den Eltern. Mir fiel es also schwer, mich auf meine Eltern zuzubewegen. Als ich 41 Jahre alt war, schlief mein eigener Sohn für immer ein. Ich wusste in diesem Moment, dass ich meinen Sohn auch nach dieser Trennung immer weiter lieben werde. Diesen Gedanken an meine ewige Liebe übertrug ich auf meine Eltern, sodass mir bewusst wurde, dass sie mich ebenfalls immer lieben. Infolgedessen verlor ich meine Verlustangst. Nun fiel die Distanz zu meinen Eltern, und das hatte positive Nebeneffekte. Durch diese Erfahrung lernte ich Zusammenhänge zu erkennen, die ich als Lebenshilfe weitergeben möchte: wie durch Trauma ausgelöste Handlungsohnmacht überwunden werden kann.
Traumatische Erlebnisse halten einen davon ab, in entsprechenden Situationen selbstbestimmt zu leben – sie machen einen handlungsohnmächtig. Bei mir zum Beispiel war solch ein Erlebnis die Trennung meiner Eltern. Ich war unfähig, zu meinen Eltern hinzugehen. Stattdessen mussten sie zu mir kommen. Es gab alsoin mir eine Blockade, die nur von außen angegangen werden konnte – das war nicht selbstbestimmt. Das war, nicht frei. Und das hat mich in vielen Lebenssituationen gehindert glücklicher zu sein.
Dazu, wie Sie Handlungsohnmacht in sich selbst erkennen können, um diese aufzuheben, biete ich Ihnen hier meine gesammelte Erfahrung an. Ich habe anhand meiner Lebensgeschichte ein Werkzeug zur Selbstanalyse entwickelt, das ich Ihnen an die Hand geben möchte: die Max-Leonard-Pyramide. Die Fragen, die sich aus den Themen der einzelnen Ebenen der Pyramide ergeben, sollen Ihnen helfen, den Ursprung Ihres Handelns besser zu verstehen. Denn meine eigenen Erfahrungen und der Erfahrungsaustausch mit so vielen anderen Menschen, die sich mir seit dem Tod meines Sohnes anvertraut haben, hat mich von einem überzeugt: Wenn wir die Ursachen dessen, was uns zurückhält, erkennen und verstehen, können wir unsere Selbstheilungskräfte steigern.
Und die Kirsche auf dem Kuchen? Uns selbst besser zu verstehen, kommt auch unseren Mitmenschen zugute. Denn so können wir das Einfühlungsvermögen entwickeln, auf Menschen mit Vertrauensproblemen einzugehen, die gegebenenfalls auch von einer Handlungsohnmacht herrühren können.
2. Einleitung
Die meisten Eltern bringen ihren Kindern bei, dass sie nicht mit Fremden mitgehen sollen. Auch wenn es hier um den Erfahrungswert meiner Lebensgeschichte gehen soll – nicht mich als Person – sollten Sie mich also etwas kennenlernen, bevor Sie mich auf dieser Gedankenreise begleiten. Schließlich ist ein zentrales Thema dieses Buches Vertrauen – genauer gesagt, Urvertrauen.
Ich heiße Robert, bin mittlerweile 54 Jahre alt und in Deutschland geboren. Über meine Person kann man wunderbar Witze reißen, da ich einen Beamtenstatus habe und man über Beamte sagt, sie seien faul und müssten aufpassen, damit sie ihren Feierabend nicht verschlafen. Wenn ich also nicht träume, dann arbeite ich für das Finanzamt und prüfe, ob Steuerpflichtige nicht noch mehr Steuern zahlen müssen. Vielleicht sind Sie nun doch froh, wenn ich auf der Arbeit weiterschlafe.
Sport ist in allen Varianten mein Hobby. Müsste ich eine Lieblingssportart benennen, wäre es American Football. Der hat mich am meisten sowohl als Zuschauer und Spieler als auch als Trainer geprägt. Die Trainer des Sports bezeichnen ihn als Rasenschach. Der wesentliche Unterschied aus Publikumssicht ist, dass sich beim Schachspiel auf dem Feld die Figuren stets nur einzeln und abwechselnd bewegen und beim American Football – wenn es richtig läuft – alle gleichzeitig. Aus Trainersicht liegt der Hauptunterschied in einer seiner wichtigsten Aufgaben: Beim American Football muss er dem Team nicht nur die richtigen Techniken beibringen, sondern auch die Bereitschaft jedes Spielers aufbauen, vollen Körpereinsatz zu zeigen. Nur so kann er den Spielern helfen, Vertrauen sowohl in die eigenen Fähigkeiten als auch untereinander zu entwickeln. Jeder muss sich auf das andere Teammitglied verlassen können.
Beruf und Hobbys sind einfach zu erzählen. Wenn mich Menschen jedoch nach meinen Charakterzügen fragen, antworte ich gerne, dass es auf die Empfindung jedes Einzelnen ankommt. Wer etwa meinen Humor mag, findet mich lustig – wer nicht, der nicht. Da muss jeder selbst herausfinden, wie er mich einschätzt.
Ich habe aber zwei große Stärken, die ich Ihnen nicht vorenthalten möchte: mein logisches Denken und meine Empathie. Natürlich können oder sollten Sie meine Fähigkeit zur Logik in diesem Buch kritisch hinterfragen. Ich konzentriere mich hier auf die Empathie.
Empathie bedeutet, dass man sich in andere Personen hineinversetzen kann, um deren Bedürfnisse und Gefühle zu erkennen. Man nennt das auch Einfühlungsvermögen. Durch dieses Hineinversetzen kann man Menschen trösten, ihnen gut zureden oder sie unterstützen. Im Laufe meiner Geschichte werden sie feststellen, dass meine Stärke für die Fähigkeit zur Empathie ein Nebenprodukt weniger schöner Aspekte meiner Kindheit war. Ich habe einen Schutzmechanismus aufgebaut, der hinterher zur Schlüsselkompetenz für mein späteres Selbststudium geworden ist.
Ich bin Vater eines Kindes namens Max-Leonard. Dieses Kind wurde mit einem Immundefekt geboren und konnte sich nicht selbstständig gegen Viren, Pilze und Bakterien wehren. Max-Leonard wurde sogar trotzdem acht Jahre alt, obwohl ihm eine viel geringere Lebenserwartung zugesprochen worden war. Nach seinem Ableben besuchte ich sofort eine Psychotherapeutin. Nach zehn Sitzungen haben wir gemeinsam festgestellt, dass ich den Tod umgehend verarbeitet habe, und meine sofortige Verarbeitung zu keiner psychologischen Beeinträchtigung geführt hat. Da kein depressives Verhalten vorlag, sondern sogar meine Schutzmechanismen aufgehoben waren, entschieden wir gemeinsam, dass ich nach dem Grund meiner sofortigen Verarbeitung suchen sollte, um meine Erfahrung weiterzugeben.
Hierbei unterstützte mich eine Psychotherapeutin vom sozialen Dienst. Mit ihr traf ich mich regelmäßig und wir sprachen meine Erkenntnisse schrittweise durch.
Während meines neunjährigen Selbststudiums habe ich oft bemerkt, dass ich aufgrund des Todes meines Kindes in eine Schublade gesteckt und mir depressives Verhalten unterstellt wurde. Letztlich macht mich der Tod meines Kindes zwar traurig – gleichzeitig wurde er aber die Voraussetzung dafür, dass ein darauffolgendes Ereignis mir meine ständige Verlustangst nahm. Durch dieses Zusammenspiel führte der Tod meines Kindes nicht zu einer Depression.
Nachdem ich meine Situation durch das Selbststudium verstanden hatte, kam ich am Ende meiner Reise zu einer weiteren Erkenntnis: Ich kann anderen Menschen das Konzept des Urvertrauens begreiflich machen. Weil es seitens der Wissenschaft noch keinen Konsens gibt, wie man Urvertrauen verstehen muss, habe ich nach einem gemeinsamen Nenner gesucht – und ihn gefunden. Mit meiner Definition von Urvertrauen konnte ich verstehen, wie ein Kind am effektivsten präventiv geschützt wird, wie Trennungskinder fühlen und wie Eltern das Vertrauen ihrer Kinder zurückgewinnen können (selbst wenn diese ihnen den Rücken zugekehrt haben). Über das Urvertrauen konnte ich mir auch erklären, wie eine Ohnmacht entsteht, die beispielsweise bei Versagensängsten, einer Borderline-Persönlichkeitsstörung, Burn-out und Suizidalität vorkommt, und wie sich sexueller Missbrauch auf das Leben auswirkt und verarbeitet werden kann. Kurz: Meine Definition von Urvertrauen hilft, zu verstehen, wie man sich vor akuten Stresssituationen schützen oder den anhaltenden Stress als Auswirkung dieser Situationen abbauen kann. Dabei betrachte ich besonders die Auswirkungen des sexuellen Missbrauchs eines Elternteils an seinem Kind. Natürlich ist keine Erfahrung eins-zu-eins übertragbar. Ich teile meine Erfahrungen und Schlüsse aber mit dem Ziel, andere zu unterstützen, bei eigenen Problemen einen eigenen Lösungsweg herauszufinden.
Zu guter Letzt gibt es noch eine Charaktereigenschaft, die ich an mir schätze. Ich rede nicht gerne um den heißen Brei. Legen wir los.
3. Meine Grundlagen für das Selbststudium
Mein Busenfreund gestand mir, dass er mich bewundert. Als ich vierzig Jahre alt war, habe ich mein einziges Kind Max-Leonard, Max, im Alter von acht Jahren durch eine Krankheit verloren. In der Regel entsteht bei den Eltern durch die Verantwortung, die sie ihren Kindern gegenüber empfinden, nach solch einem Erlebnis eine Art Ohnmachtsgefühl, was man dann Trauma nennt, das zu einer Depression führen kann. Heute bin ich sechzehn Jahre älter und mein Busenfreund erkennt keine Anzeichen von Depression bei mir.
Ließ ich einfach nur keine Trauer zu? Oder ist etwas an mir besonders außergewöhnlich?
Da ich nicht instinktiv davon ausgehe, dass ich etwas Besonderes bin, habe ich mit der Unterstützung einer Psychotherapeutin ein Selbststudium begonnen. Dabei kam heraus, dass ich vor dem Tod meines Sohnes Situationen durchlebt hatte, die mir Stress verursachten und damit zu einer Beeinträchtigung meiner Lebensqualität geführt hatten. Ich habe diese Stresssituationen, genauer gesagt die Tatsache, dass diese Situationen stressbehaftet waren, jedoch als normal hingenommen. Nach dem Tod meines Sohnes geriet ich wieder in diese gleichen Arten von Situationen, verspürte aber keinen Stress mehr. So konnte ich zum Beispiel vorher in einer romantischen Beziehung nicht als Erster ‚Ich liebe dich‘ sagen, sondern benötigte zuvor eine Sicherheit, dass meine Partnerin das auch so fühlte – meistens musste meine Partnerin die drei Worte also zuerst aussprechen. Nun fällt es mir nicht mehr schwer und ich sage ‚Ich liebe dich‘, wenn ich das Bedürfnis dazu habe. Ich habe das Vertrauen wiedergefunden, das mir diese Fähigkeit gibt.
Ich war also traurig wegen des Todes meines Kindes. Gleichzeitig befreite mich das Erlebnis von Stressempfinden in bestimmten Situationen, sodass die Traurigkeit keine Depression hinterließ. Etwas in mir musste sich also verändert haben. Etwas, das dieses unterschiedliche Empfinden in den gleichen Situationen erklärt.
Unbewusst waren hier meine Eltern der Schlüssel zum Erfolg. Kurz erklärt – ich bin mit fünf Jahren zum Trennungskind geworden, woraus in der Regel Verlustängste entstehen. Direkt nach dem Tod meines Kindes waren meine Eltern gemeinsam für mich da und gaben mir einen Tag heile Familienwelt zurück. Durch diesen Familientag verlor ich meine in der Kindheit entstandene Verlustangst und konnte meinen Sohn ziehen lassen.
Daher bin ich nicht selbst etwas Besonderes, sondern habe etwas Besonderes erlebt. Um die Zusammenhänge nachvollziehbar zu machen, zeichne ich sie hier chronologisch nach, in der Hoffnung, dass Sie meine Erfahrung für sich nutzen können.
Mein Selbststudium basiert auf fünf Säulen:
3.1 Bert Hellingers Familienkonstellationstheorie
Bert Hellinger (* 16.12.1925, † 19.09.2019) war ein Psychoanalytiker und verbreitete die Therapieform des Familienstellens.1 Der oft sehr öffentlichkeitswirksam gestaltete Umgang mit seiner Klientel ist stark umstritten.2 Seine Ansichten bezüglich Familienkonstellation waren für mich dennoch eine gute Grundlage, um meinen Lebensweg besser zu verstehen.
Eine von Hellingers Annahmen ist, dass Eltern ihre Kinder prägen. Durch Nachahmung verhalten sich Kinder zunächst genauso wie die Eltern. Das ändert sich auch nicht automatisch im Erwachsenenalter.3 Von der Gesellschaft wird die Ansicht unterstützt, dass Menschen im Erwachsenenalter ihre Entscheidungen selbstständig treffen können. Trotzdem stoßen alle Erwachsene auf mentale Hindernisse, die sie nicht überwinden können, und treffen falsche Entscheidungen. Bert Hellinger sagt dazu einfach: „Leiden ist leichter als handeln.“ Oder anders gesagt, es ist immer einfacher, im Status quo zu verharren. Nur, wenn der Leidensdruck groß genug wird, suchen die meisten Menschen, ihr Leid zu überwinden.
Das Hinterfragen von Bert Hellingers Annahmen brachte mir neue und wichtige Erkenntnisse.
3.2 Epigenetik
Es ist bekannt, dass der Mensch seine Gene von den Eltern erbt. Das Erbgut der leiblichen Eltern wirkt sich beispielsweise oft anschaulich auf den Körperbau, Augen- und Hautfarbe, Gesichtsmerkmale und Ähnliches aus.
Neben den körperlichen Merkmalen ist nun auch bekannt, dass traumatische Erfahrungen die Gene prägen.4 Diese Gene produzieren in wiederkehrenden Situationen Stresshormone. Über meine hier geschilderten Erfahrungen versuche ich darzustellen, wie stark das Erbgut in bestimmten Situationen Einfluss nimmt, und dass Kinder aus diesem Grund und ohne eigenes bewusstes Erleben einer traumatischen Situation die vererbteStressreaktion der Eltern ausleben.
3.3 Verantwortung und Verantwortungsgefühl
Für das Selbststudium meiner sofortigen Verarbeitung war es wichtig, zwischen Verantwortung und Verantwortungsgefühl zu unterscheiden.
Die Verantwortung steht für den äußeren Sachverhalt, etwa die elterliche Sorgepflicht oder bestimmte Aufgaben, die im Arbeitsvertrag festgehalten sind. Das Verantwortungsgefühlist die innere Haltung, die man zu diesem Sachverhalt einnimmt, und ist maßgeblich für die eigene Reaktion, wenn in diesem Verantwortungsbereich ein Fehler passiert.
Fühlt man sich nur verantwortlich, ohne vom Sachverhalt her Verantwortung zu tragen – beispielsweise, wenn man schon geahnt hat, dass ein Kollege, zu wenig Zeit für eine Aufgabe eingeplant hat, aber nichts gesagt hat – so ist man vielleicht emotional mit einer Situation verbunden, trägt aber keine Konsequenzen, wenn ein Fehler passiert.
Das Verständnis dieses Unterschieds kann für die Selbstheilung ein wichtiger Schritt sein.
3.4 Fremde Schicksale
Für mein Selbststudium habe ich meine eigenen Erfahrungen und Erkenntnisse mit persönlichen Lebenswegen von Bekannten verglichen. Diese Beispiele sind zur Kenntlichmachung vom restlichen Text abgesetzt:
Die Beispiele meiner Bekannten verdeutlichen, wie Kinder wieder Respekt für ihre Eltern aufbauen konnten, was gleichzeitig ihr eigenes Selbstwertgefühl stärkte; wie die Bekannten selbst eigene traumatische Erlebnisse wie sexuellen Missbrauch verarbeiteten und noch mehr. Diese Beispiele nutze ich, um bestimmte Zusammenhänge zu veranschaulichen. Bei Bedarf können sie eine Vorbildfunktion für ihr eigenes Leben erfüllen.
Neben diesen Bekanntschaften sind auch meine Lebenspartnerinnen und eine Freundschaft wichtig. Für einen einfachen Überblick stelle ich sie vorab kurz vor:5
Erika, meine „Er“ste Liebe
Greta, meine „Gr“oße Liebe
Wally, meine „Wa“hre Liebe
Birgit, meine geschiedene Ehefrau und Mutter unseres Kindes Max-Leonard
Julia, eine wichtige Freundin
3.5 Maslowsche Bedürfnispyramide
Die fünfte und letzte Säule ist die ‚Maslowsche Bedürfnispyramide‘. Der US-amerikanische Psychologe Abraham Maslow entwickelte die Bedürfnispyramide, um vereinfacht darzustellen, welche Bedürfnisse menschliches Handeln motivieren und welche Ebenen der Bedürfnisbefriedigung ein Mensch im Laufe seines Lebens durchläuft.6
Maslowsche Bedürfnispyramide
In seiner Pyramide fängt er mit den physiologischen Bedürfnissen an, solchen also, die körperlich für das Leben notwendig sind. Deren Befriedigung schafft die Voraussetzungen für alles Weitere, weswegen ich im späteren Verlauf von Grundvoraussetzungen sprechen werde – das ist einfach kürzer als ‚befriedigte Grundbedürfnisse‘. Direkt darüber stehen die Sicherheitsbedürfnisse, also solche nach Stabilität, Ordnung und Schutz. Hierbei handelt es sich demnach um eine von der Umgebung des Individuums geschaffene, äußere Sicherheit, insbesondere ein stabiles familiäres Umfeld.
Sind diese Bedürfnisse erst einmal befriedigt, so entwickeln sich aus dem umgebenden sozialen Gefüge soziale Bedürfnisse, wie das nach Gemeinschaft, Austausch und einem Platz in der Gesellschaft bzw. Gruppe.
Sind diese Bedürfnisse alle erfüllt, treten individuelle Bedürfnisse in den Vordergrund, wie der Wunsch nach Wertschätzung und Weiterentwicklung.
An der Spitze der Pyramide nach Maslow steht das Bedürfnis nach Selbstverwirklichung, also der Wunsch, dem eigenen Leben durch die Entwicklung der eigenen Persönlichkeit und Fähigkeiten Sinn zu geben, oder auch der Wunsch, die eigene Kreativität auszuleben.
Die Maslowsche Bedürfnispyramide ist ein wunderbares Mittel, um Ihnen meine Entwicklung als Mensch näherzubringen.
Wichtig für den Bau einer Pyramide ist, dass sie Ebene für Ebene von unten nach oben errichtet wird. Erst nach der ordentlichen Fertigstellung einer Ebene kann die nächste darauf aufbauen. Besteht Chaos in der untersten Ebene, so wirkt sich dies meist negativ auf alle folgenden Ebenen aus. Die Ebenen sehe ich als Ordnung eines Menschenlebens an. Deswegen kann ich anhand der Pyramide die einzelnen Phasen meines Lebens durch meine Selbstanalyse wunderbar strukturiert darstellen und mit meinen Bedürfnissen und meinem Verantwortungsgefühl in Zusammenhang bringen. So kann jeder seine eigene Selbstanalyse vornehmen.
Durch mein Selbststudium habe ich allerdings erkannt, dass die Maslowsche Bedürfnispyramide für meine Zwecke um eine Ebene erweitert werden muss.
Um sich zu verwirklichen, müssen zuvor meist Ängste überwunden werden. Diese führen nämlich dazu, dass bestimmte Situationen stressauslösend sind, wodurch ein Druckgefühl entsteht, welches zu einer Handlungsohnmacht führt. Oft wird diese Ohnmacht durch eine Vermeidungsstrategie umgangen. Dies hat aber zufolge, dass bestimmte Situationen, Dinge oder Menschen eben gemieden werden – oft leider auch welche, die ein notwendiger Schritt zur Selbstverwirklichung wären. Wenn man etwa Vater oder Mutter eines Kindes werden will, aber Angst hat, kein guter Elternteil sein zu können, wird man vermeiden, ein Kind zu bekommen. Und wer etwas vermeidet, kann sich darin nicht selbst verwirklichen.
Deswegen muss man diese Ängste überwinden (oder zumindest mit ihnen arbeiten) und bestenfalls verlieren. Daher führe ich hier das Überwindungsbedürfnis ein – kurz für ‚Bedürfnis, Ängste und somit Stress und Gefühle von Handlungsohnmacht zu überwinden‘. Es ist auch ein Bedürfnis nach Selbstsicherheit – nach der eigenen inneren Sicherheit, der es bedarf, Ängste zu überwinden, die das Urvertrauen erschüttern.
Um sich dieses Bedürfnisses als Vorbedingung zur Selbstverwirklichung erst einmal gewahr zu werden, müssen einem jedoch auch die Ängste erst offenbar sein – auch solche, die das Erbgut geprägt haben und deren Entstehung nicht selbst bewusst durchlebt wurde. Deswegen muss für viele Menschen das Überwindungsbedürfnis erst aufgedeckt werden, um befriedigt werden zu können. In dem hier angegeben Beispiel müsste der Frage nachgegangen werden, warum jemand das Gefühl hat, kein guter Elternteil sein zu können.
Und so wird aus der Maslowschen Bedürfnispyramide die …
Max-Leonard-Pyramide
Weil ich ohne mein Kind und die Erfahrungen als dessen Elternteil nicht zu meinen heutigen Erkenntnissen gekommen wäre, nenne ich meine Fassung die Max-Leonard-Pyramide.
Das Schöne an einer Pyramide ist, dass sie im Alten Ägypten eine Grabstätte war. Ich erbaue nun für meinen Sohn eine sechsstöckige Max-Leonard-Pyramide und lade Sie ein, mich bei diesem Vorhaben zu begleiten. Auf dem Weg werde ich Ihnen meine Erkenntnisse vorstellen, meine eigene Gefühlswelt offenbaren und beleuchte unter Berücksichtigung, dass unsere Gene unsere Gefühlswelt und unser Handeln beeinflussen, die Frage, warum zeitgleich zur Trauer um meinen Sohn auch eine seelische Befreiung stattfand.
Meine Erfahrungen und Erkenntnis können Sie dann für sich selbst nutzen.
4. Die Rolle der Gene: Aus der Ohnmacht zurück ins Urvertrauen
Für diesen Weg sollen meine Erfahrungen und Erkenntnisse eine Hilfe bieten. Aber bevor ich die Sichtweise der Max-Leonard-Pyramide erkläre und meine Geschichte erzähle, müssen wir erst eine gemeinsame Basis schaffen. Dazu muss ich Ihnen für einige Begriffe meine Definitionen mit auf den Weg geben. Sonst wird das Geschriebene durch den individuellen Erfahrungsschatz nicht nur unterschiedlich interpretiert, sondern hat womöglich sogar negative Auswirkungen auf einzelne Lesende.
4.1 Urvertrauen
Dieses Wort wird Sie auf der Reise mit mir nicht nur begleiten – Urvertrauen ist sowohl der Start als auch das Ziel. Urvertrauen ist das instinktive, vom Denken losgekoppelte Gefühl, das etwas gesichert und konstant ist: dass Schutz, wie die Liebe der Eltern, immerda ist; dass Körperfunktionen, wie die eigene Atmung, immererhalten bleiben; dass Fähigkeiten, wie Schmecken, wodurch sich die Genussfähigkeit entwickelt, immerabrufbar sind. In Gegebenheiten und angeborene Funktionen und Fähigkeiten, über die wir nicht nachdenken, haben wir Urvertrauen.
Wenn ich statt von Urvertrauen von Vertrauen in Fähigkeiten spreche, beziehe ich mich auf erlernte Fähigkeiten. Fußballspielen ist zum Beispiel keine angeborene Fähigkeit. Sie baut zwar auf angeborenen Fähigkeiten auf, ist aber selbst trainiert oder erlernt.
Leider liegen aber auch angeborene Fähigkeiten und Gegebenheiten nicht immer im Urvertrauen. Urvertrauen kann aus unterschiedlichen Gründen bei einigen Fähigkeiten fehlen. Ein Grund dafür kann sein, dass ein bestimmtes Erlebnis dieses Vertrauen zerstört hat: beispielsweise das Verlassenwerden durch einen Elternteil; eine Lungenentzündung mit Luftnot; sexueller Missbrauch.
Urvertrauen kann auch bei angeborenen Fähigkeiten und Gegebenheiten fehlen, wenn eine über die Gene vererbte negative Erfahrung, bestimmte Situation mit Stress behaftet, ohne, dass die Person selbst eine eigens durchlebte negative Erfahrung bewusst mit dieser Situation verbinden kann. Das bedeutet, dass bei der Geburt schon für eine angeborene Fähigkeit oder Gegebenheit das Urvertrauen fehlt.
Unabhängig davon, wie das Urvertrauen in eine Gegebenheit, eine Funktion oder eine Fähigkeit erschüttert wurde, führt diese Erschütterung zu Stress in Situationen, in denen die entsprechende Gegebenheit vermisst, Funktion gebraucht oder Fähigkeit abgerufen wird. Dieser Stress führt zu einer Handlungsblockade oder …
4.2 Handlungsohnmacht
Statt in einer Situation Urvertrauen zu haben, dass ‚alles klappt‘, geraten wir in negativ behaftete Denkprozesse und der Stress blockiert unsere Handlungsfähigkeit, was zu einer Handlungsohnmacht führt. Die Handlungsohnmacht kann aus einer unbewussten oder einer bekannten Erfahrung herrühren. Bei einer unbewussten Erfahrung besteht zudem eine Klärungsunfähigkeit, da der Grund für die Ohnmacht nicht direkt greifbar ist.
Infolgedessen versuchen wir diesen stressbehafteten Situationen aus dem Weg zu gehen, was unser Leben noch weiter einschränkt. Wir entwickeln also eine Vermeidungsstrategie.
Ich möchte Ihnen gerne drei Situationen aus meinem Leben vorstellen, um das Konzept kurz zu erläutern.
A. Ich habe Angst, von einem Hochhaus herunterzufallen!
Obwohl ich bereits von einem Zehnmeterturm ins Wasser gesprungen bin, werde ich diese Angst nicht los. Vielleicht ist es auch sinnvoll, die Höhenangst auf einem Hochhaus nicht zu verlieren.
B. Mir wird Rhabarberkuchen angeboten!
Als Kind musste ich einmal ein Rhabarberkompott aufessen und danach feststellen, dass der Mageneingang auch als Ausgang dienen kann. Heute überlege ich manchmal, ob ich einen Rhabarberkuchen esse, da er nicht giftig ist. Ich weigere mich trotzdem, weil es für mich unbedeutend ist, und esse dann lieber Kekse.
C. Ich konnte in einer Partnerschaft nicht als Erster meine Liebesgefühle gestehen, da ich nicht wusste, wie meine Lebenspartnerin reagiert!
Es war ein Gefühl, als wäre ich damals emotional in dem Folterinstrument ‚Eiserne Jungfrau‘ gefangen gewesen – ich konnte mich nicht auf andere zubewegen, aber gleichzeitig konnte ich auch nicht fliehen. Ich blieb beharrlich stehen und wartete ab. Meine Gefühle, ohne die Sicherheit einer Erwiderung, äußern zu müssen, löste in mir nahezu eine Panikattacke aus.
Es gibt also Vermeidungsstrategien, die sinnvoll sind (nicht zu nah an den Dachrand einer Hochhausterrasse gehen), solche, die unbedeutend sind (wie Verzicht auf Rhabarber) und welche, die hinderlich sind.
4.3 Vermeidungsstrategie
Vermeidungsstrategien benutzt man, um unangenehme Situationen auszuschließen. Je höher der ausgelöste Stresspegel, desto ausgeprägter die Vermeidungsstrategie. Dadurch geht man Umwege, statt direkt seine Ziele im Leben anzugehen. Genauso können Ziele auch gänzlich ignoriert werden, um gewisse Situationen zu vermeiden. Diese Situationen können etwa aufgrund sozialer Ängste als unangenehm oder gar unerträglich empfunden werden. Die Stärke der Vermeidungsstrategie kann zu einer Endlosschleife heranwachsen: Anstelle dass der Alltag wie ein Yin-Yang-Symbol rundläuft, dreht sich alles um diese Angst wie eine Schleife um ihren Knotenpunkt – gelöst wird der Knoten aber nie.
Knotenpunkt der unbewussten Angst
Umschifft man durch die Vermeidungsstrategie allerdings eine Situation, die man gerne erreichen möchte, schließt man diesen Wunsch auf immer neue Arten aus – solange, bis man eine langfristig effektive Lösung findet, ohne die angestrebte Situation bzw. die Erfüllung des Wunsches zu leben. Das Unterbewusstsein, oder vielmehr die unbewusste Angst, bestimmt das Handeln und so verbaut man sich durch die Vermeidungsstrategie Ziele im Leben.
Die Vermeidungsstrategie ist also eine Schutzfunktion, die nicht einfach mal eben ausgeschaltet werden kann und einem selbst oft kaum bewusst ist. Begutachtet eine außenstehende Person diese Vermeidungsstrategie und erklärt sie als unsinnig, wehrt sich die sich schützende Person zumeist mit Forderungen, Vorwürfen und sogar Schuldzuweisungen.
Forderungen und Vorwürfe sind also oft ein Symptom einer auf Ängsten beruhenden Vermeidungsstrategie. Diese Symptome können hilfreich sein, die Vermeidungsstrategie aufzudecken. Das ist mindestens auf längere Sicht wichtig für die Gesundheit und Beziehungsfähigkeit, denn eine Vermeidungsstrategie kann Bedürfnisse verbergen und hält das eigene soziale Umfeld in dem Glauben, dass bei einem ‚schon alles in Ordnung sei‘. Was es aber nicht ist. Dadurch staut sich Stress an, der implodieren kann (was zu Krankheit führt), oder als Konsequenz auf den eigenen Drang, die unbewusste Vermeidungsstrategie zu überwinden, explodieren kann, in Form von Kurzschlussreaktionen (was beispielsweise zu Gewalt führt).
Um die Handlungsohnmacht und die Vermeidungsstrategie effektiv zu überwinden, müssen wir uns jedoch den auslösenden Situationen stellen und uns die negativ aufgenommene Erfahrung bewusst machen. Bezugnehmend auf mein Beispiel oben habe ich allerdings weder das Bedürfnis, Rhabarberkuchen zu essen, noch endlich am Rand von Hochhäusern zu stehen. Das Bedürfnis, keine Panik zu bekommen, wenn ich einem Menschen meine Gefühle ihm gegenüber ausspreche, hingegen schon. Ich habe also das Bedürfnis, diese soziale Angst zu überwinden, um mich von diesem Stress zu befreien.
4.4 Überwindungsbedürfnis
Oft sieht ein sich durch eine Vermeidungsstrategie schützender Mensch sein Verhalten als richtig an und versteht nicht, dass seine Vermeidungsstrategie, ihn davon abhält, sich auszuleben, oder sogar der eigenen Selbstverwirklichung im Wege steht.
Bevor man Forderungen an andere Menschen stellt oder ihnen Vorwürfe macht, sollte man sich selbst hinterfragen: Was steckt wirklich hinter diesen Forderungen und Vorwürfen? Ist es vielleicht sinnvoll, eine Angst oder ein anderes unangenehmes Empfinden zu überwinden, um an sich zu arbeiten und dann befreiter zu leben? Nur, wer sich die negativen Konsequenzen der eigenen Vermeidungsstrategie bewusst macht, kann ein Überwindungsbedürfnis entwickeln.
Oft wird dann ein Vorbild genutzt, um sich von einem anderen Menschen abzuschauen, wie mit stressbehafteten Situationen umzugehen ist. Allerdings hilft ein Vorbild nur sehr begrenzt. Effektiver ist die Verarbeitung des negativen Erlebnisses, die zur Vermeidungsstrategie geführt hat. So kommt man aus dem negativen Denkprozess heraus. Die Vermeidungsstrategie ist dann nicht mehr notwendig, Forderungen werden überflüssig und Vorwürfe werden nicht mehr empfunden.
Eine innere Voraussetzung ist unabdingbar, um eine Vermeidungsstrategie abzulegen:
4.5 Seelischer Halt
Der Ursprung dieses Halts sind die beiden Elternteile. Sie sind für das Neugeborene ein Rückzugsort. Hier können Trost, Rat, Mut usw. geschöpft werden, um Verluste kompensieren zu können. Aus der Grundsicherheit dieses ursprünglichen Halts entwickeln sich andere Möglichkeiten des seelischen Halts wie die eines Busenfreundes oder Lebenspartners und des Familienkreises. Kurz: Ist seelischer Halt durch die Eltern von Grund auf gegeben, ist es auch einfacher, weitere Bindungen einzugehen, die einem diesen Halt verstärken. Umgekehrt ist es schwieriger, Halt zu finden, wenn die beiden Elternteile keinen Ursprung seelischen Halts darstellen. Sind die Bindungen zum Ursprung schwach, so können Sport, Musik, die Arbeit, Wissen bzw. Informationen und weitere Hilfsmittel genutzt werden, um die Zeit zu überbrücken. Sie bieten einen ‚einfacheren‘ Halt. Sie sind allerdings kein Ersatz für einen adäquaten Rückzugsort wie liebende Eltern, da diese Hilfsmittel sie nicht wortwörtlich in den Arm nehmen können.
Besonders der seelische Halt als auch in geringerem Maß der einfache Halt geben einem die Kraft, sich zu erholen, falls man scheitert, und befriedigen somit einen Aspekt des Sicherheitsbedürfnisses bei dem Versuch, eine Angst zu überwinden. In Anbetracht der wichtigen Rolle der Eltern für den Halt ist eine Gesundung der Beziehung zu den Eltern ein wesentlicher Bestandteil des Buches.
Was an der Verarbeitung negativer Erlebnisse besonders schön ist: Erschütterte oder zerstörte Fähigkeiten, die das Urvertrauen verlassen haben, können so auch wiederhergestellt werden.
Zusätzlich haben die bis dahin verwendeten Vermeidungsstrategien nicht nur negative Auswirkungen, sondern stellen auch Chancen dar: innovative Lösungen, die sich auf diesem Umweg entwickelt haben. Diese Lösungen stehen einem auch nach dem Überwinden einer Angst weiterhin für andere Probleme zur Verfügung – sowohl für eigene als auch für die anderer Menschen. Sie sind eine Ressource.
Abgesehen von diesen fünf wichtigen Definitionen zu Urvertrauen, Handlungsohnmacht, Vermeidungsstrategie, Überwindungsbedürfnis und seelischem Halt ergibt es Sinn für unsere gemeinsame Basis, zu schauen, was Sie und ich gemeinsam haben. So können wir den gleichen Blickwinkel für die Interpretation der hier geschilderten Erfahrungen einnehmen, denn je besser Sie meine Lebensgeschichte nachvollziehen können, desto besser können Sie das Wissen für sich nutzen.
Eine Gemeinsamkeit besteht darin, dass die Körperfunktionen eines Menschen, solange keine Behinderung vorliegt, immer gleich aufgebaut sind. Jeder Mensch hat ein Herz, das Blut fließen lässt, eine Lunge, damit das Blut Sauerstoff bekommt und ein Gehirn zum Ärgern, damit das Blut kochen kann – und wir alle besitzen Gene. Hier kommen wir zu dem Aspekt, den ich bei der Definition von Urvertrauen nur kurz angerissen habe, den Aspekt nicht eigens durchlebter negativer Ereignisse.
Dazu schrieb Dr. Reinhard Door:
„So können etwa traumatische Erlebnisse die Aktivität der Erbgutregionen verändern. Forscher untersuchten dazu Gewebeproben aus dem Gehirn von zwölf Toten, die als Kinder missbraucht worden waren. Sie entdeckten eine veränderte Genaktivität für einen Mechanismus, mit dem der Körper auf derartigen Stress reagiert. Das erklärt, wieso Missbrauchsopfer ihr Leid verarbeiten konnten und noch als Erwachsene mit Depressionen kämpften. Ausgelöst werden solche langanhaltenden Folgen von bestimmten Markierungen und der Verpackung der verantwortlichen DNA-Regionen.“7
Die Gene werden hier als Erfahrungsspeicher beschrieben, die den Hormonhaushalt anregen, und diese Erfahrungsspeicher beeinflussen dann das Empfinden und somit die Handlung des Menschen – beispielsweise, indem sie bestimmte Situationen oder Reize mit Angst behaften. Kann eine betroffene Person sich nicht von dieser Angst befreien, so bildet sie Stresshormone oder baut eine Vermeidungsstrategie auf, um den Stresshormonen auszuweichen.
Eine Geschichte meiner Bekannten Julia wird sie durch dieses Buch als anschauliches Beispiel begleiten. Sie beginnt mit einer Vermeidungsstrategie:
Julia hatte Angst, ins Wasser zu gehen. Also mied sie das Wasser und Verabredungen, die mit Schwimmen zu tun hatten. Sie verblieb demnach in einer Endlosschleife: Wasser vermeiden war eine Option, die zwar manchmal die Lebensqualität einschränkte, aber solange sich Julia nicht bewusst machte, welchen Spaß sie bei Verabredungen am Sommersee verpasste, hatte sie ja kein Problem. ‚Kein Problem haben‘ bekräftigte die Vermeidungsstrategie: Ihr Handeln bewegte sich zwar um ihre Angst – gleichzeitig musste sie sich ihr aber nicht stellen. Diese Vermeidungsstrategie brachte erst einmal keinen nennenswerten Verzicht in Julias Leben und war deswegen neutral betrachtet unerheblich. Sie ist allerdings beispielhaft dafür, wie eine Vermeidungsstrategie das gestörte Urvertrauen in eine angeborene Fähigkeit verschleiern und somit der Traumabewältigung im Weg stehen kann.
Wie ist es zu Julias Angst vor Wasser gekommen? Und wie haben sich ihre Angst und die entwickelte Vermeidungsstrategie auf das Verhältnis ihrer Kinder zu Wasser ausgewirkt?
Bert Hellinger ist wie beschrieben der Auffassung, dass Leiden leichter ist als Handeln. Hierzu wird erklärt: „In der Seele des Kindes existiert nämlich ein magisches Denken, das eine bestimmte Vorstellung von Liebe hat – Liebe heißt, ich werde wie – oder – ich mache es wie meine Eltern. Ihrem Schicksal folgen, das ist meine Liebe als Kind.“
Für Julias Kinder bedeutet das, das Verhalten „nicht schwimmen gehen“ zu übernehmen, denn so machen sie es wie der Elternteil und zeigen laut Hellinger Liebe.
Hellingers ist ein reiner Prägungsansatz. Ich hingegen betrachte auch, dass das Kind die Stresssituation erbt und die Vermeidungsstrategie eines Elternteils übernimmt. An dieser Stelle ist das Resultat – wenn auch nicht der Lösungsansatz – allerdings das gleiche: Es will selbst nicht schwimmen gehen.
Gehe ich nun aber von der Forschung Dr. Reinhard Doors aus, liegt es nahe, dass eine Angst durch die zuständige DNA-Region vererbt wird und es die Vermeidungsstrategie ist, die vom Kind akzeptiert, genauer gesagt automatisch übernommen wird. Das Resultat – nicht schwimmen gehen wollen – mag das gleiche sein, aber der Ursprung der Handlung macht einen wichtigen Unterschied: Dem Kind werden unbekannte Ängste in die Wiege gelegt. Das Kind kann sich ohne weitere Informationen dann nicht von diesen Ängsten emanzipieren oder anders handeln als die Eltern.
Auch mein Selbststudium hat bestätigt, dass eine Handlungsohnmacht immer durch ein bekanntes oder unbewusstes Vorerlebnis aktiviert wird. So auch bei meiner Bekannten:
Julia wurde im Alter von zwei Jahren von ihrer Mutter in der Badewanne unter Wasser gedrückt. Sie sollte ertränkt werden. Durch einen Zufall kam ein Angehöriger ins Bad und die Mutter beendete den Mordversuch. Die angeborene Fähigkeit des Atmens wurde meiner Bekannten durch die Atemnot im Wasser aus dem Urvertrauen gerissen. Um nicht in stressauslösende Situationen zu geraten, mied sie Verabredungen am Wasser.
Nachdem wir den Zusammenhang erkannt haben, überwand sich Julia und stieg mit sechzig Jahren das erste Mal in einen See und badete. Ihr wurde der Zusammenhang zwischen ihrem unbewussten Erlebnis und ihrer Vermeidungsstrategie aufgezeigt, und das half ihr, ein Überwindungsbedürfnis zu entwickeln. Sie brach aus ihrer Endlosschleife aus.
4.6 Urvertrauen zurückgewinnen
Julias Beispiel verdeutlicht ein Muster, das sich in vielen der Lebensgeschichten, an denen ich teilhaben durfte, herauskristallisiert hat. Es scheint, dass drei Schritte zur effektiveren Bewältigung eines Traumas von entscheidender Bedeutung sind:
Schritt 1: Die Klärungsunfähigkeit muss beseitigt werden, indem einem das Trauma bewusst (gemacht) wird.
Schritt 2: Die Handlungsfähigkeit muss beseitigt werden, indem man sich fragt und dadurch bewusst macht, ob das Trauma auf andere Situationen übertragen wird oder einen daran hindert, andere Bedürfnisse auszuleben. Oft passiert so eine Übertragung nämlich unterbewusst, um den erlebten Mangel – etwa an Elternliebe, Sicherheit oder auch Geld – oder die erlittene Machlosigkeit – beispielsweise, als Kind Misshandlungen ausgeliefert zu sein – auszugleichen und somit den traumabedingten Schmerz zu verdrängen.
Schritt 3: Bisher stressauslösende Situationen müssen bewusst wahrgenommenen und mit positiven Erfahrungen neu aufgeladen werden, um das Trauma zum isolierten Schicksalsschlag werden zu lassen. Dies kann in manchen Fällen sogar so erfolgreich geschehen, dass sich das traumatische Erlebnis nur noch wie eine emotionslose Tatsache anfühlt.
Zur einfachen Veranschaulichung der drei Schritte: Ein Mensch ist in Armut aufgewachsen. Er hat die ständigen Geldsorgen der Eltern mitbekommen und Mangel erlebt. Heute hat dieser Mensch ausreichend Geld, ist jedoch geizig, weil das Trauma ungeklärt ist und sich der Mensch unterbewusst immer noch arm fühlt. Es muss (an)erkannt werden, dass die erlebte Armut ein Trauma ist (Schritt 1), es muss bewusst werden, dass Mangelerfahrung auf die heutige wirtschaftlich sichere Lebenssituation übertragen und übermäßig Geld ge„hortet“ wird, um das Gefühl des Mangels auszugleichen (Schritt 2). Ein Restaurantbesuch mit der Frage nach Trinkgeld muss als stressauslösende Situation bewusst wahrgenommen und positiv erlebt werden – beispielsweise durch die Freude des Kellners und die eigene Erkenntnis und das „gute Gefühl“, Leistung gerecht entlohnt zu haben (Schritt 3).
Zurück zu Julia:
Da beide Töchter geboren wurden, lange bevor Julia von dem Mordversuch Kenntnis erhielt, war das Erlebnis deren gesamte Kindheit und Jugend über unbewusst. Also fragte ich nach, um an diesem Beispiel mehr über die Auswirkungen von Prägung und Erbgut zu lernen:
Die ältere Tochter erklärte mir, dass sie im Urlaub als Kleinkind nicht durch die Eltern das Schwimmen lernte, sondern weil eine angefreundete Familie sich ihr annahm. So konnte sie das Problem unbekannterweise überwinden. Bei diesem Beispiel kann man nicht erkennen, ob die Überwindung zum Schwimmen durch die Prägung der Mutter (Vermeidungsstrategie) oder die Vererbung (weitergereichte Nahtoderfahrung) erschwert wurde. Das wird allerdings bei der jüngeren Tochter klarer ersichtlich.
Die jüngere Schwester konnte bis zum 30. Lebensjahr nur im Wasser planschen. Es bereitete ihr offenbar immer noch Schwierigkeiten, zu schwimmen. Mit einem Lebenspartner, der von Beruf Bademeister war, trainierte sie dann das Schwimmen in Gewässern und überwand so das Gefühl des Ertrinkens. Sie konnte sich nicht von der Vermeidungsstrategie der Mutter emanzipieren, sondern benötigte Hilfe von außen in Form einer Fachperson, um aus der Stresssituation zu kommen.
Das legt den Schluss nahe, dass durch die Atemnot im Wasser, die von der Mutter erlebt wurde, die Fähigkeit Atmen in Zusammenhang mit Wasser auch bei der Tochter nicht im Urvertrauen lag. Dieses zerstörte Urvertrauen wurde also vererbt.
Viele traumatische Erlebnisse bzw. Traumata können solche Ängste im Erbgut speichern und auf diese Weise vererbt werden: Umweltkatastrophen, Hungersnöte, Krieg, Folter, Seuchen, Trennung der Eltern, Missbräuche, Krankheiten, vieles mehr – und der Verlust eines geliebten Menschen.
Mit diesen unbewussten, auf den Genen gespeicherten Vorerlebnissen beschäftigt sich die Epigenetik.
4.7 Epigenetik
Als eigener Wissenschaftszweig befasst sich die Epigenetik mit dem Rätsel, ob wir stärker von unserem Erbgut oder von der Familie beziehungsweise der Umwelt geprägt werden.8 Dabei ist ein Interessengebiet der Epigenetik, wie die Selbstheilungsfähigkeiten des Körpers aktiviert werden können. Ich hingegen versuche, die Rolle der Sinne in Bezug auf die Überwindung von traumatischen Erlebnissen zu verstehen.
Über die fünf klassischen Sinnesorgane Mund, Nase, Ohren, Haut und Augen nimmt der Mensch die Umwelt wahr. Diese Sinnesorgane sind mit den Genen indirekt verbunden. Beispielsweise kann der Geschmackssinn dadurch beim Essen von Zimt unterschiedliche Reaktionen hervorrufen: Für einen ist der Verzehr des Gewürzes unbedeutend; einem anderem ‚schmeckt es einfach nicht‘ und für einen Dritten ist der Geschmack von Zimt ein so starker Reiz, dass eine allergische Reaktion ausgelöst wird.9 Während wieder anderen das Gewürz schmeckt, sie ein Glücksgefühl davon bekommen oder es sogar als aphrodisierend empfinden.
Wie nachgewiesen wurde, liegt das daran, dass die Sinne sogenannte DNA-Schalter bewegen können.10 Dieser „Schalter“ wechselt nicht nur zwischen AN und AUS, sondern kann sogar auf verschiedene Stufen eingestellt werden. Ein Erlebnis ist gespeichert und der Schalter ist dafür verantwortlich, welche Hormone in welcher Dosierung bei der Wiederholung des Ereignisses freigesetzt werden – beispielsweise Stress- oder Glückshormone.
Die Hormone führen zu einer mehr oder weniger emotionalen Reaktion.
Jeder reagiert unterschiedlich betroffen. Ich beschränke mich hier auf fünf Stufen: Panik, Angst, Gelassenheit, Freude oder Euphorie.
Im Gegensatz zu den Sinnen kann reines Denken den DNA-Schalter nicht beeinflussen. Zimt wird denjenigen, die eine negative Reaktion auf den Geschmack haben, nicht einfach nur dadurch gut schmecken, dass sie „denken“ er schmeckte gut.
Die Sinne als Genschalter
Wenn man also die Reaktion des Erfahrungsspeichers auf eine Sinneswahrnehmung bzw. Situation ändern möchte, dann muss man auch etwas anderes erleben. Nur durch die Überwindung kann man den Stress minimieren oder sogar verlieren, denn Denken verändert nicht den Hormonhaushalt.
Zu guter Letzt möchte ich zu einer weiteren Zutat für unsere gemeinsame Basis kommen, eine, die alle Menschen dafür benötigen:
4.8 Einfühlungsvermögen
Wie auch Ängste entwickelt sich Einfühlungsvermögen in erster Linie durch Erlebnisse und Erfahrungen. Diesen Erfahrungsschatz kann man dann nutzen, um sich in Gefühle und Situationen anderer Menschen hineinzuversetzen. Gleichzeitig ist das Einfühlungsvermögen eines Menschen damit auch eine Selbstkundgabe – sich in etwas hineinfühlen zu können, verrät, Ähnliches schon einmal erfahren zu haben. Liegt eine Person mit ihrem Einfühlungsvermögen falsch, bzw. mit der Interpretation der Gefühle und Bedürfnisse des Gegenübers, dann zeugt das davon, dass zwar eine ähnliche Situation durchlebt, aber anders erlebt wurde: Ein Konzert kann für den einen reiner Stress und für die andere eine euphorische Erfahrung sein. Wenn also ein Freund dem anderen erzählt, dass er auf ein Konzert geht, und daraufhin die Frage kommt, „Solch einen Stress nimmst du auf dich?“, dann steckt in der Frage eine klare Selbstkundgabe, nämlich: „Für mich sind Konzerte stressig.“
Der eigene Erfahrungsschatz kann durch selbst Durchlebtes, angeeignete Informationen oder die eigene Fantasie aufgebaut werden.
Maßgeblich verantwortlich für soziale Kompetenzen wie das Einfühlungsvermögen ist der Frontallappen im Gehirn.11
Menschen, die in bestimmten Situationen Einfühlungsvermögen vermissen lassen, werden im Volksmund manchmal als Psychopathen bezeichnet. Im Gegensatz zu diesen Menschen liegt bei echten Psychopathen eine „Volumenminderungen grauer Substanz“12 im Frontallappen vor und das sollte als körperliche Behinderung angesehen werden.
Warum also scheint manchen Menschen das Einfühlungsvermögen zu fehlen, obwohl keine strukturellen Hirnveränderungen vorliegen?
Zum einen können diese Menschen schlicht unerfahren oder ihrerseits getäuscht bzw. fehlinformiert worden sein und sich deswegen schlecht oder gar nicht in eine Situation einfühlen. Zum anderen kann Angst der Grund sein.13 Angst beeinflusst die Aktivität des Frontallappens und kann somit das Einfühlungsvermögen stark beeinträchtigen.
Kurz: Wer aus Panik die Hausspinne des Mitbewohners erschlägt, hat in diesem Moment weder Einfühlungsvermögen für den Mitbewohner, der sein Haustier verliert und vermissen wird – noch für die tote Spinne. Diese Panik führt zu einer Handlungsohnmacht, ansonsten könnte man das Tier ja auf die Hand nehmen und seinem Mitbewohner bringen.
Hier übernimmt das Unterbewusstsein das Handeln, was dann nicht als selbstständige Handlung definierbar wäre.
Das unterscheidet Handlungen für diesen Zweck in zwei Kategorien: solche, die bewusst steuerbar sind, und solche, die aufgrund von Vorerlebnissen Hormonausschüttungen bedingen, die in eine Handlungsohnmacht führen und auch das Einfühlungsvermögen zeitweise aussetzen können. Um aus der Ohnmacht zu kommen und schlichthandelnzu können, entsteht ein egozentrisches Verhalten, ein sogenanntes Schutzverhalten.
Kommt man zur Ruhe und die Stresshormone nehmen ab, kehrt das Einfühlungsvermögen zurück. Oft ist es einem dann unangenehm, wie man sich in der Zeit des erhöhten Stressempfindens verhalten hat: Man bekommt ein schlechtes Gewissen – arme Spinne.
Das Prinzip der Vermeidungsstrategie
Bevor wir nun nach dem Etablieren unserer gemeinsamen Basis zurückkehren zum Bau meiner Max-Leonard-Pyramide, möchte ich den Untergrund noch einmal festigen – anhand eines Beispiels einer Bekannten für die Vererbung von Vorerlebnissen:
Eine Bekannte von mir wurde seit dem fünften Lebensjahr von Albträumen geplagt, die sie erst mit 48 Jahren verlor. Sie träumte von einer unendlichen Schwärze, die sie mit dem Tod und mit der Unsichtbarkeit verband. Mit der Hilfe von Psychologen konnte meine Bekannte das auslösende Ereignis dieser Albträume identifizieren: den Tod des Urgroßvaters.
Mit 48 Jahren bekam sie ein Buch in die Hand, das sich mit dem Leben nach dem Tod beschäftigte. Es half ihr, ihre Ängste und daher diese Albträume hinter sich zu lassen.
Der Auslöser (Tod des Uropas) erklärte allerdings nur die Albträume – nicht aber die Handlungsohnmacht, also den Fakt, dass sie jahrelang nicht in der Lage gewesen war, über die Albträume zu sprechen. Ich fragte mich hier, welche Vorerfahrung die Schwärze aus den Albträumen mit dem Tod des Uropas verband. Er war doch bekannt und nicht unsichtbar. Woher kam das Bild?
Der Tod des Urgroßvaters war zwar Auslöser des Albtraumes, sprich das wiederkehrende Erlebnis, aber nicht der Grund für die darunterliegende Angst. Also wollte ich mehr über potenziell vererbte Ängste erfahren, indem ich nach Erlebnissen der Eltern fragte. Hier musste ein Vergleich existieren, der die Symbolik im Albtraum erklärte und für die Ohnmacht verantwortlich war.
In dem Gespräch berichtete mir meine Bekannte, dass beide Elternteile enge Verwandtschaft (Eltern oder Geschwister) hatten, die sie nie hatten kennenlernen dürfen. Der Vater meiner Bekannten hatte seinen Vater nicht kennenlernen dürfen, weil dieser zeitgleich zur Geburt seines Sohnes im Krieg fiel. Die Mutter meiner Bekannten lernte ihre älteste Schwester nicht kennen, da diese vor ihrer Geburt verstarb. Beide Elternteile hatten also nahe Familienmitglieder, die ihnen unbekannt geblieben waren. Beide Erlebnisse sind traumatisch. Dieses Erbmaterial erhielt die Tochter. Damit liegt die Deutung nahe, dass der Grund für den Albtraum bzw. die Ohnmacht, die er ausgelöst hatte, die vererbten Informationen waren – Tod der unbekannten Familienmitglieder –, und der Auslöser der Tod des Urgroßvaters war. Mit ihrem Buch über das Leben nach dem Tod verarbeitete sie das traumatische Erlebnis, das ihre Eltern ihr vererbt hatten.
An diesem Beispiel erkennt man bereits, welch starkes Zusammenspiel zwischen Vererbung, Ohnmacht und Angstüberwindung besteht.
Durch die Vererbung der Gene wird ein Kind bereits vorprogrammiert, in bestimmten Situationen entsprechend zu reagieren. In diesem Beispiel hat die Tochter den ‚Tod unbekannter enger Familienmitglieder‘ mit der Erbmasse erhalten und auf die selbst erlebte Situation – Tod des Urgroßvaters – mit dieser Erblast reagiert. Es kommt zu einer Vermischung zwischen vererbtem Erlebnis und eigenem, aktuellem Erleben, woraufhin dauerhaft Stresshormone ausgeschüttet werden. So konnte sie sich den Albträumen aus eigenem Antrieb nicht widersetzen.
Es gibt einen Spruch über die Liebe, der das Prinzip gut verdeutlicht: „Liebe ist nur ein Wort, bis jemand kommt, der ihm Bedeutung gibt“. Erst der Tod des Urgroßvaters hat der vererbten Angst Bedeutung gegeben und sie für meine Bekannte so real gemacht, dass sie in Albträumen resultierte.
5. Grundvoraussetzungen
Max-Leonard-Pyramide „Grundvoraussetzungen“ allgemein
Kommen wir zum Anfang meiner Lebensgeschichte und zur untersten Ebene der Max-Leonard-Pyramide. Für einen stabilen Bau müssen die Grundvoraussetzungen gegeben sein. Vergleicht man das mit dem Backen, besorgt man sich zunächst die Backzutaten. So nutzt man für einen klassischen Eierkuchen Milch, Eier und Mehl, um diesen zuzubereiten. Hat man diese Zutaten nicht, dann gibt es Ersatzprodukte, die ähnlich sind. Bei der Milch kann man Hafermilch, für Eier kann man Bananen und für Mehl Proteinpulver nutzen. Das hat dann nicht mehr viel mit einem klassischen Eierkuchen zu tun, schmeckt allerdings auch gut.
Genauso verhält es sich mit den Grundvoraussetzungen der Max-Leonard-Pyramide: Natürlich gibt es auch hier Ersatz für viele Aspekte, allerdings kann es dann eher passieren, dass angeborene Fähigkeiten und Gegebenheiten nicht im Urvertrauen liegen. Daher ist das Original besser und gesünder.
Damit ein Embryo auf eine natürliche Art und Weise entsteht, braucht es eine leibliche Mutter und einen leiblichen Vater.
Der Embryo wächst im Schutz des Bauches seiner Mutter zum Fötus heran. Mit dem Verlassen seines Schutzbereiches benötigt der neue Mensch optimalerweise eine gut funktionierende Lunge, eigene Körpertemperaturregulierung, gesunden Schlaf und den Saugreflex – das entspricht den physiologischen Bedürfnissen alias Grundbedürfnissen nach Maslow, also Essen, Trinken, Sauerstoff und Schutz vor Witterung.14 Um seine Gesundheit zu halten, benötigt ein Säugling außerdem ein funktionierendes Immunsystem. Fehlt eine dieser Voraussetzungen, kann unterstützend geholfen werden. Eine Hilfe birgt allerdings größere Risiken als die natürlich erfüllten Grundvoraussetzungen.
5.1 Lunge (Atmen)
Der Fötus wird über die Plazenta mit Sauerstoff versorgt. Durch die Geburt und den Kontakt mit Luft nimmt das Kind zum ersten Mal den Sauerstoff über die Lunge auf und lernt das Atmen.
Es kommt vor, dass ein Baby als Frühchen zur Welt kommt. Die Schulmedizin ist auf dem Stand, dass bei einem Gewicht von über 1000 Gramm eine reelle Überlebenschance besteht.15 Mittlerweile sind auch bei leichteren Frühchen Erfolge beim Überleben zu verzeichnen. In diesem Stadium kann es noch nicht selbstständig atmen und wird daher künstlich beatmet.16 Es kommt oft vor, dass die Maßnahmen im Brutkasten zu gesundheitlichen Spätfolgen führen.17
Die Grundvoraussetzung einer funktionsfähigen Lunge steht hier stellvertretend für das Funktionieren aller Organe wie Herz, Leber, Milz, Haut, Gehirn und noch mehr.
5.2 Sinnesorgane (Körpertemperaturregulierung)
Die Körpertemperatur wird beim Fötus durch das Fruchtwasser gleichmäßig gehalten. Durch die Geburt erfährt der Säugling eine wechselnde Außentemperatur. Der Körper muss lernen, seine Körpertemperatur durch Training selbst zu regulieren, um der Witterung entgegenzusteuern. Laut des Stufenmodells nach Piaget zur kognitiven Entwicklung durchläuft jeder Mensch vier Phasen in seinem Leben, um sich zu entwickeln.18 In der ersten Stufe, die das Fundament der Pyramide legt, spricht er von der sensomotorischen Phase. Diese konzentriert sich auf die Sinneswahrnehmung und die eigenen Bewegungsmöglichkeiten.
Das Sinnesorgan Haut mit seinem überlebenswichtigen Beitrag zur Temperaturregulierung steht hier stellvertretend für alle Sinnesorgane.
5.3 Schlaf
Menschen haben das Bedürfnis, sich zu entwickeln, und benötigen dafür Phasen der Regeneration, die am besten im Schlaf erfolgen. Die durch die Nahrung aufgenommenen Nährstoffe unterstützen das Wachstum. Man kann nachlesen, dass einige Organe sich nach zwei Jahren und das Skelett nach zehn Jahren durch neue Zellstrukturen komplett erneuern können.19 Allerdings ist das Herz von der Erneuerung etwas ausgeschlossen. Das Schlafen erlernt der Mensch bereits als Fötus und wird mit dieser Grundvoraussetzung geboren.
5.4 Saugreflex (Nahrungsaufnahme)
Der Fötus ernährt sich über die Plazenta, sodass sein Bedürfnis nach Nahrungsaufnahme gedeckt wird. Um nach der Geburt selbstständig Nahrung und Flüssigkeit aufnehmen zu können, bedarf es des Saugreflexes. Hier holt sich das Baby über die Muttermilch alles Notwendige. Der Saugreflex ist bei Säugetieren im Normalfall eine angeborene Fähigkeit. Ist er nicht vorhanden, benötigt das Neugeborene eine Sonde oder muss verdursten.20
5.5 Immunsystem
Das Verbindungsorgan zwischen Mutter und Fötus ist die Plazenta. Sie ist die Schleuse, um das Kind mit allen wichtigen Nährstoffen, Sauerstoff, Antikörpern und so weiter zu versorgen.21 In der Regel löst sich die Plazenta nach dem Geburtsvorgang von der Gebärmutter ab. Mit dem Durchschneiden der Nabelschnur wird das Neugeborene von der Plazenta getrennt.
In Urzeiten fiel die Nabelschnur ohne Hilfsmittel nach einiger Zeit von allein ab. Dieses nennt man heutzutage Lotusgeburt, indem die Nabelschnur nicht abgetrennt und zwischen drei und zehn Tagen gewartet wird, bis sich Nabelschnur und Plazenta von allein vom Baby lösen.22