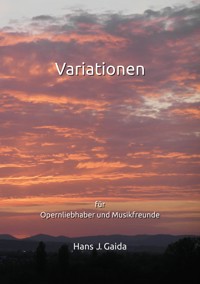
8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Vier Beschreibungen von selten gesehenen Opern: Der Rosenkavalier, La Fanciulla del West, Turandot, L‘Africaine und ein Versuch, die Meistersinger von Nürnberg zu verstehen: Wagners Sachs - ein Populist? Im Mittelpunkt stehen Richard Wagner („... und das liebe Geld“) und Giuseppe Verdi („...mein Leben war Musik“). Die Variationen des Themas zeigen viel mehr Gemeinsames in ihrem Denken als vermutet, und weniger Trennendes im Empfinden als unterstellt. Außerdem zwei Traktate „Warum Künstler reisen?“ und „Was ist das wirkliche Genie?“, sowie Impressionen von 25 Konzerten in Deutschlands größtem klassischen Konzertsaal.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Hans J. Gaida
Variationen
für Opernliebhaber und Musikfreunde
Variationenfür Opernliebhaber und MusikfreundeHans J. GaidaInhaltsverzeichnis
Präludium
1. Auftritt
2. Auftritt
3. Auftritt
4. Auftritt
5. Auftritt
6. Auftritt
Finale
1. Auftritt
Der Rosenkavalier
La fanciulla del West
TURANDOT
L’Africaine
2. Auftritt
Wagners Sachs – ein Populist?
3. Auftritt
Richard Wagner, die Musik und das liebe Geld
„Kennst du das Land? Wo die Zitronen blühn…?“ – Warum Künstler reisen?
4. Auftritt
Ich, Verdi – Mein Leben war Musik
5. Auftritt
Konzert-Impressionen
6. Auftritt
„Was haben die, was ich nicht habe?“ – Was ist das wirkliche Genie?
Finale
Wie ich zur Musik kam . . .– und dabeigeblieben bin
Impressum
Präludium
Wenn der Vorhang sich hebt, können Sie lesen, was hier als Einführung kurz beschrieben wird.
Musik hat mich mein ganzes Leben lang fasziniert, und ich hatte das Glück, so kann man es wirklich nennen, damit viel sowohl privat, wie auch beruflich zu tun zu haben, und zwar mit jeder Art von Musik.
Was ich im Laufe der Jahre und Musikerlebnisse aufgeschrieben habe, will ich hier zusammenstellen und Ihnen zum lesen anbieten, vielleicht als Bestätigung des selbst Erfahrenen oder als Anregung sich der Musik aus diesem Blickwinkel einmal näher zu widmen.
Es gibt weltweit ca. 125 Richard Wagner Verbände, davon 44 in Deutschland, die das Werk des großen Meisters pflegen und fördern. Aber nicht nur, denn sie bieten dazu noch ein breites Spektrum an Erkundungen der Musik anderer Komponisten. Das geschieht durch gemeinsame Besuche von Aufführungen im örtlichen Theater und durch Fahrten zu ausgesuchten Vorstellungen in anderen Häusern.
(https://www.richard-wagner.org/rwvi/de/)
Zwanzig Jahre lang waren meine Frau und ich Mitglied im Richard Wagner-Verband Münster und haben eine unglaubliche Vielzahl an musikalischen Erlebnissen gehabt. Besonders ereignisreich waren die Teilnahmen an den Internationalen Richard Wagner Kongressen unter dem damaligen Präsidenten Josef Lienhart, in Freiburg, Berlin, Bordeaux, Breslau, Budapest, Genf, Graz, Kopenhagen, Tallin, Trier.
Dazu gehörten auch Reisen nach Kiew, Lviv, Abu Dhabi, Delhi, St. Petersburg und Bangkok, diese mit Wolfgang Wagner und seiner Ehefrau Gudrun.
Die Reisen waren immer bestens organisiert von ars musica/Udo Bär, Köln,
1. Auftritt
Der Rosenkavalier (Richard Strauss)
La fanciulla del West / Das Mädchen aus dem Goldenen
Westen (Giacomo Puccini)
Turandot (Giacomo Puccini)
L’Africaine / Die Afrikanerin (Giacomo Meyerbeer)
Bei einigen der externen Opernbesuche des Verbandes zu Bühnen im Umkreis von Münster habe ich einen Einführungsvortrag während der Fahrt im Autobus gehalten. Vier sind hier wiedergegeben (die anderen sind mit einer defekten Festplatte meines PC untergegangen).
Es geht mir dabei vor allem um den kreativen Prozess der Entstehung des Werkes und die Umstände, unter denen der Komponist gearbeitet hat.
2. Auftritt
Wagners Sachs – ein Populist?
Ein Versuch, Richard Wagners Die Meistersinger von Nürnberg zu verstehen.
Auf Spurensuche im Operntext nach den Schlüsseln des modernen Regietheaters.
Beim Rosenkavalier habe ich geschrieben: „man muss ein Kunstwerk zunächst aus seiner Entstehungsgeschichte heraus zu verstehen suchen und es nicht mit pseudoaktuellen Zeitbezügen epigonaler Interpretationskonstrukte bis zur Unkenntlichkeit übergießen.“ Das wird besonders gern bei Richard Wagners Werken gemacht. Deshalb mein Versuch, Die Meistersinger von Nürnberg vom Text her zu verstehen.
3. Auftritt
Richard Wagner, die Musik und das liebe Geld
„Kennst du das Land? Wo die Zitronen blüh‘n…?“ –
Warum Künstler reisen
Zwei Festvorträge anlässlich der Jubiläen des Richard Wagner-Verbandes Münster, in denen es auch um Musik geht.
4. Auftritt
Ich Verdi – Mein Leben war Musik
Richard Wagner hat über sein Leben und Lieben ausführlich selbst geschrieben. Quasi als Gegenentwurf lasse ich Giuseppe Verdi anhand einer Auswahl seiner Briefe über seine Einstellung zu Musik, Oper, Zensur, Presse, Publikum und, daran führt kein Weg vorbei, über seinen Antipoden Wagner zu Wort kommen. Dabei weicht das Bild etwas von den üblichen Klischees und Mythen ab.
5. Auftritt
Konzert-Impressionen
Schon so oft gehört, und doch ist es jedes Mal das Abenteuer einer Neuentdeckung. Impressionen von Konzerten im Kuppelsaal des Hannover Congress Centrums (HCC), dem größten klassischen Konzertsaal in Deutschland.
6. Auftritt
Über das wirkliche Genie
"Was haben die, was ich nicht habe?“
Was ist das wirkliche Genie? Wird es so geboren oder erst gemacht? Am Beispiel einiger toter und noch lebender Künstler gehe ich der Frage nach.
Finale
Wie ich zur Musik kam . . . und dabeigeblieben bin
Der Versuch zu erklären, weshalb ich Opernliebhaber und Musikfreund bin.
(Werktitel, Rollennamen und Textzitate sind kursiv wiedergegeben, um Ihnen einige hundert „Gänsefüßchen“ bei der Lektüre zu ersparen. Die originale Schreibweise wurde beibehalten.)
1. Auftritt
Der Rosenkavalier
Eine Komödie für Musik
Richard Strauss
Köln, Oper, 5.1.2003
Mein erstes Erlebnis mit dieser Oper ist etwas zwiespältig und in gewisser Weise für einen Opernenthusiasten fast peinlich. Ich bin nämlich um den ganzen 1. Akt zu spät gekommen.
Es war vor gut 30 Jahren an der Bayerischen Staatsoper. Ich kannte bisher in Berlin Beginnzeiten – allerdings meist von Verdi-Opern – um 20, 19.30, ja, vielleicht auch schon 19 Uhr – Sie als gestandene Wagnerianer werden darüber lachen, da der Vorhang bei seinen ausufernden Werken sich meist schon um 17 Uhr hebt – in München aber beginnt der Rosenkavalier traditionsgemäß um 18 Uhr. Da war ich aber noch draußen auf dem Messegelände an der Theresienwiese beschäftigt. Ich hatte noch kein Billett, sondern wollte – im Glauben an Beginn um 19 Uhr mit fliegenden Rockschößen in die Stadt eilend – direkt eins an der Abendkasse erstehen. Ich bekam tatsächlich noch eins, es war inzwischen schon Viertel vor Sieben, aber – den Rest können Sie sich denken.
Tja, das war kein guter Einstand.
Kaum eine Oper ist so bekannt und gleichermaßen so verkannt wie Der Rosenkavalier. Man könnte fast Schillers Wallenstein zitieren: „Von der Parteien Gunst verzerrt, schwankt sein Charakterbild in der Geschichte“.
Dabei gibt es hier nicht die heftigen Weltanschauungskämpfe wie bei den Werken von Richard Wagner, es geht alles eine Spur moderater, betulicher zu: man mag den Rosenkavalier bis zur glühenden Leidenschaft, oder man mag ihn halt nicht, bah!
Die Vorbehalte ranken sich um folgende Abneigungen:
Diese Behäbigkeit in Handlung und Musik ist doch keine Komödie! Wo gibt’s denn da was zu lachen?
Diese Musik rinnt süßlich wie Sirup ins Ohr.
Und eine Frau in der Rolle eines Mannes, also eine sogenannte Hosenrolle, ist sowieso degoutant. Und wenn dann zum Schluss Marschallin, Sophie und Oktavian das Terzett singen, nutzt die Hosenverkleidung von Oktavian auch nichts, denn man hört doch nur drei Frauenstimmen – und wenn die nicht gut sind, kann es ganz schön auf die Nerven gehen.
Und außerdem was soll diese G’schpuserei (mein Engel – mein Bub) einer alten (auf der Bühne meist noch dicklich üppigen) Matrone mit dem jungen Schnösel im 1. Akt?
Und dann die altmodische Sprache, ständig mit Euer Liebden und halten zu Gnaden – das macht die ganze Sache noch verzopfter und beweist wie weit weg die „Heile Welt“ der besseren Leute von der Wirklichkeit entfernt ist.
Und dann schreibt doch der Textdichter, dieser Hugo von Hofmannsthal, nach einer Probe vor der Uraufführung am 26. Jänner 1911 in der Semperoper in Dresden:
...das werden wir nie mehr so sehen, mit diesem vollkom-menen Zusammenklang von Dichtung, Musik und Darstellung, so zart und leise und so schön, dass wir alle unten im Finstern sitzend die Thränen in den Augen hatten. Es ist etwas Merk-würdiges, dass einem manchmal, ganz selten im Leben die Thränen kommen über das ganz Schöne, das Vollendete, den absoluten Zusammenklang...
Ich versichere Ihnen, dass es hier tatsächlich so ist.
Richard Strauss war um die 50 als er sich mit einer neuen Oper beschäftigte.
Er hatte bisher mit seinen Tondichtungen, insbesondere dem Geniestreich Don Juan, aber vor allem den Opern Salome und Elektra – die vorangegangenen Guntram und Feuersnot sind etwas in Vergessenheit geraten – sensationelle Erfolge gehabt.
Er war aber auch ein äußerst gefragter und gefeierter Dirigent – nicht nur seiner eigenen Werke: z.B.: 1889 wird er musikalischer Assistent bei den Bayreuther Festspielen, 1893 (23.12.) dirigiert er die Uraufführung von Engelbert Humperdincks Hänsel und Gretel in Weimar, 1898 beginnt er seine Stellung als Preußischer Hofkapellmeister in Berlin mit Tristan und Isolde wie 35 Jahre später beim 50. Todestag (13.2.1933) Richard Wagners.
Während einer USA-Reise 1904 – er ist Zeit seines Lebens un-glaublich viel in der Welt unterwegs, heute würde man sagen, er gehört zu den Stars des internationalen Jet-Sets – dirigiert er allein 35 Orchesterkonzerte und begleitet seine Frau, Pauline de Ahna, mit der er 55 Jahre glücklich verheiratet lebt, auch noch bei zahlreichen Liederabenden am Klavier.
Seit 1906 dirigiert Strauss die Wiener Philharmoniker. 1919 wird er gemeinsam mit dem Dirigenten Franz Schalk, zum Direktor der Wiener Staatsoper bestellt. Bis auf 2 der 800 Mitglieder der Staatsoper wenden sich alle in einer Resolution gegen Strauss, weil er längere Arbeitszeiten, weniger Urlaube und geringere Lohnforderungen verlangt habe und damit die Existenz vieler Mitarbeiter gefährde. Die Konflikte reißen nicht ab und im November 1924 verlässt Strauss das Haus am Ring. Immerhin leitet er 1942 das Festkonzert zum 100. Geburtstag der Wiener Philharmoniker, die auch im Orchestergraben der Staatsoper musizieren.
An den wenigen Daten, die ich genannt habe, ist schon zu erkennen, in welch langen Zeiträumen sich das Schaffen von Richard Strauss abgespielt hat. Es gibt wenige Künstlerleben, bei Strauss von 1864 (11.6.) bis 1949 (8.9.), also 85 Jahre, die so anhaltend ausgefüllt sind. Noch kurz vor seinem Tod dirigierte er im Bayerischen Rundfunk und für einen Dokumentarfilm den Schluss des II. Aktes vom Rosenkavalier.
Dabei hatte er in jungen Jahren eine sehr labile Gesundheit, die ihn zu Kuraufenthalten nach Griechenland, Italien und Ägypten – der trockenen Luft wegen – führte.
Von Anfang an war sein Lebensweg von und für die Musik bestimmt. Sein Vater (Franz Joseph) war bekannter Hornist in München, der, obwohl er im Bayreuther Festspielorchester engagiert war, aus seiner Abneigung gegen Wagners Musik kein Hehl machte. Mit 7 Jahren besucht Richard seine ersten Opernaufführungen, wie die meisten von uns, den Freischütz und die Zauberflöte. Mit 18 begleitet er seinen Vater nach Bayreuth und erlebt tief erschüttert den Parsifal. Mit Wagners Musik wird er immer wieder in Berührung kommen, im gewissen Sinne sieht er sich – mit ihm – als Vollender der Entwicklung der klassischen, deutschen, Musik. Was danach kommt ist für ihn Bockmist und Schund von atonalen Bolschewiken.
Aber ich will die Diskussion hier nicht weiter vertiefen, sie wird dem Schöpfer, vor allem aber seinem Werk nicht gerecht. Ich meine, man muss ein Kunstwerk zunächst aus seiner Entstehungsgeschichte heraus zu verstehen suchen und es nicht mit pseudoaktuellen Zeitbezügen epigonaler Interpretations-konstrukte bis zur Unkenntlichkeit übergießen.
Und beim Rosenkavalier geht es um die Jahre 1909 bis 1911. Hugo von Hofmannsthal, der mit dem Text zur Elektra seit 1906 bereits den Beweis einer fruchtbringenden Zusammenarbeit mit dem Komponisten erbracht hat, schreibt am 11.2.1909 an Strauss, er habe die Idee zu einem neuen Stück, die nach dessen Zustimmung mit tätiger Unterstützung durch Harry Graf Kessler weiterverfolgt wird.
Strauss wiederum liebäugelt nach den beiden musikalisch sensationell modernen, inhaltlich aber eher blutrünstigen Opern Salome und Elektra mit dem Gedanken, etwas Leichteres, Heiteres, Mozartliches (sein Idol ist der Figaro), zu komponieren.
Das Hin und Her der beiden – Dichter und Komponist – zu berichten, würde bis Köln und zurück nach Münster reichen. Deshalb nur einige Punkte.
Hofmannsthal siedelt die Geschichte im Wien Maria-Theresias so um 1740 an, vorvoltairianisch, österreichisches Jesuitenbarock. Er rankt sie um einen Brauch, den es nie gegeben hat, der aber hübsch erfunden ist: ein adeliger Bräutigam lässt seiner Zukünftigen durch einen – ebenfalls adeligen, natürlich – Überbringer eine silberne Rose zukommen.
Besagter Bräutigam, von gestandenem mittlerem Landadel – Baron Ochs auf Lerchenau – poltert eines Morgens ins Boudoir seiner Cousine, der Fürstin (also hoher Adel) Marie-Theres’ von Werdenberg, genannt die Marschallin, weil sie mit dem gleichnamigen Feldmarschall, – der immer auf irgendwelchen Feldzügen an den Grenzen der k.u.k.-Monarchie agiert, statt bei ihr in Wien – arg unerfüllt verheiratet ist, um sie nach einem geeigneten Rosen-Überbringer zu fragen, denn so gut kennt er sich, vom Lande kommend, in der männlichen Welt jedenfalls der Hauptstadt nicht aus. Ihm steht in Aussicht, ein junges Ding zu ehelichen aus dem zwar erst jüngst in den – niederen – städtischen Adelsstand erhobenen Hause Faninal, aber dafür – er hat halt schoneinmal ein Lerchenauisch’ Glück! – mit einer ansehnlichen Mitgift an Immobilien und sonstigem Vermögen versehen.
Die Fürstin, vom landadeligen Vetter rauh aus der freuden-spendenden Umarmung ihres blutjungen Marschallinentrösters Graf (also höherer Adel) Octavian – von ihr wienerisch-zärtlich auch Taverl gerufen – Rofrano gerissen, schlägt geistesgegenwärtig den ebenso geistesgegenwärtig rasch als Kammerzofe verkleideten Grafen vor (Szenen wie diese werden in Komödien meist geschildert wie: der Liebhaber in Unterhosen unterm Bett oder im Schrank – nicht so bei Hofmannsthal).
Dem Baron dämmert erst in der letzten Szene des III. Aktes, warum ausgerechnet der Graf als Überbringer ausersehen war, denn er kennt ihn zunächst nur als Zofe, so kokett g’schamig, dass ihm ganz heiß werden soll. Als aber die Zofe sich als Graf herausstellt – das Gesicht kam ihm gleich so bekannt vor – weiß er sich als Mann von Welt zu geben:
Bin von so viel Finesse scharmiert,
kann gar nicht sagen wie.
Ein Lerchenauer war noch nie kein Spielverderber nicht.
Bevor es aber soweit ist, geht noch das berühmte Lever über die Bühne, diesmal eine tatsächlich echte Sitte, die in den hochadeligen Häusern von den Versailler Ludwig-Königen abgekupfert worden ist. Während die adelige Herrschaft, hier die Marschallin, also Damenschaft, ihre Morgentoilette macht, hält sie – die kostbare adelige Zeit nutzend – Audienz.
Nehmen Sie das Tohuwabohu der Szene einfach lustig. Aber achten Sie auf den Sänger, der in strahlend tenoralem Belcanto seine Arie singt.
Etwas unwillig den Marschallinentröster mit einem Rosenkavalier tauschen zu müssen, begibt sich im II. Akt unser Taverl, also Graf Octavian Rofrano, ins Faninal’sche Palais. Na ja, und was jetzt abgeht, nennt der Volksmund – unter Adeligen sind natürlich gehobenere Ausdrücke angebracht – Liebe auf den ersten Blick! – Und zwar wie vom Blitz getroffen, auch wenn es die beiden – Octavian und Sophie, das junge Ding – nicht gleich merken, denn der Dichter hat wunderschön ausgebreitet, welche verschlungenen Wege die Liebe sich zwischen Kopf, Herz und Bauch sucht.
Und der Komponist lässt dazu eine der wunderschönsten Melodien erklingen:
Mir ist die Ehre widerfahren,
dass ich der hoch und wohlgeborenen Jungfer Braut,
in meines Herrn Vetters Namen,
dessen zu Lerchenau Namen,
die Rose seiner Liebe überreichen darf.
Wie bei seiner Cousine benimmt sich der Baron, zum notariellen Abschluss des Ehekontrakts ebenfalls eingetroffen und vom fast bis zur Unbeweglichkeit geehrten Brautvater hofiert
Wär’ nur die Mauer da aus Glas,
dass alle bürgerlichen Neidhammeln von Wien
sie en famille beisammen so sitzen sehn!
auch hier landadelig saugrob und täppisch (Hofmannsthal und Strauss waren sich nicht ganz einig, ob der Ochs wirklich so einen tumben Dorftrottel abgeben sollte, der Dichter charakterisiert ihn als einen im Falstaff stecken gebliebener kleinadeliger Don Juan).
Seine Lakaien stehen ihm dabei in nichts nach:
Die Lerchenau’schen sind voller Branntwein gesoffen
und geh’n aufs Gesinde los
zwanzigmal ärger als Türken und Croaten!
muss der Haushofmeister seinem Herrnvon Faninal verstört berichten.
Wer sich das aber überhaupt nicht bieten lässt, ist ausgerechnet das junge Ding von Braut, sie weigert sich einfach, diesem Ungeheuer von landadeligem Macho ins Ehebett zu folgen, auch wenn der Vater ihr mit dem Kloster droht. Von solch selbstbewusster weiblicher Konsequenz beeindruckt und von der frisch entflammten Liebe beflügelt wandelt sich unser Rosenkavalier Octavian – Taverl – zum Degenkavalier. Er zieht denselben, stellt sich dem brambassierenden Baron in den Weg – Zum Satan, zieh’ Er oder ich stech’ Ihn nieder! – und ritzt ihn tatsächlich mit der Degenspitze am Oberarm.
Dem Baron geht es nicht um seinen zerstochenen Janker, sondern um sein schönes freiherrliches Blut. Auch hier erweist sich der Macho als maskulines Windei und schreit:
Mord! Mord! Mein Blut! Zu Hilfe! Mörder! Mörder!
Ich hab’ ein hitzig’ Blut!
Um Ärzt! Um Leinwand! Verband her!
Um Polizei! Um Polizei!
Ich verblut’ mich auf eins, zwei, drei!
Aufhalten den!
Das lassen sich die Lerchenauschen Lakaien, durch den Branntwein gestärkt, von ihrem Herrn nicht zweimal sagen und stürzen sich auf unseren tapferen Taverl.
„Den haut’s z’samm! Den haut’s z’samm!
Spinnweb her! Feuerschwamm!
Reißt’s ihm den Spadi weg!
Schlagt’s ihn tot auf’m Fleck!
Nehmen Sie das folgende Tohuwabohu der Szene einfach lustig.
Unser Baron aber, dem Tod gerade noch von der Schippe gesprungen, sieht nach der missglückten Rosenübergabe wenigstens einen Silberstreif am Horizont. Ihm wird ein Brieferl zugesteckt, in dem steht eindeutig verheißungsvoll:
Herr Cavalier! Den morgigen Abend hätt’ i frei.
Sie ham mir schon g’falln, nur g’schamt
Hab’i mi vor der fürstli’n Gnade,
Weil ich noch gar so jung bin.
Das bewusste Mariandel,
Kammerzofel und Verliebte.
Wenn der Herr Cavalier den Namen nit schon
vergessen hat.
I wart’ auf Antwort.
Er hat halt schon einmal ein Lerchenauisch’ Glück! der Baron Ochs auf Lerchenau, denn selbstverständlich hat er den Namen nit vergessen.
Und ganz im Sinne von des Barons Lieblingslied:
Ohne mich, ohne mich, jeder Tag dir so bang,
mit mir, mit mir keine Nacht dir zu lang!
kann der Komödie dritter und letzter Teil stattfinden.
Er spielt in einem Chambre Séparée eines urwienerischen Beisl, wir würden Kneipe oder Pinte dazu sagen. Und er beginnt diesmal mit einem Tohuwabohu. Nehmen Sie deshalb die Szene einfach lustig.
Is eine wienerische Maskerad’ und weiter nichts.
Am Ende ist der Baron der Düpierte.
Versteht Er nicht, wenn eine Sach’ ein End’ hat?
Die ganze Brautschaft und Affär’ und alles sonst,
was drum und dran hängt,
ist mit dieser Stund’ vorbei.
Und auch für die Marschallin ist alles sonst, was drum und dran hängt, zu Ende. Als Frau spürt sie, dass auch sie verloren hat, ihren Geliebten, Taverl. Sie hatte es schon immer geahnt:
Hab’ ich mir’s nicht vorgesagt?
Das alles kommt halt über jede Frau.
Hab’ ich’s denn nicht gewusst?
Hab’ ich nicht ein Gelübde tan?
Daß ich’s mit einem ganz gefassten Herzen
Ertragen werd’
Heut’ oder morgen oder den übernächsten Tag.
geht er hin und gibt mich auf um einer anderen willen,
die jünger und schöner ist als ich.
Sind halt aso, die jungen Leut’! sagt zum Schluss Herr vonFaninal, der glücklich Brautvater bleiben kann, adelige Distanzen überspringend nunmehr mit einem echten Grafen als Schwiegersohn. Und die Marschallin kann dazu nur sagen – und da liegt der ganze Weltschmerz drin:
Ja, ja!
Die Rolle der Marschallin – sie wird mit ihrer Lebensweisheit auch mit Hans Sachs in den Meistersingern verglichen – ist der Kern, die eigentliche Seele der Oper. Eine reife Frau, die regelrecht Zuflucht bei einem jungen Liebhaber sucht, erkennt, muss erkennen, dass sie von Anfang an ein verlorenes Spiel spielt. Das Alter verliert vor der Jugend, es ist machtlos gegenüber dem unaufhaltsamen Wandel.
Zum einen nimmt sie’s mit Galgenhumor:
Mein lieber Hypolite,
heut’ haben Sie ein altes Weib aus mir gemacht,
fährt sie ihren Friseur beim Lever an – wieviel Frauen können sich da gut hineinversetzen.
Aber es überwiegt doch die Melancholie, das Gefühl des Uner-klärlichen:
Aber wie kann das wirklich sein,
dass ich die kleine Resi war
– erinnert sie sich –
und dass ich auch einmal eine alte Frau sein werd’...
die alte Frau, die alte „Marschallin!
‚Siegst es, da geht die alte Fürstin Resi!’
Wie kann denn das geschehen?
Wie macht denn das der liebe Gott?
Wo ich doch immer die gleiche bin.
Und wenn er’s schon so machen muß,
warum lässt er mich dann zuschau’n dabei,
mit gar so klarem Sinn? Warum versteckt er’s
nicht vor mir?
Das alles ist geheim, so viel geheim.
Und man ist dazu da, dass man’s ertragt.
Und in dem ‚Wie’
Da liegt der ganze Unterschied.
Eine Komödie für Musik haben Hofmannsthal und Strauss ihr Werk im Untertitel genannt, nachdem „Burleske“ dem Komponisten doch etwas zu derb erschien.
Und was ist daran lustig, werden Sie fragen? Sie dürfen nicht an Rossini denken, oder Lortzing, oder gar Johann Strauß. Eher kommen da einem die Meistersinger in den Sinn.
Der Untertitel ist schon feinsinnig gewählt. Strauss hat nicht die Musik für eine Komödie komponiert, sondern der Dichter hat eine Komödie für die Musik von Richard Strauss geschrieben, und die ist unverwechselbar Strauss, nicht so himmelstürmend wie Don Juan, nicht so gewagt wie Salome und Elektra.
Der Komponist muss selber gespürt haben, dass er seine musi-kalischen Grenzen nicht weiter stecken konnte. Den Sprung etwa zum Atonalen hat er nicht über sich gebracht. Insofern blieb er konsequent – wie auch sonst in seinem Leben. Er, der zwanzig Jahre zuvor zur musikalischen Avantgarde gehörte, hat einfach beschlossen: Schluss damit, es geht nicht weiter und hat quasi eine Drehung um 180 Grad gemacht und uns damit eine traumhafte Musik geschenkt, eine Musik, wie man sie einem Komponisten Anfang des 20. Jahrhunderts einfach nicht mehr zutraut.
Wenngleich sie nicht jedermanns Sache ist. Kaiser Wilhelm, der als einzige Strauss-Oper den Rosenkavalier besuchte, verließ nach dem I. Akt das Haus mit den Worten: Det is keene Musik für mich!
Strauss selbst hat, nachdem er die ersten Texte gelesen hatte, an Hofmannsthal geschrieben: wird sich komponieren wie Öl und Butterschmalz. Das drückt sich auch in einer regelrechten Walzerseeligkeit aus.
Gerade dieser Anachronismus – zur Zeit Maria-Theresias gab es den Walzer in seiner bekannten Form noch nicht – zeigt, dass Strauss bewusst seinen „musikalischen Salto rückwärts“ gemacht hat. Nach den Dissonanzen in Salome und Elektra wollte er nichts anderes als Wohlklang komponieren.
Die Musik ist liebevoll und verbindet alles, schreibt Hofmannsthal in einem Nachwort zum Rosenkavalier, ... sie kennt nur ein Ziel: die Eintracht des Lebendigen sich ergießen zu lassen, allen Seelen zur Freude.
Nehmen Sie deshalb die Musik einfach so wie sie ist: wunderschön!
Die Komödie steckt nicht in der Musik, sondern in der Sprache – prima la musica, poi le parole, ein Thema, das Strauss in seiner Oper Capriccio nachdrücklich behandelt hat, und das ebenso für Die Meistersinger von Nürnberg gilt.
Diese Sprache, schreibt Hofmannsthal, ist es – ein Kritiker hat sie, ich glaube im tadelnden Sinn, ein Volapük des achtzehnten Jahrhunderts genannt; ich finde diese Sprache sehr annehmbar – diese Sprache ist es, welche dieses Libretto zum unübersetzbarsten in der Welt macht.
Leider lässt die zum Teil üppige Orchestrierung häufig die Sprache buchstäblich nicht zu Wort kommen. Das ist schade, denn Hofmannsthal ist wirklich ein literarisches Kabinettstückchen gelungen.
(Wenn Sie es sich ermöglichen können, sollten Sie den Text einmal lesen, gibt es auch wohlfeil als Reclam-Bändchen, Sie werden Ihren Spaß daran haben.)
Hofmannsthal jongliert mit dem echten wienerischen Dialekt, mit dem erfundenen aber hübschen Maria-Theresia-Wienerisch. Die Wiener, die den Rosenkavalier glühend lieben und als Opernfreunde ganze Passagen daraus zitieren können, seufzen innerlich gerade an diesen Stellen, weil sie an einen k.u.k.-Traum erinnern. Italienisch, französisch im Original oder in einer herzigen österreichischen Fassung, selbst das deutsche Kauderwelsch des italienischen Gastarbeiters Valzzachi, klar, als Italiener ist er ein Intrigant, bringt einen zum Schmunzeln.
Wir werden das machen, zitiert Hofmannsthal Richard Strauss später, Wir werden es aufführen und ich weiß aufs Haar, was man sagen wird. Man wird sagen, dass eine allgemeine Erwartung wieder einmal schmählich getäuscht wurde, dass dies ganz und gar nicht die komische Oper ist, welche das deutsche Volk Jahrzehnte mit Sehnsucht erwartet. Und mit diesem Kommentar wird unsere Oper durchfallen. Aber wir werden uns unterhalten, indem wir daran arbeiten...
Wenn man will, kann man die Entstehungsgeschichte selbst – dokumentiert in einem umfangreichen Briefwechsel zwischen Dichter und Komponist – partiell als Komödie lesen, auch wenn beide häufig todernst bei der Sache waren.
Strauss, schreibt der Dichter, ist halt ein so fabelhaft unraffinierter Mensch. Hat eine so fürchterliche Tendenz zum Trivialen, Kitschigen in sich.... Eine merkwürdig gemischte Natur, aber das Ordinäre so gefährlich leicht aufsteigend wie Grundwasser.
Um den Titel der Oper gab es ein langes Gezerre mit unterschiedlichen, teilweise abstrusen Vorschlägen.
Publicum ist Publicum, also warum es mutwillig vor den Kopf stoßen? räsoniert Hofmannsthal. Strauss bevorzugte lange den Titel Ochs von Lerchenau, oder nur Ochs, sogar Der Vetter vom Lande wurde erwogen, Hofmannsthal plädiert dann für DerRosenkavalier.
Schließlich schreibt der Komponist an seinen Verleger, der dringend auf die Druckfreigabe wartet:
Mir gefällt ‚Der Rosenkavalier’ gar nicht, mir gefällt der ‚Ochs’! Aber was will man machen. Hofmannsthal liebt das Zarte, Ätherische, meine Frau befiehlt: ‚Rosenkavalier’! Der Teufel hol‘ ihn!
Und so haben wir dem „Befehl“ von Frau Strauss einen der klangvollsten Operntitel zu verdanken.
Bei aller Liebe zum Zarten und Ätherischen sind dem Dichter auch einige ganz deftige Formulierungen eingefallen, die wiederum zu Vorbehalten bei den Fachleuten wie dem Intendanten der Semperoper, wo das Stück uraufgeführt werden sollte (9 der 15 Opern von Strauss kamen in Dresden auf die Bühne). Es wurden Änderungen bzw. Kürzungen verlangt. Die Änderung zugunsten der Prüderie und Heuchelei ärgert mich nach wie vor..., äußerte Strauss und entschied, dass diese nur in den vom Publikum einsehbaren Textbüchern vorgenommen wird, Partitur und Klavierauszug aber wie im Original gedruckt und dann gesungen werden.
Bei den Proben zur Uraufführung kamen zwei Namen dazu, die in der Theaterwelt später für Aufsehen sorgten: Alfred Roller als Bühnenbildner und Max Reinhardt als Regisseur. Roller hatte u.a. die Aufgabe, ein Regiebuch zu erstellen, an dessen Hand der trottelhafteste Provinzopernregisseur eigentlich kaum eine Stellung oder Nuance verfehlen kann.
Noch vor dem Uraufführungstermin haben 26 deutschsprachige (Provinz?) Opernbühnen Aufführungen vereinbart. Deutschland war in einem Rosenkavalierfieber. Hofmannsthal schrieb an Graf Kessler am 11. Januar 1911:
... hier gibt’s Proben, ein rundlicher Qinquin, (ein weiterer Kosename der Marschallin für ihren Liebhaber) rankt sich mangelhaft um eine corpulente Marschallin, alle sind rundlich, nur nicht der Ox (o Theater!) – aber die Musik ist charmant... Sonntag abends bin ich in Dresden mit Reinhardt und Strauss – dort wartet unser ein Ox, der weder basso noch buffo [die vorgeschriebene Stimmlage], weder humoristisch, noch behaglich noch drastisch ist, sondern ein ‚edler’ Comödiant, ein Mann der in Bayreuth den Amfortas singt...
Dem Vernehmen nach soll die Besetzung, die uns in Köln erwartet, sich wohltuend von diesen Schilderungen abheben. Insbesondere die Marschallin, die Finnin Soile Isokoski, soll herausragend sein. Der Regisseur, Günter Krämer, ehemaliger Hausherr im Kölner Opernhaus, ist sicher kein Provinzopernregisseur, aber, so hat er vor der Premiere verlauten lassen, er freue sich schon auf die Reaktionen des Publikums. Das verheißt heutzutage eigentlich nichts Gutes.
Wie dem auch sei, notfalls können Sie ja die Augen schließen und sich voll auf die Musik konzentrieren, die nur ein Ziel kennt, die Eintracht des Lebendigen sich ergießen zu lassen, allen Seelen zur Freude.
*
Richard Strauss, DER ROSENKAVALIER, Textbuch, Einführung und Kommentar von Kurt Pahlen, 5. Aufl., 1997, Serie Musik Atlantis – Schott, Band 8018
La fanciulla del West
(Das Mädchen aus dem Goldenen Westen)
Giacomo Puccini
Essen, Aalto-Theater, 15.03.2003
Es gehört zum Schicksal von Künstlern und ihren Werken, dass sie nicht nur Anerkennung, Lob, Begeisterung des Publikums erfahren, sondern auch mit Vorurteilen, Ablehnung, Spott und Vergessenheit verkannt und bestraft werden.
Bei Richard Wagner haben wir uns ja schon an die Verzerrung: – laut, lang und langweilig – gewöhnt. Die Verkennung Verdis wird meist mit den angeblich hanebüchenen Libretti begründet. Relativ unumstritten sind Haydn, Mozart und Beethoven, von Donizetti und Rossini kennt man zu wenig, mit Franz‘l Schubert hat man eher Mitleid, und Brahms und Tschaikowski sind auch nicht jedermanns Sache.
Es scheint, je leidenschaftlicher Musik und Charakter ihrer Schöpfer miteinander verbunden sind, desto mehr schwankt ihr Charakterbild in der Gunst des Publikums.
Das trifft insbesondere auch auf den Komponisten unseres heutigen Abends zu: Giacomo Puccini. Zugegeben, er hat es seinen Kritikern leichter gemacht als seinen Bewunderern. Der erfolgreichste, d.h. meistgespielte lebende Komponist seiner Zeit, damals wie heute hat er Hohn und Spott auf sich gezogen. Mit seiner Musik, die Grenzen der Klassik schon weit hinter sich gelassen, aber doch nicht den Schritt in die Moderne gewagt, war er eher ein Anachronismus. Eigentlich hätte er nach Meinung der Gegner keinen Erfolg mehr haben dürfen, und doch lag ihm das Publikum zu Füßen.
1904 bei der Premiere von Madama Butterfly, seiner sechsten Oper, gab es an der Scala in Mailand eines der größten Fiaskos in der Operngeschichte. Eine lärmende Claque – wie bei Wagners Pariser Tannhäuser Aufführung – Gelächter, Pfiffe, Pfui-Rufe, und dann, nach dem Fallen des letzten Vorhangs,
absolut eisige Stille, Kein Jota von Applaus, nicht einmal ein Zischen, kein einziger Laut. Nichts!
Das berichtet der Direktor der Scala, Giulio Gatti-Casazza. Die Oper schien tot und begraben.
Sechs Jahre später, 1910, ist er der Direktor der Metropolitan Opera in New York und erlebt mit La fanciulla del West das genaue Gegenteil: unbeschreiblicher Jubel für den anwesenden Komponisten, die Premierenkarten waren am Schwarzmarkt mit einem bis zu dreißigfachem Preis gehandelt worden. Und dann, nach einigen weiteren Erfolgen in Chicago, London und Rom 1911, in Paris 1912 – 1913 in Berlin zählt der anwesende Puccini zur Premiere über 70 Vorhänge – ist das Werk mehr oder minder vergessen.
Das Spektrum der (Vor-) Urteile bewegt sich zwischen – dem Verdikt von Richard Strauss, den wir ja vor zwei Monaten mit seinem Rosenkavalier in Köln erlebt haben:
... vielleicht gibt dies gerade meinen Opern die Gewähr für etwas längere Dauer, wenn ich Puccini mit einer delikaten Weißwurst vergleiche, die um 10 Uhr früh (2 Stunden nach Fabrikation) gegessen werden muß (allerdings hat man um 1 Uhr schon wieder Appetit auf etwas Reelleres) während die Salami (kompakter gearbeitet) eben doch ein bisschen länger vorhält,
– und der Feststellung:
Er hat das große Meisterstück vollbracht, eine altersschwache Gattung für Jahrzehnte galvanisiert zu haben. Er hat die Oper des Alltags geschaffen,
wie Adolf Weissmann 1925 schreibt.
Ich habe stets einen großen Sack Melancholie mit mir herumgeschleppt, klagt Puccini, den jede Enttäuschung an den Rand einer Depression bringen konnte.
Wir können ahnen warum.
Giacomo Puccini macht es einem wirklich nicht leicht.
Nach der schmelzenden Bohème (1896 in Turin), nach der atemberaubenden Tosca (1900 in Rom), nach der zarten Butterfly (1904 als Fiasko in Mailand und 3 Monate später als Triumph in Brescia) nun ein Sujet aus dem rauhen Goldgräbermilieu Kaliforniens.
Dabei hat er bei der Auswahl seiner Stoffe nicht einfach zu jedem billigen Text gegriffen.
Ich erhalte tagtäglich allerlei Skizzen und Texte, klagte er, aber lauter Trödelkram...Mein Gott, wie armselig ist die Theaterwelt, die italienische genauso wie die ausländische!
Kipling, Wilde, Dickens wird ihm vorgelegt, er hatte sich zuvor schon mit Victor Hugo, Dante, Dostojewski, Tolstoi, ja selbst Gerhard Hauptmann und Maxim Gorki befasst, und dann entscheidet er sich ausgerechnet für ein Stück des amerikanischen Theater-Autors David Belasco, das er bei seinem ersten Besuch in New York 1907 am Broadway gesehen hatte: The Girl of the Golden West.
Belasco war ihm kein Unbekannter. Schon im Sommer des Jahres 1900, als Puccini zur Erstaufführung der Tosca in London (12.7. Covent Garden) weilte, hatte er ein Stück des Amerikaners im Theater gesehen, dass ihn sehr beeindruckt hatte. Aufgeschlossen für alles Neue, insbesondere technische Entwicklungen – er war einer der ersten, die ein Auto fuhren und besaß ein Motorboot – hatte ihn bei der Inszenierung die Beleuchtungstechnik fasziniert, als 14 Minuten lang auf offener Bühne nur mit Lichteffekten das Verdämmern der Nacht und der Übergang in einen sonnigen Morgen gezeigt wurde, den zwei Frauen am Fenster stehend beobachteten: Madama Butterfly und ihre Dienerin Cho-Cho-San. Puccini hat genau diese Szene dann wunderbar zart musikalisch umgesetzt.
Nachdem er vom Direktor der Met, dem bereits bekannten Giulio Gatti-Casazza, den Auftrag bekommen hatte, eine Oper zu schreiben – die erste Uraufführung eines europäischen Komponisten auf amerikanischem Boden, zwei Wochen später (28.12.1910) folgte die zweite: Die Königskinder von Engelbert Humperdinck – ließ er sich den Text von Belasco kommen, den seine langjährige Londoner Brieffreundin Sybil Seligmann ins Italienische übersetzte, weil Puccini des Englischen nicht mächtig war. Die Autoren des Librettos waren Carlo Zangarini und Guelfo Civinini, wobei Puccini selbst sehr stark in die Arbeit eingriff und zum Beispiel den dritten Akt fast allein gestaltete.
Mit Manon Lescaut, seinem ersten Opernerfolg 1893, hatte sich Puccini im 4. Akt mit der als Strafgefangene geflohenen und in den Armen ihres Liebhabers Des Grieux verdurstenden Heldin bereits in die Weiten des wilden Westens vorgewagt.
Jetzt verlegte er die Handlung völlig in das Land des Goldrauschs, in die schroffe Bergwelt der Cloudy Mountains, mit Pistolen und Whiskygläsern in harten Fäusten, mit Pferden, Indianern, einem Saloon, einem Sheriff – und einem Galgen.
Wieder steht eine Frau im Mittelpunkt, diesmal nicht Mimi, eine suave fanciulla wie La Bohème, sondern Minnie, das Girl, eine burschikose, selbstbewusste Frau, trink- und bibelfest, die mit beiden Beinen fest im Leben ihren Mann steht, die sich mütterlich um die Armen und Ausgestoßenen des Camps sorgt, und die aber ebenso zu leidenschaftlicher Liebe fähig ist wie Tosca.
Puccini, der sich nie scheute, vom Normalen abzuweichen, gegen Widerstände anzukämpfen, Freunde wie Gegner zu verwirren, hat sich hier ohne Zweifel einen Jugendtraum erfüllt. Seit seiner Kindheit liebte er Goldgräber-, Cowboy- und Indianer-Geschichten. In Mailand versäumte er 1889 nicht, den auf einer Europatournee herumgereichten legendären Buffalo Bill zu sehen, und schrieb an seinen Bruder Michele: Buffalo Bill ist hier gewesen, das hat mir Spaß gemacht. Bill ist eine nord-amerikanische Truppe mit einer Menge von Rothäuten samt ihren Büffeln. Sie machen glänzende Schießkunststücke.
Vor allem wollte Puccini aber nach der Butterfly eine „kräftige“, moderne Oper schreiben, die nicht so viel „Süßstoff“ enthielt, wie man ihm bei den anderen Werken vorgeworfen hatte.
Er verwendet eine neue, kühne Harmonik und Instrumentation, er arbeitet amerikanische Country-Songs und Indianermusik ein, sogar eine Windmaschine (für den Hurrican im II. Akt) wird eingesetzt.
Den ganzen Abend Puccini und keine einzige Melodie, urteilt später Heinrich Mann. Dabei erinnert die Musik eher an die mitreißenden Filme John Wayne’s, oder Gary Cooper in High Noon oder Die glorreichen Sieben und das legendäre Spiel mir das Lied vom Tod.
Meiner Meinung nach die beste Oper, die ich geschrieben habe, meldet Puccini an Sybil Seligmann am 15. August 1910, zusammen mit dem erleichterten Das Girl ist vollendet!
Nach Ansicht von Giuseppe Sinopoli, der 1982 die Inszenierung an der Deutschen Oper in Berlin, die ich gesehen habe, musikalisch leitete, ist La Fanciulla del West,wenn nicht die schönste Oper Puccinis, so doch seine interessanteste.
Den Inhalt der Oper zu erzählen, und zwar so, dass wir alle den Fortgang der Handlung verstehen, ist zu kompliziert. Neben den Protagonisten Minnie (Sopran), dem Goldräuber Dick Johnson (Tenor), auch Ramerrez genannt, weil er ein Latino ist, und dem Sheriff Jack Rance (Bass), der der Hüter des Gesetzes ist und Ramerrez an den Galgen bringen will, von dem ihn Minnie in letzter Sekunde herunterholt, sind noch 15 weitere Partien vorgesehen, und natürlich ein kräftiger Männerchor, die Goldgräber, selten Glückspilze, eher Desperados.
Im Gegensatz zu den bisherigen Opern Puccinis gibt es ein Happy End, wie bei vielen Western-Filmen nach einigen wilden Schießereien üblich: Minnie und ihr Lover „…reiten in die untergehende Sonne“.
Die Uraufführung an der Met, Puccini war eigens mit dem Dampfschiff nach New York gereist und begleitete die Proben, wurde in einer Star-Besetzung gegeben. Die Minnie sang Emmy Destinn, Preußische Kammersängerin und ehemals Mitglied der Königlichen Hofoper in Berlin. Den Dick Johnson, alias Ramerrez, gab Enrico Caruso, m – jawohl! derselbige!, – und Jack Rance wurde von Pasquale Amato gesungen, der als Scarpia ebenso erfolgreich war wie als Kurwenal und Amfortas, so wie Wolfgang Brendel heute Abend, der die Partie des Sheriffs übernommen hat.
Dirigent war Arturo Toscanini. Er hatte schon 1896 in Turin La Bohème zum Erfolg gebracht und sollte erst 16 Jahre später – nachdem er sich geweigert hatte, die Uraufführungen von Puccinis La Rondine (1917 in Monte Carlo) und Il Trittico (1918 wieder in New York) zu übernehmen – ein neues Werk von Puccini dirigieren: Turandot.
Die Aufführung in Essen ist nach über 40 Jahren eine Neuinszenierung durch den Flamen Guy Joosten unter der fulminanten Stabführung von GMD Stefan Soltesz mit einem erstklassigen Ensemble, Chor und Orchester.
Die Presse war nach der Premiere im März vergangenen Jahres voll des Lobes. Kaum ein Moment, da Puccinis betörende Musik nicht tief in die Sessel drückt, schrieben die „Westfälischen Nachrichten“, und damit es Sie in den drei Stunden Aufführungszeit nicht zu lange in die Sessel drückt, gibt es eine Pause nach dem 1. und dem 2. Akt.
...eine Partitur von ganz originellem Klang. Prachtvoll. Jeder Takt überraschend. Ganz besondere Klänge. Keine Spur von Kitsch. Es hat mir sehr gefallen, urteilte Anton Webern, der als Komponist für Wohlklang nicht gerade bekannt ist. Prüfen Sie selbst, ob es auch Ihnen gefallen wird. Und danach zu Hause vielleicht mit einem Glas Bourbon-Whiskey in Gedanken durch den Wilden Westen reiten.
*
Giacomo Puccini, mit Selbstzeugnissen und Bilddokumenten dargestellt von Clemens Höslinger, Rowohlt Monografien, 5.Aufl., 1996
TURANDOT
Giacomo Puccini
Essen, Aalto-Theater, 4.11.2007
Guten Tag liebe Gäste, im Namen der gloßen Volsitzenden des Lichald Wagnel Velbandes Münstel, Dolis Meyel-Galandel, beglüße ich Sie bei unselel Opelnfahlt zu Giacomo Puccinis Tulandot im Aalto-Theatel in Essen.
Damit haben Sie – wenn es um China geht – gleich eines der gängigen Klischees: die Chinesen können kein R sprechen. Richtig ist, die chinesische Sprache kennt kein R, aber selbstverständlich können Chinesen, wenn sie fremde Sprachen sprechen, das R formulieren, also problemlos Richard Wagner sagen.
China, das riesige, geheimnisvolle „Reich der Mitte“, hat uns Europäer seit Marco Polos Reisebericht schon immer fasziniert. Seide, Porzellan, Tee, Jade, Lotusblüten, Lampions, feuerspeiende Drachen und wilde Tiger verbinden wir, wenn wir uns ein Bild von China machen. Kolumbus wollte westwärts segeln, um so, bei einer Kugelgestalt der Erde, den Weg nach Cathay und Cipangu zu verkürzen. Es gab immer wieder Wellen der China-begeisterung. Im 18. Jahrhundert wurde kaum ein Schloss gebaut, in dem nicht wenigstens ein Raum mit Chinoiserien geschmückt war; und das hielt sich bis hin zu Hans Christian Andersen und seinem zauberhaften Märchen Die Nachtigall, das so beginnt:
In China, das weißt du ja wohl, ist der Kaiser ein Chinese und alle, die um ihn sind, sind auch Chinesen. Es sind nun viele Jahre her; aber gerade deshalb ist es wert, die Geschichte zu hören, ehe sie vergessen wird.
Die Geschichte von Turandot ist auch schon viele Jahre her, sie findet sich bereits im 12. Jahrhundert in der persischen Sammlung aus Tausend und ein Tag, bei uns als Tausendundeine Nacht bekannter, und hat die Menschen beeindruckt: eine Prinzessin, die ihre Brautwerber köpfen lässt, weil sie die aufgegebenen drei Rätsel nicht lösen können.
Es hat dann zahllose Bearbeitungen dieser Geschichte gegeben.
1729 nahm in Paris Alain-René Lesage das Thema in einem Theaterstück La Princesse de la Chine auf, aber zur Geltung kam es erst 1762 durch den Venezianer Carlo Gozzi. Er, ein literarischer Gegenspieler des bekannteren Carlo Goldoni, schrieb regelrecht im Wettbewerb um die Publikumsgunst Theaterstücke, in denen er die Tradition der commèdia dell’arte bewahren wollte. Und dem Publikum in Venedig gefiel das Märchen der Prinzessin Turandot.
Es gefiel aber auch im fernen, kalten Deutschland dem Theaterdichter Friedrich Schiller, der, vom Prinzipal des Weimarer Theaters Johann Wolfgang von Goethe aufgefordert auf der Suche nach einem Stoff, für die alljährliche zum Geburtstag der Herzogin (Luise) am 30. Januar als Geschenk angesetzte Theaterpremiere, war. Goethe gefiel ebenfalls das Stück, insbesondere auch die vier Figuren Pantalone, Tartaglia, Brigella und Truffaldino, erinnerten sie ihn doch an seine Italiensehnsucht. Gozzi hatte die typischen commèdia dell’arte Figuren einfach nach China versetzt, auf diese Weise aber geschickt in das grausame Spiel der Prinzessin lockernde Heiterkeit gebracht.
Goethe und Schiller akzeptierten diese Mischung aus Tragödie und Komödie.
Es steht zu erwarten, schrieb Goethe, wie dieses Stück in Teutschland aufgenommen werden kann. Es ist freylich ursprünglich für ein geistreiches Publikum geschrieben und hat Schwierigkeiten in der Ausführung... So haben wir die angenehme Wirkung schon erfahren, daß unser Publikum sich beschäftigt selbst Räthsel auszudenken, und wir werden wahrscheinlich bey jeder Vorstellung künftig im Fall seyn, die Prinzessin, mit neuen Aufgaben gerüstet, erscheinen zu lassen...
Nach der Premiere am 30. Januar 1802 brach in Weimar eine wahre Rätselmanie aus, man überraschte sich gegenseitig mit Rätselaufgaben. Und tatsächlich schrieb auch Schiller für jede Aufführung neue Rätsel, insgesamt sind 14 davon überliefert.
In den nachfolgenden Aufführungsorten Berlin, Hamburg und Dresden wurde Turandot nicht mehr ganz so enthusiastisch aufge-nommen und geriet bald in Vergessenheit.
Auch musikalischen Bearbeitungen, wie etwa Carl Maria von Weber 1809 und Feruccio Busoni 1911/1917, blieb ein anhaltender Erfolg versagt.
Als Giacomo Antonio Domenico Michele Secundo Puccini am 22. Dezember 1858 als 5tes Kind in Lucca – etwa mittig zwischen Florenz und Pisa – geboren wurde, hatte Richard Wagner schon Der fliegende Holländer (1843), Tannhäuser (1845) und Lohengrin (1850) geschaffen und arbeitete am RING und am Tristan, und in Italien Giuseppe Verdi – beide sind ja im selben Jahr 1813 geboren – 20 von seinen insgesamt 28 Opern – vollendet.
Der Besuch einer Aufführung der Aida (1871) in Pisa 1876 – er ist die etwa 20 km von Lucca aus hin und zurück zu Fuß gelaufen, da sind unsere Opernfahrten doch etwas bequemer – ließ beim 18jährigen Puccini den Entschluss reifen, Opernkomponist zu werden.
44 Jahre später, Im Sommer 1920, als er erstmalig – und sie sollte sein Schicksal werden – Turandot begegnete, war Puccini ein erfolgreicher und weltweit gefeierter Star: 1893 Manon Lescaut, mit der er den Durchbruch erzielte, 1896 La Bohème, 1900 Tosca, 1904 Madama Butterfly, 1910 La fanciulla del West (in Deutschland als Das Mädchen aus dem Goldenen Westen bekannt), 1917 La Rondine, 1918 Il Trittico. Er war auf der Höhe seines Schaffens, aber dennoch rastlos.
Jetzt also Turandot, wieder – wie bei allen seinen großen Opern – eine Frauengestalt als Hauptfigur, noch einmal ein fernöstliches Sujet. Aber es ist nicht das Stück seines Landsmannes Gozzi, sondern die Bearbeitung des Deutschen – Puccini hatte zeitlebens eine Vorliebe für Deutschland, auch weil seine Opern hier besonders häufig gespielt wurden – Friedrich Schiller, sie war inzwischen ins Italienische (von Andrea Maffei) übersetzt worden, begeistert ihn.
Sein Verlag Ricordi in Mailand gibt ihm zwei versierte Librettisten – Giuseppe Adami und Renato Simoni, der als Journalist einige Jahre in China gelebt hatte, – an die Hand. Aber wie bei der Butterfly studiert auch hier der Komponist selbst sorgfältig alles was er über chinesische Musik und chinesisches Kolorit erreichen kann und greift häufig mit Ideen und Formulierungen in das Textbuch ein. Der befreundete Baron Fassini, ein Kenner Chinas, schenkt ihm eine Spieldose mit chinesischen Melodien, die Puccini verarbeitet.
Aber noch nie war er in einem Schaffensprozess so zerrissen, als ahnte er, dass es sein letztes Werk sein würde. Er wollte etwas ganz Großes, Einzigartiges schaffen. Anfangs passte ihm nicht das Textbuch, dann schwankte er, ob die Oper zwei oder drei Akte haben sollte. Vor allem der Schluss, die Wandlung der eiskalten Prinzessin: Principessa di morte, principessa di gelo – Prinzessin des Todes, Prinzessin aus Eis zur liebenden Frau durch einen Kuss, ließ ihn nicht zur Ruhe kommen, machte ihn verzweifelt, mutlos.
Lieber Adamino, schrieb er im November 1922 an seinen Librettisten, ich bin ein armer Mensch, tieftraurig, entmutigt, alt, überflüssig und heruntergekommen. Was tun? Ich weiß es nicht. Ich gehe schlafen, dann brauche ich nicht nachzudenken und quäle mich nicht.
Puccini gibt nicht auf. Zwei Akte kann er vollständig instrumentiert fertigstellen. In den Skizzen, immerhin insgesamt 36 Seiten, die er für den Schluss anfertigt, liest man Hinweise wie Melodie finden, weniger einfältig als bisher, kein Bombast! und ganz merkwürdig: ... dann Tristan (!). Bedenkt man allerdings, dass fast der ganze 2. Akt des Tristan eine einzige traumhafte musikalische Liebesszene ist, dann ahnt man, was Puccini vorgeschwebt haben mag.
Sicher waren es auch die stetig schlimmer werdenden Beschwerden – man diagnostizierte Kehlkopfkrebs – die Puccini belasteten. Er liebte das Leben, rassige Autos, auf seinem eigenen See bei Torre del Lago schnelle Motorboote, die Jagd, ja, wohl auch schöne Frauen, und dann dieses Ende. Am 4. November 1924 begibt er sich von seinem Wohnsitz Viareggio nach Brüssel zum damals bekanntesten Spezialisten, Dr. Ledoux; mitgenommen hat er die 36 Seiten unfertiger Skizzen der Turandot, an der er auch im Krankenhaus weiterarbeiten will.
Jetzt bin ich hier. Man sagt, ich werde ungefähr sechs Wochen brauchen. Das habe ich nicht verdient! Und ‚Turandot’?,
schreibt Puccini an Giuseppe Adami. Zwei Operationen, er erhält eine künstliche Luftröhre, verlaufen problemlos, in der Nacht zum 29. November 1924, um 4 Uhr morgens, hört sein Herz auf zu schlagen.
I.
Popolo di Pekino!
La legge è questa:
Turandot, la pura, sposa sarà
di chi, di sangue regio,
spieghi i tre enigmi
ch’ella proporrà.
Ma chi affronta il cimento
E vinto resta,
porga alla scure
la superba testa!
. . .
Volk von Peking!
So lautet das Gesetz:
Turandot, die Reine, wird Braut
dessen, von königlichem Geblüt,
der die drei Rätsel löst,
die sie ihm stellt.
Aber wer sich der Herausforderung
stellt und besiegt wird,
muss dem Henkersbeil
sein hochmütiges Haupt überlassen!
So beginnt nach einer Reihe von monumentalen Fortissimo-Akkordschlägen die Szene. Als letzter hat ein Prinz aus Persien die Auflösung verfehlt und wartet jetzt – vom Volk blutlechzend bedrängt – auf seine Hinrichtung. Die Köpfe seiner Vorgänger – immerhin waren es, nach den chinesischen Tierkreiszeichen, im Jahr der Maus 6, im Jahr des Hundes 8 und in diesem Jahr des Tigers schon 13, also insgesamt 27! – sind zur Abschreckung auf der Stadtmauer zur Schau gestellt.
Im Gedränge kommt ein alter Mann zu Fall, ein Fremdling eilt herzu, um ihm aufzuhelfen und erkennt seinen Vater, König Timur, aus seinem Reich vertrieben und hier im Exil dahinvegetierend, nur von einer Dienerin, Liù, begleitet, die ihn an frühere Zeiten erinnert.
Der Fremde also, nur Der unbekannte Prinz (Il Principe ignoto) genannt, erblickt Turandot, die herrisch – ein dramaturgisch superber Einfall: sie ist 1 ½ Akte auf der Bühne präsent, aber ohne einen einzigen Ton zu singen – die Hinrichtung des persischen Prinzen beim Mondaufgang gebietet, und ist überwältigt:
O divina bellezza, o meraviglia, o sogno! –
O göttliche Schönheit, o Wunderbare, o Traum!
Und sein Entschluss steht fest, er will diese Frau gewinnen – gegen die Mahnungen seines Vaters, die flehentlichen Bitten der Liù, die ihn liebt, und der drei Minister Ping, Pang,Pong:
Guardalo, è insordito, intontito! Allucinato!
Schaut ihn an: er ist taub! Ist benommen! Ist blind geworden!
. . .
La vita è così bella!
Das Leben ist so schön!
Der unbekannte Prinz lässt sich nicht zurückhalten, er stürmt nach vorn und schlägt dreimal den Gong, mit dem er mutig seine Anwartschaft auf die Rätsel kundtut.
A me il trionfo!
A me l’amore!
Mein ist der Triumph!
Mein ist die Liebe!
II.
Ping, Pang, Pong – Puccini und seine Librettisten haben aus den vier commèdia dell’arte Figuren von Gozzi und Schiller drei Minister gemacht, die keineswegs nur für Aufheiterung sorgen. Nachdem sie vergeblich versucht hatten, den unbekannten Prinzen vor seinem unbedachten Schritt zu bewahren, der ihn wie alle anderen zuvor zum sicheren Tode führen wird, schildern sie das grausame Ritual, seit es Turandot gibt:
. . .tre battute di gong
. . . tre indovinelli
. . . e giù teste
. . . drei Gongschläge,
. . .drei Rätsel,
und runter mit den Köpfen!
Viel lieber wären Sie in ihrer Heimat, in Honan, Tsiang und Kiù, aber die Welt ist voller liebestoller Narren: O mondo, pieno di pazzi innaorati!
Aber, wenn einer kommt und Turandot muss kapitulieren, dann, bekräftigen sie sarkastisch, werden sie die ersten sein, die der Liebe das Federbett bereiten werden. Doch es ist nur ein Traum.
Trompeten erschallen, im Palast sind die Soldaten aufmarschiert, die Menge jubelt dem Kaiser zu:
Diecimila anni al nostro
Imperatore! Gloria a te!
Zehntausend Jahre unserem
Kaiser! Dir ewiger Ruhm!
Und wieder verkündet der Mandarin:
Popolo di Pekino
La legge è questa: ...
Und dann erscheint die Principessa, Turandot. Und sie beginnt mit einer Geschichte, die alle in Bann schlägt, weil sie ihre Tod-bringende Herrschaft erklärt:
„In questa Reggia ...
un grido disperato risuonò
In diesem Palast
vor vielen Tausend Jahren
ertönte ein verzweifelter Schrei.
Es ist der Schrei ihrer Ahnin Lo-u-Ling, die von einer tatarischen Soldateska, die den Palast gestürmt hatte, vergewaltigt und ermordet worden ist. Und diese Untat, diesen Schrei, diesen Mord, will sie, Turandot, rächen: Tod gegen Tod.
Gli enigmi sono tre,
la morte è una!
Drei Rätsel sind es,
Eins ist der Tod!
Und der unbekannte Prinz hält dagegen:
No, no! Gli enigmi sono tre,
una è la vita!
Nein, Nein! Drei Rätsel sind es,
Eins ist das Leben!
Da Sie nicht Gefahr laufen, Ihren Kopf zu verlieren, gebe ich Ihnen gleich die Auflösungen der drei Rätsel, die dem unbekannten Prinzen, nach einer Bedenkzeit, in der die Menge den Atem anhält, doch spielend gelingen:
la Speranza – die Hoffnung
il Sangue – das Blut
und schließlich
TURANDOT.
Das Volk jubelt, aber Turandot bleibt eisig, niemand, auch der Fremde nicht, wird sie besitzen. Der unbekannte Prinz geht darauf ein, er will nur die Liebe, deshalb gibt er sich ein zweites Mal in ihre Hand: wenn sie bis zum Morgengrauen seinen Namen weiß, verfällt er dem Tode.
III.
Nessun dorma!
Die Prinzessin rast vor Wut und Enttäuschung. – Niemand darf in Peking in dieser Nacht schlafen, sondern muss den Namen des Fremden ausforschen, selbst die drei Minister bangen um ihr Leben und versprechen dem Unbekannten schöne Frauen, Reichtum und Ruhm, wenn er ihnen seinen Namen verrät.
Aber er ist siegessicher: Nessun dorma! Eine der glanzvollsten Tenorarien – Sie denken jetzt sicher an Luciano Pavarotti – bekräftigt seine Zuversicht:
All’alba vincerò
Am Morgen werde ich siegen!
Da schleppen die Häscher den alten Timur und Liù herbei, jemand hat sie zusammen mit dem unbekannten Prinzen gesehen, also werden sie seinen Namen kennen. Sie foltern den Alten, aber die bisher schüchterne Liù bietet Turandot die Stirn. Sie kenne den Namen, aber werde ihn nie verraten, denn sie tue das aus Liebe, – L’amore? – Turandot zweifelt.
Doch, sagt Liù, auch du, Prinzessin, noch von Eis umhüllt, wirst Liebe erfahren, denn ich opfere mich für ihn.
Und da sie den Folterungen nicht mehr widerstehen kann, entreißt sie einem der Soldaten den Dolch und ersticht sich.
Die Volksmenge ist entsetzt:
Liù... bontà... perdona!
Liù... dolcezza, dormi!
Oblia, Liù... Poesia!
Liù . . . Gütige . . . verzeih!
Liù . . . Sanftmütige . . . schlafe!
Vergiss, Liù . . . alles ist Poesie!
An dieser Stelle legte Arturo Toscanini, der die Uraufführung am 25 April 1926 am Teatro alla Scala in Mailand leitete, den Taktstock zur Seite und wandte sich ans Publikum, sprach:
Hier endet die Oper, die durch den Tod des Maestro
unvollendet geblieben ist,
und verließ den Orchestergraben. Der Vorhang fiel. Atemlose Stille, dann eine Stimme: Viva Puccini! Und ein ungeheurer Beifallssturm brach los.
Erst bei der nächsten Aufführung wurde der Schluss – den der italienische Komponist Franco Alfano sehr sorgfältig aus den Anmerkungen und Hinweisen Puccinis zusammengestellt hatte, der Text war ja schon fertig – gespielt: bei Tagesanbruch nennt der unbekannte Prinz seinen Namen Calaf und umarmt Turandot mit einem Kuss, der sie verändert. Entschlossen tritt sie vor das Volk:
Ich kenne den Namen des Fremden.
Sein Name ist... Amor... Liebe!
2001 hat Luciano Berio eine neue Fassung vorgelegt, die nicht so bombastisch angelegt ist wie von Alfano, und auch gelegentlich eingesetzt wird.
Das offene Ende gibt aber Regisseuren und Dirigenten Gelegenheit, jeweils ihre Interpretation, mehr oder minder überzeugend, zur Geltung zu bringen.
*
Im September 1998 fand für Opernfreunde etwas Ungewöhnliches statt: acht (die Zahl 8 bedeutet in China Glück) Vorstellungen von Puccinis Turandot in der Verbotenen Stadt in Peking. Eine Produktion des Maggio Musicale Fiorentino, mit Zubin Mehta als Dirigent, und etwa 1.000 Mitwirkenden, davon 350, Chor und Orchester, aus Italien.
Die 80 Meter breite Bühne war vor dem Palast der Himmlischen Reinheit aufgebaut. Regie führte der berühmte Regisseur Zhang Yimou. Er versuchte so weit wie möglich alte chinesische Elemente in die Inszenierung zu bringen, wobei allein schon die Massenszenen des Popolo di Pekino mit hunderten chinesischen Statisten in historischen Kostümen wie zu Turandots Zeiten wirkten.
Meine Frau und ich sind dabei gewesen. Nessun dorma! Unter dem Sternenhimmel Pekings – ein unvergessliches Erlebnis.
(Als ich meinen Studenten später an der Shanghai University of International Business and Economics (SUIBE) davon erzählte, war die einhellige Reaktion der männlichen Zuhörer mit einem freundlichen Lächeln: Turandot kann keine chinesische Geschichte sein, denn kein chinesischer Mann würde – sogar zwei Mal! – das Risiko des Todes eingehen – nicht für eine Frau!)
*
Was erwartet uns heute Abend? GMD Stefan Soltesz, Chor und Orchester sollen der Kritik nach eine überragende Musik bringen. In der Titelpartie die Schwedin Iréne Thulin, sie hat in Bayreuth die Ortlinde, in Nürnberg und Kopenhagen die Brünnhilde gesungen.
Kein Wunder, dass als herausragende Turandot Birgit Nilsson aus Schweden gilt, aber auch Maria Callas hat die Rolle 47mal auf der Bühne verkörpert.
Der Amerikaner Frank Poretta, u.a. als Otello, Manrico, Radamès und Cavaradossi in Europa und in den USA aufgetreten, singt den unbekannten Prinzen. Und Olga Mykytenko von der Staatsoper Kiew (auch dort ist schon der RWVM gewesen) u.a. als Violetta, Gilda, Luciadi Lammermoor, und Mimi in La Bohème, aber auch Tatjana in Eugen Onegin, weltweit gefragt, singt die Liù.
Der Regisseur Tilmann Knabe hat seine, wie heute üblich, zeitgemäße Interpretation, den Kaiser im Rollstuhl mit Sauerstoffmaske und viel nackter Komparserie – aber ohne Poesie – auf die Bühne gestellt.
Nun ja, wenn Ihnen das Bild zu sehr aufs Gemüt gehen sollte, schließen Sie die Augen und lassen Sie sich von der Musik verzaubern und nach China entführen – denn Sie wissen ja, dort ist der Kaiser ein Chinese und alle, die um ihn sind, sind auch Chinesen.
*
Giacomo Puccini, mit Selbstzeugnissen und Bilddokumenten dargestellt von Clemens Höslinger, Rowohlt Monografien, 5. Aufl., 1996
Texte: Turandot (Maria Callas), Orchestra e Coro del Teatro alla Scala, Milano, Tullio Serafin; EMI Italiana SpA, recorded 1957; Booklet.
L’Africaine
(Die Afrikanerin)
Giacomo Meyerbeer
Gelsenkirchen, Musiktheater im Revier, 20.04.2008
Bon jour mesdames et messieurs, je vous souhaite très cordialment la bienvenue. Damit möchte ich Sie im Namen unserer Frau Vorsitzenden, Doris Meyer-Galander, und unseres Generalsekretärs, Robert Hasenjäger, der wieder alles umsichtig organisiert hat, auf der Fahrt des Richard Wagner Verbandes Münster ins Musiktheater im Revier in Gelsenkirchen einstimmen. Wir sind ja dorthin schon einmal zu einer großen französischen Oper, Les Troyens von Hector Berlioz, gefahren.
Wie Sie sich erinnern werden, hatte ich auf freundliche Veranlassung der Frau Vorsitzenden schon mehrfach die Ehre und Sie hoffentlich das Vergnügen einer Werkeinführung im Bus bei den Fahrten unseres Verbandes zu verschiedenen Opernaufführungen. Aber noch nie kam mir die Vorbereitung, die Recherche, das Studium der Quellen so spannend vor wie diesmal zu Giacomo Meyerbeers letzter grande opéra L’Africaine – Die Afrikanerin.
Stoßen wir doch hier zwischen 1820 und 1860 auf knapp ein halbes Jahrhundert aufregendster Opern- und Musikgeschichte mit Namen wie Gioacchino Rossini, Gaetano Donizetti, Vincenzo Bellini, Gaspare Spontini, Daniel Francois Esprit Auber, Hector Berlioz, Carl Maria von Weber, Felix Mendelssohn Bartholdy, Luis Spohr, Franz Liszt, vor allem Giuseppe Verdi, und, natürlich, Richard Wagner.
Der unbestrittene Mittelpunkt der Musikwelt ist Paris, als ferne Satelliten grüßen noch Mailand, Berlin, London, Wien und auch New York.
Die Opernwelt verändert sich in diesen Jahren rasant, nicht nur musikdramatisch, nicht nur in den Stoffen, den Kompositionstechniken, der Aufführungspraxis. Die Opernhäuser bekommen nicht nur eine neue kulturelle, sondern auch eine gesellschaftliche, politische und ökonomische Bedeutung. Das Aufkommen von Musikverlagen wie etwa Maurice Schlesinger in Paris, Ricordi in Mailand, Breitkopf & Härtel in Leipzig, Schott in Mainz, die neben den Operndirektoren eine systematische Komponistenentwicklung betreiben, um sie in den Hitlisten ganz oben zu platzieren, wie man heute sagen würde, und die für die weltweite Verbreitung der gedruckten Noten sorgen. Aber auch weit verbreitete Musikzeitschriften, in denen Musiker wie Robert Schumann, Hector Berlioz oder Richard Wagner Kritiken schreiben, bringen eine neue Akzeptanz der Musik. Vor allem hat sich das Publikum gewandelt, neben der Aristokratie der vorangegangenen Jahrhunderte tritt mehr und mehr – auch weil wohlhabend und gebildet – ein selbstbewusstes Bürgertum in Erscheinung. Die Eisenbahn bringt dazu eine ungeahnte Mobilität – gerade auch für Musiker, Komponisten, Dirigenten, Sänger.
*
Jetzt aber Meyerbeer und seine Afrikanerin
Jakob Liebmann Beer – eigentlich ist sein Leben relativ spannungsarm, einschließlich Kindheit und Jugend 25 Jahre Berlin, etwas Darmstadt, etwas Wien, 10 Jahre Italien, 33 Jahre Paris. Im Vergleich dazu ist das Leben Richard Wagners ein Wanderzirkus.
Jakob wurde als ältester von drei Söhnen am 5. September 1791 in Tasdorf, einige Biographien nennen das 3 km benachbarte Vogelsdorf, südöstlich von Berlin geboren.
Sein Vater war Zuckerfabrikant, seine Mutter stammte aus einer Berliner Kaufmanns- und Bankiersfamilie, ihr Vater war u.a. Direktor der Preußischen Lotterie. Sein Bruder Michael wurde ein bekannter deutscher Theaterschriftsteller, sein zweiter Bruder Wilhelm wurde Kaufmann und Hobbyastronom, der u.a. 1820 die erste Landkarte des Mondes publizierte. Endlich also einmal ein Musiker, der nicht einer Musikerfamilie entstammte oder unter ärmlichen Verhältnissen aufwuchs. Jakob lernte Klavier spielen und gab mit 9 Jahren seine ersten öffentlichen Konzerte. Sein Lehrer war u.a. Muzio Clementi; (die Klavierspieler unter Ihnen werden sich noch an seine Fingerübungen erinnern). Außerdem unterrichtete ihn Karl Friedrich Zelter, der in Musikdingen Vertraute Goethes.
Als hoffnungsvoller Sprössling einer begüterten Familie ging man damals nach Darmstadt, um beim renommierten Abbé Vogler Komposition und Kontrapunkt zu studieren; er lernte dort auch Carl Maria von Weber kennen. Weber war gerade 21 Jahre alt, als am 23. Dezember 1812 seine erste Oper Jepthas Gelübde am Münchner Hoftheater aufgeführt wurde, leider mit mäßigem Erfolg. Er schrieb dennoch weitere Opern zu seinem Ruhm, Oratorien und andere Musikstücke, wie später immer wieder, sogar eine Festouvertüre zur Eröffnung der Weltausstellung in London 1860.





























