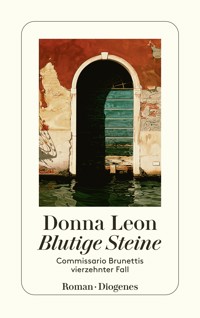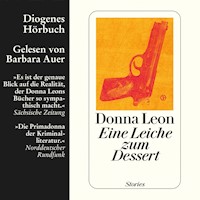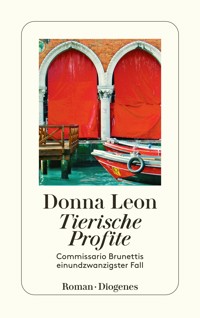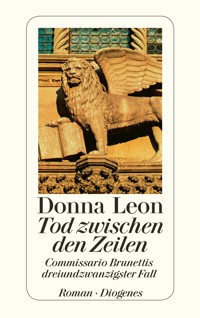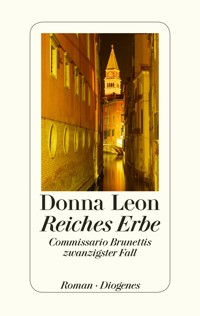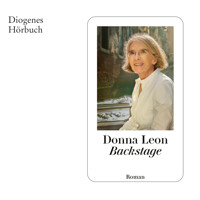11,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Commissario Brunetti
- Sprache: Deutsch
Skandal in Venedigs Opernhaus ›La Fenice‹: In der Pause vor dem letzten Akt der ›Traviata‹ wird der deutsche Stardirigent Helmut Wellauer tot aufgefunden. In seiner Garderobe riecht es nach Bittermandel – Zyankali. Ein großer Verlust für die Musikwelt und ein heikler Fall für Commissario Guido Brunetti. Und es scheint, als ob einige Leute allen Grund gehabt hätten, den Maestro unter die Erde zu bringen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 362
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Donna Leon
Venezianisches Finale
Commissario Brunettis erster Fall
Roman Aus dem Amerikanischen von
Titel der 1992 bei HarperCollins Publishers, New York,
erschienenen Originalausgabe: ›Death at La Fenice‹
Copyright ©1992 by Donna Leon
Die deutsche Erstausgabe erschien 1993 im Diogenes Verlag
Covermotiv: Foto von Fulvio Roiter
Copyright ©Fulvio Roiter
Für meine Mutter
All rights reserved
Alle Rechte vorbehalten
Copyright ©2017
Diogenes Verlag AG Zürich
www.diogenes.ch
ISBN Buchausgabe 978 3 257 22780 2 (57. Auflage)
ISBN E-Book 978 3 257 60060 5
Die grauen Zahlen im Text entsprechen den Seitenzahlen der im Impressum genannten Buchausgabe.
Ah, signor, son rea di morte E la morte io sol vi chiedo; Il mio fallo tardi vedo; Con quel ferro un sen ferite Che non merita pietà!
Ach, Herr, ich hab’ den Tod verdient, Und ich bitte Euch nur um den Tod; Ich erkenne spät mein Vergehen; Stoßt dieses Schwert in mein Herz,
[7] 1
Der dritte Gong tönte diskret durch die Foyers und Bars des Teatro La Fenice und rief zum letzten Akt der Oper. Zigaretten wurden ausgedrückt, Gläser leer getrunken, Gespräche beendet, und langsam drängte das Publikum zurück ins Theater. Der zwischen den Akten hellerleuchtete Saal war erfüllt von gedämpftem Stimmengewirr. Hier blitzte ein Diamant, dort wurde auf nackter Schulter ein Nerzcape zurechtgerückt, da ein unsichtbares Stäubchen von einem Satinrevers geschnipst. Zuerst füllten sich die Ränge, dann das Parkett, zuletzt die drei Reihen der Logen.
Langsam verloschen die Lichter, bis es ganz dunkel war im Saal, und es breitete sich jene erwartungsvolle Spannung aus, die ein Opernhaus erfüllt, kurz bevor die Vorstellung weitergehen soll und der Dirigent auf sein Podium zurückkehrt. Das Stimmengesumm ebbte allmählich ab, die Orchestermusiker rutschten nicht länger auf ihren Stühlen herum, und die allgemeine Stille verkündete, daß man bereit war für den dritten Akt.
Die Stille dehnte sich, wurde schwer. Aus dem ersten Rang hörte man plötzlich ein Husten, jemand ließ ein Buch oder eine Handtasche fallen, doch die Tür zum Korridor hinter dem Orchestergraben blieb zu.
Die Orchestermusiker waren die ersten, die leise zu reden anfingen. Ein zweiter Geiger lehnte sich zu der Frau neben ihm hinüber und erkundigte sich, wo sie dieses Jahr ihren Urlaub verbringen wolle. In der zweiten Reihe [8] informierte eine Fagottistin ihre Nachbarin, daß bei Benetton morgen der Schlußverkauf beginne. Die Leute in den Seitenlogen schlossen sich dem Getuschel der Musiker als erste an, denn sie konnten direkt in den Orchestergraben sehen und sich ein Beispiel nehmen. Die Ränge zogen nach, dann die ersten Parkettreihen, als wollten die Reichen sich als letzte von solchem Benehmen anstecken lassen.
Das Summen steigerte sich zum Gemurmel. Minuten verstrichen. Plötzlich wurden die Falten des steifen grünen Samtvorhanges energisch auseinandergeschlagen, und Amadeo Fasini, der Intendant des Theaters, trat etwas linkisch durch den schmalen Spalt. Der Beleuchter an seinem Schaltpult über dem zweiten Rang hatte keine Ahnung, was los war, und entschied sich endlich dafür, einen grellen weißen Kreis auf die Gestalt auf der Bühne zu richten. Geblendet hob Fasini den Arm vors Gesicht, und so, den Arm wie zur Abwehr eines Schlages erhoben, begann er zu sprechen: »Meine Damen und Herren –« Er hielt inne und gestikulierte wild mit der Linken zu dem Beleuchter, der seinen Irrtum bemerkte und den Scheinwerfer wieder ausschaltete. Fasini, von seiner vorübergehenden Blindheit erlöst, fing noch einmal an: »Meine Damen und Herren, leider muß ich Ihnen mitteilen, daß Maestro Wellauer die Vorstellung nicht zu Ende leiten kann.« Fragendes Geraune drang ihm aus dem Publikum entgegen, Köpfe wandten sich unter Seidengeraschel, aber er sprach weiter. »Maestro Longhi wird seinen Platz am Pult einnehmen.« Und schnell, ehe das Raunen so laut werden konnte, daß seine Worte darin untergingen, fragte er mit betont ruhiger Stimme: »Ist ein Arzt im Saal?«
[9] Lange Stille; dann begannen die Leute sich umzusehen, ob jemand sich melden würde. Fast eine Minute verging. Endlich hob vorn im Parkett zögernd jemand die Hand, und eine Frau stand langsam von ihrem Platz auf. »Dottoressa, könnten Sie bitte hinter die Bühne kommen?« Fasini winkte einem der uniformierten Platzanweiser im Hintergrund, und der junge Mann eilte ans Ende der Reihe, wo die Ärztin nun stand. »Wenn Sie so freundlich wären«, sagte Fasini, wobei er einen so schmerzlichen Unterton in seine Stimme legte, als brauchte er selbst den ärztlichen Beistand, »und dem Platzanweiser folgen würden…«
Er warf einen Blick in den hufeisenförmigen, immer noch abgedunkelten Saal, versuchte zu lächeln, erfolglos, und gab es auf. »Bitte entschuldigen Sie die kleine Verzögerung, meine Damen und Herren. Die Vorstellung geht jetzt weiter.«
Er drehte sich um, kämpfte mit den Vorhangfalten und fand die Öffnung nicht mehr. Unsichtbare Hände teilten endlich von hinten den Vorhang für ihn, er schlüpfte hindurch und stand mitten in der kargen Mansarde, wo gleich Violetta sterben sollte. Aus dem Saal hörte er den verhaltenen Applaus, der den neuen Dirigenten begrüßte.
Von allen Seiten bedrängten die Sänger, Chormitglieder und Bühnenarbeiter ihn jetzt ebenso neugierig, aber viel stimmgewaltiger als zuvor das Publikum. Sonst schützte seine Stellung ihn vor Kontakten mit solch minderen Mitgliedern des Ensembles, hier aber konnte er ihnen nicht entgehen, ihren Fragen, ihrem Flüstern. »Es ist nichts weiter«, sagte er zu niemand Bestimmtem und wedelte mit den Armen, um sie von der Bühne zu treiben, auf der sie sich [10] zusammendrängten. Draußen ging das Vorspiel zum dritten Akt seinem Ende entgegen; gleich würde der Vorhang aufgehen und den Blick auf die Violetta des heutigen Abends freigeben, die nervös auf dem Bett in der Bühnenmitte saß. Fasini verdoppelte die Heftigkeit seiner Gebärden, und sie zogen sich langsam zurück, um aber in den Seitenkulissen stehenzubleiben und dort weiterzutuscheln. Er fauchte ein wütendes »Silenzio« und wartete die Wirkung ab. Als er sah, daß sie still wurden und der Vorhang langsam die Bühne freigab, ging er rasch nach rechts zum Inspizienten, neben dem jetzt die Ärztin stand, eine kleine, dunkelhaarige Frau. Unmittelbar unter dem Schild »Rauchen verboten« hielt sie eine nicht angezündete Zigarette in der Hand.
»Guten Abend, Dottoressa«, sagte er mit einem gezwungenen Lächeln. Sie ließ die Zigarette in ihre Jackentasche gleiten und gab ihm die Hand. Falls sie sich wunderte, wie wenig eilig er es auf einmal hatte, so ließ sie es sich jedenfalls nicht anmerken.
»Worum geht es?« fragte sie schließlich, während Violetta hinter ihnen Germonts Brief zu lesen begann.
Fasini rieb sich, bevor er antwortete, energisch die Hände, als könnte ihm dies bei der Suche nach dem richtigen Wort helfen. »Maestro Wellauer ist…«, begann er, wußte dann aber nicht, wie er den Satz passend beenden sollte.
»Ist er krank?« fragte die Ärztin mit kaum verhohlenem Unmut über sein Verhalten.
»Nein, nein, krank ist er nicht«, erwiderte Fasini, und wieder fehlten ihm die Worte. Er rieb sich erneut die Hände.
[11] »Ich sollte vielleicht besser zu ihm gehen«, sagte sie, ließ es aber wie eine Frage klingen. »Ist er hier im Theater?«
Und als Fasini stumm blieb, fragte sie: »Hat man ihn irgendwohin gebracht?«
Da fand Fasini seine Sprache wieder. »Nein, nein. Er ist in der Garderobe.«
»Sollten wir dann nicht hingehen?«
»Ja, natürlich, Dottoressa«, stimmte er zu und schien dankbar für den Vorschlag. Er führte sie nach rechts, vorbei an einem Flügel und einer Harfe, die mit einem mattgrünen Tuch abgedeckt war, in einen schmalen Gang. An dessen Ende blieb er vor der Tür zur Garderobe des Dirigenten stehen. Die Tür war geschlossen, und davor stand ein großer Mann.
»Matteo«, sagte Fasini, »der Hilfsinspizient…«, und wandte sich dann höflich der Ärztin zu. »Das ist Dottoressa…«
»Zorzi«, sagte sie knapp. Es schien kaum der rechte Moment für förmliche Vorstellungen zu sein.
Bei der Ankunft seines Vorgesetzten und dieser Frau, die offenbar eine Ärztin war, trat der Hilfsinspizient nur allzugern beiseite. Fasini ging an ihm vorbei, stieß die Tür ein Stück weit auf, blickte über die Schulter und trat zur Seite, um die Ärztin an sich vorbei in das kleine Zimmer zu lassen.
Der Tod hatte die Züge des Mannes verzerrt, der in dem Sessel mitten im Zimmer lag. Seine Augen waren starr ins Leere gerichtet und die Lippen zu einer häßlichen Grimasse verzogen. Der Körper hing schwer zur einen Seite, der Kopf war gegen den Sesselrücken gepreßt. Auf der gestärkten, blendendweißen Hemdbrust waren Spritzer einer [12] dunklen Flüssigkeit. Einen Augenblick dachte die Ärztin, es sei Blut. Sie trat näher und roch mehr, als daß sie es sah, den Kaffee. Der andere Geruch, der sich mit dem des Kaffees vermischte, war ebenso eindeutig. Es war der durchdringende, säuerliche Geruch nach bitteren Mandeln, über den sie bislang nur gelesen hatte.
Sie hatte so oft mit dem Tod zu tun gehabt, daß sie nicht erst nach dem Puls des Mannes tasten mußte, dennoch legte sie die Finger ihrer rechten Hand unter sein hochgerecktes Kinn. Nichts, aber die Haut war noch warm. Sie trat zurück und sah sich um. Vor ihm auf dem Boden lagen die Untertasse und die kleine Tasse, worin der Kaffee gewesen war, der ihm auf die Hemdbrust gespritzt war. Sie hockte sich hin und berührte mit der Rückseite ihrer Finger die Tasse, doch die fühlte sich kalt an.
Dann erhob sie sich wieder und wandte sich an die beiden Männer, die noch immer an der Tür standen und die Beschäftigung mit dem Tod gern ihr zu überlassen schienen. »Haben Sie schon die Polizei verständigt?« fragte sie.
»Ja, ja«, murmelte Fasini, als habe er die Frage gar nicht aufgenommen.
»Signore«, sagte sie, nun mit klarer lauter Stimme, damit er sie auch richtig verstand. »Ich kann hier nichts machen. Das ist eine Angelegenheit für die Polizei. Ist sie schon benachrichtigt?«
»Ja«, wiederholte Fasini, ließ aber noch immer nicht erkennen, daß er sie gehört oder verstanden hatte. Er starrte auf den Toten hinunter und versuchte zu begreifen, welchen Schrecken und Skandal das bedeutete, was er da sah.
Abrupt drängte die Ärztin sich an ihm vorbei in den [13]
[14] 2
Da man hier in Venedig war, kam die Polizei mit dem Boot, das Blaulicht blitzte auf dem vorderen Kabinendach. Das Boot legte in einem kleinen Seitenkanal hinter dem Theater an, und vier Männer sprangen heraus, drei in blauer Uniform und einer in Zivil. Rasch gingen sie die enge Gasse am Theater entlang zum Bühneneingang, wo der Portier, der über ihre Ankunft informiert war, mit einem Knopfdruck das Drehkreuz freigab, das ihnen Zugang zum hinteren Teil des Theaters verschaffte. Schweigend deutete er auf eine Treppe.
Oben empfing sie der noch immer wie betäubt wirkende Fasini. Er streckte schon die Hand aus, um den Mann in Zivil zu begrüßen, der offenbar das Kommando führte, vergaß es aber dann wieder, drehte sich rasch um, murmelte: »Hier entlang« und ging durch den schmalen Korridor voraus. An der Garderobentür hielt er inne und deutete wortlos nach drinnen.
Guido Brunetti, ein Commissario aus der Questura, trat als erster ein. Als er den leblosen Körper im Sessel sah, hob er die Hand und bedeutete den Uniformierten zurückzubleiben. Der Mann im Sessel war eindeutig tot. Nach einem Lebenszeichen mußte man an diesem verkrampft nach hinten gereckten Körper mit den grausig verzerrten Gesichtszügen nicht mehr suchen.
Das Gesicht des Toten war Brunetti so vertraut wie den meisten Menschen der westlichen Welt. Auch wer diesen [15] Mann nie selbst am Pult gesehen hatte, kannte sein Gesicht mit dem gemeißelten germanischen Kinn und dem etwas zu langen, auch mit über sechzig noch rabenschwarzen Haar seit vier Jahrzehnten von den Titelseiten der Zeitschriften und Zeitungen. Brunetti hatte ihn vor Jahren zweimal dirigieren sehen und dabei statt des Orchesters fasziniert den Dirigenten beobachtet. Wie von einem Dämon besessen – oder einer Gottheit – zuckte Wellauers Körper über dem Pult hin und her, die Linke halb zur Faust geballt, als wollte er den Violinen die Töne entreißen, während die Rechte den Stab gleich einer Waffe hier und dort niedersausen ließ; ein Donnerkeil, der Wogen von Klängen auslöste. Doch jetzt, im Tod, hatte alles Göttliche ihn verlassen, und nur die boshafte Maske des Dämons war geblieben.
Brunetti wandte den Blick ab und sah sich im Zimmer um. Da lag die Tasse auf dem Boden und nicht weit davon die Untertasse. Daraus ließen sich die dunklen Flecken auf dem Hemd und wahrscheinlich auch das gräßlich verzerrte Gesicht erklären.
Reglos blieb Brunetti stehen, immer noch nicht weiter im Zimmer, ließ den Blick umherwandern und registrierte jedes Detail, unsicher noch, was sich daraus ergeben würde, neugierig. Er war ein überraschend gepflegter Mann: Seine Krawatte war sorgfältig gebunden, das Haar kürzer als derzeit Mode, und selbst seine Ohren lagen eng am Kopf, als wollten sie nur ja nicht auffallen. Die Kleidung wies ihn eindeutig als Italiener aus. Der Akzent war unverkennbar venezianisch. Sein Blick war ganz der eines Polizeibeamten.
Er streckte die Hand aus und berührte das Handgelenk des Toten, aber der Körper war kalt, die Haut fühlte sich [16] trocken an. Mit einem letzten prüfenden Blick drehte er sich um und wandte sich einem der Männer zu, die hinter ihm standen. Er wies ihn an, den Polizeiarzt und den Fotografen zu rufen. Den zweiten Beamten schickte er nach unten zum Portier, um herauszufinden, wer heute abend alles hinter der Bühne war, und eine Liste mit den Namen zusammenzustellen. Dem dritten trug er auf, zu erkunden, wer heute vor der Vorstellung oder während der Pausen mit dem Maestro gesprochen hatte.
Dann öffnete er die Tür zu seiner Linken. Sie führte in ein kleines Bad. Das einzige Fenster war geschlossen, wie auch das in der Garderobe. Im Schrank hingen ein dunkler Mantel und drei weiße, gestärkte Hemden.
Brunetti ging zurück in den Garderobenraum und trat zu der Leiche. Mit der Rückseite seiner Finger hielt er das Revers des Toten hoch und griff in die Brusttasche des Jacketts. Er fand ein Taschentuch, das er vorsichtig an einer Ecke herauszog. Sonst war die Tasche leer. Auf dieselbe Weise verfuhr er mit den Seitentaschen, aus denen er die üblichen Dinge zutage förderte: ein paar tausend Lire in kleinen Scheinen, einen Schlüssel mit Plastikanhänger, wahrscheinlich für dieses Zimmer, einen Kamm und noch ein Taschentuch. Er wollte möglichst wenig an dem Toten herumhantieren, bevor er fotografiert war, so verschob er die Untersuchung der Hosentaschen auf später.
Die drei Polizisten, zufrieden, daß ein Opfer festgestellt werden konnte, waren gegangen, um Brunettis Anweisungen auszuführen. Der Intendant des Theaters war nirgends zu sehen. Brunetti trat in den Korridor, wo er ihn zu finden hoffte und fragen wollte, wann man die Leiche entdeckt [17] hatte. Statt dessen fand er eine kleine, dunkelhaarige Frau, die rauchend an der Wand lehnte. Hinter ihnen brausten Wogen volltönender Musik.
»Was ist denn das?« fragte Brunetti.
»La Traviata«, antwortete die Frau schlicht.
»Das weiß ich«, sagte er. »Heißt das, man hat die Vorstellung nicht abgebrochen?«
»›Selbst wenn die Welt in Trümmer fällt…‹«, antwortete sie mit der übertriebenen Betonung und Emphase, die man sich für Zitate vorbehält.
»Ist das aus La Traviata?« wollte er wissen.
»Nein, aus Turandot«, entgegnete sie ruhig.
»Ja, aber trotzdem«, meinte er, »schon aus Respekt vor dem Mann.«
Sie zuckte die Achseln, ließ ihre Zigarette auf den Zementboden fallen und trat sie aus.
»Und Sie sind…?« fragte er schließlich.
»Barbara Zorzi«, antwortete sie und ergänzte, obwohl er nicht gefragt hatte: »Dottoressa Barbara Zorzi. Ich war im Theater, als ein Arzt gesucht wurde, also bin ich hinter die Bühne gegangen und habe ihn gefunden. Genau um 10 Uhr 35. Sein Körper war noch warm, so daß er nach meiner Schätzung noch keine halbe Stunde tot gewesen sein kann. Die Kaffeetasse auf dem Fußboden war kalt.«
»Sie haben sie berührt?«
»Nur mit der Außenseite der Finger. Ich dachte, es könnte wichtig sein zu wissen, ob sie noch warm war. Sie war es nicht.« Sie holte eine Schachtel Zigaretten aus der Tasche, bot ihm eine an, schien nicht erstaunt, als er ablehnte, und zündete sich ihre selbst an.
[18] »Sonst noch etwas, Dottoressa?«
»Es riecht wie Zyankali«, meinte sie. »Ich habe darüber gelesen und auch einmal damit gearbeitet, in Pharmakologie. Der Professor wollte uns nicht daran riechen lassen, weil selbst die Dämpfe gefährlich seien.«
»Ist es wirklich so giftig?« fragte er.
»Ja. Ich habe zwar vergessen, welche Dosis einen Menschen töten kann, aber es ist wesentlich weniger als ein Gramm. Und es wirkt sofort. Alles hört einfach auf – Herz, Lunge, alles. Er war tot, oder zumindest bewußtlos, bevor die Tasse auf den Boden schlug.«
»Kannten Sie ihn?« fragte Brunetti.
Sie schüttelte den Kopf. »Nicht besser als jeder andere, der Opern liebt. Oder Gente liest«, fügte sie hinzu und nannte damit ein Klatschmagazin, von dem er sich nur schwer vorstellen konnte, daß sie es las.
Sie sah zu ihm auf und fragte: »Wär’s das?«
»Ja, Dottoressa, ich denke schon. Wenn Sie einem meiner Leute noch Ihre Adresse geben würden, damit wir Sie, falls nötig, erreichen können.«
»Zorzi, Barbara«, sagte sie, nicht im geringsten beeindruckt von seinem förmlichen Gehabe. »Ich bin die einzige im Telefonbuch.«
Sie warf die Zigarette auf den Boden und trat sie aus, dann streckte sie ihm die Hand hin. »Also dann, Wiedersehen. Ich hoffe, diese Sache wird nicht allzu unschön.« Er wußte nicht, ob sie meinte, für den Maestro, das Theater, die Stadt oder ihn selbst, und so nickte er bloß als Dank und schüttelte ihr die Hand. Als sie ging, kam Brunetti der Gedanke, wie merkwürdig seine eigene Arbeit der ihren glich. Sie [19] trafen sich über Leichen und fragten beide »Warum?«. Aber wenn die Antwort auf diese Frage gefunden war, trennten sich ihre Wege, als Ärztin ging sie in der Zeit zurück, um den physischen Auslöser zu finden, und er ging vorwärts, um den Verantwortlichen zu finden.
Eine Viertelstunde später kam der Polizeiarzt zusammen mit dem Fotografen und zwei Sanitätern in weißen Jacken, die später die Leiche ins Bürgerspital bringen sollten. Brunetti begrüßte Dr. Rizzardi herzlich und gab weiter, was Dr. Zorzi ihm über den Zeitpunkt des Todes gesagt hatte. Zusammen gingen sie in die Garderobe des Maestro. Rizzardi, ein anspruchsvoll gekleideter Mann, streifte sich Gummihandschuhe über, warf automatisch einen Blick auf seine Armbanduhr und hockte sich neben die Leiche. Brunetti sah zu, wie er den Körper untersuchte, und war seltsam berührt, als er sah, wie Rizzardi den Toten mit dem gleichen Respekt behandelte, den er einem lebenden Patienten erweisen würde, ihn behutsam anfaßte, vorsichtig umdrehte und notfalls dem erstarrenden Fleisch mit erfahrenen und doch sanften Händen nachhalf.
»Könnten Sie ihm die Sachen aus den Taschen nehmen, Dottore?« fragte Brunetti, der keine Handschuhe bei sich hatte und mit seinen Fingerabdrücken nicht eventuelle Spuren verwischen wollte. Der Doktor kam der Bitte nach, fand aber nur eine dünne Brieftasche, Alligator vielleicht, die er an einer Ecke herauszog und neben sich auf den Tisch legte.
Er stand auf und zog sich die Handschuhe aus. »Gift. Eindeutig. Ich würde sagen, es war Zyankali. Ja, ich bin eigentlich ganz sicher, allerdings ist das vor der Autopsie [20] noch nicht offiziell. Aber so wie sein Körper nach hinten gebogen war, kann es nichts anderes sein.« Brunetti sah, daß der Doktor dem Toten die Augen zugedrückt hatte und nun versuchte, die verzerrten Mundwinkel zu glätten. »Es ist Wellauer, nicht?« fragte der Doktor, obwohl die Frage kaum nötig war.
Als Brunetti nickte, rief Rizzardi: »Maria Vergine, der Bürgermeister wird nicht begeistert sein, ganz und gar nicht.«
»Dann soll der Bürgermeister doch den Täter suchen«, schnauzte Brunetti.
»Ja, dumm von mir. Tut mir leid, Guido. Wir sollten lieber an die Familie denken.«
Wie aufs Stichwort kam einer der drei Uniformierten an die Tür und winkte Brunetti heraus. Draußen stand Fasini neben einer hochgewachsenen jungen Frau, die er für die Tochter des Maestro hielt. Sie war sehr groß, größer als der Intendant, ja sogar größer als Brunetti, und ihr hochgestecktes, blondes Haar verstärkte den Eindruck noch. Ihre Wangenknochen hatten, wie die des Maestro, etwas Slawisches, und die Farbe ihrer Augen konnte man schon beinah als Eisblau bezeichnen.
Als sie Brunetti herauskommen sah, trat sie mit zwei raschen Schritten auf ihn zu. »Was ist passiert?« fragte sie auf italienisch mit starkem ausländischem Akzent. »Was ist passiert?«
»Es tut mir sehr leid, Signorina«, fing er an.
Sie hörte gar nicht hin, sondern unterbrach ihn energisch. »Was ist mit meinem Mann?«
Trotz aller Überraschung hatte Brunetti doch die [21] Geistesgegenwart, mit einem Schritt nach rechts den Eingang zur Garderobe zu versperren. »Signora, es tut mir leid, aber es wäre besser, wenn Sie nicht hineingehen.« Warum wußten sie nur immer schon, was man ihnen sagen mußte? War es der Tonfall, oder gab es so etwas wie einen animalischen Instinkt, der sie den Tod aus der Stimme desjenigen heraushören ließ, der die Nachricht überbrachte?
Die Frau kippte zur Seite, als hätte man ihr einen Schlag versetzt. Sie stieß mit der Hüfte auf die Tasten des Flügels, und eine Dissonanz hallte durch den Korridor. Sie stützte sich mit einer Hand auf der Klaviatur ab und produzierte weitere unkoordinierte Töne. Dann sagte sie etwas in einer Sprache, die Brunetti nicht verstand, und hob die Hand in einer Geste vor den Mund, die so melodramatisch wirkte, daß sie nicht gespielt sein konnte.
In dem Augenblick schien es Brunetti, als habe er sein ganzes Leben damit verbracht, Menschen dies anzutun, ihnen zu sagen, daß ein geliebter Mensch tot war, oder schlimmer, umgebracht worden war. Sein Bruder Sergio war Röntgentechniker und mußte eine kleine Karte aus Metall am Revers tragen, die sich verfärbte, wenn sie gefährlichen Strahlenmengen ausgesetzt war. Hätte er etwas Ähnliches an sich gehabt, das auf Schmerz, Trauer oder Tod reagierte, die Farbe hätte sich schon längst verändert.
Sie öffnete die Augen und sah ihn an. »Ich möchte ihn sehen.«
»Ich glaube, es wäre besser, wenn Sie es nicht täten«, antwortete er, wohl wissend, daß es stimmte.
»Was ist passiert?« Sie bemühte sich, ruhig zu bleiben, und es gelang ihr.
[22] »Ich glaube, es war Gift«, sagte er, obwohl er es genau wußte.
»Jemand hat ihn umgebracht?« fragte sie, und ihr Erstaunen schien echt zu sein. Oder einstudiert.
»Entschuldigen Sie, Signora, aber ich kann Ihnen im Moment keine Antworten geben. Ist jemand hier, der Sie nach Hause bringen kann?« Hinter sich hörten sie plötzlich Beifall losbrechen, dem dann Welle auf Welle folgte. Ihr war nicht anzumerken, ob sie es hörte oder ob sie seine Frage gehört hatte, sie starrte ihn nur an und bewegte lautlos die Lippen.
»Ist jemand hier im Theater, der Sie nach Hause bringen kann, Signora?«
Sie nickte, hatte ihn endlich verstanden. »Ja, ja«, sagte sie, und dann mit etwas sanfterer Stimme: »Ich muß mich hinsetzen.« Er war schon vorbereitet auf den plötzlichen Realitätsschub, der auf den ersten Schock folgt. Der war es, der die Leute umwarf.
Er schob seinen Arm unter ihren und führte sie in den offenen Bereich hinter der Bühne. Sie war zwar groß, dabei aber so schmal, daß ihr Gewicht leicht zu stützen war. Der einzige geeignete Platz war eine kleine Nische linker Hand, voller Schaltbretter und anderer Utensilien, die ihm nichts sagten. Er half ihr auf den Stuhl davor und winkte einem seiner uniformierten Polizisten, der gerade aus den Kulissen kam, wo es jetzt von kostümierten Mitwirkenden wimmelte, die sich verbeugten und, sobald der Vorhang geschlossen war, wieder zu Gruppen zusammenfanden.
»Gehen Sie in die Bar runter, und holen Sie ein Glas Cognac und ein Glas Wasser«, wies er den Polizisten an.
[23] Signora Wellauer saß indessen auf dem einfachen Holzstuhl mit der geraden Lehne, ihre Hände umklammerten den Sitz rechts und links, und sie starrte auf den Boden. Sie schüttelte den Kopf, verneinend oder als Antwort auf ein inneres Gespräch.
»Signora –, Signora, sind Ihre Freunde hier im Theater?«
Sie beachtete ihn nicht und setzte ihr inneres Gespräch fort.
»Signora«, wiederholte er und legte ihr diesmal dabei die Hand auf die Schulter. »Ihre Freunde, sind sie hier?«
»Welti«, sagte sie, ohne aufzusehen. »Wir haben uns nach der Vorstellung hinter der Bühne verabredet.«
Der Polizist kam mit zwei Gläsern zurück. Brunetti nahm das kleinere und gab es ihr. »Trinken Sie das, Signora«, sagte er. Sie trank abwesend zuerst den Cognac und anschließend das Wasser, als sei kein Unterschied zwischen beidem.
Brunetti stellte die Gläser beiseite.
»Wann haben Sie ihn gesehen, Signora?«
»Wie bitte?«
»Wann Sie ihn gesehen haben.«
»Helmut?«
»Ja, Signora. Wann haben Sie ihn gesehen?«
»Wir sind zusammen hergekommen. Heute abend. Dann bin ich nach dem…« Ihre Stimme verebbte.
»Was, Signora?« fragte er.
Sie betrachtete einen Augenblick sein Gesicht, bevor sie weitersprach. »Nach dem zweiten Akt bin ich zu ihm gegangen. Aber wir haben nicht miteinander gesprochen. Ich kam zu spät. Er sagte nur – nein, er hat gar nichts gesagt.«
[24] Brunetti war nicht sicher, ob ihre Verwirrung dem Schock oder den Schwierigkeiten mit der Sprache zuzuschreiben war, aber ihm war klar, daß sie im Moment keine weiteren Fragen beantworten konnte.
Hinter ihnen brach eine neue Welle von Applaus los, die anschwoll und abebbte, während die Sänger ihre Vorhänge absolvierten. Die Frau vor ihm senkte erneut den Kopf, obwohl sie ihr inneres Gespräch offenbar abgeschlossen hatte.
Er wies den Polizisten an, bei ihr zu bleiben, bis ihre Freunde da wären, und fügte hinzu, danach könne sie mit ihnen das Theater verlassen.
Brunetti verabschiedete sich und ging zurück in die Garderobe des Maestro, wo der Arzt und der Fotograf gerade im Begriff waren zu gehen.
»Gibt es noch etwas?« wollte Rizzardi wissen, als er Brunetti hereinkommen sah.
»Nein. Wann ist die Autopsie?«
»Morgen.«
»Machen Sie die?«
Rizzardi überlegte kurz, bevor er antwortete. »Ich habe keinen Dienst, aber da ich die Leiche untersucht habe, wird der Staatsanwalt mich wahrscheinlich darum bitten.«
»Wann?«
»Gegen elf. Am frühen Nachmittag bin ich dann wohl fertig.«
»Ich komme raus«, sagte Brunetti.
»Das ist nicht nötig, Guido. Sie müssen nicht extra nach San Michele rauskommen. Sie können anrufen, oder ich rufe bei Ihnen im Büro an.«
»Danke, Ettore, aber ich möchte kommen. Ich war schon [25] lange nicht mehr draußen. Ich würde bei der Gelegenheit gern das Grab meines Vaters besuchen.«
»Gut, wie Sie wollen«, meinte Rizzardi. Sie gaben sich die Hand, und Rizzardi wandte sich zum Gehen. An der Tür blieb er stehen und fügte noch hinzu: »Er war der letzte der ganz Großen, Guido. Diesen Tod hat er nicht verdient. Tut mir leid, daß dies passieren mußte, Guido.«
»Mir auch, Ettore, mir auch.«
Der Doktor ging, und der Fotograf folgte ihm. Sobald sie draußen waren, drehte sich einer der beiden Sanitäter, die bisher rauchend am Fenster gestanden und die Passanten in der Gasse unten beobachtet hatten, um und machte ein paar Schritte zu der Trage hin, auf der die Leiche lag.
»Können wir ihn jetzt wegbringen?« fragte er gleichgültig.
»Nein«, entgegnete Brunetti. »Warten Sie, bis alle Leute das Theater verlassen haben.«
Der andere, der am Fenster stehengeblieben war, warf seine Zigarette hinaus und stellte sich ans andere Ende der Trage. »Das wird aber ’ne ganze Weile dauern, oder?« meinte er mit unverhohlenem Mißmut. Er war klein und vierschrötig, und sein Akzent war ziemlich eindeutig neapolitanisch.
»Ich weiß nicht, wie lange es dauert, aber warten Sie, bis das Theater leer ist.«
Der zweite Sanitäter schob den Ärmel seiner weißen Jacke zurück und sah betont auf die Uhr. »Also, unser Dienst endet um Mitternacht, und wenn wir noch lange warten, kommen wir erst viel später ins Spital zurück.«
Der erste stimmte mit ein. »Nach den Bestimmungen [26] unserer Gewerkschaft müssen Überstunden vierundzwanzig Stunden vorher angekündigt werden. Ich weiß nicht, was wir in so einem Fall machen sollen«, fügte er hinzu und deutete dabei mit der Schuhspitze auf die Trage, als sei sie ein Ding, das er auf der Straße gefunden hatte.
Einen Moment war Brunetti versucht, vernünftig mit ihnen zu reden, aber nicht lange. »Ihr beide bleibt hier und macht diese Tür nicht auf, bevor ich es sage.« Als keine Antwort kam, fragte er: »Verstanden? Beide?« Noch immer keine Antwort. »Verstehen Sie mich?« wiederholte er.
»Aber die Gewerkschaft…«
»Zum Henker mit eurer Gewerkschaft und ihren Bestimmungen«, explodierte Brunetti. »Wenn ihr mit dieser Trage hier rausgeht, bevor ich es sage, sitzt ihr sofort im Knast, sowie ihr auf einen Gehweg spuckt oder öffentlich flucht. Ich will keinen Zirkus, wenn ihr ihn raustragt. Ihr müßt also schon warten, bis ich entscheide, daß es soweit ist.« Ohne noch einmal nachzufragen, ob sie ihn jetzt verstanden hatten, drehte Brunetti sich um und schlug die Tür hinter sich zu.
In dem offenen Bereich am Ende des Korridors herrschte Chaos. Mitglieder des Ensembles, zum Teil noch in ihren Kostümen, liefen ziellos durcheinander, und auch ohne zu hören, was sie sagten, merkte er an ihren aufgeregten Blicken zur Garderobentür hin, daß die Nachricht vom Tod sich herumgesprochen hatte. Er beobachtete, wie sie weiterverbreitet wurde, wie zwei die Köpfe zusammensteckten und dann einer sich abrupt drehte, um den Korridor hinunterzustieren, zu der Tür, hinter der sich verbarg, was sie nur ahnen konnten. Wollten sie die Leiche sehen? Oder [27] brauchten sie nur ein Gesprächsthema für morgen, an der Theke ihrer Bars?
Als er zu Signora Wellauer zurückkam, waren ein Mann und eine Frau bei ihr, beide erheblich älter als sie. Die Frau kniete neben ihr und hatte die Arme um die Witwe gelegt, die jetzt heftig schluchzte. Als er Brunetti sah, kam der Uniformierte zu ihm. »Ich habe doch gesagt, Sie können sie gehen lassen«, sagte Brunetti zu ihm.
»Soll ich mitgehen, Commissario?«
»Ja, tun Sie das. Wissen Sie, wo sie wohnt?«
»In der Nähe von San Moisè.«
»Gut, das ist ja nicht weit«, meinte Brunetti und fügte hinzu: »Sie sollen mit niemandem sprechen«, denn ihm fielen die Reporter ein, die inzwischen sicher Wind bekommen hatten. »Nehmen Sie nicht den Bühnenausgang. Vielleicht gibt es ja einen Weg durchs Theater.«
»Ja, Commissario«, antwortete der Mann und salutierte dabei so zackig, daß Brunetti wünschte, die Sanitäter hätten es sehen können.
»Commissario?« ertönte es plötzlich hinter ihm, und als er sich umdrehte, sah er Corporal Miotti auf sich zukommen, den jüngsten der drei Polizisten, die er mitgebracht hatte.
»Was ist, Miotti?«
»Ich habe eine Liste der Leute, die heute abend hier waren, Chor, Orchester, Bühnenpersonal, Sänger.«
»Wie viele sind es denn?«
»Über hundert, Commissario«, antwortete er seufzend, als wollte er sich für die vielen hundert Stunden Arbeit entschuldigen, die das bedeutete.
[28] »Na ja«, meinte Brunetti und tat es achselzuckend ab. »Gehen Sie mal zum Portier runter, und bringen Sie in Erfahrung, wie man durch diese Drehkreuze kommt. Und wie man sich ausweisen muß.« Der Caporale kritzelte in sein Notizbuch, während Brunetti weiterredete. »Wie kommt man sonst noch hier herein? Gibt es einen direkten Zugang vom Zuschauerraum aus nach hier hinten? Mit wem ist er heute abend gekommen, und wann? Ist während der Vorstellung jemand in seine Garderobe gegangen? Und der Kaffee, ist er von unten aus der Bar, oder wurde er von außerhalb gebracht?« Er hielt inne und dachte nach. »Und versuchen Sie herauszukriegen, ob er irgendwelche Nachrichten, Briefe oder Telefonate bekommen hat.«
»Ist das alles, Commissario?« fragte Miotti.
»Rufen Sie in der Questura an. Die sollen die deutsche Polizei benachrichtigen.« Und bevor Miotti noch etwas entgegnen konnte: »Sagen Sie denen, sie sollen diese Dolmetscherin für Deutsch holen lassen, wie hieß sie noch?«
»Boldacci, Commissario.«
»Genau. Die sollen sie holen, und sie soll bei der deutschen Polizei anrufen. Es ist mir egal, wie spät es ist. Sie soll ein vollständiges Dossier über Wellauer anfordern. Am liebsten hätte ich es gleich morgen früh, wenn es geht.«
»Ja, Commissario.«
Brunetti nickte. Der Caporale salutierte und stiefelte mit seinem Notizbuch in der Hand zur Treppe, die zum Bühneneingang hinunterführte.
»Und, Caporale«, rief Brunetti ihm hinterher.
»Ja, Commissario?«
»Seien Sie höflich.«
[29] Miotti nickte, drehte sich um und verschwand. Daß er so mit einem seiner Untergebenen reden konnte, ohne daß der gleich einschnappte, erinnerte Brunetti wieder daran, wie dankbar er war, nach fünf Jahren in Neapel wieder nach Venedig versetzt worden zu sein.
Obwohl seit dem letzten Vorhang schon mehr als zwanzig Minuten vergangen waren, machten die Leute auf der Bühne keine Anstalten zu gehen. Einige, die offenbar mehr praktischen Verstand hatten, gingen herum und sammelten Requisiten ein: Kostümteile, Gürtel, Spazierstöcke, Perücken. Direkt vor Brunetti kam einer vorbei, der offenbar ein totes Tier über dem Arm trug, aber als Brunetti genauer hinsah, waren es lauter Frauenperücken. Hinter dem Vorhang tauchte Follin auf, den Brunetti vorhin losgeschickt hatte, den Arzt zu rufen.
Er kam auf Brunetti zu und sagte: »Ich dachte, Sie wollen vielleicht mit den Sängern sprechen, Commissario. Da habe ich sie gebeten, oben zu warten. Und den Regisseur auch. Es schien ihnen nicht zu gefallen, aber ich habe erklärt, was passiert ist, und danach waren sie einverstanden. Gefallen hat es ihnen trotzdem nicht.«
Opernsänger, dachte Brunetti und wiederholte es noch einmal: Opernsänger. »Gute Arbeit, Follin. Wo sind sie?«
»Oben, hier die Treppe rauf.« Er deutete auf eine kurze Treppe, die zu den oberen Stockwerken des Theaters führte. Dann drückte er Brunetti ein Programmheft in die Hand. Der warf einen Blick darauf, erkannte ein oder zwei Namen und begann die Treppe hinaufzusteigen.
»Wer war am ungeduldigsten, Follin?« fragte Brunetti, als sie oben angelangt waren.
[30] »Die Sopranistin, Signora Petrelli«, antwortete Follin und deutete rechts den Korridor hinunter auf eine Tür ganz am Ende.
»Gut«, sagte Brunetti und wandte sich nach links. »Dann heben wir uns Signora Petrelli bis zum Schluß auf.« Follins Lächeln machte Brunetti neugierig, wie das Zusammentreffen zwischen der widerwilligen Primadonna und dem eifrigen jungen Polizisten wohl verlaufen sein mochte.
›Francesco Dardi – Giorgio Germont‹ stand auf der maschinengeschriebenen Karte an der ersten Garderobentür links. Brunetti klopfte zweimal, und die Antwort kam sofort: »Avanti!«
An dem kleinen Frisiertisch drinnen war der Bariton, dessen Namen Brunetti erkannt hatte, damit beschäftigt, sein Make-up zu entfernen. Dardi war ein kleiner Mann, der seinen üppigen Bauch gegen die Tischkante preßte, um sich besser im Spiegel sehen zu können. »Entschuldigen Sie, meine Herren, wenn ich nicht aufstehe, um Sie zu begrüßen«, sagte er, während er sorgsam schwarzes Make-up unter seinem rechten Auge wegwischte.
Brunetti nickte, sagte aber nichts.
Kurz darauf wandte Dardi sich vom Spiegel ab und blickte zu den beiden Männern auf. »Nun?« fragte er und kehrte zu seinem Make-up zurück.
»Haben Sie gehört, was heute abend geschehen ist?« fragte Brunetti.
»Sie meinen mit Wellauer?«
»Ja.«
Nachdem seine Frage nichts weiter als diese einsilbige Antwort auslöste, legte Dardi sein Handtuch hin und sah [31] die beiden Polizisten an. »Kann ich Ihnen irgendwie behilflich sein, meine Herren?« fragte er an Brunetti gewandt.
Schon besser, dachte der, lächelte und antwortete freundlich: »Ja, vielleicht.« Er blickte in sein Programm, als müsse er den Namen des Mannes ablesen. »Signor Dardi, wie Sie inzwischen sicher gehört haben, ist Maestro Wellauer heute abend gestorben.«
Der Sänger nahm die Nachricht mit einem leichten Neigen des Kopfes auf, nichts weiter.
Brunetti fuhr fort: »Ich wüßte gern alles, was Sie mir über heute abend erzählen können, alles, was während der beiden ersten Akte vorgefallen ist.« Er hielt inne, und Dardi nickte wieder, sagte jedoch immer noch nichts.
»Haben Sie heute abend mit dem Maestro gesprochen?«
»Ich habe ihn kurz gesehen«, antwortete Dardi, schwang sich auf seinem Stuhl herum und widmete sich wieder dem Entfernen seines Make-ups. »Als ich ankam, sprach er gerade mit einem der Beleuchter, irgend etwas über den ersten Akt. Ich habe ›Buona sera‹ gesagt und bin dann hier in meine Garderobe gegangen, um mit meinem Make-up anzufangen. Wie Sie vielleicht sehen«, er deutete auf sein Spiegelbild, »dauert es ziemlich lange.«
»Wann war das?« fragte Brunetti.
»Gegen sieben, würde ich sagen. Vielleicht etwas später. Viertel nach, aber sicher nicht danach.«
»Und haben Sie ihn dann noch einmal gesehen?«
»Meinen Sie hier oben oder hinter der Bühne?«
»Beides.«
»Danach habe ich ihn nur noch von der Bühne aus an seinem Pult gesehen.«
[32] »War jemand bei Wellauer, als Sie ihn sahen?«
»Wie gesagt, er war im Gespräch mit einem der Beleuchter.«
»Ja, ich weiß. Aber vielleicht noch jemand anderes?«
»Franco Santore. In der Bar. Sie wechselten ein paar Worte. Aber da war ich schon im Begriff zu gehen.«
Obwohl er den Namen des Mannes kannte, fragte Brunetti: »Und wer ist dieser Signor Santore?«
Brunettis Unwissenheit schien Dardi nicht zu überraschen. Warum sollte ein Polizist auch den Namen eines der berühmtesten Theaterregisseure Italiens kennen?
»Er ist der Regisseur«, erklärte Dardi. Er wischte sich noch einmal mit dem Handtuch übers Gesicht und warf es dann auf den Schminktisch. »Es ist seine Inszenierung.« Der Sänger griff nach einer Seidenkrawatte ganz rechts auf dem Tisch, schob sie unter seinen Hemdkragen und band sie sorgfältig. »Haben Sie noch weitere Fragen?« Sein Tonfall war neutral.
»Nein, ich glaube, das ist alles. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Wo können wir Sie erreichen, falls wir doch noch einmal mit Ihnen sprechen müssen, Signor Dardi?«
»Im Gritti«, antwortete der Sänger, und diesmal war er sichtlich überrascht. Er warf Brunetti einen kurzen, erstaunten Blick zu, als hätte er gern gefragt, ob es wirklich noch andere Hotels in Venedig gab, traute sich aber nicht.
Brunetti dankte ihm und ging mit Follin hinaus. »Als nächstes den Tenor, ja?« fragte er mit einem Blick auf das Programmheft.
Follin nickte und ging durch den Korridor voraus zu einer Tür am anderen Ende.
[33] Brunetti klopfte, wartete einen Augenblick, hörte nichts. Er klopfte noch einmal, worauf von drinnen ein Geräusch kam, das er kurzerhand als Aufforderung zum Eintreten nahm. Als er die Tür öffnete, sah er einen kleinen, schmalen Mann fertig umgezogen dasitzen. Sein Mantel war über die Armlehne eines Sessels geworfen, und in seiner Haltung kam das zum Ausdruck, was man ihm auf der Schauspielschule wahrscheinlich als ›verärgerte Ungeduld‹ beigebracht hatte.
»Ah, Signor Echeveste«, rief Brunetti überschwenglich und ging mit ausgestreckter Hand rasch auf ihn zu, so daß der andere nicht aufstehen mußte. »Welch ungeheure Ehre, Sie kennenzulernen.« Hätte Brunetti die gleiche Schauspielklasse besucht, hätte seine Übung wahrscheinlich den Titel ›Ehrfurcht in Gegenwart eines überwältigenden Talents‹ gehabt.
Wie ein Eisstrom im Frühling schmolz Echevestes Ärger unter der Wärme von Brunettis Schmeichelei dahin. Etwas mühsam erhob er sich und deutete eine kleine, förmliche Verbeugung an.
»Und mit wem habe ich die Ehre?« fragte er auf italienisch mit leichtem Akzent.
»Commissario Brunetti, Signore. Ich vertrete in dieser höchst unglückseligen Angelegenheit die Polizei.«
»Ah ja«, antwortete der andere, als hätte er einmal vor langer Zeit etwas von Polizei gehört, aber vergessen, was sie eigentlich tat. »Sie sind also wegen dieser – dieser«, er hielt inne, machte eine matte Handbewegung und wartete, daß ihm jemand das richtige Wort eingab. Und es kam: »…dieser unglückseligen Sache mit dem Maestro hier.«
[34] »Ja, so ist es. Sehr unglücklich, sehr bedauerlich«, plapperte Brunetti drauflos und ließ den Blick nicht vom Gesicht des Tenors. »Würde es Ihnen sehr viel Mühe bereiten, mir einige Fragen zu beantworten?«
»Nein, natürlich nicht«, antwortete Echeveste und ließ sich elegant wieder in seinen Sessel sinken, allerdings nicht, ohne sorgfältig seine Hosenbeine am Knie hochzuziehen, um die messerscharfen Bügelfalten nicht zu gefährden. »Ich würde gern behilflich sein. Sein Tod ist ein großer Verlust für die Musikwelt.«
Angesichts solch überwältigender Platitüde konnte Brunetti nur kurz und ehrerbietig den Kopf neigen. Als er ihn wieder hob, fragte er: »Um welche Zeit sind Sie ins Theater gekommen?«
Echeveste dachte einen Augenblick nach. »Gegen halb acht, glaube ich. Ich war spät dran. Wurde aufgehalten. Sie verstehen?« Durch den Ton der Frage gewann man unwillkürlich den Eindruck, er habe sich nur widerwillig aus einem zerwühlten Bett und verführerischen weiblichen Umarmungen losgerissen.
»Und warum waren Sie spät dran?« wollte Brunetti wissen, obwohl ihm klar war, daß diese Frage nicht vorgesehen war, aber es reizte ihn zu sehen, inwieweit sie die Fantasie anregte.
»Ich habe mir die Haare schneiden lassen«, antwortete der Tenor.
»Und wie heißt Ihr Friseur?« fragte Brunetti höflich.
Echeveste nannte einen, dessen Geschäft nicht weit vom Theater entfernt lag. Brunetti sah kurz zu Follin hinüber, der sich Notizen machte. Er würde es morgen überprüfen.
[35] »Und als Sie hier ankamen, haben Sie den Maestro da gesehen?«
»Nein, nein, ich habe niemanden gesehen.«
»Und das war gegen halb acht?«
»Ja. Soweit ich mich erinnere.«
»Haben Sie sonst beim Hereinkommen jemanden gesehen oder gesprochen?«
»Nein. Niemanden.«
Noch bevor Brunetti sich darüber wundern konnte, erklärte Echeveste: »Wissen Sie, ich bin nicht durch den Bühneneingang gekommen. Ich bin durchs Orchester gegangen.«
»Ich wußte nicht, daß man das kann«, sagte Brunetti, den es sehr interessierte, daß man auf diesem Weg hinter die Bühne gelangen konnte.
»Nun ja«, Echeveste betrachtete seine Hände. »Normalerweise geht das auch nicht, aber ich bin mit einem der Platzanweiser befreundet, und er hat mich hereingelassen, damit ich nicht durch den Bühneneingang mußte.«
»Könnten Sie mir erklären, warum Sie das getan haben, Signor Echeveste?«
Der Tenor hob ungeduldig die Hand und ließ sie einen Moment in der Luft hängen, als hoffte er, die Frage damit wegwischen oder beantworten zu können. Es gelang beides nicht. Schließlich legte er eine Hand auf die andere und sagte schlicht: »Ich hatte Angst.«
»Angst?«
»Vor dem Maestro. Ich war schon bei zwei Proben zu spät gekommen, und er reagierte ziemlich wütend darauf, schrie herum. Er konnte sehr unangenehm werden, wenn er [36] ärgerlich war. Das wollte ich mir nicht noch einmal antun.« Brunetti hatte den Eindruck, nur der Respekt vor dem Toten hinderte den Tenor daran, einen stärkeren Ausdruck als »unangenehm« zu benutzen.
»Sie sind also auf diesem Weg hereingekommen, damit Sie ihm nicht begegnen?«
»Ja.«
»Haben Sie ihn außer von der Bühne zu einem anderen Zeitpunkt noch einmal gesehen oder mit ihm gesprochen?«
»Nein.«
Brunetti stand auf und lächelte wieder bühnenreif. »Vielen Dank, daß Sie uns so viel Zeit geopfert haben, Signor Echeveste.«
»Es war mir ein Vergnügen«, antwortete der andere und erhob sich von seinem Sessel. Er sah Follin, dann wieder Brunetti an. »Kann ich jetzt gehen?«
»Aber natürlich. Wenn Sie mir nur noch sagen würden, wo Sie wohnen?«
[37] 3
Als Brunetti aus der Garderobe des Tenors kam, erwartete Miotti ihn schon. Wie der junge Polizist berichtete, hatte der Regisseur Franco Santore sich geweigert zu warten. Wer mit ihm sprechen wolle, könne ihn im Hotel Fenice, direkt gegenüber dem Theater finden, habe er gesagt. Brunetti nickte, fast froh zu hören, daß es doch noch andere Hotels in der Stadt gab.
»Bleibt uns noch der Sopran«, sagte Brunetti, während sie den Korridor entlanggingen. An der Tür hing das übliche Schild: ›Flavia Petrelli – Violetta Valery‹. Darunter war, mit feinem schwarzem Stift gezeichnet, eine Zeile, die aussah wie chinesische Schriftzeichen.
Er klopfte an die Tür und bedeutete seinen beiden Begleitern mit einem Kopfnicken, draußen zu bleiben.
»Avanti!« hörte er und machte die Tür auf.
Zwei Frauen erwarteten ihn in der Garderobe, und es überraschte ihn, daß er nicht gleich wußte, welche von beiden die Sopranistin war. Wie jeder in Italien kannte er »La Petrelli«. Aber auf der Bühne hatte er sie nur einmal vor etlichen Jahren singen hören, und er erinnerte sich nur sehr undeutlich an Zeitungsbilder von ihr.
Die dunklere der beiden Frauen stand mit dem Rücken zum Frisiertisch, die andere saß auf einem schlichten Holzstuhl, an der gegenüberliegenden Wand. Keine sagte etwas, als er eintrat, und Brunetti nutzte das Schweigen, um beide eingehend zu betrachten.
[38] Die stehende Frau schätzte er auf Ende Zwanzig, Anfang Dreißig. Sie trug einen purpurfarbenen Pullover und einen langen, schwarzen Rock, der über ihre schwarzen Stiefel fiel. Die Stiefel hatten flache Absätze und waren aus handschuhweichem Leder. Brunetti erinnerte sich dunkel, wie er vor noch nicht allzu langer Zeit mit seiner Frau am Schaufenster von Fratelli Rossetti vorbeigegangen war und sie sich über den Irrsinn ereifert hatte, eine halbe Million Lire für ein Paar Stiefel auszugeben. Genau diese Stiefel, da war er sicher. Sie hatte schulterlanges, schwarzes Haar, naturgewellt, das selbst mit dem Löffel geschnitten noch perfekt aussehen würde. Ihre Augen paßten nicht ganz zu dem olivefarbenen Teint, das blasse Grün ließ ihn an Glas denken, aber als die Stiefel ihm wieder einfielen, doch eher an Smaragde.
Die sitzende Frau schien etwas älter zu sein und trug ihr Haar, in dem schon ein paar graue Strähnen waren, kurz geschnitten wie die römischen Kaiser in den Jahrhunderten des Niedergangs. Die strenge Frisur betonte ihre feingeschnittenen Züge.
Er tat ein paar Schritte auf die sitzende Frau zu und deutete eine Verbeugung an. »Signora Petrelli?« fragte er. Sie nickte, sagte aber nichts. »Ich freue mich, Sie kennenzulernen, und bedauere nur, daß es unter so unglücklichen Umständen sein muß.« Angesichts eines so berühmten Opernstars konnte Brunetti der Versuchung nicht widerstehen, sich der blumigen Sprache der Oper zu bedienen, als ob er eine Rolle spielte.
Sie nickte wieder und tat nichts, um ihm die Bürde des Redens abzunehmen.
[39] »Ich würde gern über den Tod von Maestro Wellauer mit Ihnen sprechen.« Er blickte zu der anderen Frau hinüber, fügte hinzu: »Und mit Ihnen auch« und überließ es den Frauen, ihm den Namen der zweiten zu nennen.
»Brett Lynch«, warf die Sängerin ein, »meine Freundin und Sekretärin.«
»Ist das amerikanisch?« fragte er die Namensträgerin.
»Ja«, antwortete Signora Petrelli für sie.
»Dann wäre es besser, wenn wir uns auf englisch unterhielten?« fragte er, nicht wenig stolz auf die Leichtigkeit, mit der er von einer Sprache in die andere wechseln konnte.
»Es wäre einfacher, wenn wir italienisch sprechen würden«, sagte die Amerikanerin. Es waren ihre ersten Worte, und ihr Italienisch war absolut akzentfrei. Sein verblüffter Blick war ganz und gar ungewollt und wurde von beiden Frauen bemerkt. »Es sei denn, Sie möchten venezianisch reden«, fügte sie hinzu, wobei sie ganz natürlich in den örtlichen Dialekt fiel, den sie offenbar ebenfalls perfekt beherrschte. »Aber vielleicht hat Flavia dann Schwierigkeiten, uns zu folgen.« Das kam völlig ausdruckslos, aber Brunetti war klar, daß er noch lange warten mußte, bis er mit seinem Englisch angeben konnte.
»Gut, dann also italienisch«, sagte er und wandte sich wieder an Signora Petrelli. »Beantworten Sie mir ein paar Fragen?«
»Natürlich«, meinte sie. »Möchten Sie sich setzen, Signor…«
»Brunetti«, ergänzte er. »Commissario della Polizia.«
Der Titel schien sie nicht im mindesten zu beeindrucken. »Hätten Sie gern einen Stuhl, Dottor Brunetti?«
[40] »Nein, danke.« Er holte sein Notizbuch aus der Tasche und zog einen Stift zwischen den Seiten hervor, als ob er sich Notizen machen wollte, was er höchst selten tat, da er bei einer ersten Vernehmung Augen und Gedanken lieber frei schweifen ließ.
Signora Petrelli wartete, bis er die Kappe von seinem Stift abgeschraubt hatte, dann fragte sie: »Was möchten Sie denn gern wissen?«
»Haben Sie den Maestro heute abend gesehen oder gesprochen?« Und bevor sie die Einschränkung selbst machen konnte, fuhr er fort: »Außer während der Vorstellung natürlich.«
»Nur auf ein ›Buona sera‹, als ich ins Theater kam, und dann noch das übliche ›Hals- und Beinbruch‹. Mehr nicht.«
»Und sonst haben Sie nicht weiter mit ihm gesprochen?«