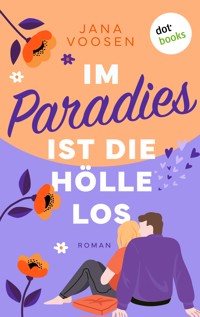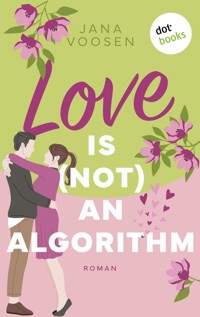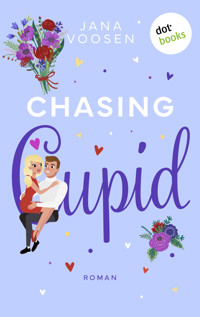6,99 €
6,99 €
oder
-100%
Sammeln Sie Punkte in unserem Gutscheinprogramm und kaufen Sie E-Books und Hörbücher mit bis zu 100% Rabatt.
Mehr erfahren.
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ihre beste Freundin geht zum Traualtar, ihre Schwester in den Mutterschutz und Helen selber – geht shoppen. Als Typberaterin für Menschen, die viel Geld, aber wenig Geschmack haben. Bis vor kurzem sah das Leben noch nicht so trostlos aus, aber was tun, wenn der Verlobte plötzlich einen Rückzieher macht?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 406
Veröffentlichungsjahr: 2009
4,6 (50 Bewertungen)
Bewertungen werden von Nutzern von Legimi sowie anderen Partner-Webseiten vergeben.
Legimi prüft nicht, ob Rezensionen von Nutzern stammen, die den betreffenden Titel tatsächlich gekauft oder gelesen/gehört haben. Wir entfernen aber gefälschte Rezensionen.
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Widmung
Kapitel 1.
Kapitel 2.
Copyright
HEYNE <
Das Buch
Die Hochzeit steht kurz bevor, die Kirche ist gebucht, die Gäste geladen, vier Kinder geplant. Wenige Wochen vor ihrem dreißigsten Geburtstag scheint alles im Leben der Typberaterin Helen nach Plan zu laufen. Bis ihr Zukünftiger es sich plötzlich anders überlegt und Helen mit dem Scherbenhaufen ihrer Träume allein zurücklässt. Statt eine Doppelhaushälfte am Stadtrand zu besichtigen, muss Helen vorläufig wieder bei ihrem Vater und der verhassten Stiefmutter einziehen. Einzige Unterstützung in diesem Gruselkabinett ist ihre innere Therapeutin Sophia, die ständig ungebeten auftaucht, um mit Helen lang und breit ihre Gefühle zu diskutieren. Helen ist todunglücklich und gibt die Hoffnung schon beinahe auf, jemals den Mann fürs Leben zu finden. Dabei liegt das Gute manchmal näher, als man denkt …
Die Autorin
Jana Voosen, Jahrgang 1976, studierte Schauspiel in Hamburg und New York. Es folgten Engagements an Hamburger Theatern, daneben war sie in TV-Produktionen wie Tatort, Stahlnetz und Marienhof zu sehen. Jana Voosen lebt und arbeitet in Hamburg. Nach ihrem vielgespielten Kindertheaterstück Hunger und ihren Romanen Schöner Lügen und Er liebt mich ist dies ihr drittes Buch. Alle Romane von Jana Voosen sind im Heyne Verlag lieferbar.
Für Tey! Du bist einzigartig und unersetzbar.
Personen und Handlung sind frei erfunden.
Danke! Steff, Natalie, Wiebke, Nina und Viola. Weil Ihr da seid, in guten wie in schlechten Zeiten. Und Ralf B. - Du weißt wofür.
1.
»Das letzte Einhorn« ist sein Lieblingsfilm, hat er mir erzählt. Entzückend fand ich das damals, ja, rührend. Wie blind kann ein Mensch sein?
»Es tut mir Leid«, sagt er, schaut mich mit seinen sanften rehbraunen Augen an und legt seine Hand auf meine. Ich erwache aus der Starre, in die ich ob seiner »Neuigkeiten« gefallen bin und ziehe meine Hand schnell weg. Wir sitzen uns im Café Real in der Hamburger »Langen Reihe« gegenüber, zum sicher hundertsten Mal in den letzten zweieinhalb Jahren, die wir jetzt zusammen sind. Waren. Verdammt! Mir schießen die Tränen in die Augen. Ihm auch. »Ich kann nichts dafür, Helen!« Wütend funkele ich ihn an:
»Fang jetzt bloß nicht an zu heulen, dazu hast du kein Recht«, krächze ich mit heiserer Stimme, »das ist ja wohl mein Part.«
»Aber mir tut es auch weh«, wimmert er, und große Tropfen kullern aus seinen Augenwinkeln über die scharfen Konturen seines braungebrannten Gesichtes, laufen sein markantes Kinn hinunter. Wie oft haben meine Lippen denselben Weg genommen? Ich liebe Jan. Ich liebe diesen Mann mehr als alles andere auf der Welt und nun soll ich ihn verlieren. Er verlässt mich und ich kann nichts dagegen tun. Ich kann noch nicht einmal um ihn kämpfen. Ich würde es tun, wenn ich eine Chance hätte. Aber so. Ich möchte am liebsten schreien.
»Verschwinde«, bringe ich stattdessen im Flüsterton heraus.
»Nein -«, will er widersprechen, doch dann sieht er meinen Blick.
»Bitte«, flehe ich ihn an, »verschwinde. Steh auf, verlass dieses Café und mein Leben.«
»Nein, Helen, bitte, das kann nicht dein Ernst sein. Wir … du weißt doch, wie lieb ich dich habe. Können wir denn nicht …« Wenn er jetzt sagt »Freunde bleiben«, bekomme ich einen Nervenzusammenbruch.
»… Freunde bleiben? Bitte!«
Ich bekomme keinen Nervenzusammenbruch. Ich bin viel zu sehr damit beschäftigt, keinen zu bekommen, um einen zu bekommen.
»Nein, das können wir nicht. Bitte, Jan, geh jetzt.« Ja, bitte geh, bevor ich vor dir auf die Knie falle und dich (sinnloserweise) anbettle, es dir noch mal anders zu überlegen. Irgendwas in meinem Blick scheint ihm zu sagen, dass ihm genau das bevorsteht. Ich bin froh, dass er mir diese Demütigung erspart. Er steht auf, ein letztes Mal kann ich seine ein Meter zweiundachtzig in voller Grö ße bewundern, der durchtrainierte Oberkörper zeichnet sich unter seinem engen weißen T-Shirt ab, braune muskulöse Arme, seine schlanken Chirurgenhände. Ich liebe diese Hände. Was hat dieser Mann mit diesen Händen in mir auslösen können? Er kann doch nicht, nein, es kann nicht sein. Gerade will ich den Mund aufmachen, als ich sehe, wie er seinen Ring vom linken Ringfinger zieht. Unseren weißgoldenen Verlobungsring. Mir bleibt das Wort im Halse stecken, als er ihn vor mich auf den Tisch legt. Und von einem Moment auf den anderen ist mein Schmerz wie weggeblasen. Ich bin nur noch wütend.
»Was soll ich damit«, fauche ich wie eine getretene Katze, »den hast du doch bezahlt. Hier, ich gebe dir meinen auch gleich.« Damit beginne ich hektisch, an dem Gegenstück zu zerren, das sich an meiner linken Hand befindet.
»Lass das, Helen«, sagt Jan beschwichtigend, »ich will ihn nicht zurück, ich dachte nur, na ja - vielleicht könntest du die Ringe einschmelzen und dir was Hübsches daraus machen lassen …« Sprachlos, mit offenem Mund, sehe ich zu ihm hoch. Für einen Moment vergesse ich sogar, an dem verfluchten Ring zu ziehen, der sich um kein Stück bewegen lässt. Anscheinend sind meine Finger von dem Schock auf das Doppelte angeschwollen. Oder ich habe stark zugenommen in den letzten fünf Wochen, seit dem 14. Februar, als er mir den Ring geschenkt hat. »Eine Kette oder so«, stammelt Jan und streicht sich nervös eine blonde Haarsträhne aus der Stirn.
»Du tickst wohl nicht mehr ganz richtig«, schreie ich ihn an und springe so schnell auf, dass er zusammenfährt und einen Schritt zurückweicht. Die anderen Gäste im Real drehen sich erschrocken zu uns um, der Barkeeper guckt richtiggehend alarmiert und tauscht einen Blick mit Jan. So nach dem Motte: »Alles okay oder dreht die Alte durch?« Natürlich dreht die Alte durch! Und sie hat allen Grund dazu. »Ich soll mir was Hübsches aus unseren Verlobungsringen machen lassen?«, kreische ich hysterisch, »so was … also, das ist ja wohl …«, mir fehlen die Worte, »das ist wirklich das GRAUSAMSTE, was ich jemals von einem Menschen gehört habe.« Jan sieht das jetzt anscheinend genau so, denn er wird erst rot, dann blass und hebt entschuldigend die Hände.
»Helen, es tut mir Leid, ich … ich habe das wirklich nicht böse gemeint, ich dachte nur, weißt du, wir hatten doch eine schöne Zeit. Eine wunderschöne Zeit, trotz allem, ich dachte …« Er redet sich um Kopf und Kragen! »… als Erinnerungsstück. Wir gehen doch nicht im Bösen auseinander, es ist doch bloß …« Ha! Wie eine Furie schnelle ich auf ihn zu. Eigentlich ist es lächerlich, dass er vor meinen knapp eins sechzig zurückweicht, aber ich bin wahrscheinlich ein gefährlicher Anblick.
»Und in diesem Punkt, mein Lieber, irrst du dich gewaltig«, keife ich, »wir gehen so böse auseinander, böser kann man gar nicht auseinander gehen. Du kannst dein Stück Blech zurückhaben«, noch immer zerre ich wie verrückt an dem Ring, meine Stimme überschlägt sich, »verschwinde, komm mir nie wieder unter die Augen …« Jan sieht mich noch einmal flehend an, dann dreht er sich um und verlässt fluchtartig das Café. In diesem Moment löst sich endlich der Ring, ich kann ihn mit einem knacksenden Geräusch vom Finger ziehen. Wütend werfe ich ihn Jan hinterher, als er gerade durch die Tür verschwindet. »Hier, lass ihn einschmelzen und mach dir was Hübsches daraus. Wie wär’s mit einem Brustwarzenpiercing?« Aber in diesem Moment schlägt die Tür hinter Jan zu, mein Verlobungsring prallt an dem dunkelbraunen Holz ab und fällt leicht klirrend auf die roten Bodenfliesen. Plötzlich scheint sich die Welt von mir zu entfernen. Es ist ein Gefühl, als würde ich mitten in einem großen Ballen Watte stehen, alles ist so unwirklich, so fern und dumpf. Ich erkenne die Gesichter der Menschen ringsherum, alle sehen mich an, die meisten mitleidig, manche auch ein wenig ängstlich, als würden sie einen Amoklauf fürchten. Die Gesichter werden größer, dann scheinen sie sich wieder zu entfernen, ebenso der Geräuschpegel aus Musik und Getuschel. Ich sehe mich selber, wie ich dort stehe und alle starren mich an. Ich bin so müde. Der Barkeeper kommt auf mich zu, fasst mich vorsichtig am Arm und plötzlich ist dieses Wattegefühl weg.
»Helen, bist du okay?« Er kennt meinen Namen? Irritiert sehe ich in seine blauen Augen. Natürlich, er heißt Martin. Er hat hier angefangen, kurz nachdem wir das Real zu unserem Stammlokal gemacht haben.
»Aber jetzt gibt es kein ›Wir‹ mehr. Jetzt muss ich lernen, wieder ein ›Ich‹ zu sein«, sage ich. Verständnislos sieht er mich an. Dabei habe ich gar nicht mit ihm geredet, sondern mit Sophia. Aber davon später. Martin guckt jetzt mehr als besorgt, ebenso wie die anderen Gäste. Einer von ihnen steht auf und reicht mir mein Glas Wasser von unserem Tisch. Meinem Tisch. Das ist nett von ihm. Sag Danke, Helen!
»Danke«, sage ich und nehme einen tiefen Schluck. Das tut gut. Es geht mir besser.
»Können wir was für Sie tun?«, fragt der Mann mich höflich. Ich blicke zu ihm auf. Nein, es wäre zu schön um wahr zu sein, wenn ich jetzt einem Doppelgänger von Brad Pitt oder Mel Gibson in die strahlend blauen Augen sehen würde. Aber das Leben ist kein Märchen, und deswegen blicke ich in zwei freundliche, jedoch von deutlichen Tränensäcken untermalte Augen, die mir aus einem etwas aufgeschwemmten Gesicht entgegensehen. Außerdem hat der Mann das, was man wohl freundlich eine »hohe Stirn« und einen »Wohlstandsbauch« nennt. In meinem jetzigen Zustand wäre ich wahrscheinlich nicht besonders wählerisch, deshalb kann ich von Glück sagen, dass er noch etwas anderes hat: nämlich eine nette schwarzhaarige Freundin mit großen dunklen Augen, die sich nun zu uns gesellt.
»Ja, sollen wir nicht vielleicht lieber einen Arzt rufen? Sie sehen wirklich sehr blass aus«, sagt sie und streichelt mir mit der Hand leicht über die Wange. Sofort schießen mir bei dieser zärtlichen Geste die Tränen in die Augen. Bloß das nicht. Nicht weinen! Wenn ich jetzt anfange zu weinen, dann höre ich nie wieder auf. Ich kämpfe den Kloß im Hals tapfer zurück und wage den Ansatz eines Lächelns:
»Nein, vielen Dank. Das ist nett von Ihnen, aber es geht mir gut.«
»Wirklich?«, erklingt es ungläubig aus drei Kehlen und die dazugehörigen Gesichter mustern mich skeptisch.
»Wirklich«, sage ich so überzeugend wie möglich. Auch für mich selbst. Vorsichtig drehe ich mich nach meinem Tisch um, gehe mit sehr geradem Rücken und erhobenem Haupt die paar Schritte darauf zu und greife nach dem weißgoldenen Reif auf der Platte. »Ich glaube, es ist besser, wenn ich jetzt nach Hause gehe und mich ein wenig ausruhe.« Meine Stimme scheint gar nicht zu mir zu gehören. Martin hat meinen Ring vom Boden aufgehoben und gibt ihn mir. »Danke. Dann noch einen schönen Abend alle zusammen. Ich hoffe, ich habe Sie nicht allzu sehr gestört.« Damit entblöße ich pflichtschuldigst ein weiteres Mal meine Zähne und verlasse das Real.
Ich gehe nicht nach Hause. Ich denke ja gar nicht daran. Ich habe etwas ganz anderes vor: Ich werde weinen. Die ganze Nacht lang. Weinen und schnapsen.
Aber sicher nicht in einem Lokal, in dem wir Stammgäste sind, Verzeihung, ich Stammgast bin. Nein, dazu suche ich mir einen geeigneten Laden. Genau so versifft und trostlos, wie es dem Anlass angemessen ist. Ich laufe ein Stück die Straße hinunter. Es dämmert bereits und eine Kirchenglocke schlägt aus einiger Entfernung sechs Mal. Meine linke Hand krampft sich um die beiden Ringe, die schon schmerzhafte Abdrücke in der Innenfläche hinterlassen. Vor einer morsch aussehenden Holztür, über der ein Schild mit der Aufschrift »Zum Harry« hin- und herpendelt, bleibe ich stehen. Zum Harry. Das klingt nach so einer Kneipe, in der sich schon mittags die Kumpels treffen, um das erste Bier zu zischen und über ihre Frauen abzulästern. Und wo um sechs alle schon betrunken unter den Stühlen hängen. Könnte genau das Richtige für mich sein. Die Tür geht auf und zwei hipp gekleidete Frauen Ende zwanzig kommen heraus. Hmm, ich hatte jetzt eher aus der Form geratene Mittfünfziger erwartet. Ich luge an ihnen vorbei ins Innere des Ladens. Sieht nicht schlecht aus. Nicht gerade versifft, im Gegenteil. Hübsch, geradezu gemütlich. Egal, ich will da mal nicht so wählerisch sein. Hauptsache, mich kennt hier keiner. Ich zumindest habe diesen Laden noch nie gesehen oder davon gehört. Mein ganzer Körper schreit mittlerweile nach Alkohol, und den werde ich hier bekommen. Das ist doch das Einzige, was zählt. Ich betrete also das »Zum Harry« und sehe mich um. Die meisten Tische sind belegt, aber da will ich mich sowieso nicht hinsetzen. Eine Frau in meiner Situation gehört an den Tresen. Da ist sie nah genug an den Flaschen, die das Vergessen bringen, und außerdem kann man dem Barkeeper ein Schnitzel an die Backe labern, wenn der Pegel entsprechend angestiegen ist. Obwohl ich nicht sicher bin, ob ich diese Geschichte überhaupt mit irgendjemandem teilen möchte. In diesem Moment fällt mir Lara ein. Meine allerbeste Freundin Lara, mit der ich eigentlich alles teile. Die sich seit Jahren tapfer mein Geheule über dieses und jenes anhört. Denn, das muss ich sagen, ich hatte in meinem bisherigen Leben nicht viel Glück mit den Männern. Bis vor zweieinhalb Jahren. Bis ich Jan kennen lernte. Da dachte ich, das Blatt habe sich gewendet. Und nun versetzt mir das Schicksal einen Tiefschlag, der seinesgleichen sucht. Eine Demütigung, die ich nicht auszusprechen wage, nicht mal gegenüber meiner besten Freundin. Jedenfalls noch nicht. Und auch Bernd, meinen besten Freund, will ich nicht anrufen. Der würde mich wieder mitleidig ansehen, in die Arme nehmen und in mein Haar hineinflüstern: »Warum hast du eigentlich niemals Glück mit den Männern, Lenchen? Irgendwas machst du falsch.« Exakt diese Worte habe ich in den letzten fünfzehn Jahren, seit denen ich Bernd kenne, so oft gehört - ich könnte es nicht ertragen, den Fehler in diesem Fall bei mir zu suchen. Außerdem hasse ich es, dass Bernd mich hartnäckig Lenchen nennt. Ich sehe schon, ich werde allein mit meinem Schicksal hadern müssen. Ich brauche was zu trinken. Sofort! Also hänge ich meine Tasche über einen der braunen abgeschabten Barhocker und setze mich dann obendrauf. Ja, das mag paranoid klingen, aber nachdem mir an einem Kneipenabend vor knapp drei Jahren mein gesamtes Hab und Gut geklaut worden ist, bin ich vorsichtiger geworden. Der Bursche hinter dem Tresen poliert gerade ein Weinglas und grinst mich an:
»Hi!«
»Hi«, gebe ich zurück. Das könnte schon eher der Märchenprinz sein. Hübscher Kerl. Trägt ein enges schwarzes T-Shirt und eine schmal geschnittene helle Jeans. Seine Augen sind unverschämt blau, die zotteligen braunen Haare und der Drei-Tage-Bart geben ihm was Verwegenes. Aber ich bin schließlich nicht zum Vergnügen hier. Ich muss Trauerarbeit leisten. Sagt Sophia. Wie alt mag er sein? Ende zwanzig? Der wird sich vermutlich nicht meine Sorgen anhören, aber immerhin hat er alles, was ich sonst noch brauche: »Einen trockenen Weißwein und einen goldenen Tequila.« Sein Gesicht zuckt nur ganz kurz, dann hat er sich wieder unter Kontrolle. Dafür sieht er mich jetzt durchdringend an. Das kenne ich schon. Trotz meiner beinahe dreißig (in zwei Monaten ist es so weit) sehe ich, zumindest in Jeans und mit (heute ausnahmsweise) wenig Make-up und zwei blonden Zöpfen hinter den Ohren aus, als dürfe ich noch nicht Auto fahren. Eventuell Mofa. Kein Witz. Ich bin nicht viel größer als eine Parkuhr. In meinem Personalausweis steht ein Meter dreiundsechzig, da kann man aber getrost vier Zentimeter abziehen. Meine körperliche Entwicklung ist ebenfalls mit fünfzehn Jahren stehen geblieben, die großen blauen Augen und die sommerbesprosste Himmelfahrtsnase vervollständigen das Kindchenschema.
»Ich weiß, ich sehe jung aus, aber ich bin neunundzwanzig. Willst du meinen Ausweis sehen«, blaffe ich ihn an.
»Äh, nicht nötig«, sagt er eingeschüchtert, »kommt sofort.« Während ich warte, erscheint Sophia neben mir auf der Bildfläche. Die kann ich im Moment gar nicht gebrauchen. In ihrem tadellos sitzenden hellgrauen Nadelstreifenkostüm steht sie neben meinem Barhocker und sieht mich mit einer Mischung aus Verständnis, Mitgefühl und elterlicher Strenge durch ihre Brillengläser an. Ich wende mich unwillig von ihr ab. Ich will jetzt nicht reden. Zum wiederholten Male verfluche ich meine Psychotherapeutin Sabine Klein, die mir Sophia aufgehalst hat. Denn Sophia ist meine innere Therapeutin. Seit der Stunde, in der mir Sabine Klein davon erzählt hat, dass wir alle einen Therapeuten in uns tragen, läuft mir Sophia nach wie eine Klette. Ständig hinterfragt sie, was ich tue, warum ich es tue und was ich dabei fühle. Zugegeben, sie kann auch mal nützlich sein, aber meistens geht sie mir auf die Nerven. Jetzt zum Beispiel. Ich konzentriere mich ganz fest auf die Getränke, die gerade vor mich auf den Tresen gestellt werden und Sophia verpufft. Ja, ich habe immer noch die Kontrolle, denn schließlich ist sie ein Teil von mir. Und Kontrolle ist mir wichtig!
In der nächsten Dreiviertelstunde trinke ich eine Flasche Wein und vier Tequila. Da sieht die Welt doch gleich ganz anders aus. Verschwommen und trostlos. Was stimmt denn nicht mit mir? Warum muss so etwas ausgerechnet mir passieren?
Das hätte ich vielleicht nicht fragen sollen, denn solche Fragen rufen Sophia auf den Plan. Sie lässt sich auf dem Hocker neben mir nieder, schlägt die Beine übereinander und sieht mich durchdringend an, während ich mich schon leicht windschief am Tresen festklammere und Zimt von meinem Handrücken schlabbere. Und dann fängt sie an, mich voll zu labern:
»Okay, Helen, lass uns darüber sprechen!« Nein, ich will nicht darüber sprechen. Verschwinde. Meine Therapeutin schüttelt bekümmert den Kopf über meine Uneinsichtigkeit:
»Helen«, sagt sie mit dieser sanften, einlullenden Stimme, »zunächst einmal möchte ich dir sagen, dass deine Reaktion auf diese Geschichte völlig normal ist.« Danke. Da fühle ich mich so viel besser. Ich werfe ihr einen scheelen Blick von der Seite zu, doch sie lässt sich nicht beirren und fährt ungerührt fort: »Wir Menschen reagieren alle gleich auf Ausnahmesituationen. Die erste Phase ist die des Schocks, wie du sie eben erst erlebt hast. Und dann kommt die Verdrängung. Verdrängung ist ein Mittel der Psyche, dich funktionsfähig zu halten, wenn du die Wahrheit nicht ertragen könntest, ohne dass deine Lebensfähigkeit massiv beeinträchtigt würde.« Ich verdränge überhaupt nichts. Ich will nur nicht darüber reden. Langsam werde ich wirklich sauer. »Aber, liebe Helen, du wirst weiterleben. Es ist eine irrationale Angst von dir zu glauben, dass du diese Kränkung nicht überleben kannst.« Wer hat denn was von Sterben gesagt? Ich doch nicht. Und überhaupt, ich bin nicht gekränkt. Im Gegenteil, es geht mir blendend. Energisch kippe ich mir einen weiteren Tequila die Kehle hinunter. Er schmeckt genauso schlimm wie die davor, aber mir fehlt die Kraft, das durch etwaiges Schütteln zu kommentieren. Wenn Sophia doch endlich die Klappe halten würde. Ich bekomme Kopfschmerzen von ihrem Gelaber. Aber nein, sie denkt überhaupt nicht daran: »Du musst es aussprechen. Stell dich den Tatsachen, erst dann kannst du es verarbeiten. Komm, Helen, du schaffst es. Sag, wie es ist. Sprich es aus und nimm ihm den Schrecken.« Ich starre auf die Pfütze in meinem Weinglas und konzentriere mich darauf, Sophia von hier wegzubeamen. Und richtig, ich kann förmlich spüren, wie sie beginnt, ein wenig flacher zu atmen. Hier kommt wieder einer meiner Lieblingswitze zum Tragen: Wie viele Therapeuten braucht man, um eine Glühbirne einzuschrauben? Antwort: Einen! Nur die Glühbirne muss auch wirklich wollen.
Ich will nicht. Ich will noch einen Tequila. Mit einer ungeduldigen Handbewegung versuche ich, Sophia endgültig von dem Barhocker neben mir zu verscheuchen. Der Barkeeper deutet mein Gefuchtel als Wink, mir einen neuen Drink einzuschenken. Großartig! Zwei Fliegen mit einer Klappe! Was ist heute doch für ein großartiger Tag. Und Sophia bleibt tatsächlich nichts anderes übrig, als sich endlich zu trollen. Über die Schulter rufe ich ihr hinterher:
»Siehst du jetzt, wer hier die Oberhand hat? Ha!« Da dreht sie sich mit einem Ruck zu mir um. Mit wenigen Schritten ist sie bei mir, funkelt mich mit ihren durch die Brillengläser unnatürlich vergrößerten grünen Augen an, öffnet den Mund und sagt:
»Dein Freund ist schwul. Ach nein, jetzt ist er ja wohl dein Exfreund.« Und nach einer Kunstpause schiebt sie noch ein triumphierendes »Ha!« hinterher, bevor sie sich auf dem Absatz umdreht und verschwindet.
Wie ein hypnotisiertes Kaninchen sitze ich auf meinem Hocker. Jetzt ist es raus. Jan ist schwul. Oh Gott, ich bin so unglücklich! Ich könnte jetzt wirklich gut eine Therapeutin brauchen. Ich schaue mich hoffnungsvoll um, ob Sophia nicht vielleicht zurückkommt, aber sie lässt sich nicht blicken. Stattdessen setzt sich ein dunkelhaariger breitschultriger Mann neben mich an den Tresen und begrüßt den Barkeeper:
»Hi, Pete. Einen Martini, bitte.« Uh, ein James Bond. Gerührt, nicht geschüttelt, oder was? Mit einem schrägen Seitenblick auf den Typ kippe ich den sechsten Tequila mit Schwung hinunter und sage:
»Hey, Pete. Noch mal dasselbe, ja?« Pete grinst und nickt. In diesem Moment beginnt Kate Winslet aus den Lautsprecherboxen zu trällern: »What if I had never let you go?« Oh mein Gott, unser Lied. Okay, eines unserer Lieder. Ist das ein Zeichen? Was wäre gewesen, wenn ich ihn wie diese Verrückte aus »Misery« ans Bett gekettet, ihm mit einem riesigen Hammer die Fußknöchel zerschmettert und ihm so die Möglichkeit genommen hätte, jemals wieder zu »gehen«? Wäre er dann vielleicht noch hetero? Mein Hetero? Tränen strömen unaufhaltsam meine Wangen herunter, ich bemerke, wie mich sowohl mein Nachbar mit seinen schönen dunkelbraunen Augen als auch Barkeeper Pete ein wenig besorgt mustern. Ach, lasst mich doch alle in Ruhe. Ich lasse meinen Kopf auf meine Arme sinken und höre zu, was Kate mir zu sagen hat. Was wäre, wenn ich dich nicht hätte gehen lassen? Wärest du noch der Mann, den ich einmal kannte? Wenn ich geblieben wäre, wenn wir es versucht hätten, ach, wenn wir doch die Zeit zurückdrehen könnten. Jetzt werde ich es nie erfahren.
Mit einem Ruck richte ich mich auf und verliere dabei beinahe das Gleichgewicht. Nein, so darf es nicht enden. Ich darf nicht aufgeben, er wird zurückkommen. Schließlich haben wir uns doch geliebt. Zweieinhalb Jahre lang hat er mit mir geschlafen und sich nie beschwert. Diese ganze Ich-bin-jetzt-schwul-Geschichte, das ist sicher nur eine Phase. Ja! Ich fühle mich plötzlich seltsam getröstet. Das ist nicht das Ende! Alles wird gut. Ich ignoriere die Tatsache, dass Jan ein erwachsener Mann von dreiunddreißig Jahren ist und kein pubertierendes Jüngelchen, das im Zeltlager mit den anderen Jungs um die Wette wichst. Er ist nicht schwul. Wie könnte er? Und vor allem, was würde das über mich als Frau sagen? Darüber will ich nicht nachdenken. Ich muss ihn anrufen. Also gehe ich auf Tauchstation, um in meiner Handtasche nach meinem Handy zu angeln. Ich krame erfolglos, verliere plötzlich den Halt und komme ins Rutschen. Mit einem Aufschrei kippe ich nach vorne, der Hocker unter meinem Hintern gleich mit und ich lande mit dem Gesicht geradewegs im Schritt meines Tresengefährten. Ein erschrockenes Zucken geht durch seinen Körper, dann hilft er mir dabei, mich wieder aufzurappeln. Mit knallrotem Kopf tauche ich leicht schwankend wieder auf und kralle meine Fingernägel in das dunkle Holz der Bar.
»Tschuldigung«, nuschele ich, »ich wollte bloß mein Handy …«
»Nichts passiert. Ich bin Michael«, sagt er und strahlt mich an. Na, war ja klar. Der denkt jetzt wohl, das war eine Vorschau auf heute Nacht, was? Fürsorglich hilft er mir auf den Barhocker zurück.
»Ich heiße Helen«, sage ich kurz und beuge mich wieder zu meiner Tasche hinunter. Schließlich habe ich mein Handy immer noch nicht. Und ich muss Jan jetzt anrufen, unbedingt. Habe keine Lust, mich jetzt von irgendeinem Kerl anbaggern zu lassen. Michael hält mich an den Schultern fest und richtet mich wieder auf.
»Sag mal, was hast du eigentlich vor? Willst du dich noch mal runterstürzen?«
»Ich brauche mein Telefon«, sage ich unwirsch und so würdevoll, wie nur möglich. Das ist gar nicht so einfach. Ich bin nämlich wirklich schon ziemlich abgefüllt. Wenn mein Gegenüber das mitkriegt, werde ich ihn gar nicht mehr los. »Ich muss meinen Freund anrufen«, füge ich deshalb noch hinzu und beuge mich erneut nach vorne. In diesem Moment wird mir plötzlich sehr schwindelig und sehr schlecht, und ehe Michael etwas unternehmen kann, plumpse ich erneut wie ein nasser Sack vom Stuhl. Jammernd liege ich auf dem Boden, über mir das besorgte Gesicht von Michael und das feixende Gesicht von Pete, der sich weit über den Tresen beugt und meinen Anblick unheimlich komisch zu finden scheint. Ein zweites Mal hilft Michael mir hoch, während Pete den Tequila hochhält und fragt:
»Bist du sicher, dass du den noch willst?« Klar! Her damit!
»Ich glaube, sie hat genug«, antwortet Michael an meiner statt. Na, da hört sich doch alles auf. Ist Sophia jetzt inkognito hier oder was ist los?
»Einen Doppelten«, krakeele ich und klammere mich an Michael fest. Der hat mir gar nichts zu sagen. Herausfordernd gucke ich ihn an. Was gar nicht so einfach ist, bei so viel Alkohol im Blut verliere ich leicht die Kontrolle über meine Augen und fange an zu schielen. Mit aller Konzentration fixiere ich den Kerl, der da glaubt, mich bevormunden zu können. Er hat kurz geschnittenes, lockiges Haar, sanfte braune Augen, eine schmale gerade Nase und verführerisch geschwungene Lippen. Hmmmm! Trotzdem darf er mir nicht so kommen. »Was dagegen?«, herrsche ich ihn an. Er guckt ganz ruhig zurück, nimmt meine Hand und sagt:
»Was ist denn mit dir los, Helen?« Augenblicklich fängt meine Unterlippe an zu zittern. Verdammt! Ich bemühe mich, meine Gefühle und Unterlippe wieder unter Kontrolle zu bekommen - mit leidlichem Erfolg. Der schließlich völlig zunichte gemacht wird, als Michael mir leicht seine Hände auf die Schultern legt und sanft sagt:
»Ist schon okay. Du kannst ruhig weinen.« Meiner Kehle entfährt ein Schluchzer, ich breche hier und jetzt in den Armen eines wildfremden Mannes zusammen und heule wie ein kleines Kind, den Kopf an seine breite Brust gelehnt. Mann, tut das gut. Der Zyniker in mir erklärt mir natürlich, dass ich jetzt nicht umhinkommen werde, mit Michael ins Bett zu gehen, aber das ist mir total egal. Von mir aus. Es tut so gut, von ihm im Arm gehalten zu werden, außerdem sieht er ziemlich klasse aus und Jan könnte ich noch richtig eins reinwürgen damit, dass ich mit einem anderen geschlafen habe. Das hat er ja schließlich auch getan. Genau das!
Nachdem ich schätzungsweise einen Liter Flüssigkeit verloren habe, löse ich mich langsam wieder von Michael. Verlegen starre ich auf sein ehemals hellblaues Oberhemd, das jetzt einen feuchten grauen Wimperntuschen-Tränen-Fleck aufweist.
»Macht nichts«, sagt er wegwerfend. Ich krabbele wieder auf meinen Hocker, und im gleichen Moment knallt Pete mir den doppelten Tequila vor die Nase. »Möchtest du drüber reden«, fragt Michael mich sanft. Ich zögere kurz und entscheide mich dann dagegen. Ich kann doch diesem Mann nicht erzählen, dass ich eine Frau bin, nach der Männer schwul werden. Und außerdem, daran halte ich fest, ist da noch nicht das letzte Wort gesprochen. Wie gesagt, ist doch nur eine Phase. Und wenn Jan wieder zur Vernunft gekommen ist, würde er es bestimmt nicht schätzen, wenn ich in der Welt rumposaunt hätte, dass er ne Schwuchtel ist. Verzeihung, war nicht abwertend gemeint.
»Danke, es geht schon«, schniefe ich und versuche ein leichtes Lächeln. Dann greife ich nach dem Schnapsglas vor mir. Bei dem bereits erreichten Pegel verzichte ich auf Orange und Zimt und stürze das Zeug einfach pur herunter. Michael schüttelt es sichtlich bei diesem Anblick.
»Ist ja nicht zu fassen, was in so eine kleine Person alles reingeht«, sagt er ehrlich erstaunt, »mich wundert, dass du überhaupt noch einen vernünftigen Satz rausbekommst.« In diesem Moment beginnt die Welt um mich herum, sich zu drehen. Erst langsam, dann immer schneller und schneller, dazu kommt jetzt auch noch eine horizontale Wellenbewegung wie bei diesen ganz gemeinen Kirmeskarussells, in denen einem sofort die Zuckerwatte wieder hochkommt. Verstört blicke ich Michael an, sein Gesicht wabert auf und ab und wird plötzlich ganz groß. Ach so, er kommt auf mich zu.
»Miiihiiissss.« Plötzlich habe ich meine Zunge nicht mehr unter Kontrolle. »Miiihhiiisssss schlächch«, versuche ich es erneut, aber keine Chance. Oh Gott, ist mir plötzlich übel. Wenn diese verdammte Kneipe bloß aufhören würde, sich zu drehen. Zum dritten Mal an diesem Abend kippe ich vom Stuhl und hänge erneut in Michaels Armen. Na, macht nichts, sein Hemd ist ja eh schon ruiniert.
»Okay, ich glaube, du musst jetzt dringend ins Bett«, höre ich Michael über meinem Kopf sagen. Hab ich’s doch geahnt. Jetzt will er mich abschleppen.
»Nichchchchmimia«, versuche ich ihm klar zu machen. Er guckt verständnislos und klemmt mich unter den Arm. Da hänge ich nun also und gucke mir interessiert die bunten Lämpchen an, die um den Ficus in der Ecke geschlungen sind. Hübsch. Wie aus weiter Ferne höre ich Pete sagen:
»Also, dein Martini macht fünf Euro und die Lady hatte vier Weißwein und sieben Tequila, macht … zweiundvierzig Euro.«
»Okay!« In diesem Moment sehe ich eine behaarte Männerhand, die sich meiner Handtasche nähert, die noch immer über dem Barhocker hängt. Als sie nur noch wenige Zentimeter davon entfernt und ihre Absicht eindeutig ist, werfe ich mich mit einem Hechtsprung nach vorne und reiße die Tasche an mich. Puh, gerade noch rechtzeitig. Erleichtert presse ich die Beute an meine Brust.
»Helen, gib mir deine Tasche, damit ich deine Rechnung bezahlen kann«, sagt Michael langsam und deutlich zu mir. Da kann ja jeder kommen. Und wenn ich in meinem jetzigen Zustand bin, dann wollen mich die Männer entweder flachlegen oder beklauen. Und dieser hier will anscheinend beides zusammen.
»Krrrichchchssssuniiicccchhh«, sage ich bestimmt.
»Du kriegst sie ja gleich wieder«, verspricht er mir und greift nach der Tasche.
»Nein«, schreie ich so laut ich kann. Alle Köpfe drehen sich in unsere Richtung und Michael zieht schnell die Hand zurück. Er guckt mich wütend an und greift dann nach seinem eigenen Portemonnaie. Klar ist er jetzt sauer, schließlich habe ich ihm die Tour vermasselt. Allerdings mag ich es nicht, wenn jemand böse mit mir ist. Michael knallt einen Fünfzig-Euro-Schein auf den Tresen.
»Stimmt so. Tschüß.« Er schnappt sich seine Jacke und zieht sie an.
»Hey, was ist denn mit ihr?«, fragt Pete. Ich stehe da wie bestellt und nicht abgeholt. Michael guckt mich so kalt an, dass mir die Tränen in die Augen steigen. Eben hat er mich doch noch so liebevoll im Arm gehalten. Ich lehne mich gegen ihn und gucke ihn von unten herauf (er muss mindestens ein Meter fünfundachtzig sein) treuherzig an.
»Na schön«, knurrt er dann auch, »ich setze sie in ein Taxi.« Halb schleift er mich, halb trägt er mich aus der Kneipe hinaus und auf die Straße.
Ist ja stockduster mittlerweile. Und ganz schön kalt. Fröstelnd ziehe ich die Schultern hoch. Nüchtern macht mich die frische Luft allerdings nicht.
»Also, wo wohnst du?«, fragt Michael mich und winkt gleichzeitig ein Taxi herbei. »Wo du wohnst, will ich wissen.« Wo ich wohne? Gute Frage! Es fällt mir im Moment partout nicht ein. Ich weiß, dass ich mal in der Helenenstraße in Altona gewohnt habe. Helenenstraße 12. Das war meine erste eigene Wohnung vor zehn Jahren. Jawoll! Dann bin ich umgezogen. Und wohin? Angestrengt lege ich die Stirn in Falten, aber ich komme einfach nicht drauf. Das Taxi hält neben uns und Michael sieht mich erwartungsvoll an. Ich finde es gerade wahnsinnig komisch, plötzlich obdachlos zu sein und fange an zu gackern.
»Jetzt sag schon«, fährt Michael mich genervt an.
»Weeeiiißßnnichh«, pruste ich.
»Wird ja wohl auf deinem Perso stehen«, sagt er und greift nach meiner Tasche. Sofort versteife ich mich, kralle meine Nägel in das schwarze Leder und sehe ihn drohend an.
»Was ist denn nu?«, erklingt es gereizt vom Fahrersitz des Taxis.
»Schon gut«, sagt Michael und schiebt mich auf den Rücksitz, »dann kommst du eben mit zu mir. Osterstra ße 30«, ruft er nach vorne. Jetzt klingt er schon wieder so böse, dabei sollte er sich doch eigentlich freuen, dass ich mit zu ihm komme, oder? Ich betrachte ihn interessiert von der Seite und lehne mich gegen seine Schulter, um mich wieder bei ihm einzuschmeicheln. Ich betrachte sein Profil. Es ist richtig schön, klassisch-griechisch. Jan wird wahnsinnig eifersüchtig sein, wenn ich mit diesem Mann schlafe. Fragt sich nur, ob auf ihn oder auf mich. Schluchz. Im Moment macht Michael allerdings keine Anstalten, mit mir zu knutschen oder so, aber das ist mir eigentlich ganz recht. Der Taxifahrer legt sich ziemlich rasant in jede Kurve, und um mich herum dreht sich schon wieder alles. Ich mache lieber kurz die Augen zu und konzentriere mich auf den Punkt zwischen meinen Augenbrauen.
2.
Vorsichtig öffne ich mein linkes Auge. Ein Lichtstrahl findet den Weg durch die noch halb geschlossenen Lider, durch meine Pupille auf die Netzhaut und weiter bis in die Mitte meines Schädels, wo er eine wahre Schmerzexplosion verursacht, die mich aufstöhnen lässt. Schnell presse ich die Augen wieder fest zu und warte ab, bis sich die Wellen des Schmerzes geglättet haben. Ich versuche, einen klaren Gedanken zu fassen. Warum tut mir der Kopf so weh? Was ist passiert? Wie spät ist es? Welchen Tag haben wir heute? Welches Jahr? Etwas kratzt mich am Kinn. Ich taste mit den Fingern danach und stelle fest, dass ich unter einer ziemlich verfilzten dunkelblauen Wolldecke liege. Was ist denn bloß über Nacht aus meiner wundervollen, neuen silbernen Satinbettwäsche geworden? Langsam kommen mir unzusammenhängende Bilder von gestern Abend in den Sinn. Das Café Real, die Verlobungsringe, Jans Coming-out. Und da war doch noch jemand, wie hieß er noch gleich? Vor meinem inneren Auge erscheint ein bis zum Rand gefülltes Schnapsglas mit einer goldenen Flüssigkeit darin. Tequila. Bei diesem Gedanken dreht sich mir der Magen um, ungeachtet des Kopfschmerzes öffne ich meine Augen, presse mir die Hand vor den Mund und suche hektisch nach irgendetwas, in das ich mich übergeben kann. Gott sei Dank brauche ich nicht lange zu suchen: Direkt neben der Couch auf der ich liege steht ein himmelblauer Zehn-Liter-Eimer, der mir, dem Inhalt nach zu schließen, anscheinend heute Nacht schon einmal zu Diensten stand. Würg! Im wahrsten Sinne des Wortes.
Nachdem ich mich entleert habe, sinke ich stöhnend zurück und lasse meine Augen sehr vorsichtig durch den mir fremden Raum wandern. Ein gerahmtes Poster der Skyline von New York hängt genau über dem Sofa, gegenüber steht ein riesiger Fernseher mit Videorekorder, DVD-Player und noch allerlei Gerätschaften. Mannshohe Boxen in jeder Ecke, ein gläserner Esstisch mit vier extravaganten türkisfarbigen Stühlen, zwei Sitzsäcke auf dem Fußboden, daneben ein Couchtisch mit Zeitschriften. Spiegel, Stern, Auto, Motor und Sport. Eindeutig ein Männerwohnzimmer. Petes Wohnzimmer. Nein, Michael hieß er doch, oder? Und wer bitte schön ist Pete? Was zum Teufel ist passiert? Ach, ich weiß, er wollte meine Tasche klauen. Und dann saßen wir plötzlich im Taxi. Ganz eindeutig hat er meinen Zustand ausgenutzt und mich in seine Wohnung verschleppt. Das ist doch die Höhe! Mein Blick fällt auf ein paar Stoffstücke auf dem Boden neben mir, die unschwer als meine Bluse und Hose zu identifizieren sind. Oh nein, bitte nicht! Mit der Hand fahre ich unter die Decke und taste meinen Körper ab. Er steckt in einem riesigen T-Shirt. Den Slip habe ich noch an, aber das will wirklich nichts heißen. Vorsichtig befühle ich meinen Schritt. Hm, nichts Außergewöhnliches festzustellen. Besonders wild scheint es nicht zugegangen zu sein. Oder der Mann ist trotz seines Körperbaus dort unten eher im Lande Liliput ausgestattet worden. Oh Gott, ich kann es nicht glauben. Ich kann mich an nichts, an gar nichts erinnern. Was ist bloß los mit mir? Ich nehme doch nicht mal die Pille. Haben wir ein Kondom benutzt? Was, wenn nicht? Ungewollte Schwangerschaft, Aids, Tripper, Herpes. Horrorszenarien schießen mir durch den Kopf. Wie kann man nur so die Kontrolle verlieren? Mein Gott, ich bin neunundzwanzig Jahre alt. Ist mir schlecht. Mühsam setze ich mich auf. Beim Anblick des gut gefüllten Eimers neben mir wird mir noch ein bisschen schlechter. Ich ziehe mir das T-Shirt über den Kopf und angle nach meinen Klamotten auf dem Fußboden. Sie sind natürlich völlig zerknautscht. Na toll. Damit mir auch jeder auf der Straße ansieht, dass ich von einem One-Night-Stand nach Hause wanke. Am liebsten würde ich mich jetzt einfach so schnell es geht von dannen schleichen, aber ich kann meine Kotze hier nicht einfach so stehen lassen. Auch wenn dieser Michael das vielleicht verdient hatte. Wo steckt der eigentlich? Ich halte die Luft an und greife nach dem Eimer. Dann gehe ich zur Tür und betrete einen lang gezogenen Flur, der mit graublauem Teppich ausgelegt ist. Drei Türen gehen davon ab, alle geschlossen. Ich öffne eine von ihnen, und siehe da, es ist das Badezimmer. Ich entsorge also meinen Mageninhalt, spüle den Eimer im Waschbecken aus und meinen Mund gleich mit und sehe mich dann im Spiegel an. Die Haut ist fahlgelb, auf der Stirn wächst ein riesiger Pickel und meine Augen sind so geschwollen, als hätte ich die ganze Nacht durchgeheult. Habe ich das? Das Make-up ist verschmiert, die Haare am Ansatz fettig und in den Spitzen zerzaust. Ein Albtraum. Wenn ich so von einem meiner Kunden gesehen würde, könnte ich mir sofort einen anderen Job suchen. Denn ich bin eine Typberaterin. Einkaufsgehilfin, Stylistin, manchmal persönliche Trainerin, was immer Sie brauchen, um sich selbst zu verbessern, zu perfektionieren, kurz: um das Beste aus sich rauszuholen. Das bin ich. Vielleicht sollte ich ein Foto von mir in meinem jetzigen Zustand machen, die Augen hinterher mit einem schwarzen Balken abdecken und das Bild meinen Kunden als abschreckendes Beispiel dessen zeigen, was Alkohol aus einem Menschen machen kann. Ach nein, lieber nicht. Mir fehlt sowieso der Elan zu irgendetwas. Wahrscheinlich werde ich nie wieder arbeiten. Jan schleicht sich wieder in meine Gedanken. Dieser Mistkerl! Er ist an allem schuld! Wenn ich mir bei diesem Michael jetzt eine Geschlechtskrankheit eingefangen habe, dann werde ich Jan persönlich dafür zur Verantwortung ziehen. Ich will lieber nicht daran denken, wie einen Syphilis-Ausschläge entstellen können. Von den tödlichen Folgen mal ganz abgesehen.
Ich lasse den Eimer mitten im Raum stehen und verlasse das Bad. Eigentlich wollte ich zurück ins Wohnzimmer, mir meine Tasche schnappen und abhauen, doch plötzlich stehe ich mitten in einer urgemütlichen, weiß-blauen Küche. Es duftet nach frisch gebrühtem Kaffee und getoastetem Weißbrot. Vier Augen, zwei dunkelbraune und zwei blaue, sehen mich an und vier Zahnreihen (sehr weiß, bestimmt gebleicht) entblößen sich bei meinem Anblick. Michael und …?
»Das ist Nick.« Einen Mitbewohner hat er also auch noch. Und der hat wahrscheinlich alles gehört. Oder selber mitgemischt? Ich wünschte, ich könnte mich an irgendetwas erinnern. Oder nein, vielleicht doch besser nicht.
»Hallo«, murmele ich verschämt. Nick erhebt sich halb von seinem Hocker, reicht mir die Hand und streicht sich dabei mit der anderen eine rotblonde Locke aus der Stirn.
»Freut mich.«
»Komm, setz dich«, sagt Michael freundlich und schiebt mir einen Hocker hin, »möchtest du Kaffee?« Etwas verunsichert stehe ich in der Gegend herum. Ich habe keinerlei Erfahrung mit solchen Situationen. Eigentlich möchte ich nur so schnell wie möglich hier verschwinden. Mein Blick fällt auf die gelbe Wanduhr. Fast halb zehn. Unter der Uhr steht eine Kaffeemaschine. Ein richtiges High-Tech-Gerät mit allem Drum und Dran. Zaubert bestimmt ganz tollen Schaum. Na schön, ein schneller Kaffee, was soll’s? Ach du Schande. Siedend heiß fällt mir Frau Biergarten ein, mit der ich in einer guten halben Stunde verabredet bin. Beruflich, versteht sich. Verdammt! Es handelt sich um einen ersten (und damit ungeheuer wichtigen) Termin. Stellt sich die Frage, was schlimmer ist: alles eine halbe Stunde vorher platzen zu lassen oder aufzukreuzen und auszusehen, als hätte man die ganze Nacht gesoffen und sich von einem Fremden durchvögeln lassen.
»Ich muss kurz telefonieren. Mach mir doch schon mal nen Kaffee«, sage ich zu Michael, der ob meines unbeabsichtigten Befehlstons erst ein verblüfftes Gesicht macht und dann mit rauchiger Stimme sagt:
»Natürlich, Meisterin, kommt sofort! Zu Ihren Diensten bei Tag und bei Nacht.« Er wirft Nick ein breites Grinsen zu und wendet sich der Kaffeemaschine zu. Irritiert starre ich auf seinen breiten Rücken. Was zum Teufel ist hier heute Nacht abgegangen? Helen, Frau Biergarten wartet. Oh, richtig, danke, Sophia. Ich werde mich jetzt sofort darum kümmern. Ich stolpere aus der Küche, nehme die nächste Tür, aha, das hier ist das Wohnzimmer und krame in meiner Tasche nach meinem Handy. Ich habe nicht mal eine Mobilfunknummer von Frau Biergarten. Aber nach dem zweiten Klingeln geht sie an ihr Festnetztelefon. Gott sei Dank!
Vollständige Taschenbuchausgabe 09/2006
Copyright © 2005 by Jana Voosen Copyright © 2006 by Wilhelm Heyne Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH
Umschlagfotos: © Stewart Cohen/getty images © Jo Kirchherr/mauritius images
eISBN : 978-3-641-03402-3
http://www.heyne.de
Leseprobe
www.randomhouse.de