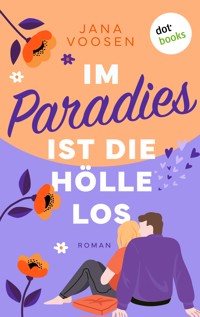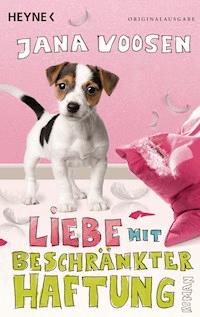Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Broken World
- Sprache: Deutsch
Die Geschichte von Yma und Len geht weiter! Nach ihrer Flucht ist Yma untergetaucht und lebt unter falscher Identität. Doch das Regime duldet keine Systemgegner. Sie werden sie jagen. Und was Yma droht, wenn ihre Häscher sie entdecken, ist schlimmer als der Tod.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 346
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Jana Voosen
Broken World 2
Wer willst du sein?
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
FSK ab 16
Was bisher geschah:
Prolog
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
Epilog
Impressum neobooks
FSK ab 16
Einige Szenen in diesem Buch könnten auf manche Leser*innen verstörend wirken.
TW: Gewalt, Blut, Ausbeutung, Prostitution, Ekel (Musophobie)
Was bisher geschah:
In Vahvin, dem Zusammenschluss der ehemaligen europäischen Staaten, herrscht das Gesetz des Stärkeren.
Ohne soziales Netz und medizinische Versorgung spaltet sich die Gesellschaft in zwei Klassen. Herrscher und Dienende, Reiche und Arme, Gesunde und Kranke.
Yma, ein Mädchen aus der Unterschicht, hat sich hochgekämpft und könnte bald, zusammen mit ihrem Freund Adriel, zur Elite gehören. Sie ist Klassenbeste, sie ist gesund, sie gehorcht dem System.
Doch Yma ist anders als die meisten Menschen. Sie kann Mitleid empfinden, und das ist in Vahvin verboten. Helfen ist Hochverrat.
Auf ihrem Weg an die Spitze begegnet Yma dem geheimnisvollen Len. Sie folgt ihm und ihrem Herzen in den Untergrund, wo sie gemeinsam gegen das System kämpfen und Menschen in Not helfen. Doch wer den Pfad der Elite verlässt, begibt sich in Lebensgefahr. Yma und Len werden gefangen genommen und vor die Wahl gestellt: Tod in einem Vernichtungslager, oder Probanden für eine neu entwickelte Droge werden, die den Menschen ihr Mitgefühl nimmt.
Yma gelingt die Flucht, weil Len sich für sie opfert. Er lenkt die Wachen auf dem Schiff ab, das sie beide ins Lager bringen soll. Mitten im offenen Meer schwimmend muss Yma hilflos zusehen, wie ihr Geliebter entschwindet, seinem sicheren Tod entgegen …
Prolog
Meine Lungen brennen und mein rasendes Herz schmerzt in der Brust. Noch immer höre ich seine Rufe.
„Yma! Yma! Wo ist sie? Bitte helfen Sie ihr. Sie kann nicht schwimmen! Yma!“
Doch seine Stimme ist nur in meinem Kopf. Len ist weit weg. Und mit jedem Zug, den ich schwimme, streben wir noch weiter auseinander. Es ist eine schier übermäßige Kraftanstrengung weiterzumachen, und das liegt nicht an dem kalten Wasser. Nicht an meiner nassen Kleidung, die mich schwer hinabzieht. Noch nicht einmal an meinen Muskeln, die zwar gut trainiert, aber durch die Tage meiner Gefangenschaft – wie viele Tage waren es? – steif und unbeweglich geworden sind. Es liegt an Len. An der magnetischen Anziehungskraft, die er auf mich ausübt. Schon länger, als es mir überhaupt bewusst war. Viel zu abgelenkt war ich von all dem Elend, das uns umgab. Das wir zu lindern versuchten. Kein Platz für romantische Gefühle. Und doch …
Ich liebe dich, Len.
Immer wieder hat es mich zu ihm hingezogen, ich habe alles riskiert, um ihm nahe zu sein. Um seinen Kampf, nein, um unseren Kampf zu kämpfen. Gegen das System, das so grausam die Schwachen und Kranken im Stich lässt. Das uns Mitgefühl und Hilfeleistungen bei Strafe verbietet. Es war die beste Zeit meines Lebens.
Schwimm, Yma, schwimm. Nicht nachlassen.
Wir haben geholfen. Wir haben Leben gerettet. Sie haben uns erwischt. Höre ich noch immer die Motoren des Bootes, das Len ins Gefangenenlager bringt, oder bilde ich mir das nur ein?
Helfen Sie ihr! Sie kann nicht schwimmen!
Er ist so klug. Wahrscheinlich hätten sie die Suche nach mir nicht so schnell aufgegeben, wenn Len nicht so geistesgegenwärtig gewesen wäre. Sie würden noch immer ihre Kreise ziehen und ziellos ins Wasser schießen. Stattdessen haben sie sich darauf verlassen, dass ich untergegangen und ertrunken bin.
Die Muskeln meiner Arme erlahmen, viel schneller als ich es von meinem morgendlichen Schwimmtraining gewohnt bin. Kein Wunder. Die letzten Tage waren nicht gerade das, was man eine gute Vorbereitung auf mehrere Kilometer Freiwasserschwimmen nennen kann. Zu wenig Wasser, kaum etwas zu essen. Und die Folter.
Als ich daran denke, fängt meine nackte Kopfhaut an zu brennen. Das Salzwasser sticht in den Wunden. Das Gesicht meines Peinigers erscheint vor meinem inneren Auge. Sein Lächeln, als er Strähne für Strähne meiner roten Haare um seine Finger wickelt, bevor er sie mir ausreißt. Sie vor meinem Gesicht baumeln lässt, damit ich sehen kann, dass Fetzen meiner Kopfhaut daran hängen. Mein Hals wird plötzlich eng. Verzweifelt ringe ich nach Luft, spüre eine Panikattacke heranrollen.
Ich drehe mich auf den Rücken und breite die Arme aus. Konzentriere mich auf meine Atmung und versuche, das Bild meiner Skalpierung zu vertreiben. Es ist vorbei. Ich lebe und bin, so merkwürdig es sich anhört, frei. Freier als Len, der auf dem Weg in ein Gefängnis ist, in dem man die Insassen auf grausame Art und Weise langsam verhungern lässt. Als Strafe für ihre Sünde. Diese Sünde heißt Mitgefühl.
Der Gedanke an den todgeweihten Len trägt nicht dazu bei, meine Panik zu mildern. Ich sehe hinauf in den strahlendblauen Himmel. Die Sonne scheint auf mich herab, ich kann ihre Wärme spüren, obwohl es hier im Wasser eisig kalt ist. So entsetzlich kalt. Ich schließe die Augen, konzentriere mich ganz auf das helle Rot hinter meinen Lidern und auf die Kraft der Sonnenstrahlen. Wie ein Stück Treibholz schwebe ich im Wasser, sanft geschaukelt von den Wellen. Mein Atem wird ruhiger. Ich hebe den Kopf. Das Boot ist schon lange nicht mehr zu sehen. Bis zum Festland ist es nicht mehr weit. Ich habe nicht die leiseste Ahnung, was ich tun werde, wenn ich dort angelangt bin.
1
Zwei Monate später:
Der kühle Satinstoff der Bettdecke fühlt sich gut an auf meiner Haut. Ich räkele mich behaglich und schlinge den Arm um den Mann neben mir. Lege meine Wange an seinen nackten Rücken. Die morgendlichen Sonnenstrahlen scheinen durch das Oberlicht direkt auf uns herab, anscheinend habe ich gestern Abend mal wieder vergessen, die Rollläden zu schließen. Ich kann nur hoffen, dass Adriel davon nicht wieder maximal genervt ist. Er ist ja so ein Morgenmuffel. Ich richte mich halb auf und schaue durch die gläserne Tür auf unsere Dachterrasse. Erfreue mich an den leuchtenden Regenbogenfarben der Blumen, die in Kübeln auf den hölzernen Dielen stehen. Ein wirklich paradiesisches Stückchen Erde, das da direkt vor unserem Schlafzimmer auf uns wartet. Mitten in dem Blumenmeer ein kleiner Tisch und zwei Stühle, eine Einladung zu einem gemütlichen Frühstück zu zweit bei Sonnenaufgang.
Ich höre ein lautes Gähnen und beschließe, dass es vielleicht tatsächlich noch ein bisschen zu früh ist, um aufzustehen. Stattdessen lasse ich mich zurück in die Laken fallen, kuschele mich an den warmen Körper neben mir und streichele sanft über seinen nackten Rücken.
Er stöhnt. Nicht wohlig, sondern schmerzerfüllt. Erschrocken ziehe ich die Hand zurück. Starre auf die langen, roten Striemen.
„Oh mein Gott, es … es tut mir leid“, stammele ich, als die Haut plötzlich an mehreren Stellen aufzuplatzen beginnt. Hellrotes Blut fließt über seinen Rücken, sickert in die hellblaue Bettwäsche.
„Oh mein Gott“, wiederhole ich, rolle mich blitzschnell auf die Seite und angele nach meiner Arzttasche, die griffbereit neben dem Bett steht. „Ganz ruhig, halb so schlimm, das haben wir gleich“, murmele ich, während ich mit fliegenden Fingern nach Gaze und Verbandszeug suche. Aber in der Tasche befindet sich nur Werkzeug: Schraubenzieher, Klemmleuchten, Steckschlüssel, Lötkolben und Spitzzange. „Was zum Teufel …“, frage ich, während ich mich noch immer durch die Tasche wühle.
Der Mann dreht sich zu mir um und ich starre ihn an. Fassungslos.
„Was machst du denn hier?“
„Ich versuche zu schlafen“, gibt er zurück. „Wann wirst du endlich begreifen, dass du mich nicht vor acht Uhr ansprechen sollst?“
„Du redest schon genauso wie Adriel“, schmolle ich, obwohl mein Herz plötzlich vor Freude schneller zu schlagen beginnt.
Er ist hier. Len ist hier.
„Das hier ist ja auch sein Bett“, gibt er zu bedenken.
„Du hast recht. Das ist seltsam.“
Wir sehen beide auf das riesige Schlafmöbel, in dem wir liegen, und in dem sich mittlerweile ein kleiner See aus Lens Blut gebildet hat. Dunkelrot und klebrig. Er streckt die Hand aus und taucht sie in die rote Flüssigkeit. Tiefer und immer tiefer. Sein Handgelenk verschwindet, dann sein Ellenbogen. Wenn er nicht aufhört, wird er gleich kopfüber hineinstürzen. Als er seine Schulter eintaucht, hebt er den Kopf und sieht mich von unten herauf an. In seinen schönen, dunkelgrünen Augen wechseln sich Angst und Wut in rascher Folge ab.
„Was ist denn los?“, fragt er. „Willst du mich nicht retten?“
„Hey, was ist? Kommst du endlich?“
Erschrocken fahre ich hoch. Vor dem dreistöckigen Etagenbett, in dem ich in der Mitte schlafe, steht Maya, eine meiner Mitbewohnerinnen. Sie trägt bereits ihren blauen Arbeitsoverall und sieht reichlich genervt aus. In der Hand hält sie die grobe Decke aus grauer Wolle, die sie mir weggezogen hat. Ihre übliche Art, mich zu wecken.
„Ich frage mich, was du ohne mich machen würdest“, brummt sie und lässt die Decke einfach auf den Boden fallen. „Ich bin doch nicht dein Kindermädchen.“
Es ist nett, dass sie mich weckt, egal auf welche Weise, und egal, wie schlecht gelaunt sie dabei ist. Es ist eine Art der Fürsorge, wie man sie selten antrifft. Hier, wo ich gelandet bin. Und eigentlich auch sonst überall.
„Danke“, sage ich. Automatisch fährt meine Hand als erstes hoch zu meinem Kopf. Zu der schwarzen Wollmütze, die ich trage. Tag und Nacht. Ich vergewissere mich, dass sie gut sitzt. Und alles verbirgt, was darunter ist und mich als jemanden enttarnen könnte, der in Schwierigkeiten steckt, um es mal milde auszudrücken. An einigen Stellen befinden sich kleine Krater zwischen den noch immer kurzen Stoppeln. Ich frage mich, ob dort jemals wieder Haare wachsen werden.
„Was ist, stehst du jetzt auf? Kann mir aber eigentlich auch egal sein.“
„Ja, ich stehe auf. Danke, dass du mich geweckt hast“, wiederhole ich noch einmal und klettere etwas mühsam aus dem Bett. Mein Traum klebt noch immer an mir wie flüssiger Teer und beherrscht meine Gefühlswelt.
Was ist denn los? Willst du mich nicht retten?
„So tief und fest schlafen wie du würde ich auch gerne mal“, sagt Maya. Sie verschränkt die Arme vor der Brust und beobachtet mich dabei, wie ich mich umziehe. Oder vielmehr, wie ich mich anziehe. Den Arbeitsanzug ziehe ich einfach über die Sachen, in denen ich schlafe. Im Gegensatz zu Mayas ist mein Overall grün. Und passt hervorragend zu meinen Katzenaugen, wie mir einer der Vorarbeiter einmal gesagt hat. Dann hat er mir an den Hintern gefasst. So ist das hier.
Ich verzichte darauf, Maya zu sagen, dass sie sich meinen Schlaf - und vor allem meine Träume - ganz sicher nicht wünscht, als es in ihren hellblauen Augen in dem dunklen Gesicht zu glitzern beginnt. „Diesen Len, von dem du immer träumst, würde ich zu gerne mal kennenlernen“, sagt sie.
Ich kann nicht verhindern, dass ich bei der Nennung seines Namens zusammenzucke.
„So wie du immer stöhnst und schreist, scheint der´s dir ja echt gut zu besorgen.“
Ich beiße mir auf die Unterlippe. Soll sie glauben, was sie will. Solange sie nur nicht die Wahrheit kennt.
„Irgendwie kann ich sogar verstehen, dass du morgens nicht aufwachen willst.“ Ihr Ausdruck verändert sich, wird weicher. „Ist doch ein Scheißleben, das wir hier führen. Jetzt komm schon. Sonst fahren sie ohne uns.“
„Ja. Ich komme.“
Im Rausgehen wendet sie sich nochmal um.
„Ach übrigens, Winona. Das muss dir nicht peinlich sein. So ist das nun mal, wenn man mit zwölf Mädels in einem Zimmer pennt. Da gibt es keine Geheimnisse.“
Ich nicke und kontrolliere ein letztes Mal den Sitz meiner Mütze. Greife nach meinem Beutel. Verdränge den Schmerz, der jedes Mal in mir aufflammt, wenn mich jemand mit meinem neuen Namen anspricht.
Denn es ist der Name meiner toten Mutter.
Ich bin Yma.
Ich stöhne und schreie im Schlaf, weil ich gefoltert wurde. Weil man den Mann, den ich liebe, dem Tod geweiht hat. Weil er mich in meinen Träumen wieder und wieder um Hilfe bittet, die ich ihm nicht geben kann.
Yma ist tot. Untergetaucht. Wenn sie mich finden, muss ich sterben, so wie Len. Sie werden mich verhungern lassen. Oder sie werden Bruak damit beauftragen, mein Leben zu beenden. Schneller als der Hungertod. Aber vermutlich so langsam wie möglich. Ich kann nur hoffen, dass Maya unrecht hat. Dass ich mein Geheimnis bewahren kann.
2
Draußen vor dem riesigen Betonklotz, in dem sich das Wohnheim befindet, warten schon die Busse. Und Hunderte von Menschen in Arbeitsanzügen. Sie haben unterschiedliche Farben, für jeden Arbeitsschritt eine andere. Dunkelrot, orange, blau, türkis, grün. Es ist ein buntes Gewusel, das so gar nicht zu der kargen, grauen Umgebung passt, in der wir uns befinden. Ein paar knorrige Bäume, krumm gewachsen, in trockener, steiniger Erde, die links und rechts die breite, endlos erscheinende Straße säumt. Die Sonne geht gerade erst auf. Es ist kalt. Fröstelnd schlinge ich beide Arme um mich. Während die Menschen in die Busse drängen, gehe ich zu dem Kaffeehäuschen neben der Haltestelle. Juri, der Besitzer, scheint der einzige zu sein, der heute Morgen nicht nur hellwach, sondern auch gut gelaunt ist.
„Guten Morgen“, sagt er und grinst mich an.
„Guten Morgen“, gebe ich zurück und krame in meinem Beutel nach einem Geldschein.
„Kaffee?“, fragt er unnötigerweise, denn etwas Anderes
gibt es bei ihm nicht zu kaufen. Einfach nur Kaffee. Aus der Filtermaschine. Schwarz und scheußlich. Sehnsuchtsvoll gestatte ich mir einen kurzen Gedanken an das Café Bohème in meinem früheren Wohnblock. Wo ich im Luxus gelebt habe, bevor alles den Bach runterging. Alleine die unterschiedlichen Kaffee-Kreationen, von Cold Drip über Dargona bis hin zu Mélange füllten dort eine ganze Speisekarte. Und erst das Frühstücksgebäck. Croissants, Zimtschnecken, belegte Panini, Bananabread. Mein Magen knurrt so laut, dass wahrscheinlich sogar Juri es hören kann.
„Na?“, fragt der ungeduldig.
„Ja, natürlich. Was denn sonst?“, gebe ich im gleichen
Tonfall zurück und werfe einen besorgten Blick in Richtung Haltestelle, wo nur noch zwei Busse stehen.
Er reicht mir einen dampfenden Pappbecher. „Wohl bekomms!“
„Ich fürchte nicht“, sage ich und gebe ihm einen zerknitterten Schein. Zwei Creds. Ein absoluter Wucher für die Plörre, die er uns andreht. Aber wie überall regelt auch hier die Nachfrage das Angebot und Juri verdient sich vor den Arbeiterunterkünften jeden Morgen eine goldene Nase.
Ich nehme den Becher entgegen, will mich schon abwenden, als ich es mir anders überlege.
„Ich nehme noch einen“, sage ich und schiebe schweren Herzens einen weiteren Schein über den Tresen.
Die Kaffeebecher vorsichtig in den Händen balancierend, um nicht einen einzigen Tropfen der widerlichen und doch so kostbaren Flüssigkeit zu verschütten, gehe ich so schnell wie möglich zu dem einzigen noch verbleibenden Bus, in den gerade die letzten Arbeiterinnen einsteigen. Die hintere Tür schließt sich bereits und ich eile nach vorne zum Fahrer.
„Nicht zumachen. Ich komme schon.“ Ich steige die Stufen hoch. „Danke. Und guten Morgen“, sage ich zu dem Busfahrer, der mich aus blutunterlaufenen Augen ansieht. Entweder hat er zu viel getrunken oder er ist todmüde. Vermutlich sogar beides. Schöne Aussichten, wenn man bedenkt, dass wir für die nächste Stunde auf Gedeih und Verderb seinen Fahrkünsten ausgeliefert sind. Ich blicke hinunter auf die Becher in meiner Hand und zögere nur eine Sekunde. Dann halte ich ihm den Kaffee entgegen.
„Hier. Für Sie.“
Er starrt erst das dampfende Getränk und dann mich an. Seine Augenbrauen ziehen sich über der Nasenwurzel zusammen.
„Was soll ‘n das?“, fragt er.
„Ich würde gerne heil ankommen. Also nehmen Sie schon“, sage ich.
Er zuckt mit den Achseln, greift nach dem Becher und nimmt einen Zug. Schüttelt sich.
„Scheußlich.“
„Was Sie nicht sagen.“
Er trinkt trotzdem weiter und sieht tatsächlich ein bisschen frischer aus. Das hoffe ich jedenfalls. Ich erwarte keinen Dank und könnte darauf wohl auch lange warten. Stattdessen gehe ich die Bankreihen entlang bis nach hinten durch, während sich der Bus in Bewegung setzt. Ich sehe in müde Gesichter, die über den farbenfrohen Krägen ihrer Anzüge noch blasser und durchscheinender wirken als ohnehin schon. Wie erwartet sitzt Maya in der letzten Reihe. Der Platz neben ihr ist leer. Ich setze mich, ohne dass sie mich eines Blickes würdigt, und sehe auf den Becher in meiner Hand. Er war eigentlich für Maya bestimmt, als Dankeschön, weil sie mich geweckt hat. Mit einiger Mühe widerstehe ich der Versuchung, ihn trotzdem für mich zu behalten, und reiche ihn ihr.
„Hier. Für dich.“
Sie greift danach wie eine Ertrinkende. Leert den Becher zur Hälfte in nur einem Zug. Verzieht nicht einmal das Gesicht. Nein, stattdessen tritt ein Ausdruck des Entzückens in ihre Augen. Als hätte sie gerade den ersten Schluck eines Bohème-Spezial genommen, jenem Mocca mit Vanillearoma und aufgeschlagener Sojasahne, den ich früher so gerne getrunken habe. „Ah. Das tut gut. Und was ist mit dir?“
„Ach!“ Ich mache eine wegwerfende Handbewegung. „Ich bekomme sowieso nur Bauchschmerzen von dem Gesöff.“
Sie zieht die Augenbrauen in die Höhe und nimmt einen weiteren Schluck. „Ich frag mich echt, wie du Mimose es bis hierher geschafft hast“, sagt sie. Es klingt nicht abwertend. Sondern ehrlich erstaunt. „Wovon du alles Bauchweh und Dünnschiss bekommst.“
Ich verziehe das Gesicht. „Ich habe einen empfindlichen Magen, das ist alles.“
„Empfindlicher Magen?“ Sie schüttelt ungläubig den Kopf. „Wer kann sich denn bitte sowas leisten? Man muss doch froh sein, wenn man überhaupt was zu Fressen hat.“
Da hat sie allerdings recht. Hier muss man darüber tatsächlich froh sein. Ich beginne, in meinem Beutel zu kramen und finde einen zerquetschten Müsliriegel, den ich vorsichtig aus seiner Verpackung pule und mir stückchenweise in den Mund schiebe. Als ich Mayas Blick auf mir spüre, wende ich mich zu ihr um.
„Ist irgendwas?“
Sie schüttelt den Kopf. „Nein, nichts. Es ist nur …“. Sie legt die Stirn in Falten und scheint angestrengt nachzudenken. Dann zuckt sie mit den Schultern. „Weiß auch nicht. Irgendwie hab ich immer das Gefühl, du gehörst hier gar nicht her. Alleine wie du diesen Müsliriegel isst. Oder wohl eher verspeist.“ Sie grinst. „Voll etepetete.“
„Ich will einfach lange etwas davon haben“, verteidige ich mich, während mir gleichzeitig heiß und kalt wird. Denn sie hat ja recht. Ich gehöre nicht hierher. Nach Ansicht der Regierung gehöre ich ins Gefängnis. Und wenn mich nach zwei ganzen Monaten immer noch ein Müsliriegel verraten kann, dann sollte ich wirklich an mir arbeiten.
„Und wie du hier mit Geschenken um dich schmeißt“, fährt Maya fort und hält zum Beweis ihren Becher hoch, „das ist doch nicht normal.“
„Kann ich ja auch demnächst sein lassen“, sage ich brüsk. „Und im Übrigen schmeiße ich nicht mit Geschenken um mich. Ich wollte mich bloß bei dir bedanken.“
Schon wieder dieses Blitzen in ihren Augen.
„Weil du mir den Arsch gerettet hast“, füge ich deshalb hinzu und komme mir gleichzeitig vor wie ein Kind, das allen Mut zusammennimmt, um seine Eltern mit dem Ausruf „Kacka“ zu schockieren. Die Wirkung bleibt aus. Maya grinst nur wissend und nickt.
„Ja, ja“, sagt sie. „Schon klar.“
Um kurz vor sieben halten wir vor den Fabrikhallen des RGE-Konzerns, strömen durch das Tor im das Gelände umgebenden Gitterzaun in Richtung Eingang. Schnelle Schritte, so, als könnten wir es kaum erwarten, endlich unsere Arbeit anzutreten. Aber das ist nur die Gewohnheit. Hier bei RGE steht ständig jemand hinter einem, um zur Eile anzutreiben. Schneller, los, mach schon, hopp hopp, nicht einschlafen! Irgendwann geht es einem in Fleisch und Blut über, sich ständig und überall zu beeilen. Sogar auf dem Weg zum Klo. Gerade auf dem Weg zum Klo. Selbst da drin, wo man ganz für sich alleine ist, treibt man sich selbst zur Eile an. Denn Zeit ist Geld. Nicht unser Geld, nein. Aber das Geld des Arbeitgebers. Und ihm sind wir alle ausgeliefert.
Der Arbeitgeber. RGE, eine Unterfirma ausgerechnet von Universo, dem Unternehmen, für das ich früher gearbeitet habe. Als ich noch ein aufstrebendes Mitglied der Elite war. Was für eine Ironie des Schicksals. Damals habe ich im Assessment-Center mit den klügsten Köpfen über neue Designs und Features für immer neue Produkte gebrainstormt. Smartpads, Laptops, Wearables. Heute löte ich Bauteile auf Motherboards für genau diese Produkte. Jeden Tag. Den ganzen Tag.
Ich erwische meine Beine dabei, wie sie ihre Schritte beschleunigen, obwohl mein Kopf etwas ganz anderes sagt. Dasselbe wie jeden Morgen.
Ich will da nicht rein. Lass uns abhauen, Yma. Ich kann da nicht noch einmal rein.
Wie jeden Tag zwinge ich die aufmüpfigen Gedanken nieder. Gehe zu den anderen Arbeiterinnen, deren Anzüge die gleiche Farbe haben wie meiner, reihe mich ein, verschwinde in diesem grünen Organismus, der seine Individuen verschluckt. Im Gleichschritt betreten wir das Produktionswerk. Endlose Reihen von Arbeitsplätzen mit Stühlen davor. Grelle Neonröhren an den Decken und Wänden. Keine Fenster, auch keine Ventilation. Der Gestank nach Luft, die schon viel zu viele Male von viel zu vielen Menschen geatmet wurde, und nach Chemikalien aus den Arbeitsprozessen riecht. Ich beiße die Zähne zusammen und setze mich an meinen Platz. Die Schicht beginnt sofort.
3
Das Schlimmste an der Arbeit ist die Eintönigkeit. Dieselben Handgriffe, immer wieder. Platine zurechtlegen, Bauteil in die entsprechende Öffnung stecken, löten, stecken, löten, stecken, löten, nächste. Zurechtlegen, stecken, löten, stecken, löten, stecken, löten, nächste. Zurechtlegen, stecken, löten, stecken, löten, stecken, löten, nächste. Die Gedanken schweifen beinahe sofort ab, ob man will oder nicht. Allerdings hat so ein Lötkolben eine Temperatur von ungefähr 380 Grad. Eine gewisse Konzentration auf die Tätigkeit ist von daher ratsam, wie ich zu Beginn mehr als einmal schmerzhaft lernen musste. Mittlerweile geht es ganz gut. Die Schmerzen im Nacken und in den verkrampften Fingern werden zu ständigen Begleitern. Aber ich bin keine Mimose. Auch wenn Maya das Gegenteil behauptet. Ist wohl alles eine Frage der Perspektive. In meinem früheren Leben galt ich als ungemein tough. Meine Mutter Winona war alleinerziehend und alles andere als reich. Auch wenn ich heute zugeben muss, dass wir von echter Armut meilenweit entfernt waren. Dennoch musste ich mir meinen Platz im Leben hart erkämpfen. Meine Schulausbildung wurde durch Stipendien finanziert, während alle meine Mitschüler aus reichen Elternhäusern stammten. In Villen mit Pools und Bediensteten lebten, statt in einer winzigen Zweizimmerwohnung so wie wir.
Ich war es gewohnt, hart zu arbeiten. Aber damit meine ich nächtelanges Büffeln in der Bibliothek. Die Vorstellung, ein Referat für den Biologieunterricht vorzubereiten, entlockt mir heute ein sehnsuchtsvolles Seufzen.
Zurechtlegen, stecken, löten, stecken, löten, stecken, löten …
Egal. In der Vergangenheit zu schwelgen, hat noch niemanden nach vorne gebracht. Mein großes Problem ist allerdings, dass ich nicht die leiseste Ahnung habe, wo vorne überhaupt sein soll. Ich stecke nicht zuletzt deshalb in meiner unglücklichen Situation fest, weil ich nicht weiß, was ich als nächstes tun soll.
Was ist denn los? Willst du mich nicht retten?
Ich sehe Len so deutlich vor meinem inneren Auge, dass sich mein Herz zusammenkrampft. Dabei erlaube ich mir tagsüber nicht oft, an ihn zu denken. Mir vorzustellen, wie es ihm geht. Denn es ist einfach zu schrecklich. Er ist in einem Gefängnis, in dem es für die Menschen nur halb so viel Nahrung gibt, wie sie eigentlich bräuchten. Ganz langsam lässt man sie verhungern. Ich kann mir keine grausamere Art vorstellen, einen Menschen umzubringen. Ob er überhaupt noch lebt? Len, der über Jahre hinweg sein Leben riskiert hat, um Menschen zu retten? Kranken und Schwachen zu helfen? Was, wenn er dort in diesem schrecklichen Gefangenenlager das Gleiche tut? Wenn er die hungrigen Augen seines Zellennachbarn nicht ertragen kann? Mit ihm sein Essen teilt, obwohl es doch sowieso schon zu wenig ist. Viel zu wenig zum Überleben.
Ich muss doch etwas tun. Ich muss ihn retten. Er bittet jede Nacht darum. Aber was soll ich machen?
Natürlich weiß ich, dass das Unsinn ist. Len bittet mich um gar nichts. Am wenigsten darum, ihn in einer Art Selbstmordkommando aus dem Gefängnis zu befreien. Schließlich war er es, der meine Flucht ermöglich hat.
Du gehst zur Reling und springst. Und dann schwimmst du. Um die Wachen kümmere ich mich. Sieh dich nicht um.
Len alleine gegen vier bewaffnete Männer. Er hatte keine Chance.
Er hat mein Leben gerettet. Und ich bin dankbar dafür. Wirklich, das bin ich. Gleichzeitig bin ich wütend. Wie konnte er? Das war nicht abgemacht. Wir wollten zusammen fliehen.
Ich liebe dich, Len.
Ich liebe dich auch, Yma.
Was habe ich jetzt von meiner Rettung? Was ist das für ein Leben? Tagein tagaus löte ich mir die Finger blutig, für einen Lohn, der gerade für das Bett in einem Zwölfer-Zimmer im Wohnheim reicht. Billige Lebensmittel. Und ab und zu einen Kaffee bei Juri.
Ich erwische mich bei dem Gedanken, dass ich lieber bei Len wäre als hier. Fühle mich gleich darauf schlecht, so zu denken. Undankbar. Als würde ich das Opfer nicht wertschätzen, das er gebracht hat. Gleichzeitig möchte ich schreien vor Wut. Ich wollte dieses Opfer nicht.
Jemand tritt an mich heran und reißt mich aus meinen Gedanken. Ich bin beinahe froh darüber, bis ich merke, dass es Kele ist. Der Vorarbeiter mit der unangenehmen Vorliebe für meine Augenfarbe. Und meinen Hintern.
„Winona“, blafft er mich an. Offensichtlich ist es nicht die Zeit zum Süßholzraspeln. Er wedelt mit einer Platine vor meinem Gesicht hin und her, so dicht, dass ich unwillkürlich vor den scharfen Kanten zurückweiche.
„Ja?“, frage ich bemüht ruhig. „Gibt es ein Problem?“
„Ja, es gibt ein Problem. An dieser Platte sind mindestens zwei Stellen unzureichend gelötet.“
„Ist ja gut“, sage ich und greife danach. „Ich korrigiere das sofort.“
„Weißt du, was passiert, wenn wir so ein fehlerhaftes Motherboard ausliefern? Was das für ein Bild auf RGE zurückwirft?“
Das Bild einer Firma, die ihre Mitarbeiter weit über ihre physischen und psychischen Grenzen hinaus ausbeutet, würde ich gerne sagen. Die sie zu einem Hungerlohn Sechzehn-Stunden-Schichten schieben lässt in einem Raum mit viel zu wenig Sauerstoff und ohne natürliches Licht.
„Wir liefern es ja nicht aus“, sage ich stattdessen. „Dazu gibt es schließlich die Funktionstests.“ Die machen die Frauen in den roten Overalls.
„Werde ja nicht frech“, schnauzt Kele mich an. Weil er weiß, dass ich recht habe. Und vermutlich auch, weil ich ihn nicht ranlasse. „Sonst sorge ich dafür, dass du noch heute mit deinem Arsch auf der Straße sitzt. Verstanden? Es gibt genug Leute, die froh darüber wären, hier arbeiten zu dürfen.“
Womit er vermutlich sogar recht hat. Die Arbeitsbedingungen sind mies, aber immerhin verdient man überhaupt ein bisschen Geld. Das Wohnheim, in dem wir untergebracht sind, ist zwar das Gegenteil von einer Luxusunterkunft. Aber genau so würde sie vermutlich jenen Menschen vorkommen, die in den Slums am Rande der Hauptstadt leben. Ich beiße mir hart auf die Unterlippe.
„Na?“, fragt Kele und sieht mich lauernd an. „Wolltest du noch irgendwas sagen?“
Ich schüttele den Kopf und strecke die Hand nach der Platine aus. Spanne sie ein und korrigiere die fehlerhaften Lötstellen. Kele steht jetzt dicht hinter mir, beugt sich zu mir herunter unter dem Vorwand, meine Arbeit genau unter die Lupe nehmen zu wollen. In Wahrheit will er einfach nur seinen Körper an meinen pressen.
„Ich behalte dich im Auge, Winona“, flüstert er mir ins Ohr. „Und du solltest dich fortan ein bisschen besser konzentrieren. Es wäre doch schade um deinen hübschen Arsch, wenn er auf der Straße landet.“
Seine Hand legt sich auf mein Knie und ich spüre, wie mir der Schweiß ausbricht. Meine Finger verkrampfen sich um den Lötkolben. Beginnen zu zittern. Seine dagegen beginnen meinen Schenkel zu kneten, langsam an der Anzughose nach oben zu wandern.
„Komm in deiner Pause in mein Büro“, sagt er schwer atmend, „du wirst es nicht bereuen.“
Ein Gefühl der Übelkeit überkommt mich. Meine Kolleginnen links und rechts sitzen nur je einen Meter von mir entfernt. Sie können alles hören.
„Nimm deine Flossen von mir oder ich ramme dir den Lötkolben ins Auge“, flüstere ich und spüre, wie sich Keles gesamter Körper versteift. Die nächsten Sekunden dehnen sich endlos. Ich halte die Luft an, spanne meine Muskeln an und wappne mich für das Kommende. Einen brutalen Schlag ins Gesicht vielleicht. Definitiv meinen Rauswurf. Was habe ich getan? Wo soll ich denn jetzt hin? Ich habe kein Geld, keinen Platz zum Schlafen, gar nichts. Aber ein kleiner Teil von mir jubiliert trotz dieser trüben Aussichten. Endlich weg von hier. Endlich frei sein.
Im Zeitlupentempo nimmt Kele seine Hand von meinem Oberschenkel. Richtet sich auf und räuspert sich. Dann wendet er sich ab und geht ohne ein weiteres Wort davon. Ich starre ihm hinterher, bis ich neben mir einen anerkennenden Laut höre. Nea, die Arbeitskollegin zu meiner Rechten, lächelt mir anerkennend zu und hebt verstohlen den Daumen. Doch der Augenblick des Triumphes verfliegt in dem Moment, als ich meinen Blick zurück auf die Leiterplatte vor mir richte. Und den Lötkolben ansetze.
4
Es ist nicht leicht, Freundschaften zu schließen an diesem Ort. Alle sind so sehr mit sich selbst beschäftigt. Mit der Arbeit und dem Elend. Sechzehn Stunden Schicht, dazu die täglichen zwei Stunden Busfahrt zu den Arbeiterunterkünften. Wir sinken völlig erschöpft ins Bett, um keine sechs Stunden später wieder aufzustehen. In der zwanzigminütigen Mittagspause schlingt man hastig sein Essen herunter, und schon geht es zurück ins Hamsterrad.
Ich würde trotzdem behaupten, dass Maya so etwas wie eine Freundin geworden ist. Es ist nur eine andere Art von Freundschaft. Man ist sich nicht ganz so egal wie alle anderen. Sie weckt mich, wenn ich verschlafe. Ich bringe ihr einen Kaffee. Solche Sachen. Nachts treffen wir uns auf dem Dach. Dort haben wir uns näher kennengelernt. Die meisten Arbeiterinnen taumeln nach der Busfahrt sofort in ihre Zimmer. Aber ich nicht. Und Maya auch nicht.
Wir steigen über eine Leiter auf das flache Dach des sechsstöckigen Gebäudes. In stillem Einvernehmen, wie schon so viele Abende zuvor. Setzen uns an den Rand und lassen die Beine baumeln. Ich lehne mich zurück und sehe hinauf in den Nachthimmel. Er ist heute wunderschön. Dunkel und sternenklar. Ich atme die frische, kalte Luft tief in meine Lungen ein, es tut so gut, dass ich weinen möchte. Eine weiße Rauchwolke schwebt an mir vorbei und ich wedele sie mit der Hand weg.
„Muss das unbedingt sein?“
Maya nickt. „Ja, allerdings.“ Trotzdem nimmt sie ihre Zigarette in die andere, weiter von mir entfernte Hand, bevor sie erneut daran zieht. Mit einem Seufzen stößt sie den Rauch aus. „Das tut gut.“
„Nein, tut es nicht“, sage ich und komme mir vor wie eine Schallplatte. „Du wirst dich damit umbringen.“
„Genau“, gibt Maya zurück und dann starren wir beide hinunter in die Tiefe. Zu den breiten Netzen, die das gesamte Gebäude auf Höhe des ersten Stockwerks umgeben. Sie hängen dort schon seit mehreren Jahren. Zu viele Leute sind gesprungen, um der Ausweglosigkeit zu entfliehen. Die Rede ist von Hunderten von Selbstmorden innerhalb weniger Jahre. Und was macht ein guter Arbeitgeber wie RGE, wenn seine Leute reihenweise in den Tod springen? Verbessert er die Arbeitsbedingungen? Erhöht er die Löhne? Nein, er spannt Netze auf. Die Botschaft ist klar: Wir scheißen auf euer Leben. Wenn ihr es beenden wollt, dann bitteschön nicht auf unserem Grundstück. Hier hat keiner Lust, die Sauerei wegzuwischen.
„Hab gehört, du hast Kele heute auf die Finger gehauen“, sagt Maya. Selbst der ewig gleiche, leiernde Tonfall, mit dem sie spricht, kann die Anerkennung nicht ganz verbergen, die in ihren Worten liegt.
„Neuigkeiten verbreiten sich schnell“, gebe ich zurück.
„Wünschte, ich hätte das auch mal getan“, sagt Maya und raucht in hastigen, schnellen Zügen. „Ein Kotzbrocken.“
Ich sehe sie von der Seite an, frage aber nicht weiter. Sie würde es mir sowieso nicht erzählen.
„Sag mal …“, fragt sie, offensichtlich erpicht darauf, das Thema zu wechseln, „ist übermorgen nicht dein freier Tag?“
Ich nicke. Ein freier Tag im Monat, mehr wird uns nicht zugestanden. Keine Wochenenden. Keine Feiertage. Nur dieser eine Tag. An dem man nichts tun muss und ganz alleine ist mit sich und seinen Gedanken.
„Und, was hast du vor?“
„Ach, mal sehen“, gebe ich zurück. „Ich werde wohl ins SPA gehen und mir eine schöne Rückenmassage gönnen. Danach ein leckeres Mittagessen in einem Restaurant. Und dann vielleicht ins Kino.“
Maya lacht, ein raues, keckerndes Lachen. „Klingt großartig. Und danach triffst du in einem schicken Hotelzimmer deinen Len und lässt dir von ihm das Hirn rausvögeln.“
Die unvermittelte Erwähnung seines Namens trifft mich wie eine kalte Dusche. Es gelingt mir nicht rechtzeitig, meine Gesichtszüge unter Kontrolle zu bringen. Ich kann es Maya ansehen.
„Sorry“, sagt sie und starrt wieder nach vorne. „Ist er tot?“
Ja, will ich antworten. Weil es einfacher ist. Und vielleicht sogar die Wahrheit. Zwei Monate. Nein, eher nicht. Ganz ohne Essen hätte er es jetzt vermutlich schon hinter sich. Aber mit der Hälfte von dem, was man braucht, kann man ziemlich lange durchhalten. Das ist dann doch wieder zu viel zum Sterben. Der Körper baut ab, greift auf die eigenen Fettreserven zurück, von denen Len sowieso nicht viele hatte. Dann auf die Muskeln. Die Organe. Der Mangel an Nährstoffen macht anfällig für Krankheiten, die einen töten können. Oder auch nicht. Es kann sich ewig hinziehen. Ich spüre einen sauren Geschmack im Mund und schlucke krampfhaft.
„Weißt du es nicht?“
Mir fällt auf, dass ich noch nicht geantwortet habe. Dass mir ein Ja nicht über die Lippen kommt, auch wenn es das Gespräch auf wunderbar einfache Weise beendet hätte. Aber ich kann nicht. Ich kann ihn nicht totsagen. Das ist, als würde ich ihn aufgeben. Dazu, so merke ich in diesem Moment, bin ich noch lange nicht bereit.
„Ich weiß es nicht“, sage ich deshalb. „Ich hoffe, dass er lebt.“
„Scheißleben“, sagt Maya. „Ich geh ins Bett.“ Sie rappelt sich auf und schnippt die Zigarette von sich. Funkensprühend fliegt sie in hohem Bogen durch die Nacht. Wie eine Sternschnuppe, fährt es mir durch den Kopf. Und wider jede Vernunft schließe ich die Augen und spreche stumm meinen größten Wunsch.
Lass mich ihn wiedersehen.
5
Zwei Tage später erwache ich noch vor dem Weckruf, der jeden Morgen per Lautsprecher in allen Zimmern ertönt und den ich sonst so gerne überhöre. Ich richte mich in meinem Bett auf, die Wäsche fühlt sich klamm an von den Schweißausbrüchen, die mich beinahe jede Nacht heimsuchen. Auch alles andere deutet darauf hin, dass ich mal wieder einen meiner Albträume hatte. Die trockene Zunge, die verspannte Kiefermuskulatur, salzige Tränenspuren auf den Wangen. Zum Glück kann ich mich nicht an den Traum erinnern. Aber das Gefühl, das er hinterlässt, ist auch ohne die genaue Handlung schlimm genug.
„Hey, Dornröschen, was ist denn mit dir los?“ Mayas krauser Lockenkopf erscheint verkehrtherum am oberen Rand meines Bettes. „Du hast frei und kannst ausschlafen. Also los, zurück in die Federn.“
Ich schüttele den Kopf. Auch wenn es meinem chronisch unterschlafenen Körper sicher guttun würde.
Das Schrillen des Weckrufs ertönt, die Frauen um mich herum taumeln aus ihren Betten, und dann geht der Wettlauf in Richtung der Toiletten los.
Fünfzehn Minuten später ist es still. Ich hole den Beutel mit meinen wenigen Habseligkeiten unter meinem Kopfkissen hervor und greife hinein. Mein Herz beginnt heftig zu klopfen, als ich nicht sofort finde, was ich suche. Doch, da, ganz unten, befindet sich der Umschlag mit meinen mühsam zusammengekratzten Ersparnissen. Ich habe sie schon an die hundertmal gezählt. Trotzdem hole ich die Scheine noch einmal hervor. Lasse sie durch die Finger gleiten. Ja, das wird reichen.
Von einem Enthusiasmus gepackt, den ich seit Wochen nicht mehr in mir gespürt habe, springe ich aus dem Bett.
In der Nasszelle ziehe ich mich langsam aus, drehe den Wasserhahn einer der Duschen ganz nach links und voll auf. Der Strahl ist nicht wirklich kräftig, aber annehmbar und schön warm. Niemand brüllt, dass ich nicht das ganze heiße Wasser verschwenden soll. Ich stehe minutenlang einfach nur da und lasse es auf mich regnen. Dann steige ich in meine einzige Garnitur Wechselkleidung, die ich selten trage und die deshalb nicht ganz so abgerissen ist wie meine üblichen Klamotten. Jeans und ein langärmeliges Shirt. Beide auf meinem Weg hierher im Müll gefunden, dabei haben sie noch nicht einmal Flecken oder Löcher.
Als ich aus dem Wohnheim trete, ist Juri gerade dabei, zusammenzupacken und die Kaffeebude zu schließen.
„Spät dran“, sagt er.
„Mein freier Tag“, antworte ich.
Sein Blick schnellt rüber zu einer der drei Filtermaschinen, die hinter ihm stehen.
„Kaffee?“, fragt er und greift gleichzeitig nach der einzigen Kanne, in der sich ein kläglicher Rest der unansehnlich braunen Flüssigkeit befindet.
„Nein, danke“, sage ich und grinse. „Heute trinke ich ihn woanders.“
Der Weg dauert um einiges länger, als ich berechnet habe. Es ist schon Mittag, als ich durch die Fensterscheibe des Zuges endlich die Skyline von Johtaja erblicke. Mein Herz beginnt aufgeregt zu klopfen. Da ist sie. Meine Stadt. Die Metropole von Zentral-Vahvin. Sie sieht beeindruckend aus an diesem klaren Oktobertag. Die hohen, verglasten Wolkenkratzer glitzern und funkeln in der Sonne wie riesige, silberne Raketen, die gen Himmel streben. Auf der Fahrt zum Hauptbahnhof passieren wir den im Zentrum angelegten Binnensee, in dessen Mitte eine riesige Wasserfontäne sprudelt, das Wahrzeichen Johtajas. Rundherum luxuriöse Kaufhäuser und Theater. Schöne, reiche, glückliche Menschen. Die Vorzeigeseite der Stadt, die im krassen Gegensatz steht zu dem Elend, das es hier auch gibt. Am schlimmsten ist es in den Slums außerhalb der Stadt. Der Gestank, die Krankheiten, der Hunger. Die Arbeitskraft dieser Menschen wird vom System aus ihnen herausgequetscht, bis sie leer sind. Dann werden sie sich selbst überlassen. Und dem Tod. Der Abfall der Gesellschaft lebt dort, passenderweise direkt neben der größten Mülldeponie von Johtaja.
Als ich aus dem Zug steige, fühle ich mich seltsam fremd an diesem Ort, der doch mein Leben lang meine Heimat gewesen ist. Dabei bin ich erst seit zwei Monaten von hier fort.
Besorgt schaue ich hinauf zu dem riesigen Uhrturm des Bahnhofs. Kurz vor eins. Ich muss mich beeilen und werde trotzdem nicht sehr lange bleiben können, wenn ich pünktlich zurück sein will. Was ich nicht will. Aber ich muss ja. Hoffentlich ist sie da!
Um nicht noch mehr Zeit zu verlieren, miete ich mir ein Fahrrad. Ich benutze die PIN von Adriel und es funktioniert reibungslos. Aber warum soll ich nicht auch mal ein bisschen Glück haben? Ich radele durch die Straßen. Der Wind pfeift durch meine zu dünne Kleidung, aber es macht mir nichts aus. Mein Körper, der so viele Wochen sechzehn Stunden täglich auf einem Stuhl gesessen hat, mit gebeugtem Kopf, reagiert mit einem wahren Schwall von Endorphinen, weil er sich endlich mal wieder richtig bewegen und auspowern darf. Zwar protestieren meine Muskeln zuerst gegen die ungewohnte Belastung, finden dann aber schnell zu ihrer alten Form zurück. Ich genieße das Pfeifen in meinen Ohren, die kalte Luft auf meiner Haut, das Gefühl von Freiheit.
Und wenn ich einfach nicht mehr zurückgehe?
Eine Dreiviertelstunde später halte ich vor einem Rotklinkergebäude am Rande von Zone Zwei. Die gute Laune fällt von mir ab, während ich langsam das Fahrrad abstelle und die Klingelschilder inspiziere. Einerseits wünsche ich mir nichts sehnlicher, als dass Kimi noch hier ist. Dass ich sie umarmen und mit ihr sprechen kann. Andererseits verkauft sie hier in diesem Haus ihren Körper an Männer. So überlebt sie. Ich kann es noch immer nicht recht glauben, auch nicht nach all der Zeit. Meine Kimi, verwöhntes Elite-Kind, die mich mitgenommen hat in die Welt der Schönen und Reichen, einfach aussortiert vom System. Weil bei ihrem Gesundheitscheck Krebs diagnostiziert wurde. Auch in der Alten Welt war eine solche Diagnose furchterregend. Aber es gab Ärzte, Krankenhäuser. Es gab wenigstens eine Chance. In unserer Welt gibt es nichts von all dem. Die Starken überleben, die Schwachen sterben. Wer versucht, trotzdem zu helfen, so wie Len es getan hat, der wird gnadenlos verfolgt.
Ich entdecke Kimis Nachnamen. Atme tief ein und drücke auf den Klingelknopf.
6
Die Frau, die mir die Tür öffnet, habe ich noch nie gesehen. Sie trägt ein rosafarbenes Baby-Doll mit Rüschen, Plüschpantoffeln mit Hasenohren und hat die platinblond gefärbten Haare zu zwei Zöpfen geflochten, die ihr auf die Schultern fallen. Die mädchenhafte Aufmachung steht in einem krassen Kontrast zu ihrem wirklichen Alter, den Falten in ihrem Gesicht und dem grauen Haaransatz. Sie geht sicher schon auf die fünfzig zu. Misstrauisch sieht sie mich an.
„Ja?“
„Entschuldigung. Ich möchte zu Kimi. Sie wohnt doch noch hier?“
„Ist beschäftigt.“ Sie macht Anstalten, mir einfach die Tür vor der Nase zuzuknallen, aber ich stelle meinen Fuß in den Spalt und halte sie davon ab.
„Ich würde gerne auf sie warten“, sage ich freundlich, und sie lässt mich widerwillig eintreten.
„Wenn´s sein muss.“ Sie mustert mich von oben bis unten. „Kennen wir uns?“
Ich schüttele den Kopf. „Nicht, dass ich wüsste. Aber ich kenne mich hier aus.“ Das ist die Übertreibung des Jahres. Schließlich bin ich nur ein einziges Mal hier gewesen. Damals. In meinem anderen Leben. Ich weiß noch, wie entsetzt ich über Kimis neuen Job gewesen bin. Mir wird heiß vor Scham, wenn ich mich an meine Gedanken von damals erinnere. Wie kann sie das tun? Es muss doch einen anderen Weg geben. Das ist würdelos.
All das habe ich Kimi nicht gesagt, Gott sei Dank. Trotzdem saß ich auf einem ganz schön hohen Ross. Wie mir jetzt klar wird.
„Ich warte einfach in der Küche und werde ganz bestimmt nicht stören“, versichere ich meinem Gegenüber, die mich noch immer betrachtet. Ich verstehe nicht ganz, warum sie das tut. Schließlich bin ja nicht ich diejenige, die diesen seltsamen Aufzug trägt, sondern sie.
Es klingelt an der Tür, und sie hört endlich auf, mich anzustarren.
„Ich bin schon weg“, sage ich schnell und gehe durch den Flur. Öffne die Tür, die meiner Erinnerung nach in die Küche führt. Und richtig.
Die Frau ist mittlerweile zur Gegensprechanlage getreten und hebt den Hörer ab.
„Wer ist da?“ Sie lauscht in den Hörer. „Oh“, haucht sie dann mit vollkommen veränderter Stimme. „Das ist schön, dass du mich besuchen kommst, Daddy!“
Mir läuft ein Schauer über den Rücken.