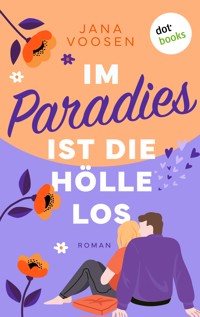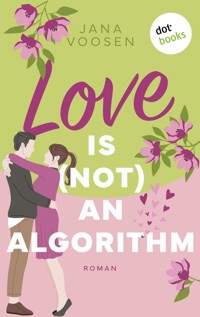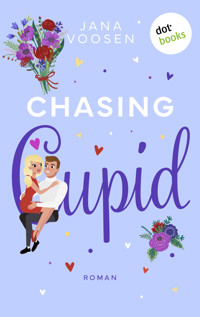10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Wie weit gehst du für die Liebe zu deinem Kind?
Hamburg, 1937: Lilo wächst als behütetes Nesthäkchen in einer parteitreuen Kaufmannsfamilie auf. Schon lange ist sie unsterblich in den Freund ihres Bruders verliebt. Als Ludwig endlich auf sie aufmerksam wird, entführt er sie in die verlockende und verbotene Welt der Swing-Jugend. Braves Hitlermädchen bei Tag, durchtanzt sie nun heimlich die Nächte im Alsterpavillon. Doch dann verschwindet Ludwig—und Lilo ist schwanger. Im Kampf um ihre Tochter wächst sie über sich hinaus.
2019: Nele hat den kleinen Buchladen ihres Vaters in Ottensen übernommen. Eines Tages übergibt ihr eine Kundin die Lebenserinnerungen von Lilo: Es ist das richtige Buch zur richtigen Zeit. Denn es gibt Nele den Mut, endlich ihren eigenen Weg zu gehen.
„Jana Voosen erzählt emotional und tiefgründig—eine faszinierende Autorinnenstimme, die lange im Ohr bleibt" Teresa Simon
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 475
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
DAS BUCH:
Hamburg, 1937: Lilo wächst als behütetes Nesthäkchen in einer parteitreuen Kaufmannsfamilie auf. Schon lange ist sie unsterblich in den Freund ihres Bruders verliebt. Als Ludwig endlich auf sie aufmerksam wird, entführt er sie in die verlockende und verbotene Welt der Swing-Jugend. Braves Hitlermädchen bei Tag, durchtanzt sie nun heimlich die Nächte im Alsterpavillon. Doch dann verschwindet Ludwig – und Lilo ist schwanger. Im Kampf um ihre Tochter wächst sie über sich hinaus.
2019: Nele hat den kleinen Buchladen ihres Vaters in Ottensen übernommen. Eines Tages übergibt ihr eine Kundin die Lebenserinnerungen von Lilo: Es ist das richtige Buch zur richtigen Zeit. Denn es gibt Nele den Mut, endlich ihren eigenen Weg zu gehen.
DIE AUTORIN:
Im Alter von sechs Jahren verkündete Jana Voosen, Jahrgang 1976, entweder Schauspielerin oder Schriftstellerin werden zu wollen. Vierzehn Jahre später absolvierte sie eine Schauspielausbildung in Hamburg und schrieb währenddessen ihr erstes Buch. Seitdem war sie in zahlreichen TV-Produktionen (»Marienhof«, »Tatort«, »Klinik am Alex« u. a.) zu sehen und veröffentlicht Romane, Kurzgeschichten, Drehbücher sowie Theaterstücke. Jana Voosen lebt mit ihrer Familie in Hamburg.
JANA VOOSEN
Unser Weg nach morgen
ROMAN
WILHELM HEYNE VERLAG
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen. Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Originalausgabe 11/2021
Copyright © 2021 by Jana Voosen
Copyright © dieser Ausgabe
by Wilhelm Heyne Verlag, München,
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Straße 28, 81673 München
Redaktion: Tamara Rapp
Umschlaggestaltung: Eisele Grafik Design, München
unter Verwendung von Trevillion Images (CollaborationJS), Shutterstock.com (BABAROGA), Alamy Stock Foto (bilwissedition Ltd. & Co. KG)
Satz- und E-Book-Konvertierung: GGP Media GmbH, Pößneck ISBN 978-3-641-27012-4V002www.heyne.de
Prolog
Hamburg, September 2002
Die Strahlen der Sonne fielen durch die hohen Fenster und erhellten den Erker, der wie ein schwangerer Bauch aus der Fassade des prächtigen Altbaus im Hamburger Stadtteil Eimsbüttel ragte. Draußen wuselte das Leben, die Menschen trafen sich in den zahlreichen Straßencafés oder bummelten durch die von Linden gesäumte Straße, um einen der letzten warmen Tage des Jahres zu genießen. Es war fast Herbst, und die Aussicht auf einen weiteren langen und nasskalten Winter trieb die Hamburger nach draußen. Vom nahe liegenden Spielplatz klang Kinderlachen herüber und mischte sich mit dem Kreischen der Möwen, die ihre Kreise am stahlblauen Himmel zogen.
Mit geradem Rücken saß Lilo an ihrem antiken Sekretär. Sie lauschte dem Ticken der Standuhr, schloss für einen Moment die Augen und spürte die Sonne warm auf dem Gesicht.
Tick, tack, tick, tack.
Ihr Körper in dem Drehsessel fühlte sich schwer an, sie hatte in den letzten Jahren an Gewicht zugenommen. Die Pralinen von Konditor Bosselmann, mit denen sie sich seit Ludwigs Tod die Abende versüßte, forderten ihren Tribut.
Lilo hob die Hände, legte sie auf die Tastatur ihrer altmodischen Schreibmaschine und konnte wie immer kaum glauben, dass die blauen Adern, die Altersflecken, die dünne Pergamenthaut zu ihr gehörten.
Tick, tack, tick, tack.
In dem Moment, da sie einen Blick auf das Ziffernblatt warf, begann die Uhr zu schlagen. Ding, dang, dong. Drei Uhr. Ihre liebste Zeit des Tages begann.
Langsam schlug sie die ersten Buchstaben an, schrieb ein paar Worte, zögerte, nickte, machte weiter.
Sie war gerade richtig in Schwung gekommen, als sie das Rumpeln des Teewagens auf dem Flur vernahm, dazu Helenes unsichere Schritte. Und ihren trockenen Husten, der sie nun schon seit Tagen quälte.
Sie sollte endlich damit zu einem Arzt gehen, dachte Lilo. Aber in diesem Punkt war Helene so stur wie ein alter Maulesel. Lilo seufzte. Es war seltsam. So viele Jahre ihres Lebens hatte sie die andere Frau weit fort gewünscht. Nun machte sie sich Sorgen um sie.
Die Klinke quietschte, und Helene betrat das Zimmer. Diesen Raum, den sie beide noch immer ihren Salon nannten, obwohl diesen Ausdruck heutzutage niemand mehr benutzte. Lilos Finger verharrten über der Tastatur. Sie wandte sich nicht um, obwohl sie wusste, dass Helenes Blick auf ihr ruhte. Doch Lilo musste sich nicht umdrehen, um zu wissen, dass die Frau, mit der sie seit siebenundfünfzig Jahren ihre Wohnung, ihr Leben und noch viel mehr teilte, in ihrem rosafarbenen Jackie-O-Kostüm und mit ein bisschen zu viel Rouge im Gesicht in der Tür stand.
»Was machst du?«, fragte Helene wie jeden Tag.
»Schreiben«, antwortete Lilo, auch wie immer.
»Ich habe uns einen Tee gekocht.«
Jeden Nachmittag dasselbe Ritual, dachte Lilo halb verärgert, halb belustigt. Sie hörte das Schaben der Räder des Servierwagens auf dem alten Parkett und Helenes beinahe lautlose Schritte. Der Duft der anderen Frau wehte heran, eine Mischung aus Chanel No 5, Lavendel und dem Minzaroma ihres Mundwassers.
Lilo wandte sich nun doch um und musterte die zierliche Frau, die zwei Meter von ihr entfernt in der Mitte des Raumes stand und Tee in zwei Porzellantassen goss.
Sie sieht nicht gut aus, dachte sie unbehaglich. Helene, ihr Leben lang eine zarte Erscheinung, wirkte heute beinahe durchscheinend. Wie ein Vogeljunges, das aus dem Nest gefallen ist, fuhr es Lilo durch den Kopf, und sie erhob sich automatisch und trat auf die andere zu.
»Was ist mit dir?« Obwohl sie das gar nicht geplant hatte, klang sie ruppig und ein wenig vorwurfsvoll. »Geht es dir nicht gut? Komm, setz dich!«, fügte sie sanfter hinzu und führte sie zu ihrem Sessel.
»Ich will dich aber nicht stören«, murmelte Helene.
»Du platzt doch jeden Tag um diese Uhrzeit hier herein.«
Helene lächelte schwach. »Weil ich weiß, dass dir ein Tee bei der Arbeit guttut.«
Sie schwiegen eine Weile. Wir klingen wahrhaftig wie ein altes Ehepaar, dachte Lilo. Und wahrscheinlich halten uns die meisten Leute auch genau dafür. Heutzutage war es ja nicht ungewöhnlich, wenn zwei Frauen zusammenlebten. Als Ludwig noch an ihrer Seite gewesen war, hatte ihre Wohngemeinschaft den Menschen mehr Rätsel aufgegeben. Und doch hatten sie mit ihren Vermutungen danebengelegen.
Helene hob die Hand und deutete in Richtung der Schreibmaschine. »Wann darf ich es endlich lesen?«, fragte sie, und Lilo beobachtete besorgt ihren schmalen Brustkorb, der sich angestrengt hob und senkte.
Sie zog den Schemel heran und bettete Helenes Füße darauf. Legte ihr eine gehäkelte Decke über die Beine.
»Wenn es fertig ist.«
»Wahrscheinlich hast du alles verdreht«, sagte Helene, und der ungewohnte Anflug von Humor ließ Lilo lächeln.
»Natürlich hab ich das.«
Helene begann zu husten. Es klang schaurig, wie ein schmerzvolles Bellen.
»Du bist krank.« Lilo legte eine Hand auf die Stirn der anderen und verbrannte sich fast die stets kalten Finger an der heißen Haut. Jetzt registrierte sie auch den Fieberglanz in Helenes Augen. »Du gehörst ins Bett! Ich bringe dich in dein Zimmer. Und dann rufe ich einen Arzt.«
Helene schüttelte den Kopf. »Gleich. Du kannst gleich jemanden rufen«, sagte sie. »Aber vorher muss ich dir noch was sagen.«
»Tu das nicht«, unterbrach Lilo sie. »Helene, tu nicht so, als würdest du …«
»Danke«, sagte Helene, ohne auf ihre Worte zu achten. »Wirklich, Lilo, ich möchte mich bei dir bedanken.«
»Du dankst mir doch andauernd«, erwiderte Lilo brüsk. »Seit damals. Wenn du dich wirklich erkenntlich zeigen willst, dann gehst du jetzt ins Bett und kurierst dich aus.«
»Keine Sorge.« Trotz des Fiebers lächelte Helene beinahe schelmisch. »Du weißt doch, dass du mich nicht so leicht loswirst.«
Auch Lilo musste lächeln. »Da hast du allerdings recht«, sagte sie.
»Weißt du noch?«, fragte Helene. »Der 25. Dezember 1945?«
»Ja, natürlich.«
»An diesem Tag hast du mir das Leben gerettet.«
»Du übertreibst mal wieder maßlos«, sagte Lilo, aber Helene schüttelte nachdrücklich den Kopf.
Versonnen blickten beide Frauen vor sich hin. Sie waren plötzlich weit weg. In einer anderen Zeit. Hier in diesem Zimmer, aber mehr als ein halbes Jahrhundert zurück …
1.
Hamburg, 2019
Ertappt zuckte Nele zusammen, als die antike Messingglocke über der Eingangstür bimmelte und Kundschaft ankündigte. Sie schlug das Buch zu, in dem sie gerade gelesen hatte, und stand schnell aus dem bequemen, mit Samt bezogenen Ohrensessel auf, der eigentlich den Kunden vorbehalten war.
Hier, in der hintersten Ecke der Bücherwelt, konnte man es sich gemütlich machen. Ein Buch aus dem Regal ziehen, es im Schein der Stehlampe durchblättern, sich einfangen lassen von der Geschichte. Erst einen Satz lesen, dann einen Abschnitt, eine Seite, ein Kapitel. Darüber die Zeit vergessen und all das, was noch erledigt werden musste. Einkäufe, Rechnungen, unbeantwortete E-Mails …
Irgendwann tauchten die Kunden dann wieder auf, überrascht von der eigenen Pflichtvergessenheit und gleichzeitig beglückt von der unerwarteten Auszeit. Dann blieb nur noch, das Buch zu bezahlen und es mit nach Hause zu nehmen. Wie einen Urlaub, den man in der Tasche aufbewahrte. Stets bereit, einen fortzutragen aus dem Alltag.
»Hallo?«
Und jetzt war es Nele selbst passiert. Sie legte das Buch beiseite.
»Ja, ich bin hier. Entschuldige. Hallo, Leonie!« Sie trat ihrer Stammkundin entgegen, die sich schüttelte wie ein nasser Hund, sodass die Regentropfen von ihrem dunkelgrünen Parka spritzten.
»Mistwetter«, schimpfte die junge Frau. »Kann denen da oben mal einer Bescheid geben, dass wir schon Juni haben?«
»Der einzige Nachteil an der schönsten Stadt der Welt«, grinste Nele.
»Ich hätte doch den Studienplatz in Freiburg nehmen sollen«, murrte Leonie und zog einen Zettel hervor.
»Das wäre schade gewesen.« Nele nahm ihr die Buchbestellung ab. Wie immer war es eine bunte Mischung: Thriller, Liebesromane, Sachbücher, Autobiografien. »Wow, ganz schön viele!«
»Ich hab noch ein paar Kommilitonen mehr von der Sache überzeugen können.« Leonie reckte die Faust gen Himmel. »Support your local bookstore!«
»Wirklich toll. Und wie schön, dass ihr jungen Leute so viel lest.«
»Ihr jungen Leute … Was bist du denn? Eine alte Frau?«, fragte Leonie, die mit Mitte zwanzig gerade mal fünf Jahre jünger war als Nele.
»Eine in den besten Jahren.« Nele zwinkerte der Studentin zu und zog los, um die Bücher einzusammeln, die sie vorrätig hatte. In der Leseecke fiel ihr Blick wieder auf den Roman, in den sie gerade noch vertieft gewesen war und von dessen Cover ihr eine junge Rothaarige mit entschlossenem Gesichtsausdruck entgegenblickte. Sie hielt das Buch in die Höhe. »Du magst doch Dystopien, oder? Hab ich gerade reinbekommen und finde es wirklich richtig …«
»Ich nehm es«, unterbrach Leonie sie, und Nele lächelte.
»Bei solchen Kunden macht es Spaß, Buchhändlerin zu sein.«
Sie trug den Stapel zum Tresen, setzte ihn ab und zog die Computertastatur heran. »Den Rest muss ich bestellen. Du kannst die Bücher morgen …«
»Ab zehn Uhr abholen«, vervollständigte ihr Gegenüber den Satz. »Super.« Sie reichte Nele eine Kreditkarte über den Ladentisch und begann, die Bücher in ihren mitgebrachten Jutebeutel zu packen.
Nele zog die Karte durch das Lesegerät und reichte Leonie Kassenbeleg und Abholschein. »Dann bis morgen.« Sie warf einen Blick durchs Schaufenster. »Soll ich dir einen Schirm leihen?«
»Geht schon.« Die Studentin zog eine Grimasse und setzte die Kapuze ihrer Jacke auf. »Ich schau lieber nicht nach, was für ein Wetter die in Freiburg gerade haben.«
Nele begleitete sie zum Ausgang und öffnete die Tür. Schräg gegenüber, auf der anderen Seite der Ottenser Einkaufsstraße, leuchtete der Schriftzug der großen Buchhandelskette, die dort vor zwei Monaten eine neue Geschäftsstelle eröffnet hatte.
Die Türglocke bimmelte, und Nele war wieder alleine im Laden. Sie kämpfte die trüben Gedanken nieder, die beim Anblick der Konkurrenz automatisch in ihr aufstiegen. Dass es Mitbewerber gab, in Form des Online-Versandhandels oder der großen Ketten, war sowieso klar. Aber die Konkurrenz genau gegenüber vor die Nase gesetzt zu bekommen, das war schon ein harter Brocken.
Na gut, sie wollte sich die Laune nicht verderben lassen, also beschloss sie, an etwas anderes, etwas Schöneres, zu denken. Morgen war Mittwoch und damit zwischen sechzehn und siebzehn Uhr Vorlesestunde für Kinder. Nele liebte diese Nachmittage, wenn die Kleinen wie gebannt an ihren Lippen hingen, sich voll und ganz auf die Geschichten einließen, die sie ihnen vorlas. Sie reagierten so ehrlich, so unmittelbar, lachten laut, stießen erschreckte Rufe aus oder versteckten sich in wohligem Grusel hinter ihren Eltern. Es war Nele egal, ob diese dann am Ende der Stunde ein Buch kauften oder nicht, die Augen der Kinder, in denen die Begeisterung funkelte, waren für sie Belohnung genug.
Sie würde aus »Eine Woche voller Samstage« vorlesen, eines ihrer Lieblingsbücher aus Kindertagen. Mit Kajalstift konnte sie sich und den Kindern blaue Wunschpunkte ins Gesicht malen, und in der Verkleidungskiste, die sie im Laufe der Jahre gut bestückt hatte, befand sich eine rote Perücke, die sie über ihren braunen Bob ziehen konnte. Grüne Augen hatte sie sowieso, und sie würde einen Hosenanzug tragen, nicht aus Neopren, aber immerhin blau. Nele lächelte voller Vorfreude.
Vor zehn Jahren, direkt nach dem Abitur, durch das sie sich mit Ach und Krach gemogelt hatte, war sie wild entschlossen gewesen, Erzieherin zu werden. Ihre Umgebung hatte wenig verständnisvoll auf diesen Berufswunsch reagiert. Wollte sie wirklich ihr Leben damit verbringen, eine Horde Kinder von fremden Leuten zu hüten? Ja, genau das wollte sie. Mit Feuereifer und sehr viel mehr Fleiß, als sie jemals auf dem Gymnasium hatte aufbringen können, hatte sie zwei Jahre lang die Berufsfachschule besucht. Nur noch das einjährige Praktikum hatte ihr gefehlt – doch dann war alles anders gekommen. Ihr Vater war an Bauchspeicheldrüsenkrebs erkrankt. Es war schnell gegangen, und vielleicht war das ein Glück, auch wenn Nele das damals nicht so sehen konnte. Wenige Wochen vor seinem Tod hatte sie die Bücherwelt übernommen. Er hatte seine Frau nur ein Jahr nach Neles Geburt verloren, hatte sein Kind alleine großgezogen, war der liebevollste Vater gewesen, den ein Mädchen sich nur wünschen konnte. Sie hatte ihn einfach nicht gehen lassen können ohne das Wissen, dass seine Tochter sein Lebenswerk für ihn bewahrte.
Manchmal fragte Nele sich, wie ihr Leben wohl aussähe, wenn es anders gelaufen wäre, doch im Grunde ihres Herzens glaubte sie, dass alles seinen Sinn hatte. Zum Beispiel hätte sie sonst vielleicht niemals Julian kennengelernt.
Bei dem Gedanken an ihn stieg ein warmes Gefühl in ihr auf. Vor einem halben Jahr war er in ihr Leben getreten und hatte es ganz schön auf den Kopf gestellt. Davor war ihr Liebesleben für fast drei Jahre praktisch nicht existent gewesen. So lange, dass sie sich um ein Haar von Franzi, ihrer besten Freundin, hätte breitschlagen lassen, sich bei einer Partnervermittlung im Internet anzumelden, und das, obwohl alles in ihr sich dagegen sträubte. Nele war eine echte Romantikerin und glaubte nicht daran, dass Amor mit Elite-Partners kollaborierte.
Tatsächlich sorgte er stattdessen dafür, dass am Mittwoch vor jenem Wochenende, an dem Nele für die Anmeldung im Partnerportal mit Franzi verabredet war, Julian in die Bücherwelt geschlendert kam. Auf den ersten Blick hielt sie ihn für einen Studenten, so jungenhaft wirkte er mit seiner langen, schlaksigen Figur, die in Jeans, T-Shirt und Sneakers steckte. Erst allmählich erkannte sie, dass er mindestens Ende dreißig war, mit sympathischen, nach oben weisenden Lachfältchen um die braunen Augen und ein paar hauchfeinen grauen Strähnen im strubbeligen dunklen Haar. Er stöberte fast eine halbe Stunde lang herum, las im Stehen, an eines der Bücherregale gelehnt, in mehrere Bücher hinein, kaufte schließlich drei davon, unterhielt sich ein paar Minuten mit Nele und verließ den Laden. Nele hatte ihm lange hinterhergeschaut. So einen hätte sie gerne mal kennengelernt. Attraktiv, ohne übertrieben gut aussehend zu sein, belesen, höflich. Seine positive Ausstrahlung hatte sie beeindruckt.
Schon am selben Nachmittag war er zurück. Nele hockte auf dem großen Lesesessel inmitten einer Gruppe Kinder. Sie trug einen spitzen Hut, unter dem ein roter Zopf mit Schleife hervorlugte, hatte sich eine lange Nase mit Warze aufgesetzt und schwarze, struppige Augenbrauen gemalt. Während sie aus Für Hund und Katz ist auch noch Platz vorlas, kam Julian mit einem kleinen Jungen an der Hand herein. Leise ließen sie sich in der hintersten Reihe nieder, Julian nickte grüßend und lächelte, woraufhin sie sich zweimal verhaspelte, dann komplett die Zeile verlor und von vorne beginnen musste.
»Da bin ich wieder«, sagte er, als er nach dem Vorlesen an die Kasse trat, um das Gesamtwerk von Julia Donaldson und Axel Scheffler zu erstehen.
»Ähm, ja«, sagte Nele wenig eloquent. Sie hätte alles dafür gegeben, nicht in Hexenbemalung vor ihm zu stehen. Andererseits war mit Blick auf das etwa fünfjährige Kind an seiner Seite ohnehin klar, dass es eigentlich egal war. Er war vergeben.
»Da hat dein Papa jetzt aber viel vorzulesen, was?«, sagte sie und reichte dem Jungen den Stapel.
Der strahlte und nickte. »Aber erst nächste Woche«, erklärte er, »diese Woche wohne ich bei Mama.« Damit sauste er davon, während Nele versuchte, diese neue Information zu verarbeiten.
»Mika, warte vor der Tür auf mich«, rief Julian seinem Sohn hinterher. »Ich komm gleich.« Er wandte sich wieder Nele zu und grinste ein bisschen verlegen.
In diesem Moment spürte Nele, wie ihr Herz schneller zu schlagen begann.
Am nächsten Tag hatte er ihr Kaffee gebracht, mit geschäumter Sojamilch, die sie nicht mochte, aber das war ihr egal. Sie hatten das Gebräu im Stehen getrunken, ganz unbefangen. Das Gespräch war so leicht gewesen, so natürlich. Er war Drehbuchautor und schrieb für verschiedene Serien, träumte aber davon, irgendwann einmal einen Roman zu schreiben. Obwohl sie sich ja kaum kannten, erzählte Nele, dass sie eigentlich lieber Erzieherin geworden wäre, weil Kinder einfach ihre Lieblingsmenschen waren. Kinder trauten sich, nur sie selbst zu sein, sagten, was sie dachten und lebten ganz im Moment.
Eine volle Stunde hatte das unverhoffte Date gedauert, und niemand hatte sie gestört. Zum ersten Mal seit Monaten hatte Nele dies nicht den schlechten Verkäufen zugeschrieben, sondern höherer Fügung.
Ein Lächeln umspielte Neles Lippen, als sie daran zurückdachte. Zwar war nicht alles so reibungslos verlaufen wie diese erste Verabredung, denn es war kompliziert, wie man so sagte – und das war vermutlich ganz normal, wenn eben nicht nur zwei Menschen beteiligt waren, sondern auch noch ein Kind mit zugehöriger Mutter. Aber sie waren ein Paar, und das nun schon ein halbes Jahr lang. Heute waren sie verabredet, sie wollten Essen vom Lieferservice bestellen und es sich auf der Couch mit einem Film gemütlich machen. Nele freute sich auf den bevorstehenden gemeinsamen Abend und summte vergnügt vor sich hin, während sie eine wasserdichte Kiste mit Büchern vollpackte.
Als sie damit fertig war, warf sie einen Blick auf die Pendelstanduhr, die seit Eröffnung der Bücherwelt vor fast einhundert Jahren Teil des Inventars und der ganze Stolz erst ihres Urgroßvaters, dann ihres Großvaters und schließlich ihres Vaters gewesen war. Viertel vor vier. Gleich würde ihre Mitarbeiterin eintreffen, um den Laden zu übernehmen, damit sie selbst Bücher an einige Kunden ausliefern konnte, die nicht mehr gut zu Fuß waren.
Zehn Minuten später kam Stefanie herein. »Puh, was für ein Wetter … Hallo, Nele!« Sie stellte ihren Schirm in den dafür vorgesehenen Ständer und streifte die Kapuze von den schwarzen Locken. »Hör mal, ich hab eine Idee. Ich glaube, sie ist gut. Drüben haben sie doch im ersten Stock eine Getränke-Bar. Für so was haben wir hier keinen Platz, aber wir könnten doch trotzdem Kaffee anbieten. Man müsste natürlich erst mal in einen Vollautomaten investieren, aber ich denke, dass es sich lohnen würde. Was meinst du?«
Nele lächelte. Stefanie war wirklich ein Phänomen. Jede Woche kam sie mit einer neuen Idee für die Bücherwelt um die Ecke, und das, obwohl sie eigentlich studierte und nur nebenbei im Laden arbeitete. »Find ich gut. Lass mich darüber nachdenken«, sagte sie.
»Aber nicht zu lange!«, mahnte Stefanie, nahm ihre vom Regen gesprenkelte Nickelbrille ab und putzte sie ausgiebig.
Nele griff nach Regenhose und Friesennerz und zog beides an. Stefanie hatte recht. Sie war zu zögerlich, was die Umsetzung von neuen Ideen betraf – und verstand eigentlich selbst gar nicht, warum. Vielleicht lag es daran, dass die Bücherwelt das Vermächtnis ihres Vaters war. Jede Veränderung schien ihn noch ein Stück weiter von ihr zu entfernen. Und doch … er war ja schon seit zehn Jahren nicht mehr da. Um auf dem Markt bestehen zu können, brauchte es innovative Ideen. Solche, wie Stefanie sie immer wieder aus dem Hut zauberte. Auch der Kurierdienst für Hamburger Kunden war ihr Einfall gewesen.
Nele packte die Kiste mit beiden Händen und marschierte in Richtung Ausgang. »So, ich fahre los.«
»Willst du nicht noch ein bisschen warten?«, fragte Stefanie mit einem zweifelnden Blick nach draußen. »Es gießt doch in Strömen.«
»Ach was. Du weißt doch, Regen ist erst, wenn der Lieferdienst im Schlauchboot kommt.«
»Wenn du meinst.« Stefanie hielt ihr die Tür auf, und Nele trat hinaus in den Regen. Verstaute die Ware in ihrem Lastenfahrrad und spannte sicherheitshalber noch eine Plane darüber. Dann breitete sie die Arme aus, wandte das Gesicht in Richtung Himmel, schloss die Augen und spürte die Regentropfen auf ihre Haut prasseln. Als waschechte Hamburger Deern mochte sie dieses Wetter, auch wenn die meisten sie deshalb für verrückt erklärten. Aber Nele hatte früh beschlossen, die häufige Nässe und Kälte ihrer Heimatstadt willkommen zu heißen, statt sich davon deprimieren zu lassen.
»Weißt du, was Obelix dazu sagen würde?«, rief Stefanie ihr zu, die noch immer im Eingang der Bücherwelt stand.
»Na klar.« Nele grinste. »Die spinnen, die Hamburger. Aber er ist eben ein Gallier. Die können uns gar nicht verstehen.« Sie schwang sich auf den Sattel und trat in die Pedale.
Nach einer zweistündigen Fahrt, die sie erst an der Ostseite der Alster entlang und dann in die schicken Elbvororte geführt hatte, war Nele trotz Regenkleidung nass bis auf die Haut.
»Vielleicht spinnen wir ja wirklich ein bisschen«, murmelte sie vor sich hin, als sie vor einem kleinen, etwas windschiefen Fachwerkhaus in einer Wohnstraße in Osdorf anhielt. Obwohl nicht allzu weit außerhalb, verströmte das Viertel ein beinahe ländliches Flair mit seinen teilweise noch erhaltenen alten Bauernhöfen und Katen, die sich mit der vorstädtischen Siedlungsweise der Nachkriegsjahrzehnte abwechselten. Eine tapfere Mutter kämpfte sich mit einem etwa dreijährigen Knirps, der begeistert in die Pfützen sprang, durch das Schietwetter. Nele lächelte den beiden zu und spannte den Schirm auf, nicht für sich, sondern um das letzte auszuliefernde Buch vor dem Regen zu schützen, und hastete die drei Stufen hinauf zum überdachten Eingang des Häuschens. Der Name Vogel stand neben dem Klingelknopf. Nele wollte ihn gerade drücken, als das Handy in ihrer Tasche den Eingang einer Nachricht auf ihrer Mailbox verkündete. Sie zog es heraus und stellte fest, dass sie einen Anruf von Julian verpasst hatte.
»Sie haben eine neue Nachricht«, teilte ihr die Ansage mit.
»Liebe Nele, ich bin’s«, erklang gleich darauf die Stimme von Julian. Das tat er immer, wenn er eine Nachricht hinterließ. Er sprach sie an, als schriebe er einen Brief. Nele fand das ebenso seltsam wie schön. »Es tut mir wahnsinnig leid, ich fürchte, ich muss unsere Verabredung absagen. Mika ist krank, und Diana hat heute Abend einen Geschäftstermin, den sie nicht absagen kann. Sie hatte natürlich einen Babysitter organisiert, aber das funktioniert nicht, wenn Mika Fieber hat. Ich muss einspringen. Tut mir wirklich leid. Wir holen das nach, versprochen! Herzliche Grüße und Küsse, dein Julian.«
Nele ließ das Telefon sinken. Enttäuschung durchflutete sie. Das war auch nur angemessen. Er versetzte sie und brachte damit ihre Abendgestaltung durcheinander. Durchaus ein Grund, um ein bisschen geknickt zu sein. Aber da war noch ein Gefühl, und das beunruhigte sie: Genervtheit. Ein unangemessener Frust über den armen, kranken Fünfjährigen, der Julians Sohn, und auf die Mutter, die seine Ex-Frau war. Eigentlich tat der Kleine ihr leid, und sie fand nichts selbstverständlicher, als dass sein Vater an seine Seite eilte, anstatt das fiebernde Kind einer fremden Betreuung zu überlassen. Tatsächlich liebte sie Julian noch mehr dafür, dass er so ein leidenschaftlicher Vater war. Bloß war es dummerweise immer sie, die zurückstecken musste.
Nele atmete tief ein und aus und zählte dabei bis zehn. Schon besser.
Sie hob das Telefon. Eigentlich sprach sie lieber direkt mit Julian, aber dieses Mal wählte sie dennoch einen Messengerdienst. Sie wollte ihn und Mika nicht beim Abendbrot stören. Und vor allem wollte sie nicht, dass er ihrer Stimme anhörte, wie sie sich fühlte.
»Lieber Julian«, tippte sie, »das tut mir sehr leid. Gute Besserung für Mika, ich hoffe, es geht ihm bald wieder gut. Ja, holen wir nach, kein Problem. Küsse, Deine Nele.«
Sie tippte auf »Senden«, und die Nachricht machte sich mit einem vernehmlichen Zischen auf den Weg zu Julian.
2.
»Sie wünschen?«
Nele zuckte heftig zusammen und wandte sich in Richtung der Eingangstür. Durch einen schmalen Spalt starrte ein Mann mit weißen Haaren sie misstrauisch an. Natürlich. Die klatschnasse Frau vor seiner Tür musste ihm seltsam vorkommen.
»Entschuldigen Sie bitte.« Schnell steckte Nele das Telefon weg. »Mein Name ist Nele Winkler von der Bücherwelt in Ottensen. Ich habe eine Lieferung für Frau Mathilda Annemarie Vogel.«
»Eine Lieferung?«
Nele war irritiert. Der Mann wirkte geradezu entsetzt, worauf sie sich keinen Reim machen konnte. »Ich, äh …«, stammelte sie und warf noch einmal einen Blick auf die Adresse. Aber es hatte alles seine Richtigkeit. Auch der Name stimmte. »Wohnt denn hier keine Mathilda …«
»O doch«, unterbrach sie der Mann und nickte heftig. »Sie wohnt hier.« Im selben Moment wurde er von jemandem zur Seite gedrängt. Die Tür schloss sich, jemand fummelte an der Kette herum, dann öffnete sie sich erneut.
»Guten Tag.« Eine kleine, alte Dame mit auffällig hellblauen Augen in dem von reichlich Falten durchzogenen Gesicht lächelte Nele an. Dann wandte sie sich an ihren Mann. »Du schaust zu viel Aktenzeichen XY, Heinz. Ich glaube nicht, dass das Mädchen uns ausrauben möchte. Oder wollen Sie das?«
»Äh, nein. Ganz sicher nicht.«
»Na, siehst du.«
»Genau dasselbe würde aber auch ein Räuber sagen«, gab der Alte zu bedenken.
Nele gab ihm im Stillen recht. »Ich bringe Ihnen das bestellte Buch«, sagte sie laut und hielt das Beweisstück in die Höhe.
»Siehst du«, sagte die Frau wieder. Sie musterte Nele mit ihren hellen Augen. »Meine Liebe, Sie sind ja pitschnass. Sie werden sich erkälten. Bitte kommen Sie herein.«
»Nein, danke, ich …«, widersprach Nele, doch da zog die Frau sie schon energisch am Ärmel ihrer Regenjacke in die kleine Diele und schloss die Tür. Das Haus war überheizt und ein bisschen stickig, aber durchgefroren, wie sie war, empfand Nele die Wärme, die ihr entgegenschlug, als äußerst angenehm.
»Fremde sollte man nicht einfach ins Haus lassen«, bemerkte der alte Mann, sah allerdings nicht so aus, als hoffte er darauf, gehört zu werden. »Und man sollte auch nicht zu Fremden ins Haus gehen«, versuchte er es daher noch mal an Nele gewandt.
»Papperlapapp«, sagte Frau Vogel, schien sich aber dennoch genötigt zu fühlen, Nele zu beruhigen. »Wir sind alte Leute. Wir tun Ihnen nichts. Im Gegenteil: Ich hab da was für Sie.«
Nele lächelte. »Zweiundzwanzig Euro wären schön«, sagte sie.
Die alte Frau sah sie verblüfft an.
»Für das Buch«, erklärte Nele rasch. »Es kostet zweiundzwanzig Euro.«
»Ach so. Selbstverständlich. Heinz, hast du vielleicht gerade mal …?«
»Natürlich.« Der Angesprochene seufzte und zog eine betagte Geldbörse aus Leder aus seiner Gesäßtasche hervor. »Ich begreife es nur nicht. Wieso schmeißt du alles weg, wenn du dann neue Sachen kaufst?«
»Ich schmeiße nicht alles weg. Nur die Sachen, die kein Glücksgefühl verströmen. Und ein neues Buch macht glücklich.« Sie drückte die Errungenschaft an sich und griff noch einmal nach Neles Arm. »Tee?«
»Nein, danke. Ich müsste dann auch gleich wieder …«
»Natürlich. Lassen Sie mich nur kurz überlegen.« Sie musterte Nele für einen Moment, dann nickte sie. »Ja, jetzt weiß ich. Kommen Sie nur herein.«
Die alte Frau tippelte voran. Der Mann, der noch immer in seiner Geldbörse kramte, gab einen unzufriedenen Laut von sich. »Ich habe leider nur einen Hunderter. Aber oben müsste noch Kleingeld sein.«
Er trottete seiner Frau hinterher, doch statt ihr ins Wohnzimmer zu folgen, nahm er die gewundene Treppe in den ersten Stock. Nele, die seine unsicheren Schritte beobachtete, begriff, dass es noch ein Weilchen dauern würde, bis sie das Geld bekam. Aber da sie ja heute nun doch nichts mehr vorhatte, folgte sie Frau Vogel, die ihr ungeduldig zuwinkte.
»Nun kommen Sie. Es ist hier drin.«
Neugierig betrat Nele das Wohnzimmer. Der Raum war altmodisch, aber geschmackvoll eingerichtet. Typisch für Menschen dieser Generation, die mit ihrem Stil anscheinend irgendwo in den Sechzigern hängen geblieben waren. Dunkle Möbel, braun gemusterte Tapeten, schwere Vorhänge. Es stand nur wenig Krimskrams auf den vorhandenen Oberflächen. Dafür war der Boden übersät mit Gegenständen. Bücher, Geschirr, Schallplatten, Fotoalben, alles lag bunt durcheinander. Nur eine schmale Schneise führte zu einem bequemen Sessel mit Fußschemel.
Frau Vogel lächelte ein wenig verlegen. »Entschuldigen Sie, es sieht hier nicht immer so aus. Ich befinde mich mitten in einem Projekt.« Sie wühlte in einem der Stapel herum, offensichtlich suchte sie etwas. »Kennen Sie Marie Kondo?«
Nele ließ ihren Blick über das Chaos schweifen und verstand. »Ja, natürlich«, antwortete sie. Die Bücher der japanischen Aufräumexpertin hatten für viele Monate auf der Bestsellerliste gestanden. Nele hatte Dutzende davon verkauft. »Sie misten aus?«
Die alte Dame nickte eifrig. »Meine Tochter hat mir dieses Buch geschenkt.«
»Magic Cleaning?«
»Genau. Ich habe ja den Verdacht, dass sie das nicht ganz ohne Eigennutz getan hat.« Die Frau lachte leise. »Schließlich hat sie vier kleine Kinder und muss sich später um alles kümmern, wenn wir mal nicht mehr sind, mein Mann und ich.«
Nele räusperte sich unbehaglich.
»Wir müssen alle sterben, meine Liebe«, sagte die alte Dame freundlich, »und bei uns ist es wohl eher früher als später der Fall. Jedenfalls sortiere ich jetzt schon mal fleißig aus. Ah, da ist es ja!« Sie lächelte zufrieden und zog einen mit einem dicken Gummiband zusammengehaltenen Stapel Papier hervor. Ihre schmale, von Altersflecken übersäte Hand klopfte auf den Blätterberg.
Nele warf einen Blick darauf, aber die oberste Seite war leer.
»Was ist das?«, fragte sie.
»Ein Buch«, sagte die Frau. »Oder ist es erst ein Buch, wenn es gedruckt wurde?« Sie sah Nele fragend an, ohne wohl wirklich mit einer Antwort zu rechnen. »Das wissen Sie besser als ich. Vielleicht ist es eher … eine Geschichte. Ja, so kann man sicher sagen.«
»Eine Geschichte?«, fragte Nele und griff nach dem Stapel. Löste das Gummiband und zog das Deckblatt weg. Mathildas Mütter stand auf der nächsten Seite. Sie schob die Papiere darunter auseinander, die beidseitig eng beschrieben waren. Augenscheinlich nicht mit dem Computer, sondern mit einer alten Schreibmaschine. Hier und da war die Schrift verwischt. Viele Stellen hatte der Autor – oder die Autorin? – mit Tipp-Ex gelöscht und dann neu überschrieben.
Nele las den ersten Satz.
Lieselotte war keine Schönheit, jedenfalls nicht in der Zeit, in der sie lebte.
»Und diese Geschichte«, wandte sich Nele wieder der alten Dame zu, »haben Sie die geschrieben?«
Ihr Gegenüber schüttelte den Kopf. »Nicht ich, nein. Meine Mutter.«
»Aha.«
»Sie ist vor vier Jahren gestorben.«
»Das tut mir leid«, sagte Nele und fragte sich gleichzeitig, wohin diese Unterhaltung wohl führen mochte.
»Schon gut, sie war sehr alt. Über neunzig. Nach ihrem Tod musste ich natürlich ihre Wohnung ausräumen, und viele Kartons sind danach einfach in unserem Keller gelandet. Aber jetzt habe ich alles rausgekramt und dabei das hier gefunden. Die Lebensgeschichte meiner Mutter.«
»Ein Tagebuch?«
Die Frau schüttelte heftig den Kopf. »Ein Roman. Wirklich spannend, kann ich Ihnen sagen. Er wird Ihnen gefallen.«
»Ich …«
»Es geht nicht nur ums Ausmisten, wissen Sie? Sondern auch darum, dass man nicht gleich wieder neuen Kram anhäuft. Und deshalb gibt es diese tolle Regel. Sie heißt: Eins rein, eins raus.«
Nele starrte verdutzt auf den Packen in ihren Händen und wollte ihn automatisch an Frau Vogel zurückreichen, doch die schüttelte den Kopf.
»Nein, nein. Das ist für Sie. Verstehen Sie? Sie bringen mir ein Buch, und ich gebe Ihnen eins dafür.«
»Ja, aber … die Lebensgeschichte Ihrer Mutter? Wollen Sie die denn nicht behalten?«, fragte Nele.
Ihr Gegenüber schüttelte heftig den Kopf. »Ich kann die Geschichte auswendig, meine Liebe. Schon als Kind habe ich sie viele Dutzende Male gehört.« Sie legte sich eine Hand auf die Brust. »Ich trage sie in meinem Herzen.«
Nele hatte plötzlich einen Kloß im Hals.
»Aber für Sie ist es ideal. Ein Buch, das sie garantiert noch nicht kennen. Obwohl Sie Buchhändlerin sind.« Frau Vogel strahlte Nele an. »Und Sie wissen ja sicher: Die Bekanntschaft mit einem einzigen guten Buch kann das Leben verändern.«
Nele riss die Augen auf. »Äh … was?«, fragte sie, und es war beinahe ein Flüstern, so verblüfft war sie über den Satz, den sie so oft in ihrem Leben gehört hatte. Von ihrem Vater.
»Das hat meine Mutter immer gesagt. Ich weiß auch nicht, warum ich gerade jetzt darauf komme.«
»So, da bin ich wieder.«
Nele hörte die schlurfenden Schritte des alten Mannes hinter sich und wandte sich ihm zu.
»Zweiundzwanzig Euro. Es tut mir leid, ich habe nur Kleingeld.« In den zusammengelegten Händen hielt er ihr einen Berg Münzen entgegen.
»Das ist kein Problem … eigentlich.« Nele stand einen Moment hilflos da, weil ihr mindestens eine Hand fehlte, um das Geld entgegenzunehmen.
Der Mann musterte den Stapel Papiere. »Ich verstehe. Eins rein, eins raus.« Er schmunzelte.
»Lach du nur«, sagte Frau Vogel. »Warten Sie, ich hole Ihnen einen Beutel.«
Sie verschwand und kam kurz darauf mit einem Leinensack zurück, in dem sie das Manuskript verstaute. »Eins rein, zwei raus«, sagte sie hochzufrieden.
Nele nahm das Geld in Empfang und ließ es in die Tasche ihrer Regenjacke gleiten.
»Wollen Sie es nicht zählen?«
»Ich vertraue Ihnen. Vielen Dank!«
Die beiden Alten geleiteten sie zur Tür und winkten, als würden sie eine Tochter verabschieden. »Auf Wiedersehen. Viel Spaß mit dem Buch! Ich werde demnächst mal bei Ihnen im Laden vorbeikommen und fragen, wie es Ihnen gefallen hat.«
»Nun setz sie doch nicht so unter Druck, Mathilda.«
»Ach Unsinn, so habe ich es ja gar nicht gemeint.«
Nele lächelte. »Schon gut. Ich freue mich auf Ihren Besuch. Auf Wiedersehen!« Sie hob grüßend die Hand und ging zu ihrem Fahrrad.
Es hatte zu regnen aufgehört. Die Sonne hatte sich wohl doch noch daran erinnert, dass es ein Sommerabend war. Sie brach durch die Wolken und brachte die Pfützen auf der Straße zum Glitzern. Frau Vogels Stimme hallte in Neles Kopf wider, als sie das Manuskript im Anhänger verstaute. Die Sentenz, die, wie sie wusste, von dem französischen Autor Marcel Prévost stammte. Die Bekanntschaft mit einem einzigen guten Buch kann das Leben verändern. Eine der meistzitierten Weisheiten ihres Vaters. Nele war nicht übermäßig esoterisch veranlagt, aber jetzt kam sie doch ins Grübeln. Konnte es Schicksal sein, dass sie dieses Buch in ihren Händen hielt?
3.
»Reiner Zufall«, sagte ihre Freundin Franzi schlicht, als Nele am selben Abend bei ihr auf dem Sofa saß. »Du lässt dir aber auch alles aufschwatzen. Du willst das doch nicht wirklich lesen, oder?« Sie warf einen Blick auf den Packen Papier mit dem ungleichmäßigen Schriftbild.
»Warum denn nicht? Die Optik sagt erst mal rein gar nichts über den Inhalt aus. Vielleicht ist es ja wirklich eine so tolle Geschichte, wie Frau Vogel behauptet hat.«
»Das wage ich stark zu bezweifeln.« Franzi zog die Beine unter sich und schüttelte den Kopf. »Meiner Erfahrung nach halten Menschen ihre eigenen Familiengeschichten für sehr viel interessanter, als sie es in Wirklichkeit sind.«
»Kann schon sein.« Nele ließ den Rotwein in ihrem Glas kreisen.
Franzi grinste. »Jetzt lieferst du deinen Kunden nicht nur ihre Bücher bis an die Haustür, sondern übernimmst auch noch den Gang zum Altpapiercontainer.«
»Ich werf das doch nicht einfach weg!«, empörte sich Nele. »Jemand hat hier seine Lebensgeschichte aufgeschrieben.«
»Dann müllst du eben deine Zwei-Zimmer-Wohnung damit zu.« Franzi kicherte. »Ganz schön geschickt von dieser Frau Vogel.«
»Ich glaube wirklich, dass sie mir was Gutes tun wollte«, beharrte Nele und trank ihr Glas aus.
»Du warst noch nie besonders gut darin, anderen irgendwas abzuschlagen«, stellte Franzi kopfschüttelnd fest und schenkte ihrer Freundin Rotwein nach.
Es war nach neun, und sie hatten es sich in Franzis Wohnzimmer gemütlich gemacht. Der Schein von einem Dutzend Kerzen spendete ein warmes Licht und milderte so das sie umgebende Chaos aus Legosteinen, Kuscheltieren und Bauklötzen. Alle paar Sekunden sprang das Babyfon auf dem Couchtisch an und übertrug das Gedudel einer CD mit Kinderliedern.
Franzi ließ den Blick über die Unordnung schweifen. »Ich müsste auch mal dringend ausmisten«, seufzte sie. »Und ich glaube, die Musik kann ich langsam mal ausstellen. Hoffentlich ist sie endlich eingeschlafen, sie war ja völlig aus dem Häuschen wegen dir«, sagte Franzi und erhob sich.
»Tschuldigung«, sagte Nele grinsend.
»Quatsch, ist doch schön, dass sie ihre Patentante so mag. Ich mag dich schließlich auch.« Franzi verließ das Wohnzimmer, und Nele schnappte sich die überdimensionale Wolldecke, die Franzi in ihrer Schwangerschaft gestrickt hatte. Sie hatte die kleine, nach ihrem Geburtsmonat benannte Juli dann doch nie darin eingewickelt, weil sie plötzlich nicht mehr sicher gewesen war, ob die verwendete Wolle irgendwelche giftigen Substanzen enthalten könnte.
Nele waren die eventuellen Schadstoffe egal. Sie kuschelte sich bis zum Kinn in die Decke ein und trank noch einen Schluck Wein. Im Babyfon knisterte es, als Franzi die Tür zum Kinderzimmer öffnete. Ihre Schritte knarzten auf dem Dielenboden. Die Musik erstarb. Eine Sekunde lang war alles still.
Dann ein Aufschrei. »Nicht ausmachen!«
»Hey, ich dachte, du schläfst«, hörte Nele Franzi mit ihrer sanftesten Stimme sagen.
»Neiiiin. Du hast mich geweckt!«, heulte die dreijährige Juli.
»Das tut mir leid, Mäuschen. Komm, mach die Augen wieder zu.«
»Ist Nele noch da?«
»Ähm. Nein.« Nele konnte förmlich spüren, wie schwer ihrer Freundin die Lüge über die Lippen kam. Aber sie wussten beide, dass aus dem gemütlichen Abend nichts werden würde, wenn Juli davon Wind bekam, dass ihre Patentante noch immer im Wohnzimmer saß. Sie würde bis um Mitternacht mit ihr spielen wollen.
»Wann kommt sie wieder?«
»Bald. Schlaf jetzt.«
»Nicht rausgehen.«
»Mach ich nicht. Leg dich wieder hin, Süße. Schau, ich setze mich zu dir ans Bett.«
Nele sah sich in dem Wohnzimmer um, in dem sie schon unzählige Abende verbracht hatte, rappelte sich auf und begann, die verstreuten Spielsachen aufzuheben und in Kisten zu verstauen. Die Kisten stapelte sie in einer Ecke, neben dem roten Stoffhaus, in dem ein gutes Dutzend Kuscheltiere lebte. Nele spähte hinein und lächelte beim Gedanken daran, dass Juli sich bei jedem Versteckspielen hier verkroch und dann lauthals »Ich bin hier!« krähte, noch bevor man angefangen hatte, nach ihr zu suchen.
Nachdem sie aufgeräumt hatte, ließ Nele sich wieder auf das Sofa fallen.
Juli war mittlerweile dabei, von ihrem Tag im Kindergarten zu berichten. Sie wirkte quietschfidel, beschwerte sich über Anton, der sie immer schubste, schwärmte von Lilly, die schon groß und eine sogenannte Forscherin war. Irgendwie machte es nicht den Eindruck, als würde das Kind in nächster Zeit wieder einschlafen.
»So, Mäuschen, bitte schlaf jetzt«, hörte Nele Franzi sagen.
»Singst du mir noch was vor?«
»Doch die Juli konnt’ nicht schlafen, sie fand keine Ruh«, sang Franzi, »niemand konnte helfen, sie bekam kein Auge zu.«
»So geht das nicht«, rief Juli empört. »Der König konnte nicht schlafen. Nicht ich.«
»Schsch, ist ja gut.« Allmählich klang Franzi verzweifelt.
Nele hätte ihrer Freundin gerne gesagt, dass sie sich nicht zu hetzen brauchte, aber zweifellos wäre es eine fürchterlich schlechte Idee gewesen, jetzt im Kinderzimmer aufzutauchen.
Sie griff nach dem Papierstapel, der auf dem Couchtisch vor ihr lag. Die Zeit konnte sie ebenso gut sinnvoll nutzen. Sie sah auf das Buchstabendurcheinander in ihren Händen. Dieses Manuskript zu lesen, würde tatsächlich ganz schön mühsam werden.
Sie blätterte vor zur ersten Seite, kniff die Augen zusammen. Der Abstand zwischen den Zeilen war so gering, dass es aussah, als würden die Buchstaben sich gegenseitig auf dem Kopf herumtanzen. Trotzdem übte das Manuskript eine unwiderstehliche Anziehung auf Nele aus. Beinahe ehrfürchtig legte sie eine Hand auf den Stapel und schloss für einen Moment die Augen. Versuchte sich vorzustellen, wie die alte, mittlerweile verstorbene Mutter von Frau Vogel vor ihrer Schreibmaschine saß. Wie sie ihre Erinnerungen konservierte und für die Nachwelt niederschrieb, bevor sie mit ihr sterben konnten.
Nele öffnete die Augen, rückte näher unter die messingfarbene Leselampe, die an einem Schwingarm über dem Sofa schwebte, und begann zu lesen.
4.
Hamburg, April 1937
Lieselotte war keine Schönheit, jedenfalls nicht in der Zeit, in der sie lebte. Sie war groß und spindeldürr. Ein Besenstil, wie ihr Bruder Herbert es in der ihm eigenen charmanten Art und Weise ausdrückte. In den Dreißigern, jenen Jahren, in denen Lilo aufwuchs, war mit einem solchen Aussehen kein Staat zu machen.
»Wenn es Krieg gibt, verhungerst du als Erste«, prophezeite ihr Großmutter Gertrud mit düsterer Miene, ehe sie ihr ein weiteres Stück Kuchen aufnötigte. Doch es half nichts. Lieselotte konnte essen und essen und blieb doch dünn.
Sie war die Tochter einer Hamburger Kaufmannsfamilie, das einzige Mädchen und Nesthäkchen unter vier Kindern.
Es war ein ungewöhnlich warmer Tag in Hamburg in diesem April des Jahres 1937. Lilo wanderte, die lederne Büchertasche unter den Gepäckträger ihres Fahrrades geklemmt, mit ihrer Freundin Elsa von der Schule nach Hause. Das Rad war Lilos ganzer Stolz. Sie hatte es Ende des letzten Jahres zu ihrem zwölften Geburtstag geschenkt bekommen. Normalerweise fuhr Elsa hinten auf dem Gepäckträger mit, doch heute hatten sie es nicht eilig und schlenderten plaudernd nebeneinanderher.
Am Nachmittag stand die Jungmädelprobe bei der Hitlerjugend an, und Lilo machte sich Sorgen. Obwohl sie größer war als die meisten Mädchen ihres Jahrgangs und viel längere Beine hatte als diese, konnte sie weder schnell laufen noch weit springen. Im Werfen war sie annehmbar, die verlangten zwölf Meter im Ballweitwurf würde sie wohl abliefern. Beim Sprint sah es anders aus. Wenn sie die sechzig Meter in vierzehn Sekunden schaffte, dann nur mit Ach und Krach. Im letzten Jahr war sie ein weiteres Stück in die Höhe geschossen und kam mit der Länge ihrer Gliedmaßen einfach nicht zurecht. Niemand stolperte so oft wie sie über die eigenen Füße. »Wie ein junges Fohlen«, pflegte ihr Vater Karl zu sagen und seine Tochter dabei gutmütig anzulächeln. »Eher wie ein Tollpatsch«, warf dann mindestens einer ihrer drei Brüder ein. Im nächsten Moment mussten Hans, Herbert und Hinrich die Beine in die Hand nehmen, um den Kopfnüssen, die ihr Vater verteilte, zu entgehen.
Insgeheim gab Lilo ihren Brüdern recht. Sie war ein Tollpatsch. Ungelenk und staksig. Seit ihr Körper damit begonnen hatte, sich in rasantem Tempo zu strecken, fühlte sie sich noch weniger wohl in ihrer Haut. Hätte sich am liebsten versteckt oder unsichtbar gemacht; doch stattdessen ragte ihr flachsblonder Kopf stets aus der Menge der kleineren Mädchen um sie herum heraus.
»Es wird schon werden«, tröstete Elsa sie und legte der Freundin eine Hand auf den Unterarm, mit dem diese ihr Fahrrad schob.
Sie war das exakte Gegenteil von Lilo, klein, ein bisschen mollig, mit Grübchen in den Wangen, schönen dunklen Locken, die in der Sonne rötlich glänzten, und hellbraunen, warmen Augen. Lilo beneidete sie glühend um diese Augen, denn ihre eigenen waren hellblau und kühl wie ein gefrorener See.
»Und wenn nicht, ist es auch egal. Dann sollen sie mich halt rauswerfen«, erwiderte sie gespielt gleichgültig, obwohl ihr bei dem Gedanken das Herz schwer wurde. Sie mochte die Nachmittage mit den Jungmädeln, alle ihre Freundinnen waren dabei. Was sollte sie sonst mit ihrer Zeit anfangen? Und was würden ihre Eltern dazu sagen, wenn man sie ausschloss?
»Das werden sie bestimmt nicht tun«, sagte Elsa überzeugt. »Im schlimmsten Fall musst du die Prüfung eben wiederholen, das ist alles.«
Gerade als Lilo zu einer Antwort ansetzen wollte, kam eine ganze Horde Jungs von hinten heran. Sie lärmten und grölten, und Lilo zog unwillkürlich die Schultern hoch, als sie Herbert, Hans und Hinrich erkannte. Zu Hause, geschützt unter den Fittichen ihres Vaters, kam sie noch einigermaßen mit ihnen klar, doch in Gesellschaft ihrer Freunde konnten die drei geradezu unausstehlich sein. Elsa warf einen Blick zurück.
»Oh, dein Bruder«, sagte sie, und ein Hauch von Rot überzog ihre Wangen, was ihr ein noch lieblicheres Aussehen verlieh.
Lilo brauchte nicht zu fragen, welchen Bruder sie meinte. Elsa war vollkommen verschossen in den sechzehnjährigen Hinrich, der sich seinerseits natürlich nicht die Bohne für sie interessierte. Vermutlich wusste ihr ältester Bruder nicht einmal, dass Elsa existierte. Es tat ihr leid für die Freundin; auf der anderen Seite hätte sie manchmal gerne mit ihr getauscht. Ihre eigene Existenz vergaßen die drei Brüder, alle im Abstand von nur etwa zwölf Monaten geboren, leider nie. Sie wurde oft zur Zielscheibe ihres pubertären Übermuts.
»Oho, sieh mal an, da ist ja unser Schwesterherz«, rief Herbert, der Zweitälteste, und Lilo seufzte innerlich.
»Nicht zu übersehen«, trompetete Hans, der Lilo nur zwei Jahre voraushatte.
Sie hörte, wie die Gruppe aus sechs Jungs ihre Schritte beschleunigte, um zu ihnen aufzuschließen.
»Hallo Hinrich«, sagte Elsa mit Piepsstimme, erhielt jedoch keine Antwort darauf.
Aus dem Augenwinkel sah Lilo, wie Herbert etwas vom Boden aufnahm und zu ihr herantrat. Eine schnelle Vorwärtsbewegung seines Arms, und plötzlich blockierte ihr Fahrrad. Mit dem Schienbein stieß sie hart gegen das Pedal und strauchelte. Im Fallen bemerkte sie den Ast, den Herbert zwischen die Speichen ihres Hinterrades gesteckt hatte. Sie spürte einen heftigen Schmerz in der linken Seite, als sie mit voller Wucht auf ihre Hüfte fiel, und streckte die Arme aus, um sich vor dem auf sie kippenden Fahrrad zu schützen.
Die Meute lachte grölend.
»Oh, Lilo«, sagte Elsa erschrocken und machte Anstalten, ihrer Freundin zu helfen, die hilflos wie ein Käfer auf dem Rücken lag, doch jemand anders war schneller.
Einer der Jungs löste sich aus der Gruppe, griff beherzt nach dem Fahrrad und zog es von Lilo herunter. Trotz ihrer misslichen Lage erkannte sie, dass es sich um den vierzehnjährigen Ludwig handelte, den besten Freund von Hans. Er stellte ihr Rad auf den Ständer und streckte ihr gleich darauf die Hand hin.
Lilo schlug die Augen nieder, wagte nicht, ihn anzusehen. Sie wusste, dass sie nicht wie Elsa hinreißend errötete, sondern dass sich auf ihrem Hals und ihrer Stirn hektische Flecken bildeten, die weniger an einen frischen Teint als vielmehr an eine unangenehme Hautkrankheit erinnerten. Mit abgewandtem Blick griff sie nach Ludwigs Hand. Ein Ruck, und sie stand wieder auf den Füßen. Dicht vor ihm, zu dicht. Der Schweiß brach ihr aus allen Poren. Sie schielte zu ihm hoch, blickte in sein zu jeder Jahreszeit wie von der Sonne geküsstes Gesicht, die grünen Augen, das spitzbübische Lächeln.
»Eieiei, was seh ich da«, stimmte Herbert an, und die anderen Jungs fielen johlend ein. »Ein verliebtes Ehepaar.«
Lilos Wangen brannten. Mittlerweile glich sie vermutlich einem gescheckten Meerschwein.
»Ach, haltet die Klappe«, rief Ludwig seinen Freunden gut gelaunt zu und schien nicht im mindesten beeindruckt von ihrem Spottlied. Dankbar schaute Lilo zu ihm auf. Er war einer der wenigen Jungs, bei dem das möglich war; die meisten, selbst die älteren, überragte sie trotz ihrer gerade mal zwölfeinhalb Jahre. Ihr Herz schlug schneller, als er ihr den Blick wieder zuwandte. Sie meinte, jeder müsste ihr die Gefühle ansehen, die bei seinem Anblick durch ihren Körper pulsierten.
Sag was, befahl sie sich selbst, sag irgendwas. Aber wie immer in seiner Gegenwart war sie wie gelähmt. Und stumm wie ein Fisch. Sag wenigstens danke, flehte sie innerlich, doch kein Laut kam über ihre Lippen.
Ludwig hob die Hand und legte sie ihr auf den Kopf. Genau über dem Haaransatz. Und dann verstrubbelte er mit schnellen Bewegungen ihr Haar, kraulte und tätschelte sie wie einen Welpen.
»Alles in Ordnung, Lottchen?«, fragte er freundlich.
Sie nickte. Immerhin.
Er grinste zufrieden, drehte sich um und zog den Stock, der noch immer zwischen den Speichen ihres Rades hing, heraus. Warf ihn in die Höhe, sodass er sich einmal in der Luft drehte, fing ihn wieder auf und drohte Herbert im Spaß damit. »Mach das bloß nicht noch mal! So geht man nicht mit kleinen Mädchen um.«
Dann schleuderte er den Ast in hohem Bogen von sich und trat zurück zu seinen Freunden.
Die Gruppe war schon fast aus ihrem Sichtfeld entschwunden, als Lilo sich endlich wieder rühren konnte. Mit einer Hand strich sie sich über die Haare, die vermutlich so aussahen, als hätte darin ein Vogel genistet. Sie versuchte, das Ganze zu glätten, während Elsa den Jungs mit einem unglücklichen Ausdruck in den Augen hinterherstarrte.
»Sie halten uns für Kinder«, stellte sie fest, und Lilo nickte.
»Aber irgendwann nicht mehr«, sagte sie und wusste nicht, wen sie überzeugen wollte, Elsa oder sich selbst. »Irgendwann werden sie sehen, wer wir wirklich sind.«
5.
Als Lilo sich an diesem Abend in der Dachkammer fürs Abendessen umzog, war sie trotz des erniedrigenden Erlebnisses am Mittag gut gelaunt. Wider Erwarten hatte sie die Jungmädelprobe bestanden. Beim Weitsprung hatte Scharführerin Gerda, die die Prüfung abgenommen hatte, beide Augen zugedrückt und die verlangten zwei Meter in ihr Leistungstagebuch eingetragen.
Lilo zog ihre Sportkleidung – kurze schwarze Hosen und weißes Trikot – aus und begutachtete den leuchtenden blauen Fleck auf ihrer Hüfte, dort, wo sie bei ihrem Sturz auf den Boden geprallt war. Aber das Hämatom schmerzte lange nicht so wie die Erkenntnis, dass Ludwig ihr nicht etwa aus Ritterlichkeit oder gar Sympathie geholfen hatte, sondern, weil kleine Mädchen, wie er sie genannt hatte, eben zu beschützen waren. Wann würde er endlich begreifen, dass sie kein Kind mehr war, sondern schon fast eine Frau? Dass die kindliche Schwärmerei, die sie bereits seit Jahren für ihn hegte, etwas anderem gewichen war? Sie konnte Stunden damit verbringen, sich auszumalen, wie er sie küsste, und es schmerzte sie, dass er von solchen Gedanken meilenweit entfernt zu sein schien.
Nur in Hemd und Unterhose stellte sie sich vor den schmalen Spiegel in der Ecke des winzigen Zimmers. Ihr Vater hatte ihn für sie gekauft und aufgehängt. Gegen den Willen der Mutter, die fand, ein zwölfjähriges Mädchen brauche sich nicht täglich mehrmals im Spiegel zu bewundern, das fördere nur Eitelkeit und Hochmut. Doch ihr Vater hatte sich in diesem Punkt durchgesetzt, ebenso wie damit, ihr ein eigenes Zimmer fern von den Brüdern einzurichten. Lilo war ihm dafür ewig dankbar, auch wenn es hier, im zweiten Dienstmädchenzimmer des Hauses, eng und zugig war.
Kritisch betrachtete sie ihr Spiegelbild. Wie ihre Mutter auf die Idee kam, ihr eigener Anblick könnte sie hochmütig machen, war Lilo ein Rätsel. Genau das Gegenteil war der Fall. Unglücklich musterte sie ihre langen, vollkommen geraden Beine und die hervorstehenden Knochen ihrer schmalen Hüften, die nicht einmal den Ansatz einer Rundung zeigten. Obenrum war sie flach wie ein Bügelbrett, während Elsa sogar schon einen Büstenhalter trug. Seufzend wandte Lilo sich ab. Kein Wunder, dass Ludwig sich nicht für sie interessierte. Und natürlich auch kein anderer Junge, auch wenn ihr Letzteres herzlich egal war.
Ohne sich eines weiteren Blickes zu würdigen, holte sie Bluse und Rock aus der Kommode, die ihr aus Platzmangel den Kleiderschrank ersetzte, zog sich an und stieg die steile Treppe hinunter.
Das Speisezimmer befand sich im ersten Stock des Hauses im Hamburger Stadtteil Eimsbüttel. Das Erdgeschoss beherbergte den Eisenwarenhandel der Familie Wiegand. Von Werkzeugen über Baubeschläge zu Haus- und Küchengeräten gab es dort so ziemlich alles zu kaufen, was das Herz begehrte. Das Gebäude mitsamt dem Geschäft war schon eine halbe Ewigkeit in Familienbesitz und wurde jeweils vom Vater zum ältesten Sohn weitervererbt.
Als Lilo den Essraum betrat, hätte sie am liebsten auf dem Absatz kehrtgemacht. Die Familie war bereits vollzählig um die lange Tafel aus schwerer, dunkler Eiche versammelt. Nein, mehr als vollzählig. Denn Ludwig hatte den Platz neben Hans eingenommen. Das kam natürlich häufig vor. Man führte ein offenes Haus, und mindestens eins der vier Kinder hatte eigentlich immer einen Gast zu Besuch. Aber warum musste es heute unbedingt Ludwig sein? Und warum hatte Elsa es ausgerechnet heute abgelehnt, Lilo nach dem Dienst nach Hause zu begleiten?
Die Antwort lag auf der Hand. Nach der mittäglichen Begegnung hatte Elsa ebenso wenig Lust auf ein Treffen mit Hinrich gehabt wie Lilo auf eins mit Ludwig.
»Bist du dort festgewachsen oder möchtest du uns Gesellschaft leisten?«, erkundigte sich Wilhelmine Wiegand mit leisem Spott.
Alle Augen richteten sich auf Lilo.
»Ich komme schon, Mutti«, sagte sie und eilte auf ihren Platz.
Gleich darauf trat Helga, die Haushälterin herein, um Kartoffeln, Gemüse und Fleisch zu servieren. Lilo kaute stumm, den Blick starr auf ihren Teller gerichtet.
Aber sie hätte sich gar nicht so bemühen müssen, die Brüder und deren Freund zu ignorieren, denn die Jungs waren mit ihren eigenen Angelegenheiten beschäftigt. Unter dem Tisch stießen sie sich gegenseitig mit den Füßen an und kicherten wie kleine Mädchen, jedenfalls fand das Lilo.
Irgendwann wurde es dem Vater zu bunt, und seine Faust donnerte auf die Tischplatte, sodass das Porzellan klirrte. Wilhelmine sog erschrocken die Luft ein. Auch wenn sie Albernheiten am Esstisch ebenso missbilligte wie ihr Mann, so sorgten seine zornigen Ausbrüche in ihren Augen doch auch nicht gerade für ein stilles und friedliches Mahl.
»Was ist denn los mit euch Jungs?«, fragte Karl mit lauter Stimme, und alle vier zogen die Köpfe ein. »Was ist so wichtig, dass es unser Abendessen stören darf?«
Niemand antwortete.
»Worüber habt ihr gelacht?«, insistierte Karl und sah streng von einem zum anderen.
Hans warf ihm einen verlegenen Blick zu und machte den Fehler, eine mit der Gabel aufgespießte Kartoffel zum Mund zu führen.
»Niemand isst weiter, bevor ich eine Antwort habe.«
Lilo ließ das Besteck sinken, obwohl sie vermutlich gar nicht gemeint war. Aber sicher war sicher. Zum ersten Mal an diesem Abend sah sie ihre Brüder richtig an, die plötzlich ungemein schuldbewusst wirkten.
»Ich habe Zeit«, sagte der Hausherr, doch der ungeduldige Ausdruck in seinen Augen sprach Bände. Wenn nicht bald jemand etwas sagte, würde er explodieren, und das war nie angenehm, selbst wenn man selbst nicht die Zielscheibe seiner Wut war.
Lilo betete, dass endlich jemand den Mund aufmachte.
»Ich habe nur eine Schallplatte mitgebracht, die wir uns gerne zusammen anhören würden«, erklärte Ludwig schließlich, und Lilo konnte sich nur wundern, wie vollkommen ruhig seine Stimme angesichts der pulsierenden Ader auf der Stirn ihres Vaters klang.
»Wir hören keine Musik beim Essen«, polterte der, und Ludwig schüttelte den Kopf.
»Natürlich nicht. Ich meinte, nach dem Essen. Und natürlich nur, wenn wir das Grammofon in Ihrem Salon benutzen dürfen.«
Hans prustete los, täuschte einen Hustenanfall vor und verbarg sein Gesicht rasch hinter einer Serviette. Erstickte Laute drangen dahinter hervor.
Karl musterte ihn misstrauisch. »Ich wüsste nicht, was dagegen spräche«, sagte er dann langsam. »Aber nun reißt euch zusammen und lasst uns das Essen in Frieden beenden.«
Alle wandten sich wieder ihren Tellern zu.
»Was ist das denn für eine Schallplatte?«, fragte Wilhelmine Ludwig.
Der sah auf. Er wirkte ertappt und für einen Moment vollkommen hilflos. Der Anblick rührte Lilo so sehr, dass sie schnell wegschaute. Doch gleich darauf hatte er sich wieder gefasst.
»Sie heißt Sing, sing, sing«, antwortete er bemüht harmlos.
Doch Lilo kannte ihre Mutter besser als er. Sie war schlau und immer bestens informiert.
»Sing, sing, sing with a swing, meinst du wohl«, sagte Wilhelmine, und Ludwig senkte den Blick.
»Etwa diese Negermusik?«, polterte Karl.
»Nun, diese Musik werden wir hier im Salon ganz gewiss nicht spielen«, stellte seine Frau ruhig fest, ohne auf den Ausbruch ihres Mannes zu achten. »Sicher weißt du, dass es sich dabei um verbotene Musik handelt. Oder, Ludwig?«
Der Angesprochene zog eine Grimasse. »Genau genommen ist sie nur vom deutschen Rundfunk ausgeschlossen. Es gibt kein offizielles Verbot für den Privatgebrauch.«
Lilo hielt erschrocken die Luft an. Sie und ihre drei Brüder starrten Ludwig an. Keiner von ihnen hätte es gewagt, sich auf diese Weise gegen ihre Mutter aufzulehnen. Auch Wilhelmine brauchte einen Moment, um sich zu fassen.
»Wenn du weiterhin in diesem Haus willkommen sein willst, erwarte ich einen respektvolleren Ton. Und du wirst keine solchen Platten mehr mitbringen. Haben wir uns verstanden?«
Für den Bruchteil einer Sekunde schien es, als wolle Ludwig ihr erneut widersprechen, dann aber nickte er.
»Wie bitte?«, fragte Wilhelmine freundlich.
»Ich habe verstanden«, antwortete er, und Lilo konnte spüren, welche Überwindung es ihn kostete.
»Das ist erfreulich.« Sie sah in die Runde. Die Jungs beugten sich tief über ihre Teller, Ludwigs Gesicht überzog ein leichtes Rosa. Der Vater war sichtlich froh, dass seine Frau die Sache so gut geregelt hatte. »Sitz gerade, Lilo«, forderte Wilhelmine ihre Tochter auf, die mal wieder wie ein Fragezeichen in sich zusammengesunken war. »Und nun guten Appetit euch allen.«
6.
Hamburg, 2019
»Nele, bitte entschuldige, es tut mir so leid. O mein Gott!« Franzi verdrehte die Augen und ließ sich mit einem tiefen Seufzer in die dicken Sofakissen fallen. »Ich liebe dieses Kind mehr als alles auf der Welt, aber warum zum Teufel kann es nicht einfach mal einschlafen, ohne dass ich drei Stunden lang Schlaflieder singen muss?«
Nele sah von ihrer Lektüre hoch und auf die alte Taschenuhr, die sie von ihrer Mutter geerbt hatte. »Es war doch nur eine knappe halbe Stunde. Du übertreibst maßlos.«
»Hast du gerade nur gesagt?« Franzi griff sich an den Hals. »Meine Stimmbänder sind vollkommen hinüber. Ich muss dringend was trinken.« Sie griff nach ihrem Glas und stürzte den Rotwein herunter.
Nele betrachtete sie amüsiert. »Das ist bestimmt genau das Richtige für deine Stimmbänder«, kommentierte sie.
»Das vielleicht nicht. Aber für meine Nerven. Na ja. Auch das geht vorbei. Sie bekommt ihren letzten Zahn, die arme Maus. Der quält sie ganz schön. Danach wird es bestimmt besser.« Franzi schenkte sich nach und bemerkte erst jetzt den Stapel Papier auf Neles Schoß. »Du hast die Zeit genutzt«, stellte sie fest. »Und? Wie ist es?«