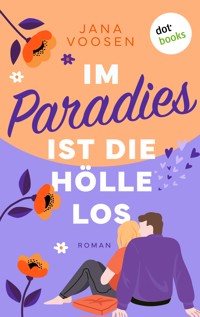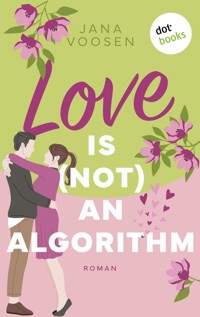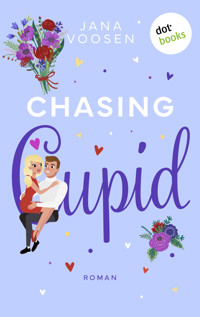9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Was bist du bereit zu opfern für eine bessere Zukunft? Ein mitreißender Roman über Gerechtigkeit und die Macht des Helfens von Jana Voosen. Yma wusste schon immer, dass sie anders ist. Sie kann Mitleid empfinden. Und das ist hochgefährlich. Denn in Vahvin überleben nur die Starken und Gesunden. Den Schwachen zu helfen ist unter Höchststrafe verboten. Yma muss ihre Emotionen sorgsam unter Kontrolle halten. Doch dann verschwindet ihre beste Freundin. Auf der Suche nach ihr begegnet Yma dem geheimnisvollen Len. Was er ihr zeigt, stellt Yma vor eine harte Entscheidung: Wer will sie sein? Wie will sie leben? Und was wird sie riskieren für eine gerechtere Welt?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 417
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Jana Voosen
Broken World
Wie willst du leben?
Über dieses Buch
Yma ist kurz davor, alles zu erreichen, wovon sie träumt. Sie hat sich aus der Unterschicht hochgekämpft und könnte bald in die Elite des Staates Vahvin aufgenommen werden. Sie ist Klassenbeste, sie ist gesund, sie gehorcht dem System. Doch die Sache hat einen gefährlichen Haken: Yma kann Mitleid empfinden. Und das ist in Vahvin verboten. Denn wer den Anforderungen der Elite nicht genügt, wird gnadenlos verstoßen. Helfen ist Hochverrat. Als Ymas beste Freundin Kimi nach einem Gesundheitscheck spurlos verschwindet, macht sich Yma auf die Suche nach ihr. Doch wer den Pfad der Elite verlässt, begibt sich in Lebensgefahr…
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
Jana Voosen beschloss im Alter von sieben Jahren, entweder Schauspielerin oder Schriftstellerin zu werden. Nach dem Abitur studierte sie Schauspiel in Hamburg und New York und schrieb zeitgleich ihren ersten Roman. Seitdem war sie in zahlreichen TV-Produktionen zu sehen (z.B. »Tatort«, »Homeland«) und veröffentlichte erfolgreiche Romane (z.B. »Für immer die Deine«). Jana Voosen lebt mit ihrer Familie in Hamburg. »Broken World« ist ihr Debütroman für junge Erwachsene.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Impressum
Erschienen bei FISCHER E-Books
© 2021 S. Fischer Verlag GmbH, Hedderichstr. 114, D-60596 Frankfurt am Main
Covergestaltung: ZERO Werbeagentur, München
Coverabbildung: pixxwerk unter Verwendung von shutterstock.com
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
ISBN 978-3-10-491435-0
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
[Motto]
Prolog
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
36. Kapitel
37. Kapitel
38. Kapitel
39. Kapitel
40. Kapitel
41. Kapitel
42. Kapitel
43. Kapitel
44. Kapitel
45. Kapitel
46. Kapitel
47. Kapitel
48. Kapitel
49. Kapitel
50. Kapitel
51. Kapitel
52. Kapitel
53. Kapitel
54. Kapitel
55. Kapitel
56. Kapitel
57. Kapitel
58. Kapitel
»Human ist der Mensch, für den der Anblick fremden Unglücks unerträglich ist und der sich sozusagen gezwungen sieht, dem Unglücklichen zu helfen.«
Voltaire (1694–1778)
»Ich zweifle in der Tat, ob Humanität eine natürliche oder angeborene Eigenschaft ist.«
Charles Darwin (1809–1882)
Prolog
Ich zerre an meinen Fesseln. Die Kabelbinder graben sich immer tiefer in mein Fleisch. Mein Gegenüber starrt mich an, die Augen angstgeweitet, mit blutigen Stellen auf der nackten Kopfhaut.
»Das ist alles deine Schuld«, flüstert sie mir zu. »Warum kannst du nicht so sein wie die anderen?«
»Ich hole uns hier heraus«, verspreche ich, um sie zum Schweigen zu bringen. »Wir sind weg, bevor er zurückkommt.«
Mit wenig Hoffnung ruckele ich an dem Stuhl, auf dem ich sitze, fest davon ausgehend, dass er irgendwie mit dem Boden verankert ist. Umso erstaunter bin ich, als ich einen kleinen Satz nach vorne mache.
Die Frau im Spiegel scheint ebenso überrascht wie ich. Ich ruckele auf sie zu, und sie kommt mir entgegen. Wie zwei Tänzer in einem seltsamen Reigen schaukeln wir hin und her, wenden uns halb voneinander ab, sitzen Schulter an Schulter. Ich schaffe es, die Lehne des Stuhls hinter dem Spiegel zu verhaken, ein letzter Blick in ihre Augen, ein entschlossenes Nicken von uns beiden, ein Stoß. Der Spiegel fällt zu Boden und zerspringt in tausend Scherben. Jetzt bin ich allein, ohne sie.
Ich nehme Schwung, schaukele hin und her, hin und her, balanciere für eine Sekunde auf zwei Stuhlbeinen, bevor ich krachend zur Seite kippe.
Wie in Zeitlupe falle ich zu Boden, schließe die Augen und bete, dass sich eine Scherbe ohne mein Zutun in meine Halsschlagader bohren wird.
1
Wenige Wochen zuvor
»Weißt du, Kimi, eigentlich habe ich etwas anderes zu tun«, sage ich zögernd zu meiner Freundin, die mich zielstrebig in Richtung des größten und teuersten Einkaufszentrums Johtajas, der Metropole Zentral-Vahvins zieht. Sie beachtet mich gar nicht.
Staunend sehe ich an der gläsernen Fassade hinauf. Hierher verschlägt es mich nicht allzu oft. Kein Staubkorn, kein Fingerabdruck stört die funkelnde Fläche, in der sich die Mittagssonne spiegelt. An jedem der Haupteingänge stehen Männer in schwarzen Anzügen. Fast sehen sie aus wie Besucher eines Theaterabends, wären da nicht die kaum sichtbaren Mikrophone an ihren Hemdkrägen und die Ausbuchtung hinten an ihren Jacken, wo sie ihre Waffen tragen. Sicherheitspersonal.
Im Inneren erkenne ich die reichen Kunden, die auf Dutzenden silberner Rolltreppen von einem Geschäft zum nächsten schweben, riesige Einkaufstaschen in den Händen haltend. Zufrieden sehen sie aus und wohltemperiert.
Das gibt den Ausschlag. Es ist ein brütend heißer Tag, mal wieder kratzt das Thermometer an der Vierzig-Grad-Marke, und dabei haben wir gerade erst Juni. Der Schweiß rinnt mir aus allen Poren, das Kleid klebt unangenehm an meinen Oberschenkeln.
Also nicke ich zustimmend. »Von mir aus.« Nicht, dass ich wirklich eine Wahl gehabt hätte. Wir machen sowieso meistens das, was Kimi sagt.
»Na also.« Sie lächelt breit und legt den Arm um mich. Dann lässt sie ihn schnell wieder sinken. Es ist einfach zu heiß.
Die Eingangstüren öffnen sich lautlos und automatisch. Der Sicherheitsbeamte wirft mir einen seltsamen Blick zu.
»Sie ist mit mir hier.« Kimi hakt mich unter. Der Mann in Schwarz deutet eine Verbeugung an und lässt uns passieren.
Die plötzliche Kälte der Klimaanlage lässt die Feuchtigkeit auf unserer Haut verdunsten und wirkt wie eine erfrischende Dusche.
»Ah«, mache ich erleichtert. »Das tut gut.«
»Sag ich doch. Und jetzt geht es los.« Kimis Augen blitzen unternehmungslustig. »Wir gehen zu Til Bander. Die neue Kollektion ist göttlich.« Sie strebt in Richtung der funkelnden Rolltreppen, ich folge ihr seufzend.
In der edlen Boutique wird Kimi hofiert wie eine Königin. Kein Wunder. Sie hat hier schon ein kleines Vermögen ausgegeben.
Eine Verkäuferin mit hüftlanger, schwarzer Mähne stürmt auf sie zu, redet in einem fort und greift wie nebenbei ein halbes Dutzend Kleider von der Stange, die wie für Kimi gemacht sind.
Ich folge den beiden in Richtung der Umkleidekabinen, darauf bedacht, nur ja keines der exklusiven Kleidungsstücke zu streifen.
»Suchen Sie auch etwas?«, fragt eine andere Verkäuferin, deren kohlschwarze, gebogene Augenbrauen sich seltsam von ihrem Porzellanteint und dem wasserstoffblonden Haar abheben, in meine Richtung, und ich schüttele den Kopf.
Sehe ich vielleicht so aus, würde ich am liebsten sagen. Stattdessen beiße ich mir auf die Lippen und zupfe verlegen an meinem schlichten Shirt herum, das nicht nur knittrig und verschwitzt, sondern vom vielen Waschen schon ziemlich ausgeblichen ist. Wie so oft, wenn ich mich in Kimis Welt aufhalte, komme ich mir fehl am Platz vor. Daran werde ich mich wohl nie gewöhnen, obwohl wir seit fast acht Jahren befreundet sind.
»Natürlich.« Kimi, die hinter dem goldenen Samtvorhang verschwunden ist, streckt kurz den brünetten Lockenkopf hervor. »Sie braucht auch ein Kleid. Elegant, nicht zu aufgedonnert. Erstes Date.«
Die Verkäuferin zuckt nicht mal mit der Wimper. »Sehr gern!« Sie mustert mich mit professionellem Blick. »Größe 36. Grün- oder Blautöne, die bringen Ihre Haarfarbe zur Geltung. Bin gleich wieder da.«
Noch bevor ich den Kopf schütteln und das Ganze aufklären kann, ist sie schon verschwunden.
In diesem Moment tritt Kimi in einem eng anliegenden Kleid aus knallrotem Satin aus der Umkleidekabine. »Was meinst du?« Sie streicht mit den Händen an ihrem kurvigen Körper entlang und schaut hinunter in ihr ziemlich offen zur Schau gestelltes Dekolleté. »Bisschen zu krass, oder?«
»Kimi«, sage ich leise, ohne auf ihre Frage einzugehen, »du weißt genau, dass ich kein Kleid kaufen kann.«
»Du nicht, aber ich.«
Vehement schüttele ich den Kopf. »Kommt überhaupt nicht in Frage.«
»Hör zu«, Kimi kommt auf mich zu und ergreift meine Hände, »das ist ja kein Almosen.« Ich zucke bei dem Wort unwillkürlich zusammen. »Sondern eine Bezahlung. Ich muss vor dem Nachmittagsunterricht noch Mathe und Physik bei dir abschreiben.« Sie grinst. »Der reine Kapitalismus.«
Ich schüttele den Kopf. »Deshalb musst du mir doch kein Kleid kaufen.«
»Doch, muss ich. Sonst ist es nämlich eine unentgeltliche Hilfeleistung von dir, und du weißt ja …« Sie spricht den Satz nicht zu Ende, und das muss sie auch gar nicht. Natürlich weiß ich.
Zwanzig Minuten später verlassen wir das Modegeschäft mit fünf neuen Kleidern. Vier für Kimi, eins für mich. Es ist so grün wie meine Augen, lässt meine kupferroten Haare leuchten und hat über dreihundert Credits gekostet. Das ist mehr, als meine Mutter in einer Woche verdient.
Kimi holt uns noch einen extragroßen, frisch gepressten Saft vom Vitamintresen und reicht mir einen davon. »Und, findest du immer noch, dass du deine Mittagspause besser hättest verbringen können?«
»Na ja.«
Gespielt genervt verdreht sie die Augen. »Trainiert hast du heute Morgen vor der Schule. Und ich weiß, dass du alle Hausaufgaben in der dafür vorgesehenen Arbeitsgruppe erledigt hast. Wie immer.« Sie seufzt leise. »Man braucht auch mal ein bisschen Spaß. Das ist unabdingbar für die Gesundheit eines funktionierenden Mitglieds unserer Gesellschaft.«
»Schon klar«, antworte ich und werfe einen Blick auf meine Smartwatch. »Ich wollte nur eigentlich noch ein bisschen Chemie wiederholen.«
»Meine Güte, man kann es aber auch übertreiben, Yma. Du bist doch schon Klassenbeste. Wen willst du noch überflügeln?«
Darauf antworte ich lieber nicht. Was soll ich auch sagen? Kimi ist meine beste Freundin, trotzdem wird sie mich nie ganz verstehen. Das kann sie gar nicht. Sie gehört zur Elite und wurde, wie sie selbst gern sagt, mit dem goldenen Löffel im Arsch geboren. Die Villa ihrer Eltern hat zehn Zimmer und einen Pool. Das Schulgeld für das Gymnasium zahlt sie aus der Portokasse. Bei mir ist das anders. Meine Mutter hat zwei Jobs, wir leben in einer winzigen Zwei-Zimmer-Wohnung, und alle in meiner Klasse überflügeln kann ich nur, weil ich mich seit der Fünften von Förderstipendium zu Förderstipendium hangele. Ich bin Klassenbeste, weil ich gar keine andere Wahl habe. Zumindest, wenn ich mal ein besseres Leben haben will. Ein Leben als Mitglied der Elite.
Kimi stupst mich freundschaftlich in die Seite. »Hey, alles in Ordnung? Tut mir leid.«
Ich glaube, sie weiß eigentlich gar nicht so richtig, wofür sie sich entschuldigt, trotzdem lächele ich sie dankbar an. »Schon gut.«
2
Als wir nach draußen treten, hatte ich schon wieder vergessen, wie heiß es wirklich ist. »Mannomann«, ächze ich, und erneut bricht mir der Schweiß aus. »Smarty, wie viel Grad haben wir?«, frage ich meine Smartwatch. Ihr diesen Namen zu geben war Kimis Idee. Und ich tue ja meistens, was sie sagt.
»Wir haben einundvierzig Grad im Schatten«, antwortet Smarty.
»Wahnsinn.« Kimi nimmt einen großen Schluck von ihrem Saft.
»In dreißig Minuten beginnt dein Mathematikunterricht. Du bist fünfzehn Fußwegminuten von der Schule entfernt«, sagt meine Smartwatch ungefragt. »Das sind etwa 1500 Schritte. Bis zu deinem Tagespensum fehlen dir danach noch ungefähr 4000 Schritte.«
»Danke, Smarty«, sage ich, und Kimi kichert.
»Es ist einfach zum Schreien, dass du dich bei einem elektronischen Gerät bedankst«, sagt sie nicht zum ersten Mal.
»Ja, ja, ich weiß«, sage ich. »Komm, wir gehen zurück. Du willst doch noch abschreiben.«
»Stimmt.«
Ich hole meinen Sonnenschirm hervor und spanne ihn auf, weil meine helle sommersprossige Haut jedes Zuviel an UV-Strahlung übel nimmt. Dann wandern wir langsam die von Kastanien- und Lindenbäumen gesäumte Hauptstraße hinunter in Richtung unserer Schule. Ein Bewässerungsfahrzeug überholt uns. Der feine Sprühnebel weht von dem kräftigen Wasserstrahl zu uns herüber und benetzt mein heißes Gesicht. Es fühlt sich herrlich an, leider ist der Wagen schnell an uns vorbei und lässt uns in der Mittagshitze zurück.
Als er etwa zehn Meter von uns entfernt seine Fahrt verlangsamt und einen besonders großen Baum gießt, springt eine schmale Gestalt hinter dem Stamm hervor. Ein Junge. Er stellt sich mit geöffnetem Mund unter den Wasserstrahl, formt die Hände zu einer Schale und trinkt. Nur Sekunden später versiegt die Quelle. Der Fahrer brüllt etwas aus dem geöffneten Seitenfenster, dann öffnet er mit einem Ruck die Tür und springt aus dem Auto.
Ich sehe, wie der Junge die Flucht ergreifen will, doch der Mann, groß und breitschultrig, schnappt ihn am Arm und hält ihn fest. Unwillkürlich beschleunige ich meine Schritte.
»Was machst du denn?«, höre ich Kimi rufen.
»Mach das nicht noch mal, Kleiner, sonst lernst du mich kennen, verstanden?« Der Hüne schüttelt das Kind, das, wie ich jetzt erkenne, kaum zehn Jahre alt sein kann. Seine Hose ist zu kurz und hat Löcher an den Knien, das T-Shirt dagegen ist viel zu groß und so verwaschen, dass man weder die Aufschrift noch seine ursprüngliche Farbe erkennen kann. Er trägt keine Schuhe, seine Füße starren vor Dreck.
Wie hält er es aus, über den glühenden Asphalt zu laufen, fährt es mir durch den Kopf.
»Das Wasser ist für die Bäume bestimmt und nicht für schmutziges Gesindel wie dich, kapiert? Geh zurück in die Slums, wo du hingehörst. Was hast du hier überhaupt zu suchen?«, schimpft der Mann weiter. Seine Pranke hinterlässt rote Spuren auf der Haut des Jungen, der mir in diesem Moment sein Gesicht zuwendet und mich aus großen blauen Augen ansieht. Seine Lippen sind rau und aufgesprungen, die Haut entlang des Haaransatzes schuppig und entzündet.
Neben ihm auf dem Boden entdecke ich Müllsack und Abfallgreifer.
»Ist ja schon gut, lassen Sie ihn los«, sage ich, »er hat ein Recht, hier zu sein, sehen Sie doch.« Ich deute in Richtung der Arbeitsmaterialien des Kleinen.
Der Fahrer sieht mich irritiert an und stößt den Jungen so grob von sich, dass dieser am Fuß des Baumes zu Boden fällt.
»Er soll Müll aufsammeln. Kein Wasser stehlen«, sagt er aufgebracht. Bei diesem Wort zuckt der Junge zusammen.
»Nun hören Sie schon auf«, sage ich, »es ist doch nichts passiert.«
»Kennen Sie ihn etwa?«, fragt der Mann misstrauisch.
»Nein.«
»Sollten sich besser um Ihre eigenen Angelegenheiten kümmern«, brummt er, dann steigt er zurück in sein Fahrzeug und fährt davon.
Der Junge schaut zu mir auf.
Kimi ist inzwischen herangekommen und bleibt in einem Sicherheitsabstand stehen. »Kommst du?«, fragt sie ungeduldig.
»Ja.« Aber ich rühre mich nicht von der Stelle. Etwas hält mich zurück. Etwas in den Augen des Jungen. Diese Mischung aus Trotz, Dankbarkeit und unendlicher Verzweiflung.
Das könntest auch du sein, fährt es mir durch den Kopf, ohne deine Mutter, die sich beide Beine ausreißt. Ohne das Stipendium.
Der Junge wendet seinen Blick ab. Schaut auf die dunkle Erde um den Baum herum, in die das Wasser schon fast vollständig eingesickert ist. Da sind nur noch ein paar kleine Pfützen. Er denkt nicht einmal darüber nach, bevor er sich bäuchlings in den Dreck wirft. Ungläubig beobachte ich ihn dabei, wie er zu trinken beginnt, im Wettlauf mit dem verdorrten Erdreich.
»Yma«, drängelt Kimi.
Ich nicke geistesabwesend. Mache einen Schritt auf den Jungen zu, halte ihm, ohne nachzudenken, meinen noch zur Hälfte gefüllten Saftbecher hin.
Fassungslos starrt er zu mir hoch. Und genau das, seine Fassungslosigkeit, bringt mir ins Bewusstsein, was ich da gerade zu tun im Begriff bin. Noch mehr als Kimis empörter Ausruf in meinem Rücken. Ich ziehe meine Hand so schnell zurück, dass mir das Getränk entgleitet und auf den Boden fällt. Die Zeit scheint für einen Moment stillzustehen, während wir beide, ich und das Kind aus den Slums, beobachten, wie der Becher umkippt und sein Inhalt versickert. Dann kommt Bewegung in den Jungen, er hechtet nach vorne, doch ehe er das Trinkgefäß ergreifen, die letzten noch darin befindlichen Tropfen retten kann, tritt Kimi mit ihrer eleganten Riemchensandale dagegen. Der Becher fliegt durch die Luft, Saft spritzt umher, und in den Augen des Jungen blitzt ein so lodernder Zorn auf, dass ich erschrocken zurückweiche.
»Verschwinde«, sagt Kimi knapp und vollkommen unbeeindruckt. Ohne darauf zu warten, ob er ihrem Befehl folgen wird, nimmt sie meine Hand und zieht mich mit sich die Straße hinunter. Ich stolpere neben ihr her, während das Blut in meinen Ohren rauscht. Obwohl ich es nicht will, wende ich mich noch einmal um. Sehe den Jungen, der den Becher nun doch aufgehoben hat. Ihn über seinen geöffneten Mund hält und schüttelt, in dem verzweifelten Versuch, ihm einen Tropfen Saft abzuringen. Ich kann nichts dagegen tun. Ich weiß, dass es falsch ist, was ich fühle, aber er tut mir unendlich leid.
»In zwanzig Minuten beginnt der Mathematikunterricht«, sagt Smarty.
Ich wende den Blick wieder nach vorne, schüttele den Kopf, um die düsteren Gedanken zu vertreiben, und bemühe mich um einen lockeren Tonfall.
»Wir sollten uns beeilen«, sage ich.
Kimi fährt zu mir herum, und ich sehe, dass sie nicht bereit ist, den Vorfall einfach so auf sich beruhen zu lassen.
»Bist du eigentlich von allen guten Geistern verlassen? Was hast du bloß getan?«
»Ich … na ja.« Ich beiße mir auf die Lippen.
»Du wolltest ihm helfen«, sagt Kimi.
»Nicht wirklich. Wenn mir ein Kellner ein Wasser bringt, dann ist das doch schließlich auch keine Hilfeleistung im üblichen Sinne«, versuche ich einen Scherz, der gründlich misslingt.
»Weil du dein Wasser bezahlst«, fährt sie mich an.
»Ja, schon gut.« Ich weiche ihrem Blick aus und sehe auf meine Fußspitzen hinunter.
»Es ist verboten, den Hilflosen zu helfen«, sagt sie, und ich blicke genervt auf.
»Das weiß ich selbst. Hör auf, mit mir zu sprechen, als sei ich vollkommen verblödet.«
»Es macht ganz den Anschein, als seist du genau das. Vollkommen verblödet.«
»Ich habe es ja nicht getan.« Ich zucke mit den Schultern. »Es war nur ein … Reflex. Ich hatte sowieso keinen Durst mehr und …«, kurz halte ich inne, »… außerdem muss es ja niemand erfahren.« Ich mustere sie forschend.
»Guck mich nicht so an. Als würde ich so was tun. Dich verpfeifen. Was denkst du denn von mir?«
Ich lächele und spüre, wie sich die Erleichterung in mir breitmacht. »Aber dann ist doch alles gut.«
Kimis Miene bleibt so finster wie zuvor. »Nichts ist gut.« Sie deutet zur Straße. Ein paar Meter weiter steht eine Überwachungskamera. Natürlich. Ihr Anblick lässt das ungute Gefühl in meiner Magengegend erneut aufleben.
»Oh. Mist«, sage ich tonlos.
»Nun ja«, bemüht sich Kimi um einen aufmunternden Ton, »wie du schon sagtest: Du hast es nicht getan. Und außerdem wird zwar alles aufgezeichnet, aber ohne ein Verdachtsmoment schaut bestimmt keiner in den Film hinein.«
»Ja.« Ich nicke. Ganz beruhigt bin ich trotzdem nicht.
Eine Weile gehen wir schweigend nebeneinanderher.
»Hast du gesehen, wie dünn er war? Der kleine Junge. Furchtbar dünn. Und wie er das Wasser aus der Erde gesaugt hat.«
»Ja«, sagt Kimi, und ihre Stimme hat einen ungeduldigen Unterton, »ich habe es gesehen. Und?«
»Nichts und. Er tut mir halt leid, das ist alles.«
»Yma«, sagt sie warnend.
»Schon gut. Das ist schließlich nicht verboten.«
»Das nicht. Aber es ist der erste Schritt in die falsche Richtung. Also lass es sein.«
3
Gerade noch rechtzeitig zum Nachmittagsunterricht erreichen wir unsere Schule. Ich mische mich unter die Schüler, die allesamt entspannt und erholt aussehen. Kein Wunder, sie haben die Zeit nach dem Mittagessen genutzt, um ihre Leistungsfähigkeit auf den optimalen Stand zu bringen. Viele haben vom Duschen nach ihrer Sporteinheit noch nasse Haare.
Ich trainiere immer morgens, die Mittagspause verbringe ich, wenn ich nicht gerade lerne, meist entweder im Meditations- oder im Schlafraum. Dessen Tür öffnet sich gerade, und der Duft von entspannenden, ätherischen Ölen – Lavendel, Bergamotte und Rosen – steigt mir in die Nase. Zwei Jungen aus meinem Jahrgang treten heraus. Als ich erkenne, um wen es sich handelt, werden meine Wangen heiß. Einer von ihnen ist Adriel.
»Hey, Yma.« Er schließt zu mir auf.
»Hi.« Ich lächele ihn an.
»Wo warst du denn heute Mittag?«, fragt er, und mein Lächeln verrutscht.
»Wieso?«
Er legt den Arm um meine Schultern und lehnt sich zu mir herunter. Eine dunkelblonde Haarsträhne fällt ihm dabei hinreißend in die Stirn. »Muss ich es wirklich sagen?«, flüstert er mir zu.
Ich halte abrupt an, das Herz klopft mir bis zum Hals.
Er hebt die Schultern. »Es fällt mir sehr schwer, einzuschlafen, wenn du nicht neben mir liegst.« Mit zur Seite geneigtem Kopf sieht er mich an, seine sehr hellblauen Augen funkeln vor Vergnügen. Dann hebt er entschuldigend die Hände. »Tut mir leid. Du wolltest es unbedingt hören.«
»Ach so.« Ich brauche eine Weile, um mich von dem Schreck zu erholen. Dann nenne ich mich innerlich einen Dummkopf. Selbst wenn die Überwachungskamera mich aufgezeichnet hätte. Selbst wenn jemand gesehen hat, was ich um ein Haar getan hätte. Warum sollte derjenige zu Adriel laufen, um ihm davon zu erzählen? Da merkt man mal wieder, dass ein schlechtes Gewissen jeglichen gesunden Menschenverstand zuverlässig auszuschalten versteht.
»Ich war im Einkaufszentrum«, beantworte ich endlich seine Frage.
»Mit einem anderen Mann?« Gespielt entrüstet zieht er die Augenbrauen zusammen.
»Vielleicht.« Geheimnisvoll wiege ich den Kopf hin und her. Das Ganze fängt an, mir Spaß zu machen.
Adriel greift sich mit der rechten Hand ans Herz und verzieht das Gesicht. »Tu mir das nicht an, Yma. Brich mir nicht das Herz. Ich weiß, dass wir beide füreinander geschaffen sind.«
»Tatsächlich?« Ich versuche, ganz cool zu bleiben, obwohl ich vor lauter Aufregung das Blut in meinen Adern rauschen höre.
Yma und Adriel. Eigentlich haben wir nicht viel gemeinsam. Er ist Elite von Geburt an, wahnsinnig gutaussehend und strotzt nur so vor Selbstbewusstsein.
»Und du weißt es auch.« Er grinst, was ihm ein entzückendes Grübchen in die linke Wange zaubert. »Noch zwei Wochen, dann können wir endlich miteinander ausgehen.«
In zwei Wochen endet das Schuljahr. Der sogenannte Fusion-Break beginnt, und jeder, der bis zu diesem Zeitpunkt volljährig, also achtzehn Jahre alt ist, darf mit der Partnersuche beginnen. Sofern er auch alle sonstigen Voraussetzungen erfüllt.
»Freut mich, dass du so überzeugt von dir bist«, sage ich neckend.
»Von uns, Yma. Von dir und mir.« Er greift nach meinen Händen. »Und dann werde ich nie wieder Schlafprobleme haben. Weil du nämlich neben mir liegen wirst. Jede Nacht. Allerdings …« Er stockt und mustert mich plötzlich von oben bis unten. Unbehaglich sehe ich ihn an. Er schüttelt den Kopf. »Ich fürchte, wir werden ein Problem bekommen«, sagt er mit ernster Miene. »Vermutlich werde ich nie mehr schlafen wollen, wenn du neben mir liegst. Da fallen mir ganz andere Sachen ein, die ich lieber täte.«
Ich spüre, wie mir das Blut in die Wangen schießt, und suche verzweifelt nach einer schlagfertigen Antwort. Natürlich werde ich nicht fündig. Ich stehe einfach nur da mit meiner knallroten Birne und frage mich wie schon so oft, ob Adriel eigentlich ein süßer Typ oder ein übergriffiger Aufschneider ist. Als er mir fröhlich zuzwinkert und in einem der Klassenräume verschwindet, entscheide ich mich für die erste Variante. Er ist hinreißend.
Noch während ich versuche, meine Gesichtsfarbe wieder einigermaßen unter Kontrolle zu bringen, holt mich Kimi ein.
»Danke«, sagt sie ein bisschen atemlos und reicht mir meine Hausaufgaben. »Hab ein paar Fehler eingebaut, damit es nicht so auffällt. Und, was wollte Mister Sexy von dir?« Sie hält inne und mustert mich eingehend. »Wie siehst du denn aus? Bist du sicher, dass mit deinem Blutdruck alles in Ordnung ist?«
»Ja, natürlich«, wehre ich ab.
»Ah, ich verstehe.« Kimi grinst wissend. »Er hat dich mal wieder angebaggert. Was hat er denn gesagt?«
»Ach nichts.« Meine Ohren werden schon wieder ganz heiß.
Kimi lacht. »Hat er dir etwa ein eindeutiges Angebot gemacht?«
»Ich glaube schon.«
Sie seufzt theatralisch. »Du Glückliche. Wenn ich du wäre, müsste ich schwer an mich halten, um ihn nicht in den Ruheraum zu zerren und den Antrag anzunehmen.«
Das meint sie natürlich nicht ernst. In Vahvin haben wir keine Beziehungen mit dem anderen Geschlecht. Jedenfalls nicht bis zum Fusion-Break. Vorher sollen wir uns auf unsere Ausbildung konzentrieren. Aber Kimi schaut so verträumt in die Ferne, dass ich doch nachhake.
»Ehrlich?«
Kimi zuckt lächelnd mit den Achseln. »Zumindest der Gedanke ist überaus reizvoll, findest du nicht?«
»Doch«, seufze ich und nehme den Weg in Richtung unseres Klassenraumes wieder auf. »Aber ich kenne ihn doch kaum.«
»Stimmt. Gerade mal acht Jahre lang. Seit der fünften Klasse«, spöttelt Kimi mir folgend.
»Ich meine, ich habe ihn noch nie außerhalb der Schule getroffen.«
»Na, dazu wirst du ja bald Gelegenheit bekommen.«
»Meinst du?«
»Was ist das für eine Frage? Natürlich. Er will, du willst. Was gibt es da noch zu überlegen? Außerdem passt ihr zusammen wie Arsch auf Eimer. Das sieht sogar ein Blinder.«
Ich verziehe das Gesicht, und Kimi lacht.
»Verzeihung. Nicht romantisch genug? Dann lass es mich so formulieren: Ihr beide gehört zusammen wie der Schmetterling und die Blume, wie die Sonne und der Sommer, wie …«
»Schon gut, veräppeln kann ich mich alleine.« Ich beschleunige meine Schritte, weil Nita Icho, unsere Lehrerin, soeben ein paar Meter vor uns den Kursraum betreten hat. Eilig schlüpfen Kimi und ich hinter ihr hinein, sie nimmt mein entschuldigendes Lächeln mit einem Nicken zur Kenntnis und bedeutet uns, Platz zu nehmen. Ich setze mich an meinen Tisch, Kimi sitzt zwei Reihen hinter mir. »Auf jeden Fall werdet ihr verdammt niedliche Kinder bekommen, so viel steht fest«, raunt sie mir im Vorbeigehen zu und grinst zufrieden, als mein Gesicht schon wieder die Farbe wechselt.
4
Ich versuche, den Gedanken an Adriel und unsere eventuellen Nachkommen beiseitezuschieben, um dem Unterricht zu folgen. Geschichte ist eines meiner Lieblingsfächer.
Mit der Fernbedienung schaltet Nita Icho die elektronische Tafel ein.
»Eure Prüfungen nahen«, sagt Nita Icho, »und deshalb wollen wir in den nächsten Stunden ein bisschen Basiswissen wiederholen.«
Ein Aufstöhnen geht durch die Reihen, von dem sich unsere Lehrerin nicht aus der Ruhe bringen lässt. Sie lächelt. »Ja, ja, es mag euch langweilig, vielleicht sogar unnötig vorkommen, aber ihr werdet überrascht sein, wie viel Wissen aus den unteren Jahrgangsstufen ihr mittlerweile vergessen habt. Also, nehmen wir mal an, die Prüfer sind euch wohlgesonnen, dann stellen sie euch vielleicht eine lächerlich einfache Frage wie die folgende: Beschreiben Sie den sogenannten Sozialstaat der Postmoderne und seinen Niedergang anhand seiner primären Merkmale.«
Ihr Blick schnellt suchend zwischen den Schülern umher. Ganz automatisch hebe ich den rechten Arm, obwohl sie mich vermutlich sowieso nicht drannehmen wird. Und richtig.
»Aluna«, sagt sie. Ich wende mich um und stelle fest, dass meine sonst stets fröhliche Klassenkameradin rot geweinte Augen hat. Jetzt starrt sie Nita Icho an wie ein hypnotisiertes Kaninchen die Schlange.
»Nun?«, fragt die Schlange ungeduldig, und Aluna erhebt sich im Zeitlupentempo. Zieht geräuschvoll die Nase hoch, versucht sich zu sammeln.
»Ich …«
»Ja?«
»Ähm. Der Sozialstaat der Postmoderne …« Aluna starrt auf die Tischplatte ihres Pults, als könne sie darauf die Antwort auf die Frage ablesen.
Komm schon, Aluna, denke ich, reiß dich zusammen. Aber das tut sie nicht. Stattdessen rinnt ihr ganz langsam eine Träne die Wange herunter, bleibt zitternd an ihrem Kinn hängen und fällt auf das helle Holz, wo sie in winzige Tröpfchen zerplatzt. Was ist denn bloß los mit ihr?
»Setzen«, sagt Nita Icho schneidend, ohne den Tränen ihrer Schülerin Beachtung zu schenken. Dann sieht sie sich im Raum um. »Irgendjemand hier, der eine Karriere oberhalb des Kloputzens anstrebt und diese wirklich einfache Frage beantworten kann?«
Ich ziehe den Kopf ein, aber ausgerechnet dieses Mal ruft Nita Icho mich auf.
»Yma.«
Mit leisem Widerwillen erhebe ich mich. »Der Sozialstaat der Postmoderne hatte die soziale Gerechtigkeit und Sicherheit jedes einzelnen Bürgers zum Ziel. Dieses verwirklichte er mit entsprechenden gesetzgeberischen Maßnahmen sowie materiellen Unterstützungsleistungen. Alle sogenannten benachteiligten Bürger – Kranke, finanziell Schwache und anderweitig schutzbedürftige Personen – wurden vom Staat unterstützt. Lebensrisiken und ihre sozialen Folgewirkungen wurden abgefedert. Zu den sozialen Leistungen zählten Arbeitslosengeld, Wohngeld, Renten, Entschädigungszahlungen, Krankenversicherung und vieles mehr. Lange Zeit galt diese Staatsform als die einzig moralisch vertretbare. Das Sozialstaatsprinzip war bis zu seiner Aufhebung vor hundertfünfzig Jahren im Grundgesetz verankert«, leiere ich herunter, so schnell ich kann.
»Und warum wurde er aufgehoben? Das klingt doch eigentlich ganz nett«, fragt meine Lehrerin, noch bevor ich mich wieder setzen kann.
»Kurz vor den Reformen stand das System vor dem Zusammenbruch. Es herrschte eine enorme Überbevölkerung. Die Bevölkerung vergreiste, man ließ die Alten und Kranken nicht sterben, sondern verlängerte ihr Leben auf teilweise unwürdige Art und Weise. Die Verlierer der Gesellschaft, die sich nicht selbst versorgen konnten und unter natürlichen Bedingungen gestorben wären, wurden durch das System mitversorgt. So überlebten sie nicht nur, sondern konnten sich sogar vermehren. Dadurch stellte sich der Mensch selbst ein Bein. Er stoppte nicht nur die eigene Evolution, sondern er überforderte auch den Planeten, auf dem er lebte. Die Natur wehrte sich durch den Ausbruch einer Pandemie. Ein Virus umrundete die Welt und forderte viele Menschenleben. Die Regierungen der einzelnen Länder versuchten, das Virus durch strenge Lockdowns einzudämmen. Die daraus resultierende wirtschaftliche Not vieler sollte durch den Staat aufgefangen werden. Doch kaum war das erste Virus besiegt, folgte eine zweite, noch tödlichere Pandemie. Die Welt versank im Chaos, und die Machthaber des ehemaligen Europas erkannten, dass nicht jeder gerettet werden konnte. Sie schlossen sich zum heutigen Vahvin zusammen. Heute leben wir nach den Naturgesetzen. Die Starken überleben. Die Schwachen sterben.«
»Danke, Yma.« Nita Icho nickt mir zu und wendet sich wieder an Aluna. »Und kannst du mir wenigstens sagen, worin die Reformen durch unseren verehrten Ersten Präsidenten bestanden?«
»Die Abschaffung staatlicher Unterstützungsleistungen und jeglicher medizinischer Versorgung«, antwortet diese leise.
»Ganz recht. Die Zahlen sprechen für sich. Unser Bevölkerungswachstum ist negativ, und da sich hauptsächlich die Elite erfolgreich fortpflanzen kann, wird unser Volk mit jeder Generation gesünder und leistungsfähiger. Sogar das Einwanderungsproblem wurde gelöst. Wir brauchen dafür nicht einmal Mauern oder Stacheldraht, wie es in der Alten Welt der Fall war. Niemand kommt auf einen Kontinent, in dem er keine Hilfe erwarten kann. Wolltest du noch etwas sagen, Aluna?«
Die Angesprochene beißt sich auf die Lippen. »Aber wie kann man einfach danebensitzen, wenn jemand stirbt?«, platzt es aus ihr heraus.
Nita Ichos Blick wird eisig. »Du musst ja nicht danebensitzen.«
Nach der Stunde verlässt Aluna mit gesenktem Blick den Kursraum. Ich beeile mich, meine Sachen zusammenzupacken, und folge ihr.
»Aluna?«, frage ich, nachdem ich sie eingeholt habe. Sie bleibt nicht stehen.
»Ich muss weg«, murmelt sie, ohne mich anzusehen.
Ich lege ihr eine Hand auf den Unterarm. »Jetzt warte doch mal«, bitte ich, und sie hält tatsächlich inne. Sieht mich an. Widerwillig. »Was ist denn? Ich hab doch gesagt, dass ich keine Zeit habe.«
Ich betrachte sie mitleidig. Aus der Nähe ist deutlich zu erkennen, dass sie in letzter Zeit viel mehr Tränen vergossen hat als nur die eben im Klassenzimmer. Ihre Augen sind gerötet, die Lider geschwollen. Es scheint ihr schlecht zu gehen.
»Kann ich dir irgendwie helfen?«, bricht es aus mir heraus. Sie sieht mich erschrocken an. Hilfe – das Unwort von Vahvin. »Ich meine«, korrigiere ich mich sofort, »kann ich dich unterstützen?«
Sie schüttelt den Kopf. »Nein, danke.«
Ich trete noch ein Stück näher an sie heran. »Jemand aus deiner Familie?«, flüstere ich, damit niemand der um uns herumwuselnden Schüler etwas mitbekommt.
Sie nickt. »Mein Vater«, antwortet sie erstickt, und schon wieder glitzern die Tränen in ihren Augen.
»Das … oh nein, ich meine … tut mir leid«, stammele ich unbeholfen.
»Ja. Mir auch.«
»Was hat er denn?«
Sie strafft die Schultern, ihre Miene vereist. »Spielt das eine Rolle? Ist doch vollkommen egal. Wahrscheinlich hat er eine Krankheit, die man vor hundertfünfzig Jahren hätte heilen können. Durch eine Operation. Oder ein paar Tabletten.«
Ihre Stimme ist lauter geworden, und ich sehe mich unbehaglich um, ob jemand unser Gespräch mit anhören kann. Aber zum Glück scheint sich niemand für uns zu interessieren.
»Du solltest leiser sprechen«, sage ich trotzdem.
»Es geht ihm so schlecht«, ihre Augen füllen sich mit Tränen, »jeder Atemzug ist eine Qual. Und ich soll einfach dabei zusehen, wie er stirbt? Ich verstehe nicht …« Sie bricht ab, und sie muss auch gar nicht weitersprechen. Ich weiß, welche Worte sich hinter ihren fest zusammengepressten Lippen aufstauen. Was sie am liebsten laut herausschreien würde. Wie soll das gehen? Woher kommt der Impuls in mir, den Schwachen helfen zu wollen? Bin ich nicht normal, oder seid ihr es?
Ich denke an den kleinen Jungen, sehe vor meinem inneren Auge, wie meine Hand mit dem Getränk sich ganz automatisch in seine Richtung streckt.
»Aber was soll man machen?« Beinahe flehend sieht Aluna mich an. Und ich kann nichts anderes tun, als mit den Schultern zu zucken.
Man kann nichts machen. Man darf nichts machen. Unsere Blicke kreuzen sich, dann sieht sie schnell zu Boden.
»Ich muss los.«
»Natürlich.« Ich nicke. »Dann also …«
Sie wendet sich ab und läuft schnellen Schrittes davon. Betreten sehe ich ihr hinterher und frage mich, wie es sich anfühlt, den Vater an eine Krankheit zu verlieren. Einen Vater, den man gekannt hat. Der einem Gute-Nacht-Geschichten vorgelesen und das Radfahren beigebracht hat. Der für einen der Held, der Beschützer, der stärkste Mensch der Welt gewesen ist. Es muss schrecklich sein, wenn dieses Bild zerbricht. Wenn man erkennt, dass er schwach ist. Zu schwach zum Überleben. Trotzdem, und ich schäme mich für den Gedanken, beneide ich Aluna für einen kurzen Augenblick. Immerhin hatte sie einen Vater. Von meinem habe ich nicht einmal mehr eine bewusste Erinnerung. Nur ein Foto, auf dem er in die Kamera lacht und ein kleines, rothaariges Mädchen mit Sommersprossen auf dem Arm hat. Mich. Ich bin noch nicht einmal zwei Jahre alt.
Ein Stoß trifft mich an der Schulter und reißt mich aus meinen trüben Gedanken. Kimi. Natürlich. Sie folgt meinem Blick, sieht Aluna am Ende des langen Korridors um die Ecke biegen.
»Es ist ihr Vater«, sagt sie im Plauderton, hakt mich unter und zieht mich den Gang entlang. »Sieht nicht gut aus.«
»Was hat er denn?«
»Keine Ahnung. Er ist halt krank und macht es wohl nicht mehr lange. Mehr weiß ich auch nicht.« Sie zuckt mit den Schultern und sieht mich dann irritiert an. »Was guckst du denn so?«
»Ich gucke doch gar nicht«, wehre ich ab.
»Das ist nun mal der Lauf der Dinge, Yma«, sagt sie eindringlich. »Und du solltest dich wirklich langsam daran gewöhnt haben. Bevor du dich irgendwann in Schwierigkeiten bringst«, fügt sie düster hinzu.
»Warum sollte ich Schwierigkeiten bekommen?«, frage ich heftiger als beabsichtigt. »Ich mache doch gar nichts. Ich sage noch nicht mal was.«
Mit hochgezogenen Augenbrauen sieht sie mich an. »Du denkst«, sagt sie trocken.
»Wenigstens das wird ja wohl noch erlaubt sein«, antworte ich eingeschnappt. Kimi wirft mir einen vielsagenden Blick zu, wechselt dann aber das Thema.
»Lass uns über angenehmere Dinge sprechen«, sagt sie friedfertig. »Über den Fusion-Break zum Beispiel.« Ihre Augen glitzern unternehmungslustig. Dann wirft sie einen schiefen Blick auf meine Smartwatch. »Sag mal, welche Generation ist eigentlich Smarty? Bist du sicher, dass du die neueste Tender-Version da überhaupt draufladen kannst?«
»Äh. Siebte«, antworte ich unsicher.
»Ah, ja, dann müsste es gehen.«
Ich atme erleichtert aus. Mir eine neue Smartwatch zu kaufen liegt ungefähr genauso innerhalb meiner Möglichkeiten wie eine Wohnung im Cape Coral, dem Neubaugebiet des Eliteviertels. Und wegen technischer Probleme nicht an der großen Liebeslotterie teilnehmen zu dürfen wäre tatsächlich sehr ärgerlich. Dabei fällt mir etwas anderes ein.
»Sag mal, Kimi, warst du schon bei der J12?«
»Nö. Du?«
Ich schüttele den Kopf und fühle plötzlich ein merkwürdiges Ziehen im Bauch. Kimi merkt sofort, was mit mir los ist.
»Ich bitte dich, Yma«, sagt sie, »du bist kerngesund. Willst du mir allen Ernstes erzählen, dass du dir Sorgen machst?«
»Ist wohl nur so ’ne Art Prüfungsangst«, murmele ich, und sie lacht.
»Ausnahmsweise musst du mal nichts leisten«, sagt sie und legt freundschaftlich den Arm um mich. »Du musst einfach nur gesund und fruchtbar sein, pling, schon gibt’s den Zugang zu Tender, und deiner Zukunft mit Adriel steht nichts mehr im Wege.«
Ich zucke verlegen mit den Schultern. »Wenn der mich wirklich will.«
»Natürlich will er. Sonst wäre er schön blöd. Du bist das perfekte Paket. Hübsch, superschlau und dazu noch der netteste Mensch, den ich kenne.«
Ich werde rot.
Kimi legt nachdenklich die Stirn in Falten. »Hm. Wenn ich es mir recht überlege, vielleicht manchmal ein bisschen zu nett. Aber das weiß er ja nicht. Und daran kann man arbeiten.« Sie wirft mir einen vielsagenden Blick zu. Ich schlage den Blick nieder. »Und ein bisschen mehr Selbstvertrauen könnte dir nicht schaden.«
»Davon spreche ich ja.« Ich starre unglücklich vor mich hin. Genau damit ist es nämlich bei mir nicht weit her. Ich war immer schon eher gehemmt, vor allem in unbekannten Situationen. Keine komplett graue Maus, das nun auch wieder nicht, aber einfach etwas schüchtern. Ganz im Gegensatz zu Adriel, der jeden Raum betritt, als gehöre er ihm.
»Gegensätze ziehen sich an«, wischt Kimi meine Bedenken vom Tisch. »Und er kann froh sein, wenn er dich bekommt.«
5
Nervös sitze ich ein paar Tage später neben Kimi auf den unbequemen Plastiksesseln im steril ausgestatteten Wartesaal des Gesundheitsamtes. Irgendwann halte ich die Spannung nicht mehr aus, jeder Muskel in meinem Körper scheint zu jucken, so dass ich schließlich aufspringe und den Raum durchschreite. Immer von einer Wand zur anderen. Fünf Schritte hin, fünf Schritte zurück.
»Kannst du das bitte sein lassen?«, sagt Kimi, die lässig die Beine von sich gestreckt hat und beinahe gelangweilt aussieht. »Du machst mich ganz wuschig. Außerdem könnte man meinen, du hast ein nervöses Leiden.«
»Ja, ja, du hast ja recht. Trotzdem. Es ist nicht nur irgendein Gesundheits-Check-up.« Wenn ich die J12 nicht bestehe, nützen mir auch gute Schulnoten nichts mehr.
»Deshalb musst du dir trotzdem nicht in die Hose machen. Mit dir ist alles in Ordnung. Wirklich.«
Plötzlich muss ich an Aluna und ihren Vater denken. »Aber manchmal werden Leute krank. Obwohl sie alles richtig machen«, sage ich leise.
»Ja. Manchmal fällt auch ein Ziegelstein vom Dach und erschlägt jemanden«, gibt Kimi trocken zurück.
In diesem Moment springt die Anzeige mit den leuchtend roten Zahlen über der gläsernen Tür des Wartezimmers von 1487 auf 1488. Gleichzeitig gibt Kimis Smartwatch einen Signalton von sich. Sie steht gelassen auf. »Endlich. Dann wollen wir mal.«
»Viel Glück«, rufe ich ihr hinterher.
Sie öffnet die Glastür des Wartebereichs und sieht sich grinsend zu mir um. »Brauch ich nicht. Bis nachher.«
Nur drei Minuten später melden die Anzeigetafel und Smarty zeitgleich, dass ich nun an der Reihe bin. Mit wackeligen Beinen gehe ich in Richtung der Untersuchungsräume.
Zimmer 43, meldet das Display meiner Smartwatch. Ich laufe durch einen langen Gang mit unzähligen, dunkelblau lackierten Türen zu beiden Seiten. Der weiche Linoleumboden dämpft die Geräusche meiner Schritte. Es riecht nach Desinfektionsmittel. Laut meiner Recherche war das Gesundheitsamt in früheren Jahren ein Krankenhaus. Eine Lungenklinik, um es genau zu sagen. Schon wieder muss ich an Alunas Vater denken. Jeder Atemzug ist eine Qual.
Da ist es. Zimmer 43. Beinahe wäre ich daran vorbeigelaufen. Ich klopfe und trete ein.
Eine Frau um die dreißig im weißen Kittel sitzt hinter einem breiten, bis auf Tastatur und Monitor leeren Schreibtisch und sieht mir erwartungsvoll entgegen. »Yma.« Sie lächelt so strahlend, dass ich mich für einen Moment unsicher frage, ob wir einander persönlich kennen. Auf dem Monitor sehe ich ein Bild von mir selbst. Was darunter steht, kann ich nicht erkennen, aber ich kann es mir denken. Meine medizinischen Daten. Alle Ergebnisse sämtlicher Untersuchungen, die ich je mitgemacht habe. Angefangen mit der K1 wenige Stunden nach meiner Geburt bis hin zur J11 vor einem Jahr. Und nun also die letzte J-Untersuchung. Die wichtigste. Die über meine private und berufliche Zukunft entscheiden wird. Ich atme tief durch.
Die Frau nickt beruhigend. »Du brauchst keine Angst zu haben.« Wenn sie das so genau weiß, frage ich mich, warum ich überhaupt hier bin. Trotzdem nicke ich tapfer und nehme auf dem Stuhl ihr gegenüber Platz, den sie mir mit einer Handbewegung anbietet.
»Mein Name ist Sadia«, stellt sie sich vor. »Heute ist ein großer Tag für dich.«
»Ja. Stimmt.« Was soll ich auch anderes sagen?
»Herzlichen Glückwunsch erst mal. Wie ich sehe, bist du Klassenbeste.«
Irritiert versuche ich, einen Blick auf den Monitor zu erhaschen, doch sie dreht ihn mit einem entschuldigenden Lächeln zu sich. »Datenschutz.«
»Aber das sind doch meine eigenen Daten«, protestiere ich, doch sie schüttelt bestimmt den Kopf. Mit einem Mal sieht sie gar nicht mehr freundlich aus. »Trotzdem. Jedenfalls ist das eine tolle Leistung. Und gelingt nicht vielen Mädchen deiner Herkunft.«
»Ach?«, kann ich mir nicht verkneifen zu sagen, »ich dachte immer, in Vahvin hat jeder die gleichen Chancen und kann durch harte Arbeit seinen Lebensstandard verbessern.«
Sie lächelt nachsichtig. »Theoretisch ja. Fleiß und Ausdauer sind ein Faktor. Begabung ein anderer, und die kann man nun einmal nicht groß beeinflussen. Sie wird einem in die Wiege gelegt. Weshalb es Sinn macht, sich mit einem genetisch hochwertigen Partner zusammenzutun.«
»Äh. Ja.«
»Und deshalb steht ja nun auch der Fusion-Break bevor, nicht wahr?« Sie zwinkert anzüglich, was ich ausgesprochen unangenehm finde.
»Hast du denn schon jemand Bestimmtes im Auge?«
»Ich … ich …«, stammele ich und spüre, wie ich puterrot anlaufe. Muss ich das beantworten? Gehört das zur Untersuchung dazu?
»Aha. Ich hoffe, er bietet ausgezeichnetes Genmaterial. Du möchtest deine eigenen Anlagen nicht verschwenden, indem du dich mit Mittelmäßigkeit paarst.«
Ich starre sie an. Darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht. Ich weiß nur, dass ich in Adriel verknallt bin, seit ich denken kann. Und dass ich es auch wäre, wenn er nicht aus einer Elite-Familie käme.
»Schon gut. Das ist natürlich deine Privatangelegenheit. Genug geplaudert.« Sie wechselt abrupt den Tonfall und erhebt sich. »Wir machen einen allgemeinen Check-up. Das kennst du ja schon. Danach eine gynäkologische Untersuchung. Ich überprüfe, ob deine Geschlechtsorgane gut entwickelt und gesund sind. Wenn alles in Ordnung ist, bekommst du die Zulassung zur Partnersuche und ein Implantat zur Verhütung. Es wird jährlich erneuert, bis es Zeit für das erste Kind ist. Idealerweise in etwa um das dreiundzwanzigste Lebensjahr.«
»Ja, ich weiß.« Die Situation scheint ihr lange nicht so absurd vorzukommen wie mir. Zu wissen, dass ich in fünf Jahren ein Baby bekommen werde, aber nicht, von wem, findet sie wohl ganz normal. Prompt erscheint vor meinem inneren Auge das Bild eines Babys mit sehr hellen, blauen Augen. Adriels Augen.
Die Untersuchung ist nicht besonders angenehm, aber lange nicht so schlimm, wie ich es mir vorgestellt habe. Als sie mir vollkommene Gesundheit bescheinigt, fällt mir ein Stein vom Herzen. Ich verabschiede mich von Sadia und gehe beschwingt den Gang hinunter.
Pling.
»Herzlichen Glückwunsch, Yma«, sagt Smarty mit einer mir fremden, samtweichen Stimme, »dein Zugang zu Tender ist jetzt freigeschaltet. Mit Tender erhältst du Zugriff auf Tausende gesunder, junger Männer deines Jahrgangs. Klick dich durch unsere Datenbank und finde ein Date für heute Abend. Unser Tipp: Vervollständige dein Profil bei Tender. Je mehr Informationen dein künftiger Partner über dich hat, desto besser. Viel Spaß mit Tender!«
Mein Herz macht einen aufgeregten Hüpfer. Jetzt geht es also los. Ich beschleunige meine Schritte und eile am Pförtner vorbei in Richtung Ausgang.
»Junge Dame«, ruft er mir hinterher. »Hände desinfizieren nicht vergessen.«
»Ach ja. Entschuldigung.« Eilig trete ich an den Spender heran und tue wie geheißen. »Auf Wiedersehen.«
Ich trete hinaus ins Freie und atme tief durch. Die Nachmittagssonne hat ihre sengende Strahlkraft verloren, aber heiß ist es nach wie vor.
Suchend sehe ich mich nach Kimi um, doch sie steht noch nicht am vereinbarten Treffpunkt. Vielleicht dauert es länger. Ich setze mich in den Schatten eines Baumes neben den Treppenstufen, die zum Gesundheitsamt führen, lehne mich zurück und schließe die Augen.
Pling.
»Hallo, Yma, du hast eine Anfrage für ein Date. Sieh dir an, wer sich mit dir treffen will.« Mein Herz rast, während ich auf das Display tippe. Ein Bild von Adriel erscheint. »Yma, willst du morgen Abend mit Adriel tanzen gehen? Sage ja für ja und nein für nein.«
»Ja«, sage ich.
»Yma, du bist morgen Abend mit Adriel verabredet. Ihr trefft euch um acht Uhr im Roxy. Viel Spaß bei deinem ersten Date. Vervollständige nun dein Profil bei Tender, um noch mehr Verabredungen zu bekommen.«
Ich schließe das Programm, sehe mich um, und weil niemand in meiner unmittelbaren Nähe ist, springe ich auf, reiße die Arme hoch und vollführe einen kleinen Freudentanz. Dann setze ich mich wieder hin. Ich kann es kaum erwarten, Kimi von meiner Verabredung mit Adriel zu erzählen. Wer weiß, vielleicht hat sie ja auch schon ein Date für morgen Abend.
Was für eine Frage. Natürlich hat sie. Vermutlich sogar zwanzig. Mit den langen, dunklen Locken und der kurvigen Figur werden die Jungs jetzt, da sie endlich dürfen, bei ihr Schlange stehen. Ich bin gespannt, wem sie letzten Endes ihre Gunst erweisen wird.
Ich beende meinen Tanz und sehe mich suchend nach Kimi um. Aber Kimi kommt nicht.
6
Als die Dämmerung hereinbricht, steige ich schließlich auf mein Fahrrad. Vielleicht habe ich Kimi auch missverstanden, und sie liegt längst wieder am Pool der Villa ihrer Eltern, während ich hier Wurzeln schlage.
Ich fahre durch den weitläufigen Charles-Darwin-Park, in dem trotz Hitze und anhaltender Wasserknappheit die Blumen blühen, das Gras saftig grün ist und die Bäume stolz in den Himmel ragen. Hinter der Anlage biege ich rechts ab und fahre Richtung Osten.
Vom guten Ausgang der J-Untersuchung und der Aussicht auf meine morgige Verabredung beflügelt, trete ich kräftig in die Pedale. Wie jeden Nachmittag, wenn ich von der Schule nach Hause fahre, habe ich das Gefühl, zwischen den Welten zu pendeln. Die Umgebung verändert sich, die Vegetation nimmt ab, schließlich nur noch grauer Stein, so weit das Auge reicht.
Mächtige Plattenbauten stehen dicht an dicht. Ich bin am Ziel. Lasse meinen Blick die Betonfassaden hinaufgleiten. Erinnere mich an Kimis entsetzten Blick, als sie das erste Mal bei mir zu Hause war. Aber so schlecht ist es gar nicht hier in der Hochhaussiedlung, in der ich mit meiner Mutter wohne. Die Treppenhäuser sind sauber, auf manchen der winzigen Balkone leuchten rote, gelbe und blaue Blumen, Farbtupfer in einer tristen Welt.
Ich schultere mein Fahrrad, betrete das Treppenhaus und erklimme, immer zwei Stufen auf einmal nehmend, die Treppen zum fünften Stockwerk. Im dritten Stock macht mich meine Smartwatch mit einem leisen Piepton darauf aufmerksam, dass meine Herzfrequenz den anaerobischen Bereich verlassen hat. Ich drossele mein Tempo, gehe eine Stufe nach der anderen und verringere meine Herzfrequenz auf 143 Schläge pro Minute.
Vor unserer Wohnungstür angekommen, krame ich in meinem Rucksack nach dem Schlüssel, zögere dann und klopfe stattdessen an die Tür. Einmal, zweimal, dreimal. Ich lausche, ob von innen Schritte zu hören sind.
Vielleicht ist es ein bisschen albern. Kimi jedenfalls verdreht jedes Mal die Augen, wenn ich in meinem eigenen Zuhause an die Tür klopfe und warte, bis meine Mutter mir öffnet. Aber ich finde es schön, von ihr begrüßt zu werden. Wenn die Tür aufschwingt und sie vor mir steht. Dunkelhaarig, zierlich und mittlerweile einen halben Kopf kleiner als ich. Wie ihre Augen strahlen, wenn sie mich sieht, wie ihr Mund sich zu einem Lächeln verzieht, bevor sie die Arme hebt und mich an sich drückt.
Plötzlich wird mir bewusst, dass mein Zuhause nicht mehr lange mein Zuhause sein wird. Wenn alles gut geht, werde ich nach dem Fusion-Break meinen Partner fürs Leben gefunden haben. Werde mit ihm zusammenziehen, die Schule beenden, Karriere machen, Kinder kriegen. Bei dem Gedanken schwirrt mir der Kopf, nicht nur, weil es natürlich Adriel ist, der in diesem Traumszenario meiner Zukunft die Hauptrolle spielt. Reg dich ab, Yma, rufe ich mich selbst zur Ordnung. Ihr habt euch noch nicht einmal geküsst. Dennoch, es stehen viele Veränderungen bevor, in so kurzer Zeit.
Die Tür öffnet sich.
»Hallo, Mama«, sage ich, um mich gleich darauf zu verbessern, »ich meine natürlich Winona.« Ab dem vollendeten vierzehnten Lebensjahr sprechen wir unsere Eltern mit dem Vornamen an. Ich habe mich immer noch nicht daran gewöhnt. Normalerweise lächelt Winona darüber. Aber nicht heute.
»Hallo, Yma.« Sie klingt angespannt. »Komm herein. Du hast Besuch.« Mit dem Kopf deutet sie in Richtung Wohnzimmer.
Ich spähe an ihr vorbei. Eine Frau mit streng zurückgebundenem Haar und perfekt sitzendem Hosenanzug thront auf dem ausziehbaren Sofa, auf dem meine Mutter nachts schläft. Mir rutscht das Herz in die Hose. Sofort denke ich an den Vorfall mit dem Jungen, die Straße vor dem Einkaufszentrum, die Überwachungskameras. Das kann doch nicht sein, schießt es mir durch den Kopf. Ich habe nichts Verbotenes getan. Ja, vielleicht war ich kurz davor, aber ich habe es nicht getan. Was also will sie von mir?
Mama öffnet die Tür ein Stück weiter, und ich trete zögernd ein. Mein T-Shirt ist verknittert und durchgeschwitzt, die Jeans hat am Saum Ölflecken von der Fahrradkette. Ich könnte keinen krasseren Kontrast zu der kühlen, trockenen Dame im Wohnzimmer bilden, aber das kann ich nun leider auch nicht ändern.
Pling macht meine Smartwatch in dieser Sekunde. »Bravo, Yma«, sagt Smarty, »du hast dein Tagespensum von fünfzehntausend Schritten erfüllt.«
Die Frau lächelt.
»Guten Tag«, sage ich heiser.
Meine Mutter betritt hinter mir das Zimmer. Ich kann ihre Nervosität förmlich spüren. »Yma, das ist Lolo Kaß.«
»Es freut mich sehr, deine Bekanntschaft zu machen«, sagt Lolo.
»Äh, danke. Ich meine, ganz meinerseits«, stammele ich, während meine Gesichtsfarbe vermutlich im Sekundentakt die Farbe wechselt. Könntest du bitte aufhören, so verdammt schuldbewusst auszusehen, schimpfe ich mit mir selbst, während ich mich ihr gegenüber hinsetze.
Meine Mutter bleibt stehen, wie in Alarmbereitschaft.