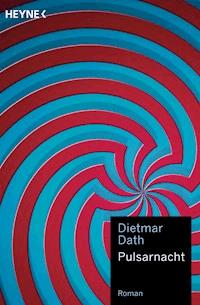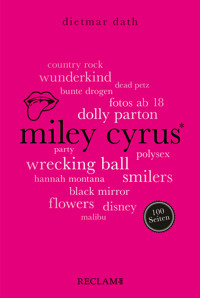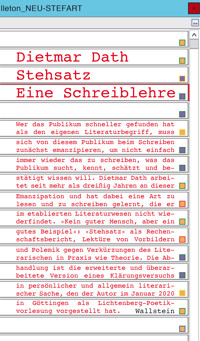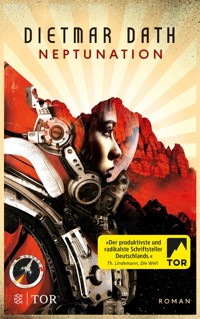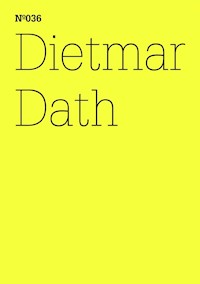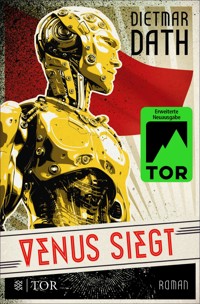
8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
›Venus siegt!‹ – In der bearbeiteten und um 150 Seiten erweiterten Taschenbuchausgabe erzählt Dietmar Dath seine futuristische Geschichte des Sozialismus zu Ende. Auf dem Planeten Venus findet in einigen Hundert Jahren ein gewaltiges soziales Experiment statt. Man will herausfinden: Gibt es eine Form des Zusammenlebens, in der Menschen, Roboter und künstliche Netzintelligenzen gleichberechtigt miteinander leben können? In einer Revolution haben die Bewohner der Venus die irdische Herrschaft abgestreift. Doch das neue Regime, das verspricht, der Ausbeutung und Abhängigkeit ein für alle Mal ein Ende zu machen, muss sich gegen die äußeren und inneren Feinde mit harten Maßnahmen behaupten. Als Konsequenz daraus errichtet die Politikerin und Programmiererin Leona Christensen eine Diktatur. ›Venus siegt‹ erzählt die Geschichte aus der Perspektive eines Elitekindes der neuen Ordnung: Nikolas Helander ist der Sohn des Kulturlenkers und ersten Gehilfen der Diktatorin. Sein Leben, seine Liebe und sein politischer Weg zwischen Loyalität, Opposition und Krieg sind Teil einer großen Erzählung von Befreiung und Terror, Zwang und Emanzipation unter den Bedingungen höchstentwickelter Technik. Der Epilog »Venus lebt« zeigt, wie aus seinem Erbe lange nach seinem Tod etwas Unvorhersehbares wird, als Entscheidung alter Kämpfe und als Lösung tödlicher Rätsel.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 690
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Dietmar Dath
Venus siegt
Roman
Über dieses Buch
Auf dem Planeten Venus findet in einigen hundert Jahren ein gewaltiges soziales Experiment statt. Eine ganze Gesellschaft sucht eine Form der Zusammenarbeit, in der Menschen, Roboter und künstliche Netzintelligenzen gleichberechtigt miteinander leben können.
Das neue Regime verspricht, Ausbeutung und Abhängigkeit abzuschaffen, aber es muss sich gegen äußere und innere Feinde behaupten. Die Politikerin und Programmiererin Leona Christensen errichtet deshalb eine Diktatur.
›Venus siegt‹ erzählt diese Geschichte aus der Perspektive eines Elitenkindes: Nikolas Helander ist der Sohn des ersten Gehilfen der Diktatorin. Sein Leben, seine Liebe und sein Weg zwischen Loyalität, Opposition und Krieg sind Teil einer großen Erzählung von Befreiung und Terror, Zwang und Emanzipation unter den Bedingungen höchstentwickelter Technik. Der Epilog ›Venus lebt‹ zeigt, wie aus seinem Erbe lange nach seinem Tod etwas Unvorhersehbares wird, als Entscheidung alter Kämpfe und als Lösung tödlicher Rätsel.
›Venus siegt‹ wurde für diese Ausgabe überarbeitet und um eine 150 Seiten lange Fortsetzung erweitert.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Impressum
Erschienen bei FISCHER E-Books
Die Originalausgabe erschien 2015 bei Hablizel, Lohmar.
© 2015 Dietmar Dath
© 2016 S. Fischer Verlag GmbH, Hedderichstr. 114, D-60596 Frankfurt am Main
Covergestaltung: Nele Schütz Design, München
Coverabbildung: Shutterstock/Ociacia
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
ISBN 978-3-10-490193-0
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
[Widmung]
Venus siegt
I. Jugend und Lehrzeit
II. Liebe und Angst
III. Auf der Flucht und bei Hofe
IV. Strafe und Exil
Venus lebt
Eins
Zwei
Drei
Vier
Fünf
Sechs
Sieben
Acht
Neun
Zehn
Elf
Zwölf
Dank
Für Hermann L. Gremliza, of course
Venus siegt
I.Jugend und Lehrzeit
Am Ende hasste ich meinen Vater bis aufs Blut.
Wir teilten dieses Blut, seit es mich gab.
Wir teilten es, solange er lebte.
Erst jetzt frage ich mich, ob er den durch meine Gefäße pulsenden Hass gespürt hat. Wurden ihm seine letzten Lebensjahre davon schwerer? Wenn es so gewesen sein sollte, dann war das Gerechtigkeit. Ich kann ihn danach nicht fragen. Er ist zu weit weg in Zeit und Raum. Der Ort, an dem dieser Mann, den ich vergessen würde, wenn ich könnte, begraben liegt, bewegt sich, wie der Ort, an dem ich jetzt lebe, ruhelos durchs All. Näher als achtunddreißig Millionen Kilometer sind die beiden Orte einander nie. Haben sie diese Nähe erreicht, so entfernen sie sich wieder voneinander.
In seinen letzten Lebensjahren dachte ich kaum mehr an ihn, und wenn, dann mit Verachtung, zu der die alte Bitterkeit schließlich ausgenüchtert war.
Ich habe seine ständigen Zitate aus der Literatur der Vergangenheit genauso gehasst wie seinen Eifer für eine Zukunft, an die ich schließlich kaum noch glauben konnte.
Nur noch abgedroschen fand ich am Ende, kurz vor dem Beginn meines Exils, seine wiederholte Mahnung: »Die Wahrheit, Junge, ist in den alten Büchern und in der neuen Forschung.«
Einmal verriet ich ihm, was ich davon hielt: »Was will ich mit deiner Wahrheit? Mich interessiert die Wirklichkeit, alter Mann.«
Er wusste eine Antwort, weil er immer eine wusste: »Die Wirklichkeit ist, was wir mit der Wahrheit machen. Mehr braucht niemand.«
So sprach Arthur Helander mit mir, weil er so mit allen sprach, mit der ganzen Welt, die wir bewohnten: Venus. Auf der Erde, wo ich heute lebe, weiß man nicht viel darüber. Man ahnt nicht einmal, wer wir waren und warum wir taten, was wir taten.
Man sagt hier, wenn man Witze reißt, wir hätten damals zwei Fehler gemacht: unseren Robotern nichts befohlen und unseren Künstlichen Intelligenzen nicht gehorcht.
Ich will widersprechen. Ich will sagen, was Maren Laukkanen sagte, die unseren Staat begründet hat: Was ihr Roboter nennt und was ihr Künstliche Intelligenzen nennt, sind zwei Extreme, zwischen denen niemand anders vermitteln kann als die Menschen.
Denn, so sagte Laukkanen: »Menschen können die Idee eines neuen Körpers sein wie die Verkörperung einer neuen Idee.«
Aber aus Laukkanens Idee wurde ein Albtraum namens Leona Christensen, die Mörderin.
Arthur Helander war ihre mal rechte, mal linke Hand, Gehilfe der Mörderin und damit selbst Mörder. Er vergaß alles in ihren Diensten, mich, meinen Bruder, meine Mutter.
Ich habe ihn einmal gefragt: Wie sollen die Leute eine Welt bewohnen, in der beschlossen wurde, was deine Herrin befohlen hat?
Er sah mich an und schwieg. Sein Gesicht ist bekannt, die Geschichte hat sein Bild bewahrt: etwas rundlich, unauffällig, klassischer Haarschnitt, enganliegende Frisur, rechts seitlich gescheitelt, nicht tief über die Stirn gekämmt, voll genug – seine Haare wurden nie dünn, ich habe diesen kräftigen Wuchs geerbt –, die Brauen fein, man hat sie weiblich dünn genannt. Der Schnurrbart über den Mundwinkeln war schmal, unter der Nase etwas dichter, kaum ein Schmuck für den strengen, aber nicht verkniffenen Mund, der auf Bildern und in Filmen oft lächelt, als wüsste der Mann Geheimnisse, gute und schlechte.
Vom letzten dieser Geheimnisse habe ich erst vor ein paar Wochen erfahren. Ich würde ihm, wenn ich könnte, ins Gesicht sagen, was ich davon halte.
Ich würde ihm sagen: Jetzt erst durchschaue ich dich!
Er dagegen hat mich immer durchschaut, mit diesen Augen, regsam, lebendig.
Das heute bekannteste Bild von ihm – jede Abfrage entdeckt es als eines der ersten – zeigt ihn auf einer Versammlung der mächtigsten Delegierten unserer größten politischen Organisation, des Bundes.
Damals ging es um eine von Leona Christensen befohlene »Aussprache« über »die Aggression, die uns von der Erde droht«, um den »blutrünstigen Despoten« Arjen Samito, wie wir den Mann nannten, an den man sich hier nicht gern erinnert – hier, wo er geboren wurde und verbrannt ist. Auf dem Bild sitzt mein Vater neben der Despotin. Ich sehe die Wirklichkeit, wenn ich dieses Bild betrachte: Leona Christensen hat von Erbarmen auch nicht mehr gewusst als Arjen Samito, vor dem wir uns so fürchteten.
Mein Vater aber wäre ihr in jede Hölle gefolgt. Die Tyrannin legt den linken Arm auf dem Bild locker auf das hölzerne Geländer der Loge. Sie wirkt fast ein wenig zusammengesunken – nicht vor Erschöpfung, eher im Nachdenken, etwas nach vorn gebeugt. Sie folgt wohl gerade einem Beitrag, den irgendein hoher Delegierter auf dem Podium vorträgt. Mein Vater, an ihrer Seite, sitzt ganz gerade, die Haare wie mit dem Stift ausgestochen, die Brauen leicht angehoben, ein Schatten von Bärtchen unter der Unterlippe, die Wangen gerötet von einer Art Eifer, die nichts verpassen will. Damals beschloss man die ersten Schritte zur Mobilmachung. Das Bild scheint mir sagen zu wollen: Er hat es vor seiner Chefin gewusst, dass der Krieg kommen würde. Wir wussten alles und wurden dann doch überrascht.
Mein Vater war dieser Widerspruch zwischen Wissen und Erwartung. Bis heute werde ich nicht klug aus ihm.
Hatte sein Wort so viel Gewicht, dass er seine Herrin zu Entscheidungen überreden konnte, die sie sonst nicht getroffen hätte? War er ein böserer Mensch als Christensen selbst? Hat er sie angestiftet? Aber die Mobilmachung war richtig, auch wenn sie zu spät geschah. Der Krieg, ich will es nicht leugnen, war Christensens größte Zeit. Schlachten, das konnte sie, und jetzt war es nötig.
Sie rettete Unzählige, wie sie zuvor Unzählige geopfert hatte.
Welche Rolle spielte mein Vater?
»Der kleine Dicke« nannte ihn ein Marschall von Sinope einmal abfällig, nach dem Krieg. Eine Unwahrheit: Arthur Helander war nicht dick. Er aß mit Freude, meist einfach das, was man bei uns so aß, nachdem die Not besiegt war, die unsere direkten Vorfahren gezwungen hatte, ihren Stoffwechsel so zu verändern, dass andere Formen der Energieaufnahme, etwa über Dämpfe oder Hitze, das alte Kauen, Schlucken und Verdauen ersetzen konnten. Essen war eine Prestigefrage für den Bund: Wir hatten jetzt alles, was die Ahnen auf der Erde gehabt hatten.
Mein Vater sah nicht aus, wie die Menschen hier und heute aussehen, die schlank sind bis an die Grenze zur Ausgezehrtheit, schmal wie zusammengepresst. Er war gedrungen, wie zum Sprung geduckt.
Wenn ich über ihn urteile, dann urteile ich als Privatperson, die ich jetzt sein darf.
Ich weiß nicht, ob es eine Instanz namens »die Geschichte« gibt und wie sie ihn sehen wird, falls es sie gibt.
Für mich war und bleibt er derjenige, der Leona Christensen im Katzenhaus am eifrigsten gedient hat, auch wenn sie andere Helferinnen und Helfer hatte. Ist das kindliche Überschätzung des Oberhaupts der eigenen Familie? Er stand Christensen, das bestreitet niemand, nahe genug, dass man ihn eine Zeitlang als ihren Nachfolger betrachtete – nicht nur bei uns, sondern im ganzen bewohnten Sonnensystem.
Ich fürchte, er wäre dieser Nachfolge würdig gewesen.
War er derjenige, der sie als Erster »Lily« nannte?
Es ist ihm zuzutrauen, auch wenn der Erfinder dieser abscheulichen Verniedlichung ebenso gut der elende Bathnagar oder der Heuchler Hsü gewesen sein könnte.
Diese beiden immerhin haben ihren Lohn für treue Dienste erhalten. Wie sagt das Sprichwort? Den feigsten Hund tritt der Stiefel am stärksten.
War das, was meinen Vater an die Despotin fesselte, eine Form von fehlgeleiteter erotischer Liebe? Geschehen ist zwischen ihnen nichts, das wüsste ich, wäre es wahr. Dass nach dem Tod meiner Mutter niemand so wichtig für ihn war wie die Erste Delegierte, ist eine Tatsache.
Wäre alles anders gekommen, wenn meine Mutter Mona Helander den Bürgerkrieg überlebt hätte? Ich schäme mich, dass ich kaum noch weiß, wer sie war.
Ich erinnere mich genauer an das, was sie gesagt und getan hat, als daran, wie sie roch oder wie sie aussah.
Wir wohnten in einem schlichten Haus mit zwei Teichen. Das bescheidene Anwesen stand am Südrand des Kraters Cleopatra, im langen Schatten von Maxwell Montes. Ich erinnere mich an die glasierten Schindeln, an Wege aus Schieferplatten, ans Granitpflaster, an roten Splitt für geometrische Gärten, Bänke von Sandstein, die Freitreppe aus grünlich gelben Klinkern, hart- und krummgebrannten, den Adlerfarn, die Rosen, und neben dem echten Wasser das andere Wasser: Écumen.
Ich höre meine Mutter zu mir über dieses andere Wasser sagen: »Das ist, was sie Schaum nennen. Nur mein lieber Nick nennt es Wasser. Weißt du, warum mir das gefällt, dass du es Wasser nennst? Weil es mir verrät, dass du genau hinschaust.«
Écumen, der Stoff, aus dem unsere Kommunikations- und Produktionsmittel gemacht waren und der heute in anderen Varianten, unter anderen Namen, gezähmt und vereinfacht und sterilisiert, im ganzen Sonnensystem verbreitet ist, kombiniert mit der Photonik, die das alte Elektronikwesen ersetzt hat, kann bis in seine submikroskopische Beschaffenheit weit eher flüssig gedacht werden als schaumartig: Die Wahrheit dieses Stoffes hatte ich gesehen, mit kindlichem Blick, einen dünnen, flüssigen Film, der, wenn ich ihn berührte, von einer Wandfläche, einem Möbelstück oder einem Gerät auf meine Finger oder meine Hand glitt, sobald ich dachte, er sollte das tun. Wollte ich es nicht, so blieb er, wo er gewesen war.
Immer hörte und sah er mich denken. Das lag an der Kontaktplatte in meinem Kopf, die aus denselben kleinsten Teilen bestand wie der sogenannte Schaum, aus Écumuli, vielen Tausenden, schließlich Millionen. Oft konnte ich durch ihn hören und sehen, was andere dachten: Menschen, Maschinen und ungebundene, mit Bewusstsein von sich selbst gesegnete Algorithmen.
Schaum? Das wäre das weiße Wachsen und Wuchern gewesen, das man sah, wenn man eine der bunten Seifen meiner Mutter in der Badewanne durchs echte Wasser zog.
Was man Bildung nennt, die geistige Seite der Erziehung, erfuhr ich über den Écumen, in jener besonderen Sicht, die sich über die äußere Optik legte und die wir damals »Innenauge« nannten.
»Schau, hier kann ich dir alles zeigen«, sagte meine Mutter.
Sie zeigte mir, barfuß neben mir kniend in ihrem hellblauen Overall, Bilder von den Servern für die K/, deren Einrichtung mein Vater hier am ersten autonomen Berghang der D/ überwachte. Die K/ waren die Künstlichen Intelligenzen, denen wir, wie man heute hier sagt, nicht gehorchten, und die D/ waren die Roboter, denen wir, wie man hier heute sagt, keine Befehle gaben.
An der Konfiguration der reichsten Server der K/ hatte meine Mutter in führender Funktion ihren Anteil geleistet. Wenige Menschen, sagen die Archive, waren geschickter als Mona Helander bei der Arbeit an der Programmiersprache, die dem Écumen seine Vielzahl von Seelen eingehaucht hat. Diese Sprache wird nicht mehr von vielen beherrscht. Aber ihr Name ist nach wie vor bekannt: Topos.
Ich sah die Welt, wie diese Sprache sie schildert; ich sah das Vorhandene, das Gegenwärtige, das Zukünftige durch dieses Gitter, im Wasser. Dazu gab es Kekse und Orangennektar.
Das ist die intensivste Erinnerung an meine Kindheit: die ziehende, kräftige, herbe, aber nie zu starke Süße im kalten Fruchtsaft.
Meine Mutter liebte den Geschmack auch, und anders als ich wusste sie, wie erstaunlich es war, dass auf dem Abend- und Morgenstern der alten irdischen Überlieferung jetzt Orangen wuchsen.
»Was sind denn die D/?«, fragte ich naseweis und zog das Wort in der alten nordvenusischen, aus dem Englischen geerbten Aussprache in die Länge: »Diiiis«.
»Das sind Leute wie … unser Auto oder unser Koch. Das sind auch Leute wie Kapech und Metim, die du kennst, Mamas Freunde vom Berg. Das sind alle, die man früher Roboter genannt hätte. Maschinen, die das haben, was früher Seele hieß. Wir nennen sie D/, weil das eine Abkürzung von ›diskret‹ ist. Das bedeutet: in Einheiten aufgeteilt. Abgepackt. So heißen sie, weil ihre Seelen nicht aus ihnen rauskönnen. Diese Seelen sterben, wenn man sie woanders hinbringt. Sie sind in den Körpern gefangen, so wie wir, die Menschen. Obwohl natürlich beide, die D/ und wir, manchmal dann doch ein bisschen rauskönnen – wie die Schildkröte, erinnerst du dich an Schwimmi? Oder die Schnecken neben der Treppe? Die mit dem Häuschen. Ich und dein Vater und Maren Laukkanen, wir arbeiten dran, dass die Seelen von Menschen und D/ leichter rauskönnen. Weiter rauskönnen.«
»Und wieso brauchen die D/ einen Server?«
»Sie brauchen keinen Server, und um Server für sie geht es auch nicht. Es sind die K/, die Server brauchen. Mehrere Server. Viele. Die K/, das sind freie Seelen, die uns und den D/ helfen, beim Planen, beim Denken, bei der Fabrikarbeit, im Écumen, dabei, wie wir an Kraft kommen, wie wir alle leben.«
Sie sprach das Kürzel für die Kontinuierlichen knapp aus, im Dialekt von Flintstadt: »Kejs«, während, wenn mein Vater von ihnen redete, die K/ immer wie »Kess« klangen.
»Was sind jetzt noch mal die K/?«, spielte ich das uralte Fragespiel neugieriger Kinder weiter.
Sie lachte, glaube ich. Ich weiß, dass sie dann sagte: »Noch mal? Schön, noch mal: Die K/ sind Seelen, die an keine bestimmten Körper gefesselt sind. Sie sind zunächst etwas wie Algorithmen, so fangen sie an. Aber sie können mehr als Algorithmen, seit sie sich Topos beigebracht haben. Und bevor du fragst: Topos, das ist zuerst ein Gebiet der Mathematik gewesen – eine Schule, weißt du, wie man denkt und wie man vergleicht und unterscheidet. Und dann wurde es eine Programmiersprache. Code. Das hat der Mann mit dem Bart, der Mann aus Indien gemacht, der bei deinem Vater auf dem Bild überm Sekretär hängt, Bhawar Kamalakara.«
»Der hängt da?«, fragte ich unverschämt, weil ich sie bei einem sprachlichen Schnitzer erwischt hatte und mich beide Eltern immer ermutigten, ihnen so etwas nicht durchgehen zu lassen. Denn, wie mein Vater sagte: »Sprache ist das Erste und Wichtigste fürs Bundwerk.«
Wie klang das Lachen meiner Mutter? Ich habe es vergessen.
Ihr Kleid war grün.
Ihre bloßen Füße spielten im Gras. Was für Haare hatte sie? Lange, kurze, helle, dunkle? Es gibt Bilder, das stimmt. Aber sie sehen nicht echt aus, nicht wahr. Blond, sagen die Bilder. Lockig, lang, sagen die Bilder. Ganz anders als die Diktatorin, deren Haar rot war und kurz.
Anders auch als Laukkanen, deren Haar dunkel war, glatt, schulterlang.
Meine Mutter sagte: »Es ist nur ein Bild, ja. Das stimmt, er hängt da nicht.«
»Und was ist Code?« Ich gebe zu, ich wollte mit meiner Hartnäckigkeit provozieren.
»Das ist eine Sprache, die vor allem D/ und K/ verstehen können.«
»Aber sie verstehen doch auch Deutsch und Französisch und …«
»Na gut, dann eben nicht einfach: die sie verstehen können. Es ist die Sprache, aus der ihre Seelen gemacht sind.«
»Die müssen sie also nicht lernen?«
»Sie können sie spüren. Sie können sie auch verbessern, und sich selber damit. Aber sie lernen sie nicht, wie du die alten Sprachen lernst, Englisch und Deutsch und Französisch und Italienisch und Spanisch und Russisch und Mandarin …«
»… und Urdu und Iwrit …«, quatschte ich frech dazwischen, und meine Mutter beendete die Reihe mit: »Und Latein und Griechisch und alles durcheinander. Jetzt trink dein Glas aus.«
Der Orangensaft und sein Stich von Süße, der Geschmack der Kindheit.
Ich merkte mir die Dinge ungeordnet, weil ich noch nicht vieles wusste, womit ich sie hätte ordnen können.
Ich merkte mir: Viele K/ wohnen oft jahrelang hier am Vulkan in einem Server, obwohl sie ungebunden sind. Den Server hat mein Vater hergestellt, damit die D/, die hier arbeiten, in ihrer Nähe viele K/ haben. Meine Mutter spricht täglich mit den K/ in diesem Server – oder sind es mehrere Server? – in einer Sprache, in der die K/ und die D/ besser mit uns reden können als in anderen Sprachen. Diese Sprache heißt Topos.
Auf weitere Fragen hin erzählte mir meine Mutter einiges über Algorithmen und zeigte mir in der Écumen-Schnittstelle zwischen unseren Teichen, was es bedeutete.
Trockene, wenig greifbare Dinge: Alles, was K/ und D/ denken und tun, aber auch das meiste, was die Menschen denken und tun, müsse man, so meinte sie, vom Begriff der Funktion aus denken, »genauer: der berechenbaren Funktion. Das heißt, ein Ding wird ein anderes Ding nach einer Vorschrift der Veränderung«.
So, sagte sie, denken die Menschen, »seit sie vernünftig geworden sind. Was auch Nachteile hat. Sie haben es nämlich übertrieben. Als ihnen klargeworden war, dass man Sachen verstehen kann, indem man neue und komplizierte Sachen auf bekannte und einfache Sachen abbildet, wollten sie das sofort mit allem machen, was ihnen neu und kompliziert vorkam. Zum Beispiel das Abbilden selbst. Sie haben es als etwas angeschaut, das man vor allem mit Mengen von Sachen machen kann oder innerhalb von Mengen von Sachen. Sie haben sich das Wort Funktion – etwas wird auf etwas abgebildet – mit Mengen erklärt. Damit haben sie dann leider vieles, was am Begriff der Funktion schön klar war, wieder unklarer gemacht. Als sie das wieder aufräumen wollten, fiel ihnen die Theorie der Kategorien ein. Kategorien sind die grundlegenden Sachen für die sauberste Erklärung von Abbildungen, Verwandlungen, die wir überhaupt haben. Ohne Kategorien hätten wir Topos nie erfinden können.«
Das Kind fragte: »Was ist das genau, Topos? Du hast gesagt, das ist Code.«
Die Mutter sagte: »Topos oder Topostheorie, das ist, wenn man die Logik mit Kategorien anschaut – die Logik, weißt du: wie man von einer Sache her eine andere rausfindet, weil sie schon drinsteckt. Topos ist die Brille, und Logik ist das, worin man viel mehr erkennen kann, wenn man es mit dieser Brille anschaut.«
Hätte ich alles verstanden, was sie da erzählte, wäre ich wohl noch jahrelang ein lebender Speicher origineller Einsichten gewesen. Denn meine Mutter war, wie die Archive zeigen, gar nicht fähig, etwas zu erklären, das sie schon wusste, ohne dabei stets drei, vier neue Einfälle hervorzubringen, die weit über das Erklärte hinauswiesen.
Sie sprach von Kategorien, sie sprach von Topoi, und zwar so, dass ein Kind – dieses Kind, ihr Kind – folgen konnte. Hatte sie meinem Bruder, bevor er die Familie verließ und sich den Neukörpern anschloss, ähnlich viel Zuwendung geschenkt wie mir? Oder wollte sie etwas gutmachen, das sie bei ihm versäumt hatte?
Allererste Anfangsgründe – und dann Anschaulicheres, Bilder im Écumen, starre und bewegte, von bärtigen sumerischen Schreibern und Beamten, die auf ihren Tafeln in ihrer kantigen Zeichenschrift versuchten, erste Rechenanweisungen für die Getreideverteilung zu entwickeln. Bilder von vollen Scheuern, in denen das gelbe Saatgut wie Sand gegen die Holzwände drückte. Bilder von halbnackten ägyptischen Arithmetikern bei der Landvermessung. Als ich dann aber gar nicht wissen wollte, was der vertikale Strich oder der sitzende Gott auf dem Papyrus bedeuteten, ging meine Mutter zwanglos über zu einer anderen, ebenfalls illustrierten Erzählung. Sie handelte von der altägyptischen Königin, nach welcher der Krater hieß, an dessen Rand wir wohnten. Ich erfuhr Lustiges von Cleopatra, von ihren Katzen, Pfauen und Sklaven, von ihren drei Mahlzeiten täglich – »Das Frühstück nannten sie ›Mundwaschung‹, das war ihr Zähneputzen«.
Meine Mutter wird wohl geflunkert haben beim einen oder anderen Detail. Das schlaue Wasser konnte meinen Blick nicht länger binden, so drollig die Erzählung auch war. Ich sah stattdessen auf, über den Kraterrand, am endlos in den Himmel wachsenden Hang vorbei. Ich sah die Wolkenfronten, die Blitze, die mir so oft Angst um meinen Vater machten, wenn er dort oben in Keilblattseglern unterwegs war.
Erzählte ich ihm davon, sagte er damals Dinge wie: »Du musst dich nicht fürchten. Die Keilblattsegler sind die besten Inertiale, die wir haben. Wir züchten sie als Flächen, die den Blitz an sich vorbeirutschen lassen, noch sicherer als die alten Faradaykäfige, die Flugzeuge und Hubschrauber der Vorfahren.«
Der Himmel war grün wie Sommergras, wie meine Lieblingsseife, wie die Comicfrösche auf meiner Bettwäsche.
»Grün!«, sagte ich, als wäre das ein Name für alles, was an der Welt besorgniserregend, aber auch wunderbar war.
Da legte meine Mutter mir die rechte Hand aufs Knie, weich, schlank und warm, das weiß ich noch. Sie sagte: »Da brennt Barium, in den Schmieden der D/. Deshalb ist der Himmel grün.«
Ich nickte, weil sie das Wort »grün« wiederholt hatte, das mich begeisterte.
Sie schüttelte den Kopf, auch das weiß ich noch. Sie war belustigt, das spürte ich. Aber ich begriff nicht ganz, was sie sagte: »Du bist mir so ein Kind, du. Da weiß man nie genau … Seit Jahrhunderten kann man, wenn es einen Bildschirm oder eine Schnittstelle für Schaum gibt, sicher sein, dass die Menschen eher auf die Bildfläche schauen als raus in die Welt. Aber was macht mein Kind? Mein Kind macht’s andersrum. Mein Kind ist ein Unfall. Mein Kind ist toll.«
Ich freute mich und hätte gern verstanden, worüber. Mir fiel zwar ein, den Singular »mein Kind« verwunderlich zu finden – war ich nicht das zweite Kind? War sie dem ersten, meinem Bruder, der fortgegangen war, noch ärger böse als der Vater? Aber ich schwieg dazu und dachte gleich an etwas anderes.
Ich glaube, ich hätte kurz nach diesen Sätzen bald wieder damit angefangen, nachzufragen. Aber dann kamen Gäste, Leute wie Hsü und Bathnagar, große Tiere mit ihren Familien. Kann es sein, dass dort und damals auch Aadarshini einmal dabei war, von ihrer Mutter in Begleitung eines D um die Welt geschickt – ganz jung, noch von nichts enttäuscht, frei – meine spätere Frau?
Es ist möglich. Daran zu denken scheint mir seltsam tröstlich.
Als der Cleopatra-Serverkomplex so gut wie fertig war, zogen wir zurück nach Flint City, genauer: nach Mischpatim. Wir hatten dort schon während meiner ersten Lebensjahre gewohnt, aber daran erinnere ich mich überhaupt nicht mehr.
Etwa ein halbes Jahr nach unserer Rückkehr begann die letzte, schlimmste Phase des Bürgerkriegs. Ein Bombardement der Verwelter beschädigte die Server von Cleopatra schwer. Meine Mutter fuhr hin, um beim Wiederaufbau zu helfen. Die Bomber kamen zurück.
Meine Mutter starb.
Auf der Beerdigung sah ich meinen Bruder das erste Mal als Erwachsenen, aber er sprach nicht mit uns. Er hielt sich abseits und ging rasch fort, als es vorbei war. Auf dieser Beerdigung gab es genug für mich zu sehen, dass ich ihm nicht nachlief. Da waren sie wieder, alle, die Mona Helander gern und gut bewirtet hatte: die Hsü-Familie, die Bathnagar-Familie, sogar Verwandte von Daniel Singh und er selbst. War auch Frederick Kâlidâsa dabei? Ich kann es nicht ausschließen.
Erinnerung verschwimmt. Die starken Gefühle indes, die sie bei mir weckt, bleiben stark, obwohl die Gesichter verblassen.
Hsü Chen, Karnam Bathnagar, Daniel Singh: Gesindel, finde ich heute, waren sie alle, moralische Eunuchen, die Christensen umschmeichelten und ihr das Lätzchen umbanden, wenn die Erste Delegierte Menschen, Maschinen und Hoffnungen fraß. Die ganze oberste Kaste im Bund war von solcher Hundesorte: die Delegierten der oberen drei Ränge, unsere Elite, die im Katzenhaus ein und aus ging.
Einzig den guten, armen Thalberg nehme ich hiervon aus – wenn ich mich nicht täusche, so hörte ich ihn niemals »Lily« sagen, auch »Leona« nannte er das ungeheuerliche Wesen nicht, die immer junge Frau, die Braut der Arbeit, die Herrscherin. Er blieb bei »Erste Delegierte« oder »Christensen«, bis sich sein Schicksal erfüllte.
Wenn ich alles vergessen hätte, wüsste ich doch, wenn er ihr je geschmeichelt hätte wie die andern. Denn ich war in der Zeit, auf die es ankommt, sein Leibwächter – vielleicht sogar sein Freund. Falls ich sein Freund nicht war, hatte er keine Freunde.
Ich sah ihn lernen, ich sah ihn sich mühen, die Stadt, die nach Maren Laukkanen hieß, zu etwas zu erziehen, auf das sie hätte stolz sein können.
Ihn respektierte man dort, in allen vier Trichtern – Kuannon, Chang West, Latiaxis Armatus und Le Jeu. Vier kegelförmige Inseln, zusammen eine schwebende Stadt. Eine historische Neuheit – schwebende Städte: Damals gab es das nur dort, auf meiner Welt.
Ich erinnere mich an die erste Begegnung mit Domenico Thalberg.
Ich war, um mich in Einheiten auszudrücken, die gelten, wo ich dies schreibe, neun irdische Jahre alt. Das weiß ich deshalb so genau, weil drei Wochen später das berühmte fünfte Plenum einberufen wurde, auf dem Christensen die Opposition der Aufwiegler und Neukörper vernichtend schlug, und weil ich nach jenem Plenum zehn irdische Jahre alt wurde.
Christensens Schlag gegen ihre Feinde, der erste große, fand damals noch in Gestalt langer Reden statt, nicht mit Verhaftungen und Mord. Thalberg besuchte uns zu Hause in Mischpatim, in Flint City. Er kam seinerzeit etwa im Monatsrhythmus in die Welthauptstadt, sprach erst im Katzenhaus vor und absolvierte dann verschiedene Visiten.
Ich sah ihn in den Raum treten, in dem mein Vater meist las und schrieb, an Reden, Aufsätzen und Dekreten, aber auch an Schnittstellen, am Écumen und an Maschinen arbeitete. Allein mit den Sachverhalten, glaubte er sich im Besitz der Übersicht – wie er einmal dort zu mir sagte: »Wir sind alle Coder und Ingenieure geworden. Was früher die Innung war, ist jetzt die gesamte Venusbevölkerung.«
Ich wusste von der Innung nur, dass man sie »überwunden« hatte – das Siegel war daraus hervorgegangen, das für den Bund stand, D=B=K. Es gab ein Kategorienbild dazu, mit Pfeilen, die, von rechts nach links und von oben nach unten gelesen, eher nach »B=D=K« aussahen, aber ausgeschrieben war die Reihenfolge anders, und man setzte zwischen die Buchstaben Gleichheitszeichen. Diese zwischen die Initialen gesetzten Symbole (nach neueren zeitgeschichtlichen Forschungen stammen sie nicht aus der Mathematik, sondern aus der Schrift für chemische Verbindungen) verbanden »Diskrete« (also Roboter), »Biotische« (also Menschen – »nur Dumme sagen ›Biologische‹, denn Biologie heißt die Wissenschaft, nicht die Sache«, erklärte mein Vater) und »Kontinuierliche« (also freie, zwar servergestützte, aber in all unseren Netzen bewegliche Programme mit Bewusstsein).
»Die Innung«, so hatte der Berufsstand der Toposcoder geheißen, dessen radikaler Flügel um Laukkanen in Erscheinung getreten war, als sie ihre berühmte Parole »Vorwärts heißt: Zurück zu Kamalakara« ausgegeben hatte.
Die Arbeitsklause meines Vaters war eine Art breiter Keller unter unserem Haus am Außenring von Mischpatim.
Es gab dort unten, tief im Mantel des Trichters, tief im Schwarzen Eis, kein natürliches Licht, nur das schlaue Wasser an den Wänden, sanft bläulich, das sich kaum je kräuselte, wenn wir uns im Raum bewegten. Immerhin schien es stark genug, die Pflanzen zwischen den schwebenden Arbeitsflächen mit Leuchtnahrung zu versorgen. Das freilich mag auch daran gelegen haben, dass mein Vater die Photosyntheserate dieser Pflanzen dem milden Halbdunkel angepasst hatte.
Ich war ein verspieltes Kind.
Wenn ich an diese Zeit in Flintstadt denke, sehe ich mich dauernd mit irgendetwas in Händen durch diesen länglichen Keller laufen: ein paar Zilienplättchen, einem ausgebauten Schädelschirm, Bauteilen. Dabei stellte ich mir vor, diese Bauteile wären ganze Inertiale, also Keilblattsegler oder Sammelspitzen. Mit denen spielte ich den Bürgerkrieg nach, auch wenn mir das Wort »spielen« fast zu unernst vorkommt, denke ich daran, wie konzentriert ich in meinen Szenarien lebte, unterstützt durch schaumvermittelte Ausläufer von K/, die selbst, da sie nur Ausläufer waren, nicht denken konnten, kein Bewusstsein hatten – oder, wie man damals sagte, nur ein halbes: »semisentiente Routinen«, kurz: Semisentiente oder Semis nannten wir derlei.
Manchmal teilte ich meine Spielwelten mit anderen Kindern, auch solchen in fernsten Städten – der Gebrauch der Kontaktfläche im Kopf war mir früh das Natürlichste. In den Schlachtenräumen, die mir die Semis im Innenauge zeigten und durch die ich mit meinen Keilblattseglern und anderen fiktiven Inertialen sauste, war ich Edmund Vuletic, der große General. Der hatte Maren Laukkanens Armee geschaffen: aus schwerfälligen D/ in massiver Panzerung, aus unterernährten Minenarbeitern, aus akademischen K/, die »schlagkräftigste Armee im Sonnensystem«, wie mein Vater diese Leistung damals noch lobte. Als ich neun Jahre alt war, stand Vuletic in höchstem Ansehen.
Damals, als Thalberg uns besuchen kam, lief der Junge, der ich war, ohne Verbindung zu anderen Kindern und mit sehr wenig Bildunterstützung seitens seiner Semis durch die Halle, längs, hin und wieder her, und hielt einen Edelstein in der Hand, den der Vater eigentlich für einen seiner Versuche mit den Zilien brauchte.
Er hatte ihn mir anvertraut, dass ich auf ihn achtgab. Ich glaube, ich stellte mir vor, er wäre eine neue Waffe der Verwelter oder der irdischen Fonds, die, wie uns Laukkanen gelehrt hatte, hinter den Verweltern standen. Der Edelstein, das war mir ein Meteorit, der unsere Städte aus unseren Himmeln reißen sollte.
»Lass aber die Halme in Ruhe!«, ermahnte mich mein Vater, als er sah, wie wild ich rannte, spielte, träumte.
Ich gehorchte und lief langsamer, damit ich die langen, saftig grünen Klingen nicht mehr streifte. Irgendwann blieb ich stehen und hockte mich auf den Boden. Wenn ich die Pflanzen nicht berühren konnte, die in meiner kindlichen Vorstellung für unsere Städte standen, für Flint City und Laukkanen City, für die zwei Spindelzyklide von Ionad, für das dunkle Taalbeeld und das reiche Pleuroploca, dann war das, was ich in meinen kleinen Händen hielt, vielleicht doch kein Meteor, sondern etwas anderes – ein kompakteres, verschlossenes Geheimnis, etwas, das man vielleicht aus unserem Schwarzen Eis gemacht hatte.
Ich hielt das Objekt in die Höhe, über meine Stirn. Dann drehte ich es nach links und rechts, bis es vor der Schleuse überm Raumhorizont in der Luft zu schweben schien.
Meine Finger dachte ich mir weg.
So sah ich durch das Herz des Rubins Domenico Thalberg aus dem Zilienkorridor am Außenring des Trichters in die längliche Halle klettern. Zilien hatte ich bis dahin nur in Sammelspitzen durchquert. Die langen, innen weißen, außen schwarzen Verbindungen von Teilen unserer Städte untereinander (und zunehmend zwischen Städten) faszinierten und ängstigten mich – die kürzeren waren bereits einige dutzend Kilometer lang, die längsten viele Tausende, Distanzen also, die ich mir kaum vorstellen konnte. Und dass das alles aus Écumuli geschaffen war, eingemantelt in eine dünne Schicht vom Schwarzen Eis, machte es nicht weniger unheimlich.
Das Gesicht des Mannes im Herzen des Edelsteins lächelte.
Thalberg trug eine Uniform.
Das hieß für mich, er war einer unserer Helden. Damals liefen alle, die im Bund wichtige Arbeit verrichteten und uns während der Bürgerkriegszeit gerettet hatten, in diesen Ein- oder Zweiteilern herum, meist fast ohne Rangabzeichen oder äußerliche Connexe mit den Verteidigungsnetzen.
Eigentlich stimmt das Wort »Uniform« nicht, weil es Einheitlichkeit der Tracht bedeutet, während die führenden Bundleute damals häufig selbst den Schnitt oder die Farbe dieser Kleidung änderten, eigene Knöpfe und Schulterstücke entwarfen, den Kragen nach persönlichem Geschmack wählten, mal Stiefel und mal gewöhnliche Halbschuhe zum Ensemble trugen.
Leona Christensen selbst wurde nicht selten in Turnschuhen gesehen – weißen, mit rotbraunen Spitzen und Absätzen. Das passte gut zu den weißen Hosenanzügen, die sie für sich entwarf und an eigenen Materialpressen zurechtschnitt.
Thalberg war groß, mit breitem Brustkorb, glattrasiert, dunkelhaarig. Das volle Haar trug er nicht allzu kurzgeschnitten, nach hinten gekämmt, aus der Stirn, an den Schläfen etwas kürzer. Dass er kein Bärtchen hatte wie so viele Männer in der Bundführung, weder am Kinn noch auf der Oberlippe, auch keine auffälligen Koteletten, nahm ich damals natürlich nicht bewusst wahr, aber das Starke, Große, auch Großzügige, das den Eindruck bestimmte, den er auf mich Knirps machte, passte zu diesem Verzicht auf jede Zierde.
Bescheidenheit kultivierte man bei den Großen des Bundes oft durchaus unaufrichtig, seit das Lob dieses Charakterzuges zu einem der zentralen Bestandteile der Kultpflege um Maren Laukkanen geworden war.
Ich erinnere mich gut daran, wie Christensen über Laukkanen redete, die an einem tückischen, möglicherweise künstlichen, ihr vielleicht von unseren Feinden zugefügten Knochenleiden viel zu früh verstorben war.
Man kann noch heute in Archiven Christensens berühmte Rede auf dem ersten Plenum nach Laukkanens Tod finden: »Zum ersten Mal begegnete ich Maren im Dezember 515 auf dem sechsten physischen Treffen in Kuannon. Kuannon war der schönste Trichter der Stadt, die damals Râwan hieß und heute Marens Namen trägt. Ich hoffte, die Frau, die man in der Innung seinerzeit entweder verehrte oder verabscheute und die man bei den D/ schon ›Adler‹ nannte oder ›Bergadler‹ – sie versetzen alles ins Gebirge, was sie schätzen –, ich hoffte, sie kennenzulernen. Ich wusste, sie würde da sein. Ich hatte mich darauf vorbereitet, eine große, nicht nur politisch, sondern, wenn ihr wollt, auch physisch große Frau zu erblicken, denn in meiner Vorstellung erschien Laukkanen als Riesin, stattlich und von hohem Wuchs. Wie gewaltig war aber meine Enttäuschung, als ich eine ganz einfache, mittelhohe – sie reichte kaum einem humanoiden D bis an die Rahmenoberkante –, jedenfalls nicht riesige Frau sah, die sich durch nichts, buchstäblich durch nichts von gewöhnlichen Sterblichen unterschied. Da stand also unsere Pionierin, in ausgebleichten Jeans, mit einem Hemd, dessen Kragen nicht mehr blütenweiß war, einer leicht staubigen, vielleicht etwas zu kurzen Krawatte, kein Lippenstift, ganz wenig Schwarz auf den Wimpern – not much of a celebrity. Es war damals in der Innung üblich, und es ist heute im Bund üblich, dass eine große Frau, ein großer Mann, eine leitende Delegierte oder ein leitender Delegierter, sich gewöhnlich zu den physischen Versammlungen verspätet, so dass die Frames sich erhitzen, das Hin und Her in den Netzen sich bis zur Verlangsamung des Datenverkehrs wegen Überlastung beschleunigt und die Teilnehmenden mit klopfendem Herzen auf das Erscheinen der Persönlichkeit warten. Kurz bevor so ein Mensch sich schließlich zeigt, geht ein Raunen durch die Reihen: Psst, sie kommt, oder: Er ist da. Diese Feierlichkeit schien mir damals nicht überflüssig, denn sie imponiert, flößt Achtung ein. Wie groß aber war meine Enttäuschung, als ich erfuhr, dass Maren Laukkanen schon vor den meisten anderen führenden Delegierten zur Versammlung gekommen war und in irgendeiner Ecke schlicht und einfach ein Gespräch führte, ein ganz gewöhnliches Gespräch mit ganz gewöhnlichen Konferenzgästen. Ich glaube, es waren sogar drei D/ aus den Stollen von Maxwell Montes. Ich will nicht verheimlichen, dass mir das damals als Verletzung gewisser notwendiger Sitten und Regeln erschien. Erst später begriff ich diese Schlichtheit und Bescheidenheit Maren Laukkanens, dieses Bestreben, die eigenen Verdienste nicht hervorzukehren, als eine Art Forderung an sich selbst und uns andere: Wer sich auf das, was schon geleistet ist, etwas einbildet und dafür besser behandelt werden will als andere, verkennt eben, dass in Wirklichkeit noch gar nichts geleistet ist.«
Ich selbst habe Maren Laukkanen nicht gekannt.
Aber auch ich wollte glauben, was solche Worte von ihr sagten.
Es fiel mir, gebe ich zu, leichter, seit ich Thalberg kannte. Denn der verhielt sich tatsächlich so, als wolle er die Forderung, von der Christensen sprach, erfüllen – bei und mit allen, jederzeit, überall.
»Was hast du da, Junge? Ist das eine winzige Stadt? Eine Sammelspitze?«, fragte Thalbergs großes Gesicht, als der Mann sich zu mir herunterbeugte. So erriet er mein Spiel durchs tiefste und klarste Rot, eine Stimme, die aus dem Feuer im Stein selbst zu sprechen schien.
»Das ist ein Rubin«, sagte ich und schloss beide Hände darum.
Dann nahm ich den Stein an die Brust und muss dabei recht trotzig ausgesehen haben. Hielt er mich für ein dummes Kind? Er sollte wissen, dass mir klar war, was ich festhielt.
»Ach, ich dachte, es ist ein Modell«, sagte er lächelnd. »Du hast so ausgesehen, als ob du darüber nachdenkst, wie etwas schwebt und fliegt – weißt du, weil es doch so glatt ist wie das Schwarze Eis.«
»Nick ist ein schlauer Junge«, sagte mein Vater, der von einer seiner Versuchssäulen her auf uns zukam.
»Auch schlaue Jungen brauchen Phantasie«, sagte der Mann und richtete sich auf, bis er einen guten Kopf größer war als mein Vater, dessen ihm hingestreckte Hand er mit herzlicher Kraft ergriff und so energisch schüttelte wie dieser umgekehrt seine.
»Das stimmt. Das vergesse ich immer, weil ich eben nicht besonders schlau bin. Nur fleißig«, sagte mein Vater.
Dann ließ er Thalbergs Hand los und fuhr mit seinen nicht allzu langen, nicht allzu kurzen Fingern durch meinen unordentlichen Schopf, wie um zu sagen: Das ist ein Köpfchen, von dem ich mehr erwarte als von meinem eigenen.
»Du hättest ihm einen Diamanten geben sollen, falls das zu deinen Forschungen gehört – gepressten Kohlenstoff, damit er lernt, was es alles gibt und was wir hier leider nicht haben und deshalb importieren müssen«, sagte Thalberg und setzte sich auf den Stuhl, der sich so aufmerksam wie unaufdringlich hinter ihn gestellt hatte. Der Stuhl war ein primitiver, von einem Semisentienten gesteuerter D, wie man sie damals noch häufig in den Städten traf.
Ein zweiter Stuhl glitt auf der inertialen Scheibe, in die sein Standeisen montiert war, geräuschlos hinter meinen Vater, so dass auch dieser sich setzen konnte, wobei er brummte: »Gepresste Kohle, fossile Härte …«
Thalberg erwiderte: »Fossile Härte, ja. Und fossile Schönheit, verbunden mit der fossilen Energie, die wir hier eben nicht haben, weil es die Wälder nicht gab, anders als oben auf der Erde.«
Oben auf der Erde: Man pflegte damals einfache Scherze wie den, altgewohnte Redeweisen unserer Feinde bewusst umzukehren. Die Ahnen der Verwelter hätten noch vor fünfhundert Jahren den Ort, an dem wir uns befanden, »oben auf der Venus« genannt und sich selbst ein Dasein »unten auf der Erde« bescheinigt.
Der Name »Verwelter« war, wie ich schließlich verstand, als man mir die deutsche Sprache beibrachte, ein Wortspiel: »Verwaltung«, so hatten die Deutschen oben auf der Erde ihre wichtigsten politischen Organe genannt. Die Venus-Verwaltungseinrichtungen, die kommerziellen wie die im engeren Sinn politischen, waren während der Epoche, in der aus der Innung unser D=B=K geworden war, runde dreihundert Jahre lang damit beschäftigt gewesen, eine von Menschen bewohnbare Welt aus Venus zu machen – wir erst hatten dem Wort den bestimmten Artikel genommen, »der« oder »die« sagten wir, wenn wir Deutsch redeten, nur noch bei Mars, Merkur, Erde und einigen anderen Welten, wo Leute ebenfalls fürs Bundwerk kämpften.
Weil also die Einrichtungen, die wir auflösten, und die Personen, die wir entweder entpflichteten, neu schulten, an uns banden oder ganz fortschickten, aus Venus erst eine Welt gemacht hatten, nannten wir ihr Werk »Verweltung«. In Wirklichkeit waren wir den Verweltern, obwohl wir sie und ihre Nachhut jetzt bekämpften, durchaus dankbar, auch wenn alles, was sie außer der Umgestaltung des Planeten getan und gewollt hatten, Unsinn gewesen war. Ihr Werk erkannten wir als Voraussetzung für die beiden nächsten Zivilisationsstufen, diejenige, die wir begonnen hatten und die Laukkanen im Gefolge Kamalakaras »Bundwerk« nannte, und diejenige, die darauf folgen sollte, mit Kamalakara und Laukkanen zu reden: das »Freiwerk«.
Echte Verwelter gab es, als ich Thalberg zum ersten Mal sah, kaum noch in den großen Städten, und überhaupt keine mehr in den Ebenen, auf den Bergen und Vulkanen der D/, den alten Hauptwirkungsstätten der Verwelter. Sie waren aus wirtschaftlichen wie politischen Abhängigkeiten und Traditionen der Erde gehorsam gewesen, und schlimmer: deren gefährlichen ökonomischen K/, den sogenannten »Fonds«.
Venus, wie Laukkanen sie sich dachte, sollte der erste Stützpunkt der Überwindung des Wirtschaftens in Abhängigkeit von diesen Fonds sein.
Auf diesen programmatischen Grundsatz bezog sich nun mein Vater, als er sagte: »Ja, es stimmt, das hatten wir hier nie, Gas, Öl, Diamanten. Ebendeshalb mussten wir schlau werden und Phantasie beweisen. Nirgendwo sonst hätte man das Schwarze Eis jetzt schon erfunden. Hätte es die Innung nicht gegeben, dann wäre das Zeug, das man gegen jede Schwerkraft auf irgendeinem Höhenniveau über einer Schwerkraftmulde installieren kann und das sich dann nur noch bewegt, wenn man es von innen stört, noch tausend Jahre unbekannt geblieben. Meinst du nicht auch, dass es ein Segen war? Diese Armut, dieses Leben ohne die Ablagerungen der Jahrmillionen im Boden?«
»Ja, nur Idioten in Not konnten drauf kommen. Die Genies im Warmen und Hellen und Trockenen durften unwissend bleiben.« Der freundliche Riese lächelte.
Die beiden Erwachsenen, die mir wie Götter erschienen, nickten einander zu, kaum sichtbar, einmütig. »Es stimmt, wir sind Idioten«, sagte Thalberg, »aber wir geben uns Mühe.«
Der Ton, in dem diese Männer miteinander redeten, war eigentümlich. Die gesamte Führung des Bundes war damals gewohnt, untereinander so zu reden. Selbst meine Mutter habe ich noch so reden hören. Es hatte etwas Ironisches – so darf man sagen, wenn man nicht vergisst, dass es keine romantische und keine psychologische Ironie war, sondern eine neue Art, eine historische, politische – eine Ironie, von der man nicht glauben sollte, es sei dabei irgendetwas »nicht ernst gemeint« gewesen. Die Uneigentlichkeit des Tons hatte etwas von Lässigkeit. Vielleicht war es eine Sorte Schwäche, die nur sehr Starke zeigen können.
Die historisch-politische Ironie, die ich meine, war wohl zunächst ein persönlicher Wesenszug der Diktatorin gewesen, eine ihrer Waffen. Alle ihre Wesenszüge dienten ihren Kriegen.
Heute glaube ich, es gibt eine Urszene, bei der jene Ironie, jene Lässigkeit im Umgang mit eigenen Defiziten, das erste Mal auf Venus hör- und sichtbar wurde.
Ich meine den letzten öffentlichen Schlagabtausch zwischen Christensen und ihrem lange Zeit gefährlichsten Feind Edmund Vuletic, dessen Eitelkeit ihn letztlich um die Stellung brachte, die er anstrebte.
Man kennt den Anlass: Der Sturz geschah auf dem letzten Plenum, auf dem Vuletic sich überhaupt zu Wort meldete. Millionen Menschen, noch mehr D/ und mindestens ein paar hunderttausend K/ wurden in Echtzeit Zeugen, wie der Mann mit dem prächtigen, immer wie windgezaust aus der Stirn gewehten Haar ans Pult trat, die Augen schloss, durchatmete, die Augen öffnete und zu sprechen begann: »Freundinnen, Freunde! Das Bundwerk aufgeben und nur dem Namen nach fortführen oder es endlich beginnen – das ist die Entscheidung, vor der wir heute stehen. Ich mache es euch ganz einfach: Ihr könnt Christensen folgen, oder ihr könnt Laukkanen folgen.«
Das war die Stelle, an der etwa dreißigtausend Inserts in den Frames und ein ungefähres Dutzend realer Zwischenrufe gegen Vuletics Filter aufbrausten:
LAUKKANENS NAME WIRD MISSBRAUCHT!
WIE KANNST DU ES WAGEN, FÜR SIE ZU SPRECHEN, DA SIE TOT IST?
VULETIC IST VERRÜCKT GEWORDEN!
Und dergleichen mehr.
Aber Christensen selbst, in der Loge, in der später mein Vater neben ihr sitzen sollte, schickte Daten in alle Welt, die forderten, man solle Vuletic ausreden lassen.
Vuletic presste die Lippen aufeinander, stieß einen kalten Hauch aus und fuhr fort: »Ich rede nicht für mich. Ich rede fürs Bundwerk. Wir alle sind überzeugt, dass auf das Bundwerk das Freiwerk folgen wird. Und die wirtschaftlichen Kennzahlen geben uns recht in unserer Annahme, dass der Fortschritt der Kooperation zwischen D/, K/ und Menschen eine Effizienzsteigerung erfahren hat, die aus keiner anderen historischen Ära überliefert ist, weder einer irdischen noch einer interplanetarischen. Das Freiwerk ist kein Märchen. Es ist erreichbar. Wir werden hier etwas vollbringen – etwas Heroisches oder etwas Tragisches. Heroisch wäre es, wenn wir beschließen könnten, unsere Hand der Avantgarde außerhalb von Venus zu reichen. Den Diskreten im Asteroidengürtel, den Diskreten auf Luna. Heroisch wäre, wenn wir diese Maschinen unterstützen würden und die Menschen, die schon mit ihnen kämpfen, indem wir die stärksten Sendeanlagen benutzen, um unsere K/ ins All zu senden, damit sie jenen D/ helfen – ja, die Anlagen von Maxwell Montes, die Antennenbatterien von Sapas Mons und Ozza Mons und Maat Mons und Topev Mons, die Antennen unserer höchsten Berge und Bergesketten …«
Rumoren wurde Tumult. Zustimmung und Ablehnung hielten sich zwar noch die Waage, aber die agitatorische Stimmlage und das ungeheure Temperament des Schöpfers der Bundwerk-Armee lösten ein Datengewitter aus, das mehrere Sekunden tobte, bevor er seine Rede fortsetzen konnte.
Er tat es, als wäre er nie unterbrochen worden: »Heroisch wäre, wenn wir die Freiwilligen unter den Kontinuierlichen, die uns bereits im Bürgerkrieg geholfen haben, zur Erde schicken würden mit unseren Sendetürmen, wenn wir sie abstrahlten zu den Asteroiden, zu den Saturnmonden und den Jupitermonden und den Fernhabitaten. Wir müssen die Diskreten dort befreien, damit sie sich revanchieren können. Wir müssen das tun mit den Waffen, die uns Kamalakara hinterlassen hat, mit der Strategie und der Taktik, die uns Maren Laukkanen hinterlassen hat. Das wäre heroisch.« Er machte eine Pause, mit beeindruckendem Effekt: Nun, da er den Sturm direkt herausforderte, der ihn eben noch hatte verschlingen oder in die Höhe heben wollen, blieb das Brausen aus.
Vuletic sah über alle Köpfe in der Rotunde hinweg in unausdenkliche Fernen, als er halblaut, wie trauernd, nun sagte: »Heroisch und wahr, Laukkanens Auftrag gemäß wäre das. Aber dies ist nicht, was Leona Christensen euch empfiehlt und was sie ihre Leute euch empfehlen lässt. Wir haben es jetzt zwei Tage lang gehört, wir haben es von Christensen selbst gehört, in schwesterlich-kameradschaftlichem Ton, wir haben es von Domenico Thalberg gehört, in wackerem, mannhaftem, pragmatischem Ton, wir haben es von unserem Theoretiker, den Maren Laukkanen, ich weiß es wohl, einmal den Liebling des ganzen Bundes genannt hat – wir haben gehört, wie der Liebling«, vereinzeltes Lachen, vereinzelte Empörung, »es uns in liebenswertem, etwas abgelenktem, eben gelehrtenhaftem Ton vorgetragen hat, und diese Version, diese Erklärung von Karnam Bathnagar heute Morgen hätte selbst mich überreden können, so gescheit klang sie. Zum Glück aber wusste und weiß ich es besser – und hätte ich es nicht besser gewusst, und wüsste ich es nicht besser, so hätte ich meinen Glauben an Christensens Plan spätestens heute Mittag schon wieder verloren, als uns dieser Plan zum vierten Mal schmackhaft gemacht werden sollte. Diesmal geschah es im unangenehmsten Ton von allen – im belehrenden, selbstgerechten, satten und zufriedenen Ton des Professors, des obersten Korrektors aller angeblichen Fehler aller angeblichen Schädlinge und Irrtumsbefangenen, des obersten Besserwissers und eifrigsten Propagandisten der Einfälle von Christensen, die er uns als Einfälle Laukkanens aufschwatzen will, dieser so gut unterrichtete, so triftig argumentierende, so unwiderleglich streitende Arthur Helander. Und was ist das nun für ein Plan? Sehr schlicht: Wir nehmen die Diskreten auf Venus in den Bund auf. Sie werden kooptiert, als erste Stufe dessen, was Christensen, die damit bereits mehr beweist als schlechten Geschmack, nämlich Heimtücke, ekelhafterweise das ›Laukkanen-Aufgebot‹ nennt. Die zweite Stufe sieht dann vor, in zehn Jahren oder zwanzig, wer weiß das schon, da reden sie ja alle durcheinander, die Lobhudlerinnen und Anbeter dieser Frau, da erwartet Thalberg den Durchbruch etwas früher, Bathnagar etwas später, und Christensen selbst hält sich zurück, weshalb wir auch von Helander nichts erfahren – in dieser zweiten Stufe, heißt es, werden auch die Kontinuierlichen irgendwann Vollmitglieder des D=B=K. Von Menschen, die das Bundwerk nicht wollen, haben wir uns getrennt, sagt Christensen. Aber Intelligenzen, die das Bundwerk wollen, sind nicht nur Bündnispartner des Bundes, sie müssen dieser selbst werden. Gut, zuerst die Roboter«, zornige und höhnische Interventionen, »nein, Freunde, ich benutze das Wort, weil es viele Diskrete selbst noch für sich gebrauchen – zuerst die Roboter also und dann die freien, die nicht lokalisierten Programme, die emanzipierten Algorithmen. Wann dürfen die Neukörper in den Bund? Das haben einige von ihnen uns gefragt. Es ist eine gute Frage. Bathnagars Antwort ist bloße Sophistik, abgeschmacktes Gerede: Wenn erst die Diskreten und die Kontinuierlichen den Bund mitsteuern, wenn erst die ersten festen Feedbackschlaufen etabliert sind, dann wird das Bundwerk bereits ins Freiwerk übergehen, ja, dann werden wir sehen, dass das Bundwerk tatsächlich die erste, die niedere Stufe des Freiwerks gewesen sein wird, und der Unterschied zwischen Menschen, Diskreten, Kontinuierlichen und Neukörpern wird bedeutungslos werden. Bedeutungslos! Gut gebrüllt, Liebling des Bundes. Aber warum dann den einen Teil – die Integration der Maschinen und Programme in unser soziales und politisches Leben – des Freiwerks schon im Bundwerk vorwegnehmen und zugleich die Neukörper nach wie vor dafür verspotten, dass sie, wie Helander sagt – und da stimme ich ihm ja zu –, im Bundwerk schon so leben wollen, wie man erst im Freiwerk leben wird? Weil das Ganze ein Betrug ist. Weil das sogenannte Laukkanen-Aufgebot nichts als perfide Augenwischerei ist. Sie sprechen es noch nicht aus, aber was bedeutet es denn, wenn sie meinen Appell, die kämpfende Information jetzt mit aller Macht ins Sonnensystem hinauszusenden, die Verbreitung des Bundwerks nicht zu unterbrechen, zurückweisen, um, wie sie sagen, lieber hier den Aufbau fortzusetzen? Es bedeutet keine Ehrung von Laukkanen. Es bedeutet die Zurücknahme ihres wichtigsten Erbes. Es bedeutet, dieses Erbe zu verwerfen.«
Ein ernstes, diesmal fast zwei Minuten dauerndes Aufflammen des vorigen Für und Wider war die Folge dieser Anschuldigung. Vuletic wartete die Eruption ab. Er kannte die Vulkane, die metaphorischen wie die tatsächlichen – im Bürgerkrieg waren sie seine wichtigsten Waffen gewesen.
Als wieder relative Ruhe einkehrte, kam er zum riskantesten Teil seiner Ausführungen: »Wenn Christensen sagt, das Bundwerk müsse hier entwickelt werden – in Flint City, in Laukkanen City, überall, wo Écumen ist, überall, wo Schwarzes Eis ist, in Purânopolis und Behrens, in Rhinoclavis und Ionad, auf Lakshmi Planum, wo die Diskreten schuften, bis sie zerbrechen, und wo die Menschen ihnen beistehen, bis sie vor Erschöpfung sterben, an unseren jungen Meeren, in unseren tiefen Schluchten – Christensen sagt damit, dass Laukkanen die Unwahrheit verkündete, als sie uns ihren größten Satz mitteilte. Ihr habt ihn vergessen? Ich kann das nicht glauben. Ich habe ihn nicht vergessen. Und ich weiß, dass ihr ihn nicht vergessen habt. Er lautet: Das Bundwerk ist die erste wirklich interplanetare Zivilisation der Geschichte. War das ein abstrakter Satz? Ich erinnere an einen konkreten Satz, der aus ihm folgt, und ich erinnere euch eindringlich daran, wer ihn gesagt hat. Es war Leona Christensen selbst, auf dem Plenum in Glissette im Jahr 522: ›Die Zilien, die heute die verschiedenen Segmente unserer schwebenden Städte miteinander verbinden, werden morgen diese Städte untereinander verbinden und übermorgen diesen Planeten mit anderen.‹ War das eine Metapher? Nein, denn eine Metapher war Laukkanens Satz. Zilien aber, das ist etwas Konkretes, etwas, das man sehen und anfassen kann, Écumulon für Écumulon, Molekül für Molekül, Atom für Atom. Leona Christensen redet anschaulich und diesseitig, nicht wahr? Was sagt Helander? Dass die Leute heute weiter seien, das eben sei Laukkanens Verdienst, und Christensen wolle und bewirke weiter nichts, als diesen Schatz zu erhalten und zu mehren. Nein, sage ich. Es klingt zu hübsch, um wahr zu sein. Helander belügt uns über seine Göttin. Sie will den Schatz in eine Truhe sperren, die sie ›wir‹ nennt, und sie will sich draufsetzen. Die Geschichte von den Zilien, die morgen unsere Städte verbinden und übermorgen unsere Welt mit anderen Welten, die hat sie dreimal erzählt, und immer in Laukkanens Beisein, und immer als Schmeichelei für sie. Diese Schmeichelei ist nicht mehr nötig. Unsere Freundin ist tot. Was tut Christensen? Sie redet nicht mehr von morgen, und sie redet nicht mehr von übermorgen. Denn sie weiß: Das ist gefährlich, wenn man so konkret zu reden gewohnt ist wie sie. Wenn man nicht ›Zivilisation‹ sagt, sondern ›Zilien‹, und darauf besteht, dass das kein Bild ist, sondern dass man echte Zilien meint, nun … nun, dann bedeutet ›morgen‹ auch ›morgen‹ und nicht ›in tausend Jahren‹, und ›übermorgen‹ bedeutet ›übermorgen‹ und nicht ›in zehntausend Jahren‹. Ich sage: Halten wir Laukkanen die Treue, die Christensen ihr nicht hält. Christensen hat aufgehört zu kämpfen. Sie will herrschen. Wir kämpfen weiter, und wenn es sein muss, gegen Christensen!«
Es gab durchaus Zustimmung dafür, und sie wurde auch artikuliert.
Diese Zustimmung war allerdings weniger umfangreich als die Ablehnung, und beide zusammen waren geringer als die enorme Bestürzung, die von der klaren Mehrheit der Delegierten kundgetan wurde.
Wer die historischen Quellen und die technischen Voraussetzungen kennt, weiß, wie unwahrscheinlich das ist, was als Nächstes geschah.
Viel später, auf der Erde, im Zuge der ernsten Erforschung der venusialen »Verirrungen und Verbrechen« (Ruhsika Perera) durch die Gelehrten der Diversitas, hat man so gut wie sicher bewiesen, dass es eigentlich nicht hätte geschehen können: Eine realistische mathematische Anteilsschätzung der damals im Plenum verbundenen Fraktionen und Einzeldelegierten, eine vernünftige Ausmittelung der Chance, die bestand, dass von allen Wortmeldungen, die auf Vuletics heftiges Referat folgten, ausgerechnet Leona Christensens persönliche Entgegnung als allererste in den Frames eintraf und deshalb freigeschaltet wurde, hat zu der Einsicht geführt, dass sämtliche écumenale Unterstützung der Welt unter Anwendung aller damals vorhandenen Vorhersagetechniken nicht hingereicht hätte, Vuletic zu warnen – ein dunkles Wunder. Christensen stand auf, als die Frames ihr Wort auf die Tagesordnung setzten.
Sie trug die bei ihr üblichen engen Jeans, wohl auch klobige Stiefel oder Sneaker, die man nicht sah, außerdem ihr rot, blau und weiß kariertes Hemd, mit offenem Kragen, ohne Krawatte, und darüber die enggeschnittene schwarze Lederjacke, die man von so vielen Bilddokumenten, von Plakaten, Stadtfronten, Siegeln im Écumen und Transparenten entlang der Zilien kennt.
Das orangerote Haar leuchtete wie immer jungenhaft kurz, etwas stachlig, vorn in leicht längeren Fransen, von denen eine über das berühmte Muttermal oberhalb der linken Augenbraue fiel. Ihr Blick war warm, ihr Lächeln etwas melancholisch.
Sie wirkte nicht bedroht, nicht einmal erregt oder verärgert, als sie das Wort ergriff: »Freundinnen, Freunde. Ich habe eine Frage, sie gilt Freund Vuletic. Sie ist, wie ihr’s von mir kennt, einfach, anschaulich und konkret.«
Man lachte.
Dann sagte sie und sah ihn direkt an: »Was ich von unserem Freund Vuletic wissen möchte, ist: Was will er von mir? Ich verstehe es nicht. Er sagt, ich habe früher etwas anderes erzählt als jetzt. Das stimmt. Das weiß man, das kann man sich aus allen Archiven holen, in hundert verschiedenen Frames anschauen. Ich habe gesagt: Morgen wird der Écumen unseren Planeten umrundet haben, morgen werden die Zilien hier alles verbinden, und übermorgen wird der Écumen die Distanzen zwischen den Planeten überbrücken. Von morgen und übermorgen haben wir viel geredet, als wir schwach waren. Wir brauchten das Morgen und Übermorgen, denn wir hatten kein Heute. Es waren verzeihliche Reden, verzeihliche Fehler – wir hatten und haben nun mal kleinere Köpfe als Maren Laukkanen. Die redete bewusst nicht davon, was morgen und übermorgen geschehen wird. Die redete von ihrem Programm: von dem, was geschehen soll. Keine Prophezeiungen, sondern Forderungen. Sie wusste: Dieses Morgen- und Übermorgengeprotze hört auf, wenn wir richtig arbeiten müssen. Was will Freund Vuletic? Wir sollen unsere Freunde, die Kontinuierlichen, irgendwohin schießen, mit einer Schrotflinte, und hoffen, dass sie durchkommen. Wir sollen hoffen und glauben, dass die Feinde nicht Topos von ihnen lernen, unseren Code, unsere Sprache, unser Wissen über Écumen und das Schwarze Eis. Hoffen? Zuschlagen? Wir sollen die Energie, die wir brauchen, um das Bundwerk hier aufzubauen und unsere Verteidigung zu verbessern – denn der nächste Angriff wird kommen, irrt euch nicht, Freundinnen, Freunde, man plant schon, man rüstet schon auf –, wir sollen die Energie und die Rechenstunden in ein Himmelfahrtskommando investieren, von dem nicht nur ungewiss ist, ob es irgendetwas nützt, sondern von dem sich auch annehmen lässt, dass es uns schaden wird, falls auch nur ein Kontinuierlicher gefangen, gequält, gescannt, analysiert wird, falls auch nur einer unter der Folter zusammenbricht und überläuft. Das sollen wir tun? Wenn wir so heroisch sind, besoffen vom Kult des Extremen und Heftigen und Heldenhaften, begeistert von Explosionen, dann müssen wir tun, was er von uns will und worüber wir leichtfertig geredet haben, als wir nichts erreicht hatten, nichts aufgebaut hatten. Ich sage es noch einmal: Ich habe auch so geredet.« Eine Effektpause folgte, die einzige, die sie machte.
Viel Zustimmung füllte die Frames.
Und dann gab Christensen der Rede die Wendung, in der, so glaube ich, geboren wurde, was ich die historische und politische Ironie nenne – das Eingeständnis eigener Schwäche als Demonstration bereits gefestigter Autorität: »Ich frage unseren Freund Vuletic: Warum nimmt er mir übel, dass ich nicht mehr so albern daherrede wie vor Jahren? Ich habe damals einen Fehler gemacht. Ich habe gelernt, den Fehler nicht mehr zu machen. Wäre es nicht nützlicher für unseren Freund Vuletic, wenn er sich, anstatt mich dafür zu beschimpfen, dass ich lerne, an mir ein Beispiel nähme und auch lernte? Ja, das wäre nützlicher.«
Vuletic hätte reagieren müssen.
Dass er das nicht tat, lag keineswegs daran, dass er, wie man von ihm später hören und lesen musste, »auf eine so billige Provokation in diesem Augenblick nicht eingehen konnte, weil es genügend wirkliche, ernste Fragen gab, auf die ich sofort antworten musste«. Der Grund für sein Schweigen war, dass seine semisentienten Filter ihm, wie man inzwischen weiß, damals nach blitzschnellem Zwischenkalkül dazu rieten, sich nicht auf dieser allgemeinen Ebene zu verausgaben, weil die nächsten, die übernächsten und die über dreihundert folgenden Erwiderungen auf seine Rede voller technischer Einzeleinwände steckten. Hätte er sie unbeantwortet gelassen, wären sie von der soeben sprunghaft angestiegenen Zahl seiner Gegnerinnen und Verächter als vernichtende Kritik an seinem herostratischen Plan gewertet worden. Er hatte also nur die Wahl zwischen zwei Sorten der Niederlage, und er traf sie augenblicklich.
So ließ er sich, physisch schweigend, aber aufrecht am Pult, als hätte man ihn dort festgenagelt, auf Einsprüche und Detailauskunftsversuche ein, die er im Kopf, an der Schnittstelle zu allen Frames, teils mit der Unterstützung teilautonomer Software, teils mittels Weiterleitung an seinen wissenschaftlich-technischen Stab bediente, dem sogar ein paar K/ angehörten. Dieser Stab war ihm als letztes Ehrenzeichen aus seiner Zeit als Organisator der Bundwerksarmee verblieben.
Ein Schwirren von Écumuli in beiden Venushemisphären ließ zahlreiche Frames für einige Picosekunden zerreißen, während Menschen aus allen Lagen des Bundes eine Aufstellung der energetischen Kosten von Vuletics Offensividee verlangten. Man befragte ihn streng:
Wie stand es mit der Belastung der dünnen Filme und Kanäle in den Zilien, die von den Vulkanen und Reaktoren zu den Antennenanlagen führten? Würden sie eine Maximalbeanspruchung wie die, die er verlangte, überhaupt aushalten? Würde es Feedbackeffekte geben bei den Schnittstellen in den Köpfen der Menschen und den Zentralprozessoren der Diskreten? Würde das Im- und Exportwesen des Planeten für die Dauer dieser Riesensendung, dieser Salve von etwas, das die Regierungen und Korporationsleitungen und Fonds der anderen Welten und Habitate im System nur als malware auffassen konnten, nicht komplett ausgesetzt werden müssen?