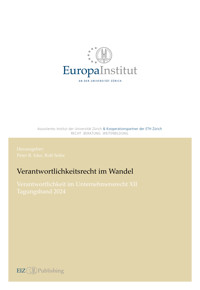
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: buch & netz
- Kategorie: Fachliteratur
- Serie: EIZ Publishing
- Sprache: Deutsch
Dieser Sammelband widmet sich Grundsatzfragen des Verantwortlichkeitsrechts (Verantwortlichkeit im Konzern, Finanzierungsverantwortung von Grossaktionären sowie Zusammenhänge von Verantwortlichkeit und Vergütung). Sodann werden die Wechselwirkungen des Verantwortlichkeitsrechts zu anderen Rechtsgebieten beleuchtet (Prozessfinanzierung sowie Haftung des Verwaltungsrats für Steuern und steuerliche Aspekte bei Verantwortlichkeitsansprüchen). Schliesslich wird die Rechtsprechung zum Diesel-Skandal rechtsvergleichend analysiert.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 230
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Verantwortlichkeitsrecht im Wandel Copyright © by Peter R. Isler und Rolf Sethe is licensed under a Creative Commons Namensnennung-Nicht kommerziell-Keine Bearbeitung 4.0 International, except where otherwise noted.
© 2025 – CC BY-NC-ND (Werk), CC BY-SA (Text)
Herausgeber: Peter R. Isler / Rolf Sethe – Europa Institut an der Universität ZürichVerlag: EIZ Publishing (eizpublishing.ch)Produktion, Satz & Vertrieb:buchundnetz.comISBN:978-3-03805-790-1 (Print – Softcover)978-3-03805-791-8 (PDF)978-3-03805-792-5 (ePub)DOI: https://doi.org/10.36862/eiz-790Version: 1.00 – 20250318
Das Werk ist als gedrucktes Buch und als Open-Access-Publikation in verschiedenen digitalen Formaten verfügbar: https://eizpublishing.ch/publikationen/verantwortlichkeitsrecht-im-wandel/.
1
Vorwort
Die vom Europa Institut Zürich regelmässig durchgeführte „Zürcher Tagung zur Verantwortlichkeit im Unternehmensrecht“ fand am 30. Januar 2024 zum zwölften Mal statt. Die Veranstalter haben bei der Themenwahl versucht, die sich aus der jüngeren Rechtsprechung und dem wissenschaftlichen Diskurs ergebenden Grundsatzfragen des Verantwortlichkeitsrechts aufzugreifen (Verantwortlichkeit im Konzern, Finanzierungsverantwortung von Grossaktionären sowie Zusammenhänge von Verantwortlichkeit und Vergütung). Beleuchtet wurden weiter Fragen der Prozessfinanzierung sowie der Haftung des Verwaltungsrats für Steuern und steuerliche Aspekte bei Verantwortlichkeitsansprüchen. Das Thema Dieselskandal, das wir bereits im letzten Tagungsband angesprochen hatten, ist in Deutschland weiterhin aktuell und man dürfte dort vor einer dritten Klagewelle stehen. Nun hat es auch in der Schweiz zu höchstrichterlichen Entscheiden geführt. Wir haben daher ein rechtsvergleichendes Referat zu diesem Thema aufgenommen.
Mit der 12. Tagung schliessen die Veranstalter die Tagungsreihe zur Verantwortlichkeit im Unternehmensrecht. Anlass für ihre Begründung war die prozessuale Aufbereitung des Groundings der Swissair. Prof. Dr. Rolf H. Weber (1. bis 6. Tagung), Dr. Peter R. Isler (4. bis 12. Tagung), sowie Prof. Dr. Rolf Sethe (7. bis 12. Tagung) haben versucht, die grosse Bandbreite des Verantwortlichkeitsrechts bei der Auswahl der Tagungsthemen darzulegen, um offene Rechtsfragen klären und in einen systematischen Kontext stellen zu können. Zugleich sollten die Referate eine Handreichung für Praktiker sein, die vor der konkreten Aufgabe stehen, in einem Fall die zivilrechtlichen Folgen des Verantwortlichkeitsrechts beurteilen zu müssen. Aus diesem Grund wurden die Referate anschliessend in vertiefter und aktualisierter Form in Tagungsbänden veröffentlicht. Einzig die Referate der Tagung von 2017 sind 2018 im Heft 2 der ZSR erschienen. Die grundlegenden Fragen des Verantwortlichkeitsrechts konnten im Rahmen der zwölf Tagungen (weitgehend) geklärt werden. Da derzeit nicht zu erwarten ist, dass ein weiterer spektakulärer Fall des Verantwortlichkeitsrechts eine Vielzahl neuer Fragen aufwerfen würde, schliessen wir die ausschliesslich dem Verantwortlichkeitsrecht gewidmete Tagungsreihe nun ab. Das Thema Verantwortlichkeit im Unternehmensrecht wird künftig in Form von Einzelreferaten in der Zürcher Tagung für Aktien- und GmbH-Recht behandelt.
Unser Dank gebührt unseren Referentinnen und Referenten dieser Tagung, aber auch aller früheren Tagungen, die sich neben ihrem grossen Einsatz an der Veranstaltung der Mühe unterzogen haben, ihr Referat schriftlich niederzulegen.
Ausserdem danken wir dem bewährten Team des Europa Instituts, das die Veranstaltungen all die Jahre hervorragend und zuverlässlich betreut hat. Für die Durchführung der diesjährigen Tagung und für die Erstellung und Gestaltung dieses Bandes danken wir Frau Deak, Frau Tschalèr und Frau Schwegler.
Zürich, im Dezember 2024 Peter R. Isler/Rolf Sethe
2
Inhaltsübersicht
Verantwortlichkeit im Konzern
Dr. Peter R. Isler, LL.M., Rechtsanwalt, Lehrbeauftragter an der Universität Zürich, Partner bei Niederer Kraft Frey AG, Zürich
Finanzierungsverantwortung von Grossaktionären für unterkapitalisierte AGs
Prof. Dr. Valentin Jentsch, LL.M., Assistenzprofessor für Gesellschaftsrecht, Universität St.Gallen
Verantwortlichkeit und Vergütung
Dr. Valerie Meyer Bahar, LL.M., Rechtsanwältin, Partnerin bei Niederer Kraft Frey AG, Zürich
Reichweite des Abgasskandals bis in die Schweiz
Prof. Dr. Rolf Sethe, LL.M., Rechtsanwalt, Ordinarius für Privat‑, Handels- und Wirtschaftsrecht an der Universität Zürich
Prozessfinanzierung
Dr. Isabelle Berger, Rechtsanwältin, Chief Investment Officer, Partnerin bei Nivalion AG, Steinhausen
Haftung des Verwaltungsrats für Steuern und steuerliche Aspekte bei Verantwortlichkeitsansprüchen
Dr. Tobias F. Rohner, Rechtsanwalt, dipl. Steuerexperte, Partner bei Vischer AGPatrik Fisch, MLaw HSG, MAccFin HSG, dipl. Steuerexperte
Verantwortlichkeit im Konzern
Peter R. Isler
Inhalt
EinleitungVerantwortlichkeit auf Stufe ObergesellschaftAllgemeine BemerkungenPflichtverletzungSchadenKausalzusammenhangVerschuldenAktivlegitimation von AktionärenAllgemeine BemerkungAktionärsklagen aus unmittelbarem SchadenAktionärsklagen aus mittelbarem SchadenAktivlegitimation der GesellschaftAllgemeine FeststellungenGrosse Zurückhaltung bei Klagen der GesellschaftKlage gestützt auf einen GV-Beschluss der geschädigten GesellschaftKlage der Gesellschaft unter Einbezug der D&O VersicherungDer Fall ABB als Musterbeispiel einer VergleichslösungAktivlegitimation des Konkurs- oder Nachlassverwalters bzw. von Gläubigern durch Abtretung von VerantwortlichkeitsansprüchenAllgemeine BemerkungDas Interesse des AbtretungsgläubigersPassivlegitimation von Verwaltungsrat, Geschäftsleitung und RevisionsstelleAllgemeine BemerkungenBei KonzernholdinggesellschaftenPassivlegitimation von faktischen Organen und Körperschaften des öffentlichen RechtsQualifikation als faktisches OrganBei KonzernobergesellschaftenKörperschaft des öffentlichen RechtsVerantwortlichkeit auf Stufe UntergesellschaftAllgemeine BemerkungenAktivlegitimation der Muttergesellschaft, eines Minderheitsaktionärs, des Konkurs- oder Nachlassverwalters bzw. eines AbtretungsgläubigersTochtergesellschaft nicht im Konkurs oder NachlassTochtergesellschaft im Konkurs oder NachlassPassivlegitimation bei Verantwortlichkeit auf Stufe UntergesellschaftAllgemeine BemerkungenPassivlegitimation von Verwaltungsrat und Geschäftsleitung der UntergesellschaftPassivlegitimation der Organe der ObergesellschaftPassivlegitimation der Obergesellschaft selbstSchlussbemerkungenLiteraturverzeichnisEinleitung
Nach dem Grounding der Swissair im Herbst 2001 wurde von den vier in Nachlassliquidation gefallenen Konzerngesellschaften SAirGroup, SAirLines, Swissair und Flightlease, handelnd durch die Nachlassliquidatoren, versucht, in sechs Verantwortlichkeitsprozessen von Mitgliedern des Verwaltungsrates und Teilen der Geschäftsleitung beträchtliche Schadenersatzforderungen durchzusetzen. Bekanntlich wurden sämtliche Verantwortlichkeitsklagen von allen Gerichtsinstanzen vollständig abgewiesen, zuletzt im November 2019 durch ein Bundesgerichtsurteil in Sachen Swissair/Cash Pool.[1]
Seither scheint die Meinung verbreitet zu sein, dass bei einem Scheitern von Grossfirmen der Verwaltungsrat kaum je zur Verantwortung gezogen werde. Nachdem nun im Frühjahr 2023 die einst hochangesehene Credit Suisse infolge der Not-Übernahme durch die UBS unterging und in der Schweiz soweit bekannt keine Verantwortlichkeitsklagen im Raum stehen, wurde diese Ansicht wohl noch gestärkt. In einem Gastkommentar von Jean-Daniel Gerber in der NZZ vom 5. August 2023 unter dem Titel „Den Verwaltungsrat in die Pflicht nehmen“ wurde denn auch folgende klare Aussage gleich an den Anfang gestellt:
„Der Verwaltungsrat trägt die Verantwortung für die Gesamtpolitik der Unternehmung. Kommt er seinen Pflichten nicht nach, ist er haftbar. Um ihn straf- oder zivilrechtlich zu belangen, müssen jedoch hohe Anforderungen erfüllt sein. Es muss nachgewiesen werden, dass 1) der Verwaltungsrat seine Pflichten verletzt hat, 2) ein Schaden entstanden ist, 3) der Schaden kausal mit der Verletzung der Pflichten zusammenhängt und 4) ein Verschulden vorliegt.
Diese vier Kriterien müssen zudem kumulativ erfüllt sein. Dieses System verunmöglicht es nahezu, Schuld zu belegen und Verantwortung einzufordern, denn Fehlentscheide fallen nicht unter die Haftungsgründe. Im Gegensatz zu den Mitarbeitenden und Aktionären, die um ihre Stelle oder ihr Kapital bangen müssen, kommt der Verwaltungsrat ziemlich ungeschoren davon.“
Diese ziemlich ernüchternde Feststellung stammt von einem fundierten Kenner der Wirtschaft, war Gerber doch Staatssekretär für Wirtschaft und später Verwaltungsrat in so bekannten Unternehmen wie der Weltbank, Lonza, Credit Suisse und Präsident der Sifem AG (Swiss Investment Fund for Emerging Markets).[2]
Dennoch möchte ich in diesem Beitrag die These – mit Fokus auf Konzernverhältnisse – kritisch hinterfragen. Dabei soll die juristische Theorie eher allgemein behandelt[3] und mehr anhand von Beispielen aus der Praxis und eigener Erfahrung aufgezeigt werden, wo auch in Grossunternehmen die aktienrechtliche Verantwortlichkeit nicht toter Buchstabe bleiben muss.
In einem straff geführten Konzern, aber auch in einer zusammengekauften Unternehmensgruppe (z.B. im Medien- oder Medizinbereich sowie in der Vermögensverwaltung) entsteht in der Tat ein recht komplexes Beziehungsgeflecht zwischen den möglichen Klägern und den potenziellen Beklagten eines Verantwortlichkeitsprozesses. Dieses kann sich zudem im Laufe der Zeit ändern, wenn eine Konzerngesellschaft in Konkurs oder Nachlassliquidation fallen sollte. Es kann etwa wie folgt schematisch dargestellt werden:
Nachfolgend sollen die aktienrechtlichen Themen getrennt nach Obergesellschaft und Untergesellschaft behandelt werden.
Verantwortlichkeit auf Stufe Obergesellschaft
Allgemeine Bemerkungen
Wie Gerber zurecht betont, sind die von der Klägerschaft zu beweisenden, kumulativen vier Voraussetzungen für eine erfolgreiche Verantwortlichkeitsklage ziemlich hoch. Bei einer Verantwortlichkeit für einen Schaden auf Stufe Obergesellschaft müssen sie aufgrund der rechtlichen Selbständigkeit der Konzerngesellschaften zudem in Bezug auf diese selbst und nicht auf den Konzern als Ganzes oder eine Untergesellschaft erfüllt sein. Es bestehen insbesondere die nachfolgend aufgeführten Schwierigkeiten:
Pflichtverletzung
Für eine Verantwortlichkeitsklage bei der Obergesellschaft ist, wie soeben angesprochen, grundsätzlich nur die Pflichtverletzung gegenüber dieser entscheidend. Trotzdem darf die Konzernsicht nicht ausgeblendet werden, da eine unmittelbar zulasten der Obergesellschaft gehende Handlung, z.B. ein günstiges Darlehen an die Untergesellschaft, den Wert der Untergesellschaft (mindestens) im selben Umfang erhöhen kann, wie sich jener der Obergesellschaft unmittelbar reduziert. Der gestiegene Wert der Beteiligung an der Untergesellschaft kompensiert dann den unmittelbaren Verlust bei der Obergesellschaft, sodass diese nicht geschädigt ist und auch keine Pflichtverletzung vorliegt.[4] Das gilt solange, als die Untergesellschaft nicht überschuldet ist, da sonst der Zuschuss mindestens teilweise anderen Gläubigern zugutekommt.[5] Auch dann ist ein Transfer zulässig, wenn er im Eigeninteresse der Obergesellschaft liegt, etwa weil die unterstützte Untergesellschaft unersetzliche („systemrelevante“) Funktionen für die Gruppe erbringt.[6] Hingegen wurde ein Verantwortlichkeitsanspruch bejaht für eine Darlehensgewährung an eine überschuldete Tochtergesellschaft, für die keine Sanierungsbemühungen getroffen worden waren.[7]
Die Pflichtverletzung besteht meist in einer Verletzung der Sorgfalts- oder Treuepflicht. Sie ist vor allem bei strafbaren Handlungen sowie einer Schadensverursachung infolge eines Interessenkonflikts relativ leicht nachweisbar. Bei blossen geschäftlichen Fehlentscheiden ist dies viel anspruchsvoller. Geschäftsentscheide, welche sich in der Folge als schadensverursachend herausstellen, müssen aus einer ex-ante-Sicht und nach den Grundsätzen der Business Judgment Rule beurteilt werden.[8]
Letztere Regel setzt einen „von Interessenkonflikten freien Entscheidprozess“ voraus.[9] Interessenkonflikte sind grundsätzlich auch konzernintern möglich. Wie anhand von Transfers der Ober- an die Untergesellschaft aufgezeigt, schliesst aber das Interesse der Konzernmutter in der Regel auch jenes anderer Konzernglieder ein. In diesem Fall liegt kein der Business Judgment Rule entgegenstehender Interessenkonflikt vor. Auch dann kann aber nach der Rechtsprechung bei der Beurteilung konzerninterner Transaktionen ein strengerer Massstab als üblich greifen, wenn die verantwortliche Person etwa aufgrund einer Doppelorganschaft besondere Kenntnisse z.B. von Gegenparteirisiken eines konzerninternen Darlehens hat.[10]
Schaden
Die Schadensberechnung nach der Differenztheorie ist in vielen Verantwortlichkeitsprozessen eine Knacknuss, insbesondere auch beim Nachweis eines Konkursverschleppungsschadens.[11] Zudem ist nun höchstrichterlich geklärt, dass eine Zahlung von ausgewiesenen fälligen Schulden auch in einer finanziellen Krisensituation des Konzerns (mit nachfolgender Insolvenz) keinen verantwortlichkeitsrechtlichen Schaden darstellt, sondern höchstens Anlass zu einer paulianischen Anfechtungsklage geben könnte, sofern einzig die (übrigen) Gläubiger geschädigt sind.[12]
Auch wenn die Anforderungen an die den Kläger treffende Beweislast zur Substantiierung des Schadens hoch sind, hat das Bundesgericht auch anerkannt, dass im Rahmen eines Verantwortlichkeitsprozesses der Schaden auch nach Art. 42 Abs. 2 OR vom Richter geschätzt werden kann, wenn er ziffernmässig schwer nachweisbar ist.[13]
Kausalzusammenhang
Hier ist in einem Konzernverhältnis im Gegensatz zu Verantwortlichkeitsklagen bei einer Einzelgesellschaft oft die zusätzliche Schwierigkeit zu beurteilen, ob es an der Kausalität fehlen könnte, weil der behauptete Schaden auch bei rechtmässigem Verhalten eingetreten wäre. Mit dem Argument des rechtmässigen Alternativverhaltens fehlt es dann an der natürlichen Kausalität als einer Haftungsvoraussetzung.[14]
Verschulden
Bei einer festgestellten Pflichtverletzung ist in der Regel auch ein Verschulden gegeben, aber trotzdem wird immer wieder von nicht direkt beteiligten Verwaltungsräten eingewendet, es würde sie kein Verschulden treffen. Grundlage für die Beurteilung ist die in Art. 759 Abs. 1 OR geregelte differenzierte Solidarität für die Haftung in der aktienrechtlichen Verantwortlichkeit.[15]
Im Verhältnis zwischen dem haftenden Organ und dem Geschädigten kann der Betrag des Schadens, zu welchem ein haftendes Organ verurteilt werden kann, jenen Schaden nicht übersteigen, den das Organ verursacht hat und der ihm persönlich aufgrund seines Verschuldens zugerechnet werden kann. Unter diesem Aspekt ist der Nachweis des Verschuldens trotzdem von erheblicher Bedeutung.[16]
Eine Verantwortlichkeit kann somit für ein Organ wegfallen, wenn das Verhalten eines anderen Verantwortlichen den Kausalzusammenhang zwischen seiner eigenen Pflichtverletzung und dem Schaden als inadäquat erscheinen lässt. Die Rechtsprechung ist bei der Erfüllung dieser Anforderung jedoch streng, damit der Schutz des Geschädigten nicht weitgehend illusorisch gemacht wird.[17]
Aktivlegitimation von Aktionären
Allgemeine Bemerkung
Aktionäre haben bei einer aufrechtstehenden Gesellschaft zwei Klagemöglichkeiten, je nachdem welche Vermögensmasse durch die Pflichtverletzung von Gesellschaftsorganen geschädigt wurde:
Wenn das Vermögen der Gesellschaft betroffen ist, steht die Klage aus mittelbarem Schaden auf Leistung an die Gesellschaft zur Verfügung (Art. 756 Abs. 1 Satz 2 OR).Wenn dagegen das Vermögen der Aktionäre bzw. des klagenden Aktionärs betroffen ist, steht die Klage aus unmittelbarem Schaden auf Leistung an den Kläger zur Verfügung. Dazu gibt es keine spezifische gesetzliche Bestimmung. Der Anspruch basiert auf dem allgemeinen Haftpflichtrecht mit Modifikationen des Aktienrechts bezüglich Gerichtsstand, Solidarität und Verjährung.[18]Aktionärsklagen aus unmittelbarem Schaden
Diese sind in der Praxis eher selten. Ein bekanntes Beispiel ist die im Jahre 1994 von der BK Vision gegen die Verwaltungsräte der Schweizerischen Bankgesellschaft (SBG) erhobene Verantwortlichkeitsklage. Martin Ebner wollte zu Beginn der 90er Jahre die Kontrolle über die SBG erwerben und kaufte möglichst viele Namenaktien, welche Stimmrechtsaktien im Verhältnis 5:1 gegenüber den Inhaberaktien waren. Der Verwaltungsrat der SBG versuchte dies zu verhindern durch den Beschluss der Generalversammlung, eine Einheitsinhaberaktie zu schaffen. Der GV-Beschluss kam knapp mit qualifiziertem Zweidrittel-Mehr zustande und wurde von der BZ Bank angefochten. Um den Druck auf den Verwaltungsrat zu erhöhen, wurde aber auch die Verantwortlichkeitsklage erhoben aufgrund des Wertverlustes der Namenaktien. Aber durch die bald darauf angekündigte Fusion zwischen der SBG und dem Schweizerischen Bankverein zur neuen UBS wurde diese Klage einvernehmlich beendet.[19]
Aktionärsklagen aus mittelbarem Schaden
Auch diese Klagen sind recht selten, weil sie finanziell uninteressant sind und die Informationsbeschaffung für die Klagevoraussetzungen schwierig ist. Immerhin gibt es auch hier ein paar bekannte Beispiele:
Dem Fall SKA Filiale Chiasso aus dem Jahr 1977 lag folgender Sachverhalt zugrunde: Diese Filiale war in den 60er und 70er Jahren sehr erfolgreich im Akquirieren von Geldern italienischer Kunden. Jedoch wurden diese Mittel nicht wie vereinbart am Euromarkt angelegt, sondern über die liechtensteinische Texon Anstalt in italienische Unternehmen investiert. Als der Lirekurs Mitte der 70er Jahre stark fiel, verloren die Investments erheblich an Wert. 1977 wurde bankintern festgestellt, dass die SKA Chiasso vielen italienischen Kunden Rückzahlungsgarantien ausgestellt hatte. Der SKA entstand ein Schaden von rund CHF 1.4 Mia., was grosse negative Publizität zur Folge hatte. Ein Aktionär klagte daraufhin gegen den Verwaltungsratspräsidenten gestützt auf die vielen Zeitungsartikel auf Schadenersatzleistung an die Gesellschaft und liess sich dann rasch zu einem vergleichsweisen Klagerückzug gegen eine Zahlung an sich selbst bewegen.Etwas ähnliches geschah etwas früher bei der Alusuisse. Es war ein Prozessanwalt, welcher nach Bekanntwerden einer hohen Ruhegehaltszahlung an den ehemaligen Verwaltungsratspräsidenten trotz grosser Verluste der Unternehmung eine Klage auf Rückzahlung an die Gesellschaft erhob und diese bald wieder gegen eine angemessene Entschädigung zurückzog.Diese zwei Beispiele waren wohl Vorgänger der heutigen Spezies von aktivistischen Shareholdern, welche sich bei Gesellschaften mit unterbewerteten Aktien einkaufen und Druck auf die Organe (einschliesslich Drohung mit Verantwortlichkeitsklagen) zur Vornahme von wesentlichen Veränderungen im angeblich besten Interesse der Unternehmung machen und sich dann ihre Aktien bald einmal wieder mit Gewinn abkaufen lassen.Dies war vor einigen Jahren beim schweizerischen Chemieunternehmen Clariant zu beobachten, welche mit dem amerikanischen Industriekonzern Huntsman fusionieren wollte, worauf der Aktienkurs fiel. Amerikanische Investoren unter dem Sammelnamen White Tale kauften grössere Aktienpositionen und gaben an, dass ihnen die Eigenständigkeit von Clariant sehr am Herzen liege. Sie verhinderten den Fusionsbeschluss, um kurze Zeit später ihre Aktien zu einem sehr guten Preis an einen weissen Ritter aus Saudi-Arabien zu verkaufen.Das Musterbeispiel einer erfolgreichen Aktionärsklage bei einem mittelbaren Schaden ist im Konzernverhältnis der Fall Lorze gegen die Verwaltungsräte der Reishauer Beteiligungen AG. Die Lorze AG war mit 47% Minderheitsaktionärin an Reishauer via zwei Gesellschaften beteiligt, welche fusionierten. Reishauer weigerte sich, die vinkulierten Namenaktien, welche die fusionierte Gesellschaft hielt, auf die übernehmende Gesellschaft mit Stimmrecht im Aktienbuch einzutragen. Die entsprechende Klage auf Eintragung als Aktionärin mit Stimmrecht wurde sowohl vom Handelsgericht Zürich wie vom Bundesgericht gutgeheissen, weil die Verweigerung von Reishauer als rechtsmissbräuchlich und gegen das aktienrechtliche Gleichbehandlungsgebot (Art. 717 Abs. 2 OR) verstossend erachtetet wurde. Anschliessend verlangte Lorze in einem aktienrechtlichen Verantwortlichkeitsprozess, die Verwaltungsräte von Reishauer hätten der Gesellschaft Schadenersatz zu leisten für die im ersten Prozess verursachten Kosten – und sie gewann den Prozess zu einem wesentlichen Teil. Die Beklagten mussten rund CHF 1.2 Mio. an die Gesellschaft bezahlen.[20]Aktivlegitimation der Gesellschaft
Allgemeine Feststellungen
Bei einem von der Gesellschaft erlittenen Schaden infolge von pflichtwidrigen Handlungen oder Unterlassungen ihrer Organe wäre grundsätzlich die Gesellschaft selbst die richtige Klägerin, um Verantwortlichkeitsansprüche geltend zu machen. Typische Fälle in der Praxis für solche Klagen wären etwa:
verlustbringende Akquisitionen nach ungenügenden Vorabklärungen,Kreditausfälle wegen fehlendem oder fehlerhaftem Risikomanagement,Schaden aus spekulativer Geschäftstätigkeit,Schaden durch betrügerische Handlungen von Angestellten oder Dritten, welche wegen mangelhafter Kontrollen lange nicht entdeckt wurden.Hier wäre eine Verantwortlichkeitsklage insbesondere dann geboten, wenn den Organen von der Generalversammlung keine Décharge erteilt wurde. Mit der Klage sollte versucht werden, für die Gesellschaft zumindest einen Teil des erlittenen Schadens wieder zu kompensieren.
Grosse Zurückhaltung bei Klagen der Gesellschaft
Wenn die Gesellschaft nicht im Konkurs ist, kann jedoch eine grosse Zurückhaltung gerade bei Konzernverhältnissen oder bekannten Unternehmen festgestellt werden, in solchen Schadensfällen Klage zu erheben. Diesbezüglich hat Jean-Daniel Gerber bei seiner anfangs zitierten Aussage schon recht. Die Gründe für diese Zurückhaltung können vielfältig sein, z.B.
Ausrichtung der Unternehmenstätigkeit auf die Zukunft und nicht auf die Vergangenheitsbewältigung;Grosser finanzieller und zeitlicher Aufwand und vermutlich relativ kleiner Ertrag und erhebliches Prozessrisiko;Mögliche negative Auswirkung auf das bestehende Management, welches sich auf die Verbesserung der geschäftlichen Situation konzentrieren sollte, insbesondere wenn die Gefahr besteht, dass die eingeklagten (ehemaligen) Organe dem Management den Streit verkünden sollten (Art. 78 ff. ZPO);Fortdauer einer negativen Publizität über die Gesellschaft bei Berichterstattung über den Prozessverlauf in den Medien[21].Je nach Konzernstruktur, v.a. bei einer Aktienkotierung auch in den USA oder einem substantiellen Aktionärskreis von amerikanischen Investoren, können Verantwortlichkeitsklagen nach Schweizer Recht auch Grundlage für Klagen ausländischer Aktionäre gegen die Gesellschaft im Ausland sein, weil diese Aktionäre durch grobe Verfehlungen von Organen der Gesellschaft, welche der Gesellschaft zuzurechnen seien, im Wert ihrer Aktien geschädigt wurden.[22]
Klage gestützt auf einen GV-Beschluss der geschädigten Gesellschaft
Das neue Aktienrecht gewährt nun in Art. 756 Abs. 2 OR explizit der Generalversammlung der durch Pflichtverletzung von Organen geschädigten Gesellschaft die Kompetenz, in einer bestimmten Sache Verantwortlichkeitsklage zu erheben. Die Generalversammlung kann auch bestimmen, ob der Verwaltungsrat oder ein aussenstehender Vertreter mit der Prozessführung betraut werden soll. Allfällige Stimmrechtsprivilegien gelten bei dieser Beschlussfassung nicht, d.h. die Bemessung der Stimmkraft richtet sich nicht nach der Zahl der Aktien, sondern nach dem Nominalwert der zustimmenden Aktien (Art. 693 Abs. 3 Ziff. 4 OR).[23]
Die Bestimmung entspricht einer schon früher geltenden Rechtspraxis (vgl. BGE 132 III 707). Es wird im Einzelfall zu prüfen sein, unter welchen Voraussetzungen und durch welche Personen in Prozessbeistandschaft eine erfolgsversprechende Klage geführt werden soll. Jedenfalls müssen die mit der Klage beauftragten Personen frei von irgendwelchen Interessenkonflikten und mit weitgehenden Kompetenzen ausgestattet sein. Diese Befugnisse sollten auch die Ermächtigung enthalten, einen Vergleich abzuschliessen, insbesondere wenn dieser unter Einbezug einer gerichtlichen Beurteilung abgeschlossen wird.
Klage der Gesellschaft unter Einbezug der D&O Versicherung
Nach meiner Wahrnehmung noch wenig bekannt und selten verwendet, besteht für die geschädigte Gesellschaft auch die Möglichkeit, durch eine Verantwortlichkeitsklage gegen ihre Organe einen Deckungsbeitrag an ihren Schaden zu erhalten, wenn (wie weitgehend üblich) zugunsten dieser Organpersonen eine D&O Versicherung von der Gesellschaft abgeschlossen wurde.[24]
Auf dieses Vorgehen wurden wir in der Schweiz im Sommer 2021 aufmerksam, als den Aktionären von Volkswagen und Audi im Zusammenhang mit dem Milliarden-Schaden aus dem sog. Dieselskandal eine Vergleichsvereinbarung vom 9. Juni 2021 vorgelegt wurde. In dieser Vereinbarung, welche eine Schadenersatzforderung gegen Herrn Prof. Martin Winterkorn, langjähriges Vorstandsmitglied bei Volkswagen und Audi und zuletzt Vorstandsvorsitzender und zuständig für die Geschäftsbereiche Forschung und Entwicklung, zum Gegenstand hatte, wurde ein umfassender Haftungsvergleich abgeschlossen. Die verschiedenen D&O Versicherungen bezahlten für Rechnung der durch sie versicherten Organe insgesamt rund EUR 270.0 Mio. und Prof. Winterkorn und ein weiteres Vorstandsmitglied zusammen rund EUR 15.0 Mio. an die Gesellschaften Volkswagen und Audi per Saldo aller Ansprüche aus dem Dieselskandal.[25]
Ein solches Vorgehen wäre auch in der Schweiz möglich, etwa nach folgendem Schema:
Die geschädigte Gesellschaft macht eine Untersuchung über die Hauptursachen des Schadens und der Pflichtverletzung, vorzugsweise durch eine unabhängige, auf solche Untersuchungen spezialisierte Anwaltskanzlei.Die Prozessvertretung der Gesellschaft macht gegenüber einzelnen Organpersonen, welche als Hauptverantwortliche angesehen werden, Schadenersatzansprüche in einem Teilbetrag geltend, welcher auch die finanziellen Verhältnisse der betreffenden Organe und die Deckungssumme der D&O Versicherung berücksichtigt.Die angeschuldigten Organpersonen notifizieren die D&O Versicherung der Gesellschaft, was zur Folge hat, dass diese die Anwaltskosten der betreffenden Personen übernehmen und eine eigene Beurteilung machen muss.Nach weiteren Abklärungen von allen Beteiligten wird versucht, allenfalls vorprozessual oder – wahrscheinlicher – in einem eingeleiteten Gerichtsverfahren unter Mitwirkung der Richter einen Prozessvergleich abzuschliessen.Die Interessenlage der Beteiligten ist häufig durchaus gleichgelagert, um die Auseinandersetzung zu einem vernünftigen Ergebnis zu bringen:
Die D&O Versicherung hat ein Interesse, einen langwierigen und teuren Prozess durch Vergleich zu beenden und zu verhindern, dass eine grosse Zahl von Personen eingeklagt wird, welche alle ihre Anwaltskosten von ihr bezahlt haben wollen.Die Gesellschaft hat ein Interesse, ohne übermässigen Aufwand und erhebliche interne Belastung des Managements einen fairen Netto-Deckungsbetrag an ihren Schaden zu erhalten.Die in Anspruch genommenen Organe haben ein Interesse, ihr finanzielles Risiko zu begrenzen und nicht (wie in den Swissair Verantwortlichkeitsklagen) über sehr lange Zeit durch einen sehr unangenehmen Prozess belastet zu werden.Die nicht im Prozess eingeklagten, aber doch vom Sachverhalt her auch exponierten Personen haben ein Interesse, dass ein für die Gesellschaft möglicherweise erfolgreicher Prozessausgang nicht Grundlage für weitere Klagen gegen sie schaffen würde.Deshalb wird es in solchen Fällen möglich sein, für einen seitens der D&O Versicherung und den Beklagten (die in der Regel auch persönlich einen finanziellen Beitrag leisten müssen) sowie seitens allfälliger weiterer exponierter Personen eine Vergleichslösung zu einem bezahlbaren Betrag[26] zu finden. Mit diesem Vergleich sollte auch durch eine Saldoquittung ein Schlussstrich unter der Auseinandersetzung gezogen werden.
Der Fall ABB als Musterbeispiel einer Vergleichslösung
Es gibt wenige bekannte Gerichtsentscheide über Verantwortlichkeitsklagen der aufrechtstehenden Gesellschaft gegen ihre Organpersonen.[27] Die meisten Fälle dürften durch einen gerichtlichen oder aussergerichtlichen Vergleich erledigt worden sein.[28] Im Rahmen von Konzernverhältnissen gibt es einen bekannten Fall, welcher den ABB Konzern betraf: Dieser wurde 1988 durch die Fusion zwischen der schweizerischen Brown Boveri und schwedischen Asea gebildet und war anfänglich dank starkem Wachstum sehr erfolgreich. Allerdings wurde in dieser Wachstumsphase auch der US-amerikanische Konzern Combustion Engineering erworben, welcher vor allem Kraftwerke baute. Einige Jahre nach der Akquisition wurde bekannt, dass die produzierten Kraftwerkanlagen grosse Mengen Asbest enthielten, welche für Mitarbeitende erhebliche gesundheitliche Schäden verursachten. Combustion Engineering und ABB wurden zur Zielscheibe von exorbitanten Sammelklagen in den USA und waren durchaus existenzgefährdet. Der Aktienkurs von ABB fiel dramatisch.
Der nach der Fusion amtierende sehr erfolgreiche CEO wurde anschliessend Verwaltungsratspräsident und sein Nachfolger machte zusätzlich zum Asbest-Problem erhebliche strategische Fehler. Im Jahr 2001 wurde bekannt, dass der Verwaltungsratsausschuss von ABB dem Verwaltungsratspräsidenten und dem CEO hohe Beträge für Salär und Ruhestandabfindungen zugestanden hatte. Martin Ebner war bedeutender Minderheitsaktionär und Verwaltungsrat von ABB und wollte sofort gegen die massgebenden Personen eine Verantwortlichkeitsklage seitens der Gesellschaft einreichen. Aber unmittelbar vor der ordentlichen Generalversammlung, an welcher diesen Personen die Décharge verweigert werden sollte, siegte die Vernunft und das Unternehmensinteresse an einer erfolgreichen Zukunft, und es wurde in Verbindung mit einer substanziellen Rückzahlung der erhaltenen Beträge seitens des Verwaltungsratspräsidenten und des CEO ein Vergleich abgeschlossen und Décharge erteilt.[29]
Aktivlegitimation des Konkurs- oder Nachlassverwalters bzw. von Gläubigern durch Abtretung von Verantwortlichkeitsansprüchen
Allgemeine Bemerkung
Wenn die Konzernobergesellschaft jedoch in Konkurs oder Nachlassliquidation gefallen ist, ändert sich die Ausgangslage für die Beurteilung, ob von einer Aktivlegitimation zur Einreichung einer Verantwortlichkeitsklage Gebrauch gemacht werden soll, ganz wesentlich:
Verantwortlichkeitsansprüche gegen Organe der insolventen Gesellschaft werden routinemässig als Aktivum ins Inventar der Konkurs- oder Nachlassmasse aufgenommen und müssen demzufolge verwertet werden. Bedenken wegen negativer Publizität oder nachteiliger Auswirkung auf das Management fallen weg.Die Aktivlegitimation steht zunächst dem Konkursverwalter oder Nachlassliquidator als Vertreter der Masse zu. Dessen Interesse ist es, wenn finanziell möglich, zum Vorteil aller Gläubiger eine Schadenersatzzahlung der verantwortlichen Organpersonen in einer vernünftig kurzen Zeit und ohne allzu grossen Einsatz von finanziellen Mitteln der Konkurs- oder Nachlassmasse zu erreichen.Diese Ausgangslage spricht für einen Vergleich zu einem fairen Betrag, insbesondere bei Bestehen einer D&O Versicherung.Im häufigen Fall, dass die finanziellen Mittel der Konkurs- oder Nachlassmasse keine Prozessführung erlauben, muss der Konkursverwalter bzw. Nachlassliquidator den kollozierten Gläubigern die Abtretung der Verantwortlichkeitsansprüche gemäss Art. 260 SchKG anbieten. Wenn kein Gläubiger die Abtretung verlangt, käme auch noch eine Verwertung nach Art. 256 SchKG in Frage.Verantwortlichkeitsklagen in Insolvenzsituation sind daher recht häufig, insbesondere von Abtretungsgläubigern.[30]
Das Interesse des Abtretungsgläubigers
Voraussetzung für die Aktivlegitimation eines oder mehrerer Abtretungsgläubiger ist die Aufnahme als Gläubiger im Kollokationsplan. Wenn die Forderung des Gläubigers noch nicht definitiv zugelassen ist und er seine Gläubigerstellung zuerst durch eine Kollokationsklage erstreiten muss, kann er eine bedingte Abtretung verlangen.[31] Allerdings wird nicht das materielle Forderungsrecht abgetreten, sondern nur die Kompetenz dieses geltend zu machen.
Deswegen hat der klagende Gläubiger nur ein Interesse, den im Rechtsbegehren zu beziffernden Forderungsbetrag so festzulegen, dass damit seine eigene Forderung gedeckt wäre. Einen Überschuss müsste er an die Konkursmasse abliefern (Art. 260 Abs. 2 SchKG).
Ein weiterer Vorteil für den Abtretungsgläubiger besteht darin, dass er nicht seinen eigenen Schaden, sondern einen Teilbetrag des Schadens aus dem einheitlichen Anspruch der Gläubigergemeinschaft geltend machen kann. Überdies können sich die beklagten Organpersonen nicht auf die Einrede der Erteilung der Décharge oder der Einwilligung der Aktionäre der Gesellschaft berufen, sondern nur die Einrede der Verjährung oder der Verrechnung mit einer Gegenforderung erheben.[32]
Verantwortlichkeitsklagen von Abtretungsgläubigern werden oft über viele Jahre geführt.[33] Die meisten enden aber doch mit einem Vergleich.
Passivlegitimation von Verwaltungsrat, Geschäftsleitung und Revisionsstelle
Allgemeine Bemerkungen
Die in Ziff. II.1 genannten vier Voraussetzungen des Schadens, der Pflichtverletzung, des natürlichen und adäquaten Kausalzusammenhangs und des Verschuldens müssen von der klagenden Partei gegenüber jeder beklagten Organperson nachgewiesen werden. Deshalb empfiehlt es sich, auch bei einer grossen Anzahl von Personen im Verwaltungsrat und in der Geschäftsleitung nur wenige Personen einzuklagen. Wenn diese Beklagten von einer D&O Versicherung profitieren können, wird der Deckungsbeitrag durch die Bezahlung der anwaltlichen Verteidigungskosten ohnehin geschmälert.
Ebenso empfiehlt es sich, nur Personen einzuklagen, gegen welche die gleiche Art der Pflichtverletzung nachgewiesen werden kann. In der Regel sind dies die Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung, nicht aber die Revisionsgesellschaft.[34]
Die Klägerschaft kann häufig davon profitieren in ihrer Argumentation, wenn sich die Beklagten gegenseitig beschuldigen. Deshalb ist eine gemeinsame Abwehrstrategie der Beklagten wichtig, auch wenn sie von verschiedenen Anwälten vertreten werden.





























