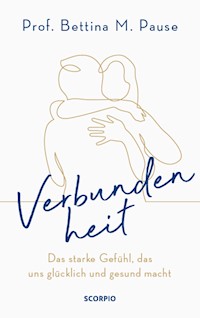
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Scorpio Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Der Mensch ist ein soziales Wesen, benötigt den Kontakt zu anderen wie die Luft zum Atmen. Doch ein Drittel der Menschen in den Industrieländern leidet unter Einsamkeit. Wie gefährlich dieses Gefühl ist, zeigen mittlerweile zahlreiche Studien: Da Einsamkeit chronischen Stress auslöst, hat kein anderer Faktor so großen negativen Einfluss auf unsere Gesundheit und Lebensqualität. Soziale Beziehungen bereichern also nicht nur das Leben, sie verlängern es auch. Wenn die Bedrohung durch das Coronavirus langsam nachlässt, müssen wir teilweise neu lernen, unbeschwert mit anderen zusammen zu sein. Dafür braucht es Vertrauen, die Bereitschaft, sich auch körperlich wieder so nahe zu kommen, dass man den anderen riechen kann. Gerade Körpergerüche vermitteln uns auch heute noch eine Vielzahl an Informationen, es sind sogenannte Ehrlichkeitssignale. Ihre Bedeutung ist uns oft nicht bewusst, aber viele unserer Reaktionen basieren darauf. Prof. Pause beleuchtet die Heilsamkeit von körperlicher und seelischer Verbundenheit in ihren psychologischen, biologischen und evolutionstheoretischen Aspekten und führt uns dabei unterhaltsam in hoch komplexe wissenschaftliche Zusammenhänge und Erkenntnisse aus der bisher noch relativ unbekannten Forschung der Sozialen Neurowissenschaften. Dort finden wir auch Lösungen für die drängenden Probleme der Zukunft, denn die Kraft, um durch schwierige Zeiten zu kommen, lässt sich nur aus einem achtsamen Miteinander schöpfen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 289
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Prof. Dr. Bettina M. Pause
Shirley Michaela Seul
Verbundenheit
Das starke Gefühl, das uns glücklich und gesund macht
1. eBook-Ausgabe 2022
© 2022 Scorpio Verlag in Europa Verlage GmbH, München
Umschlaggestaltung: Hauptmann & Kompanie Werbeagentur, Zürich, unter Verwendung eines Motivs von © Navalnyi/shutterstock.com
Layout und Satz: Margarita Maiseyeva
Konvertierung: Bookwire
ePub-ISBN: 978-3-95803-486-0
Das eBook einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt.
Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen. Der Nutzer verpflichtet sich, die Urheberrechte anzuerkennen und einzuhalten.
Alle Rechte vorbehalten.
www.scorpio-verlag.de
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlags wiedergegeben werden.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von §44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Ansprechpartner für ProduktsicherheitEuropa Verlage GmbHMonika RoleffJohannisplatz 1581667 Mü[email protected]+49 89 18 94 [email protected]
Those Were the Days
Once upon a time there was a tavern
Where we used to raise a glass or two
Remember how we laughed away the hours
And think of all the great things we would do
Refrain:
Those were the days my friend
We thought they’d never end
We’d sing and dance forever and a day
We’d live the life we choose
We’d fight and never lose
For we were young and sure to have our way
Then the busy years went rushing by us
We lost our starry notions on the way
If by chance I’d see you in the tavern
We’d smile at one another and we’d say
Refrain:
Those were the days my friend
We thought they’d never end
We’d sing and dance forever and a day
We’d live the life we choose
We’d fight and never lose
Those were the days, oh yes those were the days
Just tonight I stood before the tavern
Nothing seemed the way it used to be
In the glass I saw a strange reflection
Was that lonely woman really me?
Refrain:
Those were the days my friend
We thought they’d never end
We’d sing and dance forever and a day
We’d live the life we choose
We’d fight and never lose
Those were the days, oh yes those were the days
Through the door there came familiar laughter
I saw your face and heard you call my name
Oh, my friend we’re older but no wiser
For in our hearts the dreams are still the same
Refrain:
Those were the days my friend
We thought they’d never end
We’d sing and dance forever and a day
We’d live the life we choose
We’d fight and never lose
Those were the days, oh yes those were the days1
1»Those were the Days« wurde 1968 von der walisischen Sängerin Mary Hopkin gesungen. Die Melodie geht auf ein russisches Volkslied zurück. Das Lied gibt es in vielen Sprachen, darunter Deutsch, Französisch und Hebräisch. Die englischen Lyrics stammen von Gene Raskin.
Inhaltsverzeichnis
Zauberhaft!
Gleich und Gleich gesellt sich gern
Spiegeln schafft Vertrauen
Wie du mir, so ich dir
Wenn die Verbindung bröckelt
Stress stresst!
Stress hat viele Gesichter
Ohn(e)Macht
Stress kappen
Glück zieht Menschen an – und Gesundheit
Gemeinsames Erleben ist tausendmal so schön
Selbstbild mal drei
Wie ich mir, so ich dir
Zu viele Helfer verderben den Brei
Selbstwirksamkeit
Internaler Locus of Control
Menschen machen Menschen glücklich
Two in one
Die Boten des Glücks und der Gesundheit
Verbindung ist die Nahrung der Seele
Die Heimat der Seele
Seele und Körper im Verbund
Künstliche Verbundenheit
Die Terror-Management-Theorie
Menschen wollen Freunde sein
Durch Bindungsfähigkeit zum Menschen
Auf Linie
Kopflos oder Zahl
Wenn der Schein trügt
Ohne Verbindung kein Leben
Kostbare Augenblicke
Im Bauch der Mutter
Vertrauen
Der Schmerz der Ungebundenheit
Allein sein ist nicht einsam sein
Mutterseeleneinsam
Einsamkeit im Labor
Social Distancing
Viren lieben Einsamkeit
Kluge Wissenschaftler lieben Vielsamkeit
Vom Fremden zum Vertrauten
Der Mere-Exposure-Effekt
Ich auch!
Self-Handicapping
Blut ist dicker als Wasser?
Empathie
Die Nase lügt nicht
Die chemosensorische Kommunikation
Nase hinter schwedischen Gardinen
Demaskiert!
Das hohe Gut der Freundschaft
Das kleine große Wunder tiefer Verbundenheit
Freunde im Netz
Liebe!
Wer ist der/die Schönste im Land?
Geschlechtsrollen engen uns ein
Affäre
Beziehungs-Weisen
Freundschafts-Waisen
Heimat
Dank
Literatur
Gleich und Gleich gesellt sich gern
Stress stresst!
Glück zieht Menschen an – und Gesundheit
Verbindung ist die Nahrung der Seele
Menschen wollen Freunde sein
Ohne Verbindung kein Leben
Der Schmerz der Ungebundenheit
Vom Fremden zum Vertrauten
Die Nase lügt nicht
Das hohe Gut der Freundschaft
Liebe!
Über die Autorin
Zauberhaft!
Als ich mit Anfang vierzig meine Professur für Biologische und Sozialpsychologie in Düsseldorf antrat, ging dieser Ortswechsel für mich mit überraschend viel Körperkontakt einher. Kaum hatte ich jemanden privat kennengelernt, wurde ich beim nächsten Treffen umarmt; Küsschen rechts in die Luft, Küsschen links in die Luft. Natürlich kannte ich die Sitten und Gebräuche jenseits meiner norddeutschen Heimat, wo man sich deutlich seltener umarmt, und wenn, dann betont herzlich: kurz und kräftig. Ob Düsseldorf oder München, diese für mich als Norddeutsche distanzlose Art der Begrüßung kam mir vor wie eine beiläufig vollzogene Körperfloskel. Nun gut, wenn die Gepflogenheiten hier so waren … Ich gewöhnte mich schnell daran.
Länger dauerte es, mich an das Befremden zu gewöhnen, das ich hervorrief, wenn ich Unbekannten in die Augen schaute. Ich war es gewohnt, in der Öffentlichkeit auch mit Fremden Blickkontakt zu suchen, für mich die direkte Art von Verbindung. Doch in Düsseldorf wie in vielen anderen Großstädten galt dies gemeinhin als aggressiv. Unvergessen ist mir eine Frau im Bus, die meinen freundlichen Blick mit einer ruppigen Bemerkung quittierte und von mir wissen wollte: »Was denken Sie sich dabei, mich so anzustarren?«
Starren? Ich hatte doch nur geschaut. Und gedacht hatte ich gar nichts, was ich nun nachholte, indem ich mir ziemlich viele Gedanken machte. Ich kam zu dem bekannten Schluss, dass man in größeren Städten gut beraten ist, Augenkontakt zu meiden, sich selbst sozusagen aus dem Verkehr zu ziehen, gar nicht da zu sein: unsichtbar. Denn die Folgen des Augenkontakts könnten übel sein. Jemand könnte sich provoziert fühlen, und das könnte mit einem blauen Auge enden. Also lieber gar nicht schauen und nicht Gefahr laufen, eine unheilvolle Verbindung einzugehen.
Doch wie wir es auch drehen und wenden: Wir müssen Verbindung eingehen. Ohne Verbindung können wir Menschen als soziale Wesen nicht leben.
Ja, auch nicht als biologische. Denn wir atmen. Alle atmen dieselbe Luft. Ein und aus. Durch unseren Atem sind wir verbunden, mal mehr, mal weniger intensiv. Je kälter die Luft, desto weniger Stoffe werden flüchtig, je wärmer die Luft, desto mehr. Wer wusste vor fünf Jahren schon genau, was es mit Aerosolen auf sich hat. Heute wissen wir es alle. In einem geheizten Raum, in dem wir uns mit anderen Menschen aufhalten, schwirren aber nicht nur mehr Aerosole herum, wir erhalten auch viel mehr menschliche Informationen über andere als in einem kalten Raum. Wir tauschen nämlich nicht bloß Viren aus, sondern vielzählige Statements darüber, wer wir sind, wie es uns geht und was wir zu tun beabsichtigen. So verraten wir in der Kommunikation über Körpergerüche, der Chemokommunikation, etwas über uns und erfahren gleichzeitig etwas über andere. Und das alles, ohne es bewusst zu merken. Wir sind miteinander verbunden … und haben meistens keine Ahnung davon.
Verbundenheit ist neben Essen, Trinken und Schlafen das wichtigste Grundbedürfnis des Menschen. Fehlt sie vollständig, das haben viele Studien gezeigt, werden Menschen dauerhaft traurig, geraten in eine schwere Depression, werden ernsthaft krank, auch krebs- und herzkrank, sind anfälliger für Diabetes und ernste psychische Störungen, Angsterkrankungen und Schizophrenie und werden früher dement. Nicht ohne Grund werden soziale Isolation als schwere Strafe und vollständige Isolation als Folter eingesetzt. Bei längerem Verlust der Verbundenheit ist die Wahrscheinlichkeit, vorzeitig zu sterben, um 50 Prozent erhöht.
Verbundenheit ist also etwas enorm Wichtiges. Und dennoch kümmern wir uns in der Regel nicht wirklich darum. Es ist so ähnlich wie in einem Aquarium. Das Wasser ist einfach da. Es geht so lange gut, bis es kippt. Bis die Fische mit den Bäuchen oben treiben. Dann wird es sicht- und riechbar: Da stimmt etwas nicht.
Wann haben Sie sich das letzte Mal mit einem Menschen oder etwas verbunden gefühlt? Verbundenheit kann auch bedeuten, Fan eines Fußballklubs zu sein, oder bei gemeinsamen Unternehmungen mit Fremden. Die soziale Welt ist der Dreh- und Angelpunkt unserer Existenz. Wir sind ständig damit beschäftigt herauszufinden, wie andere »drauf sind«, interpretieren ihr Verhalten, verbinden uns in gemeinsamen Sichtweisen, orientieren uns an wahrgenommenen Stimmungen, wollen dazugehören, manchmal um jeden Preis. Denn intuitiv wissen wir: Allein sind wir verloren. Nur im Verbund mit anderen sind wir lebensfähig. Gleichzeitig üben Einzelkämpfer, die angeblich völlig unabhängig sind, eine starke Faszination auf uns aus. Frei und ungebunden, individualistisch bis zur Egozentrik – doch in Wahrheit sind es arme Würstchen. So zu leben geht auch nicht lange gut und im Kino gerade mal knapp zwei Stunden.
Tatsache ist, dass unser Leben durch die Erfahrung von Verbundenheit erst sinnvoll wird: einer anderen Person oder Personengruppe in vertrauensvoller Beziehung zuzugehören. Verbundenheit ist neben dem Selbstwert und der persönlichen Freiheit ein hohes Gut. Weil Menschen das Wichtigste für Menschen sind, brauchen wir das Gefühl, verbunden zu sein.
Wir schauen uns an und lesen uns von den Augen ab, dass wir einer Meinung sind.
Wir fühlen uns aufgehoben im Zusammensein.
Wir wissen, was richtig und falsch ist, weil andere das genauso sehen.
Hast du das eben auch gespürt?
Ja, hab ich.
Schon mit einer Betrachtungsweise allein dazustehen, kann unendlich schmerzvoll sein. Man fühlt sich unverstanden, im Stich gelassen, isoliert … so beginnt manchmal der dornenvolle Pfad in die Depression. Die Geborgenheit in der Verbundenheit ist wichtiger als die Verbindung zum Computer. Auch wenn wir mutmaßen, ohne Smartphone wären wir verloren – in Wirklichkeit sind wir es ohne Menschen.
Wie wichtig Verbundenheit für die Lebensqualität ist, haben viele Menschen tatsächlich erst durch Covid-19 bemerkt. Man hat sich vorher nie Gedanken darüber gemacht, war selbstverständlich Teil einer Gemeinschaft. Niemand wäre auf die Idee gekommen, in zum gesellschaftlichen Klebstoff gehörenden Gesten Gefahren zu wittern, nun gut, außer ein paar Virologen. Man hat sich umarmt und Hände geschüttelt, man hat sich Küsschen auf die Wangen gehaucht und sich herzlich gedrückt.
Plötzlich war das nicht mehr möglich. Was vorher ein warmes schönes Gefühl machte, wurde nun zu einer potenziellen Todesdrohung. Der Mensch gegenüber war nicht mehr nur mein Freund, Verwandter, Bekannter, Nachbar, sondern jemand, der mich an die Beatmungsmaschine bringen kann. Also jemand, mit dem ich mich auf keinen Fall verbinden darf. Wenigstens nicht körperlich. Man kann ja trotzdem nah sein. Auch wenn man sich nicht sieht, nicht spürt, nicht riecht.
Tatsächlich?
Die Forschung sagt Nein. Und ganz tief drin wissen die meisten von uns, dass sie recht hat, auch wenn wir anfangs dachten, das kriegen wir schon hin. Ein paar Monate, dann ist alles wieder gut. Aus den Monaten der gekappten Verbindung sind Jahre geworden, und die Veränderungen sind noch nicht absehbar, zumal einige aktuelle Studien gravierende und langwierige Folgen ankündigen. Denn bei all unseren Maßnahmen haben wir die Rechnung ohne den Wirt gemacht: die Seele. Menschen bestehen nicht nur aus einem Körper, wir sind beseelte Wesen. Seelen ohne Verbindung leiden, manchmal bis zum Suizid. Warum das so ist, werde ich auf den folgenden Seiten darlegen.
Seit mehr als 20 Jahren beschäftige ich mich mit der chemischen Kommunikation beim Menschen. Also mit jenen unbewussten Ausdrucksmöglichkeiten, die Nähe voraussetzen und die einen erheblichen Einfluss auf unsere physische und psychische Verfassung, auf unsere Gesundheit haben. Im Laufe meiner wissenschaftlichen Arbeit hat sich deutlich herauskristallisiert, dass die soziale Bindung eine Art Lebenselixier für uns Menschen ist. Sie hält uns am Leben, schützt uns vor Krankheit und macht uns froh. Wenn sie fehlt, wenn wir sozial isoliert sind und in die Einsamkeit abdriften, haben wir ein ebenso erhöhtes Risiko, schwer zu erkranken und früh zu sterben, als würden wir uns maßlos dem Nikotin und Alkohol zuwenden.
Anhand von Millionen von Datensätzen ist schon lange bekannt, wie wichtig Verbundenheit und wie desaströs Einsamkeit ist. Aus diesem Grund hat England vor einigen Jahren auch einen Einsamkeitsminister berufen.
Verbundenheit mit nahen Menschen, das kennen wir alle, macht uns ein warmes Gefühl, das Herz wird weit, alles scheint zu fließen. Ganz egal, von wem die Initiative ausgeht, findet sie Resonanz, dann strömt es. Ein lieber Mensch streichelt mir über die Hand, schaut mich an mit Zuneigung im Blick. Oder ich schaue, und mein Schauen wird erwidert; jemand hat mit einer Kleinigkeit an mich gedacht, oder ich habe an jemanden gedacht, auch mein Denken an ihn verbindet mich.
Verbindung kann entstehen mit fremden Menschen, die es danach nicht mehr sind. Man tauscht auf der Straße ein Lächeln mit einer unbekannten Person, erhält oder schenkt ein Kompliment, das Herz auf der Zunge, und hört »you made my day«. Manchmal kann eine flüchtige Begegnung im Vorübergehen zu einer Verbindung werden, die über Jahre, Jahrzehnte hält, an die man sich immer erinnert … Als das Kind mit dem Roller gegen den Laternenpfahl gefahren ist und ich diese fremde Frau angeschaut habe und wir beide wie auf Kommando losgelaufen sind. Wir waren eins in unserer Reaktion und Sorge um das kleine Mädchen. Und später noch verbunden in der Erleichterung, dass nichts Schlimmes passiert ist …
Kein Wort wurde gewechselt. Man weiß nicht, wie die andere heißt, woher sie kommt, wohin sie geht. Aber es gibt einen Moment, in dem die Zeit stillsteht. Es ist der Moment der Verbindung. Er kann auch im gemeinsamen Lachen erlebt werden, man teilt den gleichen Humor, sitzt mit vielen fremden Menschen in einem Konzert und erfreut sich an der Musik, egal welcher Tonart.
Wann immer wir etwas gemeinsam mit anderen Menschen tun, tanzen, singen, spielen, uns gemeinsam bewegen, verstärkt sich das Gefühl der Verbundenheit, und das dient später oft als Anknüpfungspunkt für eine weitere gemeinsame Zukunft.
Ohne Verbindung keine Gemeinschaft. Verbundenheit ebnet dem Vertrauen den Weg, was zu noch mehr Verbundenheit führt.
Verbundenheit wächst in die Tiefe, doch sie ankert nie. Sie macht glücklich und gesund … wie alles, was uns lieb und teuer ist. Sie lässt sich jedoch nicht festmachen, einfangen. Ihrem Wesen nach ist sie flüchtig, das macht ihren Wert aus. Sie ist ein unsichtbarer Zauber, der sich jederzeit verflüchtigen kann wie ein Duft. Und nun folgen wir ihrer Fährte …
Gleich und Gleich gesellt sich gern
Auf einem Geruchskongress in Stockholm war ich mit einigen Kollegen zum Abendessen verabredet und wartete in der Lobby des Hotels. Ich hatte den ganzen Tag konzentriert zugehört, referiert, diskutiert und genoss es, eine Weile meine Blicke schweifen zu lassen. Sie blieben an einer kleinen Bar in einer Ecke der Lobby hängen, wo sich auf stylischen Hockern am Tresen ein Mann und eine Frau augenscheinlich eben kennenlernten. Die nächsten Minuten verbrachte ich wie im Kino. Leider war die Tonspur ausgefallen, ich konnte nur sehen, nicht hören, aber letztlich spielte das keine Rolle, so eindeutig war das Drehbuch.
Spiegeln schafft Vertrauen
Die beiden saßen sich offen zugewandt gegenüber wie ein Paar, was sie vermutlich auch werden würden, wenn auch ungewiss war, für wie lange. Alle ihre Gesten signalisierten es, und vor allem die Art und Weise, wie sie sich spiegelten. Sie beugte sich vor, er beugte sich vor. Er hob sein Glas, sie hob ihres. Sie stützte den Kopf auf, er tat es ihr gleich. Er lehnte sich zurück, sie lehnte sich zurück. Die beiden zeigten die täglich milliardenfach gezeigte Choreografie, die Menschen vollführen, die sich sympathisch sind, sich mögen, lieben. So bekannt ist dieser Tanz, dass er in Kommunikationstrainings geübt wird. Man spricht dann vom »Spiegeln« und rät den Teilnehmern: Tun Sie, was Ihr Gegenüber tut, das schafft Vertrauen. Das Spiegeln des anderen findet sogar auf einer gänzlich unbewussten Ebene statt. Im psychologischen Labor können wir dabei mittels Elektroden leichte Schwankungen der Herzrate und der Hautleitfähigkeit aufzeichnen. Wir erhalten dadurch einen Hinweis auf die Aktivierung des sogenannten vegetativen Nervensystems. Dabei wurde vor Kurzem die folgende Beobachtung gemacht: Wenn bei zwei einander unbekannten Menschen – von beiden unbemerkt – die körperliche Aktivierung zeitgleich ganz leicht abfällt oder ansteigt, ist dies die beste Voraussetzung dafür, dass sie sich beide in dieser unbewussten körperlichen Verbundenheit gegenseitig für sehr attraktiv halten. Diese Verbundenheit kann innerhalb weniger Minuten entstehen.1
Der Geruch lügt nicht
Haben Sie sich schon einmal über einen Kinderwagen gebeugt, und wenn der kleine Mensch darin Laute des Wohlbefindens ausstieß, diese imitiert? Haben Sie schon einmal mit einem Kind gespielt, und plötzlich ist ein Ball unter das Sofa gerollt? Das Kind schaut Sie mit kullerrunden Riesenaugen an, und Sie machen Ihre Augen auch weit und groß und rufen erstaunt »Ui! Wo ist er jetzt hin?« Falls Sie eine Hundefreundin sind: Haben Sie sich schon einmal vom Gähnen Ihres Hundes anstecken lassen und mitgegähnt, und dann diese gemeinsame Entspannung genossen, in der noch viel mehr steckt: eine tiefe Verbundenheit. Es klappt sogar andersrum: Hunde lassen sich auch von menschlichem Gähnen anstecken, und diese Gefühlsübertragung ist umso stärker, je besser sich Mensch und Hund kennen.2 Und wie ist es, wenn ein geliebter Mensch heiter ist oder traurig? Innerhalb von Sekundenbruchteilen kann sich das Gefühl auf uns übertragen. Ja, die Kommunikationscoachs haben recht. Was sie lehren, basiert auf wissenschaftlichen Erkenntnissen meines Fachbereichs, der Psychologie.
Dennoch ist es ein großer Unterschied, ob wir bloß so tun als ob – oder ob wir spüren, was wir tun, ob wir authentisch sind.
Ein untrügliches Messinstrument für die Wahrheit ist unsere Nase. Der Geruch, den jeder Mensch unentwegt ausdünstet, lügt nie, und mittels unseres Bauchgefühls können wir wahre Empathie von der Ware Empathie unterscheiden.
Leider musste ich die Beobachtung des Paares im Foyer aufgeben, denn zwei meiner Kollegen traten aus dem Fahrstuhl … und kamen im Gleichschritt auf mich zu.
Der Eisbrecher-Effekt
In der Psychologie bezeichnen wir das landläufige »Spiegeln« als Verhaltenssynchronizität. Ohne diese Verbindung wäre vieles nicht möglich, wie zum Beispiel gemeinsames Tanzen. Und sie macht glücklich, denn es werden Endorphine, also körpereigene Opiate, ausgeschüttet.3 Wir fühlen uns pudelwohl, vielleicht sogar richtig glücklich, warm, geschützt, vertraut. Das kennen wir auch vom gemeinsamen Singen oder Lachen. Wenn einander Unbekannte miteinander singen, entsteht unmittelbar ein Gefühl von Verbundenheit und Freude. Wir sprechen vom »Eisbrecher-Effekt«, da das Gefühl von Gemeinsamkeit und Verbundenheit direkt entsteht ohne vorherige Gespräche und langwieriges Kennenlernen. Manche Wissenschaftler gehen davon aus, dass das Singen in der menschlichen Evolution entstanden ist, um in größeren Gruppen von Menschen Bindung herzustellen. Damit wird die Voraussetzung für soziale Unterstützung und Altruismus geschaffen.4
Verhaltenssynchronizität zeigt sich auch beim Umarmen, Streicheln, Schmusen, Küssen und Austauschen anderer Zärtlichkeiten. Doch wenn es dazu kommt, kennen wir uns vermutlich schon ziemlich gut, besser als die beiden im Foyer, die noch einen langen Weg vor sich haben könnten. Den sehen wir uns nun genauer an.
Wie du mir, so ich dir
Es gibt vielerlei Arten von Beziehungen. Häufig beginnen sie in Gestalt einer sogenannten Austauschbeziehung. In diesem Stadium haben wir noch keine verlässlichen Gefühle zu einem Menschen, den wir noch als eher unbekannt einstufen. Wir rechnen häufig auf: Ich habe ihm eine Tasse Kaffee bezahlt, jetzt muss er mir eine bezahlen. Ich habe ihn mit dem Auto ein Stück mitgenommen, jetzt habe ich was bei ihm gut. In Austauschbeziehungen muss es in erster Linie gerecht zugehen.
Die sogenannte Ungleichheitsaversion besteht nicht nur beim Menschen, wir finden sie auch bei anderen Säugetieren, wie zum Beispiel Hunden, Kapuzineräffchen oder Schimpansen.5 Allen Arten gemeinsam ist ein Gefühl dafür, dass niemand bevorteilt oder benachteiligt werden sollte. Darauf wird umso mehr geachtet, je unbekannter sich die einzelnen Individuen sind. In einem mittlerweile sehr bekannten Versuch von Sarah Brosnan und Frans de Waal6 konnten Kapuzineräffchen einen kleinen Gegenstand in Futter eintauschen, entweder in Gurkenscheiben, die sie recht gerne essen, oder in Weintrauben, die sie über alles lieben. Wenn die Äffchen allein waren, fanden sie es okay, wenn sie auch mal eine Gurke bekamen, es kann ja nicht immer Weintrauben geben. Befanden sie sich allerdings in Sichtweite eines zweiten Äffchens und konnten sie sehen, dass das andere Äffchen eine Weintraube im Austausch für den Gegenstand erhielt, während sie selbst bloß eine Gurke bekommen hatten, waren sie so erbost über diese Ungerechtigkeit, dass sie dem Versuchsleiter die Gurkenscheibe an den Kopf warfen. Lieber nichts essen, als ungerecht behandelt zu werden! Später zeigte sich bei Schimpansen, dass die Ungleichheitsaversion am stärksten bei unbekannten Individuen auftrat und bei langjährigen Freunden kaum noch zu beobachten war.
Beziehung auf dem Prüfstand
Solche »Berechnungen« werden also mit dem Gefühl der Verbundenheit weniger und hören schließlich ganz auf. Die Beziehung tritt in eine neue Phase, man könnte sagen, die erste Prüfung ist bestanden. Vertrauen ist gewachsen, wir fühlen eine deutliche Verbindung und tun dem anderen gern einen Gefallen, schenken ihm gern etwas und freuen uns, wenn er sich freut. Wir befinden uns nun in einer sogenannten Gemeinschaftsbeziehung. Hier macht es uns nichts aus, wenn wir etwas geben, ohne etwas dafür zu bekommen. Natürlich darf das nicht einseitig werden, doch meistens achten Menschen intuitiv darauf, dass die Balance stimmt. Denn beide sind ja interessiert an dieser Verbindung. Beide freuen sich daran.
Auch Affen helfen einander, ohne dass sie etwas dafür bekommen würden.5 Wir sprechen hier von einem altruistischen Hilfeverhalten. In einem Versuch können Kapuzineraffen eine von zwei unterschiedlichen Spielmarken wählen, die danach gegen ein Stück Apfel eingetauscht werden kann. In Sichtweite des Äffchens sitzt ein weiteres Äffchen, das keine Spielmarken erhält. Wählt das Äffchen nun eine bestimmte, die »pro-soziale« Spielmarke, bekommt auch das andere Äffchen einen Apfel, während es bei der anderen leer ausgeht. In vielen solcher Versuche konnten die Forscher beobachten, dass das erste Äffchen umso häufiger die pro-soziale Marke wählte, je höher die Bindungsstärke zwischen den beiden Tieren war, also je besser sie sich kannten und je enger sie miteinander befreundet waren. Die Belohnung für das erste Äffchen war immer die gleiche, es erhielt bei beiden Spielmarken die gleiche Menge Apfel. Doch mit zunehmender Verbundeinheit wuchsen die Empathie, die Besorgnis um den anderen, das Mitgefühl und der Wunsch, dass es dem anderen gut geht.
Die Bindung verstärkt sich durch das Vertrauen, das zum vorherrschenden Bindemittel wird. Wir mögen den oder die andere – haben sie zum Fressen gern, total lieb, würden unser letztes Hemd für sie geben. Ein warmes Strömen, wenn wir an sie denken, wenn wir sie sehen. Es erfüllt uns mit Freude und Glück, wenn wir ihnen etwas Gutes tun können. Doch so ganz uneigennützig ist das nicht, denn wir profitieren selbst enorm von unseren kleinen Aufmerksamkeiten, auch bei Fremden oder nur oberflächlich Bekannten. Unsere Großzügigkeit, unsere Freundlichkeiten sind wie ein Bumerang: Indem wir einem anderen Menschen nahekommen, erweitern wir unser Selbst. Etwas Neues tritt herein. Ein neues Lieblingsgericht, eine neue Musikrichtung, eine inspirierende Lebenseinstellung, eine interessante Meinung, wir machen einen Ausflug in ein anders Land und verlassen den gewohnten Rahmen.
Andere Menschen bieten uns immer die Chance, unseren Horizont zu erweitern. Je näher wir einem anderen kommen, umso intensiver werden diese bereichernden Erfahrungen, da wir einen guten Freund mit in unser Selbst integrieren. Verbindung führt also zu Selbsterweiterung und einer Vergrößerung der Selbstkomplexität.
Es liegt auf der Hand, warum dies große Vorteile bietet: Je mehr Aspekte ich für mich wichtig finde, die mich persönlich ausmachen, je komplexer sich meine Persönlichkeit entwickelt, desto stabiler und glücklicher bin ich. Angenommen, meine Fähigkeiten würden sich darauf beschränken, dass ich leidlich gut Klavier spiele. Wenn dies das Einzige wäre, was ich an mir wertschätze, und ich mich dann beim Vorspielen in der Tonart vergreife, wird mich das zutiefst erschüttern. Alles futsch! Sind aber noch mehrere andere Aspekte meiner Persönlichkeit wichtig und ich bin zum Beispiel stolz darauf, gut kochen oder zeichnen zu können oder über ein fundiertes politisches Wissen zu verfügen, kann mich ein Fehlgriff nicht allzu sehr erschüttern. Es ist wie in vielen Bereichen des Lebens: Je breiter wir aufgestellt sind, je komplexer die Aspekte unseres Selbst sind, desto besser. Und wie erreichen wir diese Breite? Durch Kontakt mit Menschen, die uns wertvoll sind, mit denen wir uns verbunden fühlen und unser Selbst erweitern.
Verbundenheit kennt keine Grenzen
Während ich diese Zeilen schreibe, ist das alles beherrschende Thema in den Medien nicht mehr Corona, sondern der Krieg in der Ukraine. Ich höre manche Stimmen, die vom Feind sprechen, andere sprechen vom Brudervolk. Ich bin überzeugt davon, wenn das Gefühl der Verbundenheit international vorherrschen würde, sähe die Welt anders aus. Es beginnt ganz klein, in jeder Begegnung von Menschen und kann sich, wie wir es bei großen Sportereignissen erleben, rasant ausbreiten.
Verbundenheit ist eine Brücke, die uns Toleranz lehrt. Wir mögen jemanden, der anders ist als wir. Weil wir ihn mögen, akzeptieren wir sein Anderssein.
Wir springen schon mal über unseren Schatten nach dem generalisierenden Motto: Eigentlich mögen wir ja keine Porschefahrer, Rollerfahrer, Anwälte. Aber der ist wirklich nett … Und wenn es gut läuft, erweitern wir den Kreis und finden nun mehrere der Genannten sympathisch und wer weiß, eines Tages vielleicht sogar alle.
Kurioserweise fällt das Akzeptieren in Liebesbeziehungen manchmal schwerer als in Bekanntschaften. Da man den anderen als Erweiterung des eigenen Selbst betrachtet, kann einen die von der eigenen abweichende Meinung des Partners durchaus erschüttern, weil man sich in seinem Selbst angegriffen fühlt.
Es gibt noch eine Situation, in der das Akzeptieren schwerfällt, ja mehr noch, nicht mehr möglich ist: wenn wir uns lebensbedrohlich angegriffen fühlen. So ist es vielen Menschen in der Covid-19-Pandemie ergangen, und mittlerweile haben wir uns fast schon an die viel zitierte Spaltung der Gesellschaft gewöhnt, die genau genommen bereits lange davor beklagt wurde. Doch erst im Angesicht der allgemeinen Restriktionen wurde für viele Menschen spürbar: Vertrauen, Schutz, Sicherheit, Stabilität, Gesundheit und Glück können nur auf der Basis intakter Verbindungen gedeihen.
Wenn die Verbindung bröckelt
Eine gute Verbindung hält so einiges aus. Die eine ist Jägerin, die andere würde nicht mal eine Fliege erschlagen, und doch sind sie seit vielen Jahren beste Freundinnen. Ebenso die zwei Nachbarn der Doppelhaushälfte, obwohl sie politisch in verschiedene Richtungen blicken. Oder die Freundinnen, die gelernt haben, das Kinderthema auszuklammern, um ihre wundervolle und inspirierende Freundschaft zu schützen. Dieses kluge Vorgehen funktioniert allerdings nur, solange wir nicht in Stress geraten. Während der Corona-Pandemie, die für zahlreiche Freundschaften zu einer Bewährungsprobe wurde, haben das viele Menschen gemerkt. Vor der Krise war es kein Problem, dass Peter an Naturheilverfahren »glaubte«, Petra dagegen an die Schulmedizin. Die Conclusio lautete: Wer heilt, hat recht. Heute gibt es keine Conclusio mehr bei den beiden, ihre langjährige Freundschaft ist zerbrochen. Nie im Leben hätten sie das für möglich gehalten. Doch wenn wir im Krisenmodus sind, ja vielleicht sogar den Eindruck haben, es gehe für alle Altersgruppen um Leben oder Tod – und so wurde Covid-19 sehr lange Zeit in den Medien kommuniziert –, greifen psychische Mechanismen, die uns unbewusst in die Spaltung treiben.
Warum wir die eigene Endlichkeit so gern ausblenden
Menschen sind vielleicht die einzigen Lebewesen, die sich fortdauernd darüber bewusst sind, dass das Leben endlich ist. Eigentlich ist unsere Sterblichkeit ein wunderbares Glück, denn bei einem ewig währenden Leben würden wir vermutlich mit der Zeit unsere Fähigkeit zu fühlen verlieren.
Wir verspürten kein Glück und keine Angst mehr, und die Dinge und Menschen um uns herum würden mit der Zeit immer bedeutungsloser werden.
Wenn Sie sich mit dem Gedanken eines unendlichen Lebens beschäftigen möchten, empfehle ich den Roman Alle Menschen sind sterblich von Simone de Beauvoir. Sie hat die Tragik eines unendlichen Lebens wunderbar beschrieben. Wir wissen jedoch aus vielen Bereichen der Psychologie, dass Menschen im Allgemeinen nichts mehr fürchten als den Gedanken an den eigenen Tod. Ihn zu verdrängen hilft uns tatsächlich über viele Schwierigkeiten im Leben hinweg. Wenn wir uns verlieben, haben wir das Gefühl, für immer zueinander zu gehören. Wir durchleiden Entbehrungen mit dem Ziel vor Augen, dass es uns und den Menschen, mit denen wir uns verbunden fühlen, einmal besser gehen soll.
Der ständige Gedanke an den eigenen Tod könnte dazu führen, dass wir keine Kraft mehr verspüren, die Dinge um uns herum zum Besseren zu verändern. Wir könnten mutlos werden, uns weniger anstrengen, aufgeben. Bringt doch sowieso alles nichts. Und die große Liebe für immer wäre dann doch nur eine Affäre auf Zeit. So kann der Gedanke an den eigenen Tod für viele Menschen mit einem Gefühl der Sinnlosigkeit des Seins verbunden sein. Wozu sollte das eigene Leben gut sein, wenn nach einer Weile vielleicht niemand mehr von unserer Existenz weiß?
Es gibt unzählige psychologische Schutzmechanismen, die uns dabei helfen, den eigenen Tod zu verdrängen.7 Zu den wichtigsten zählt das Gefühl, eine übergreifend wahre Weltanschauung zu besitzen, die der Welt ringsum Struktur und Ordnung verleiht. Außerdem hilft es, eine mögliche Sinnlosigkeit des Lebens zu verdrängen, wenn der Einzelne sich selbst als besonders und wertvoll betrachtet.
Wir wissen aus vielen Experimenten, dass sich Menschen bei der gedanklichen Konfrontation mit dem eigenen Tod noch stärker aufwerten und ihre persönliche Weltanschauung mit mehr Nachdruck verteidigen. Leider geht dies auch mit einer vermehrten Abwertung Andersdenkender einher.
Diese Abwertung, diese manchmal regelrechte Vernichtung anderer Meinungen, ist ein Schutzmechanismus. Man möchte seine Schäfchen irgendwie ins Trockene bringen, und das funktioniert nicht mehr mit Teilhabe – indem man sich also die Weide teilt, denn es wäre ja genug Platz für alle da, sondern indem man die anderen von der Weide vertreibt. Schließlich geht es gefühlt um Leben und Tod, ein Eindruck, der während der Pandemie von den Medien eher geschürt als abgeschwächt wurde.
Das erklärt, weshalb viele schöne, echte und langjährige Freundschaften an der Pandemie zerbrochen sind; weshalb gute Nachbarn zu erbitterten Feinden wurden – jeder kennt solche traurigen Geschichten oder hat sie selbst erlebt. Bedenkt man, wie extrem die Positionen kommuniziert wurden, ist das nicht verwunderlich.
Stress bedeutet Notstromaggregat
Für meine Wissenschaft, die Psychologie im weitesten Sinne, sind die Auswirkungen der Corona-Pandemie eine Forschungsweide, die uns noch sehr lange beschäftigen wird. Leider wurden bei den Beratungen zu den Maßnahmen, wenn überhaupt, zu wenig unterschiedliche Fachleute gehört. Viele längst gewonnene Erkenntnisse blieben unberücksichtigt.
Vielleicht gelingt es, im Nachhinein manche Fragen zu beantworten, damit unterbrochene Verbindungen wieder aufgenommen werden können. Denn wenn man erkennt, dass man sozusagen von seiner Biologie gesteuert wurde, ist die Umkehr einfacher. Wir sollten niemals vergessen, und das ist in unzähligen Versuchen nachgewiesen, dass die Identifikation mit den eigenen Normen und Moralvorstellungen unter Todesbedrohung stärker wird.
Gleichzeitig erleichtert es das Überleben in schwierigen Zeiten und überhaupt das Leben, wenn man sich als Teil eines sinnvollen Ganzen betrachtet, als zugehörig zu einer Gruppe – worauf in Notzeiten zu deren Stärkung die Abwertung anderer Gruppen erfolgt. Die Verbindung ist unterbrochen, und das ist tragisch, denn sie ist ja genau das, was wir jetzt dringend brauchten, zumindest seelisch.
Doch wenn wir mit dem Notstromaggregat laufen, denken und handeln wir nicht mehr logisch. Menschen, die dauerhaft Stress ausgesetzt sind, haben nicht mehr alle ihre Ressourcen zur Verfügung. Deshalb sehen wir uns im nächsten Kapitel zuerst einmal die spaltenden Folgen von Stress an, ehe wir erneute Verbindungen knüpfen.
Stress stresst!
Sind wir offen für andere Menschen, neugierig? Interessiert daran, uns mit ihnen zu verbinden? Oder sind sie uns im Zweifelsfall fremd, ja empfinden wir sie vielleicht sogar als feindlich? Wie begegnen wir ihnen? Stellen Sie sich vor, Sie laufen durch eine Stadt und haben es gerade sehr eilig, da Sie zu einem wichtigen Termin unterwegs sind, und Sie sind leider bereits fünf Minuten zu spät. Da sehen Sie vor sich einen jungen blinden Mann, der offensichtlich die Orientierung verloren hat und mit seinem weißen Blindenstock hilflos wirkend vor einer Baustelle steht. Vielleicht verspüren Sie kurz den Impuls, ihm zu helfen. Aber Sie sind wie gesagt spät dran. Und es sind ja genug andere Leute da. Sie eilen weiter. Wie würden Sie sich verhalten, wenn Sie alle Zeit der Welt hätten und sich kein bisschen gestresst fühlten? Und was könnte daraus entstehen? In einem unterhaltsamen Roman vielleicht eine berührende Begegnung; oder es käme sogar eine Immobilie heraus, weil die außerordentlich reiche Mutter des Jungen Ihnen eine kleine Freude machen will, und man will ja nicht unhöflich sein und so eine Villa am See zurückweisen.
Realistisch betrachtet ist es so, dass Stress uns Scheuklappen aufsetzt. Zu seinen Eigenschaften gehört es, dass er uns voneinander trennt.
Stress hat viele Gesichter
Obwohl zahlreiche Menschen über Freizeitstress klagen, wird Stress landläufig noch immer mit viel Arbeit gleichgesetzt. Doch soziale Isolation bedeutet hochgradigen Stress, und das hat nun überhaupt nichts mit ständig klingelnden Telefonen, Terminen, mit schreienden Kindern oder pflegebedürftigen Senioren zu tun – also mit dem, was man sich landläufig unter Stress vorstellt. Stress hat viele Gesichter!
Wann immer der Mensch gegen seine Grundbedürfnisse lebt, nimmt er Schaden. Gewiss hält man ein paar Tage ohne Sozialkontakt durch. Doch wenn aus Tagen Wochen werden und im Anschluss nie mehr die gleiche Verbundenheit hergestellt werden kann wie zuvor, müssen wir mit schwerwiegenden Folgen rechnen, die aus diesem Stress resultieren.
Das passiert bei Stress im Körper
Stress macht uns sofort hellwach. Das merken wir zum Beispiel, wenn wir knapp einem Unfall entronnen sind oder uns im Dunkeln erschrecken oder plötzlich mit einer unvorhersehbaren körperlichen oder mentalen Belastung konfrontiert sind: Wir fühlen, wie uns das Herz im Hals schlägt.
Für diese und weitere Reaktionen werden zwei unterschiedliche Körpersysteme angeregt: Zum einen der Sympathikus, das sind Nervenstränge im vegetativen Nervensystem, in dem Adrenalin und Noradrenalin ausgeschüttet werden. Herzschlag und Blutdruck erhöhen sich, die Bronchien erweitern sich, und die Atemfrequenz steigt, damit wir mehr Luft bekommen, die Pupillen werden größer, damit wir besser sehen können, und noch einiges mehr. All das sind wichtige Schutzmaßnahmen des Körpers. Aus diesem Grund ist Stress zuerst auch eine gesunde Reaktion, damit wir optimal mit einer Bedrohung umgehen können. Das zweite Körpersystem, das eine wichtige Rolle bei Stress spielt, ist das Cortisol-System. Cortisol wird aus der Nebennierenrinde geliefert und bewirkt, dass mehr Zucker im Gehirn freigesetzt wird. Dadurch können wir schneller und flexibler denken und gelangen rascher zu mentalen Lösungen. Auch wenn wir schon länger nichts gegessen haben, wird das Gehirn, unsere Schaltzentrale, mit Zucker versorgt. Außerdem aktiviert Cortisol auch die Immunkompetenz, kurz: Unser Immunsystem wird angekurbelt. Nun ist der Körper optimal vorbereitet auf eine als bedrohlich eingestufte Situation.
Diese Zusammenhänge sind Ihnen vermutlich bekannt. In der Wissenschaft wurden sie bereits in den 20er- und 30er-Jahren des letzten Jahrhunderts durch den Physiologen Walter Cannon und den Mediziner und Hormonforscher Hans Selye beschrieben. In der frühen Stress-Forschung wurden fast ausschließlich physikalische Stressoren verwendet, wie Hitze, Kälte oder Schmerz. Später stellte sich heraus, dass Stress beim Menschen weit überwiegend durch mentale Stressoren ausgelöst wird.





























