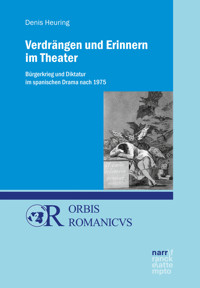
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Narr Francke Attempto Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Orbis Romanicus
- Sprache: Deutsch
Kennzeichnend für den Postfranquismus war eine erinnerungskulturelle Paradoxie, die sich durch das politisch-institutionelle Verdrängen des für die Menschen Unvergesslichen auszeichnete. Der Übergang zwischen Diktatur und Demokratie charakterisierte sich durch eine offizielle Rhetorik des Neuanfangs, des Konsenses und der Versöhnung, die Erinnerungen an Bürgerkrieg und franquistische Repression als Gefahr für die politische Konsolidierung Spaniens betrachtete und traumatischen Erfahrungen kaum diskursiven Raum gewährte. Die Studie untersucht, inwiefern diese Diskrepanz zwischen gemachter Erfahrung und unerfüllter memorialer Erwartung strukturgebend auf das Werk der Theatermacher José Sanchis Sinisterra, José Luis Alonso de Santos und Ignacio Amestoy Egiguren wirkte. Diese gehörten zu einer Gruppe von Dramatiker:innen, die den Franquismus erlebten und sich nach dem Tod Francos in der Rolle der Neuerer der spanischen Bühne wiederfanden. In ihren Dramen und Inszenierungen reagierten sie auf den pacto de silencio. Dabei changierten sie zwischen der mimetischen Darstellung von Vergangenem und performativen Akten des gemeinsamen Erinnerns, um erinnerungskulturelle Leerstellen abzubilden und das Theater zugleich zu einem wirkmächtigen Medium des kulturellen Gedächtnisses werden zu lassen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 803
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Denis Heuring
Verdrängen und Erinnern im Theater
Bürgerkrieg und Diktatur im spanischen Drama nach 1975
Umschlagabbildung: Francisco de Goya: El sueño de la razón produce monstruos (Der Schlaf [Traum] der Vernunft gebiert Ungeheuer), 1797-1799, Capricho Nr. 43, Radierung, Madrid
DOI: https://doi.org/10.24053/9783823395072
© 2023 • Narr Francke Attempto Verlag GmbH + Co. KGDischingerweg 5 • D-72070 Tübingen
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetztes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Alle Informationen in diesem Buch wurden mit großer Sorgfalt erstellt. Fehler können dennoch nicht völlig ausgeschlossen werden. Weder Verlag noch Autor:innen oder Herausgeber:innen übernehmen deshalb eine Gewährleistung für die Korrektheit des Inhaltes und haften nicht für fehlerhafte Angaben und deren Folgen. Diese Publikation enthält gegebenenfalls Links zu externen Inhalten Dritter, auf die weder Verlag noch Autor:innen oder Herausgeber:innen Einfluss haben. Für die Inhalte der verlinkten Seiten sind stets die jeweiligen Anbieter oder Betreibenden der Seiten verantwortlich.
Internet: www.narr.deeMail: [email protected]
ISSN 2365-3094
ISBN 978-3-8233-8507-3 (Print)
ISBN 978-3-8233-0307-7 (ePub)
Inhalt
IDAS NICHT-ERINNERN DES UNVERGESSLICHEN: SPANIENS UMGANG MIT DEN ERINNERUNGEN AN DIKTATUR UND BÜRGERKRIEG NACH 1975
1La transición – Spaniens Weg in die Demokratie
„Franco ha muerto“ – in großen Lettern prangte diese Schlagzeile am 20. November 1975 auf den Titelblättern der spanischen Tageszeitungen. Der schlichte, konstative Charakter dieser Aussage mutet angesichts der sich aus diesem historischen Ereignis ergebenden politischen Handlungsaufträge aus heutiger Sicht geradezu ironisch an. Franco war tot – was folgte nun? Zwar hatte der selbst ernannte “caudillo“ bereits vor seinem Ableben über die Inthronisierung des bourbonischen Prinzen Juan Carlos und die damit verbundene Re-Etablierung der Monarchie verfügt1, doch lieferte die Klärung der personellen Nachfolge noch keine endgültige Antwort auf die Frage nach der zukünftigen politischen Ausrichtung des Landes. In den letzten Jahren des Franquismus hatten sich bereits unterschiedliche politische Lager formiert, deren Ziele sich zwischen den Extrempunkten der Weiterführung des franquistischen Systems bis hin zu dessen radikaler Demontage bewegten.2 Diesen extremen Positionen stand der Wunsch nach gemäßigter Modernisierung und europäischem Anschluss auf der Grundlage der bestehenden Strukturen gegenüber.3 Zu diesem Zeitpunkt war insbesondere für die Bevölkerung nicht abzusehen, ob der Tod Francos auch das Ende des Franquismus bedeutete; zudem hatte die Ermordung des Almirante Luis Carrero Blanco durch die baskische Terrororganisation ETA am 20. Dezember 1973 deutlich vor Augen geführt, welche Gefahr von den über Jahrzehnte hinweg unterdrückten Kräften auszugehen drohte.4 In ihrer verbalen Nüchternheit spiegelte die zitierte Schlagzeile somit gewissermaßen die Stimmung einer Gesellschaft wider, die sich zwischen den Parametern der historischen Chance, der “nationalen Tragödie“ und der systemischen Ungewissheit verorten musste.
Während der nach der Ermordung Carrero Blancos ins Amt berufene Ministerpräsident Carlos Arias Navarro keinen Zweifel an seiner Systemtreue sowie an der über den Tod hinausreichenden Loyalität zu Francisco Franco ließ, gab dessen rechtmäßiger Nachfolger, Juan Carlos de Borbón, im Rahmen seiner Antrittsrede am 22. November 1975 seine Ambitionen im Hinblick auf die „Öffnung und Demokratisierung des Systems“5 zu erkennen, ohne sich dieser Vokabeln explizit zu bedienen. Vor den Augen der Politiker des franquistischen Establishments sowie der Opposition und nationaler wie internationaler Medien kündigte er ein neues Kapitel in der spanischen Geschichte an. Zu diesem Zeitpunkt war noch nicht klar, dass die Wortwahl des Königs einen Vorgeschmack auf die Rhetorik der Versöhnung und des Neubeginns lieferte, die den offiziellen Transitionsdiskurs in den folgenden Jahren bestimmen sollte.6 Die Hervorhebungen in den im Folgenden zitierten Auszügen aus der Antrittsrede belegen deutlich eine Isotopie des Konsenses:
Hoy comienza una nueva etapa de la Historia de España. Esta etapa, que hemos de recorrerjuntos, se inicia en la paz, el trabajo y la prosperidad, fruto del esfuerzo común y de la decidida voluntad colectiva. […]
La Institución que personifico integra a todos los españoles, y hoy, en esta hora tan transcendental, os convoco porque a todos nos incumbe por igual el deber de servir a España. Que todos entiendan con generosidad y altura de miras que nuestro futuro se basará en un efectivo consenso de concordia nacional. […]
Un orden justo, igual para todos, permite reconocer dentro de la unidad del Reino y del Estado las peculiaridades regionales como expresión de la diversidad de pueblos que constituyen la sagrada realidad de España. El Rey quiere serlo de todos a un tiempo y de cada uno en su cultura, en su historia y en su tradición. […]
Si todos permanecemos unidos, habremos ganado el futuro.7
Die Herausforderung, vor der Juan Carlos I stand, ergab sich aus der Diskrepanz zwischen politisch-systemischem Stabilisierungsstreben und gesellschaftlicher Realität sowie den daraus resultierenden Konfliktpotentialen. Zwar hatten die ideologischen Säulen des Systems bereits ab den 50er Jahren zu bröckeln begonnen, doch repräsentierten der Franquismus und seine Vertreter bis dato noch immer die herrschende Ordnungsmacht. Der politische Sonderweg, den Spanien nach Beendigung des Bürgerkriegs eingeschlagen hatte und der das Land lange von den europäischen Nachbarn abschottete, wurde trotz einer ökonomischen Öffnung8 bis zuletzt nicht vom Regime in Frage gestellt. Stattdessen wurden die franquistischen Propagandisten nicht müde, die unter dem Lemma des „Anti-Spanien“ subsumierten Feindbilder des Liberalismus, des Kommunismus, des Sozialismus und der Freimaurerei am Leben zu halten, um sie im nächsten Moment zu stigmatisieren.9
Zum Zeitpunkt von Francos Tod war, so der Historiker Walther L. Bernecker, die Ideologie des Franquismus überlebt und der Wunsch nach einem Systemwechsel in weiten Teilen der Zivilgesellschaft verbreitet: „Schon in der Spätphase des Franquismus – dies haben repräsentative Umfragen ergeben – war eine Mehrheit der Spanier für einen Wandel hin zur Demokratie […].“10 Die Ironie dieses zivilgesellschaftlichen Mentalitätswandels liegt darin begründet, dass die Vertreter des Systems einen nicht geringen Beitrag zur ideologischen Unterminierung des Franquismus geleistet hatten. Die Entwicklung zu einem modernen Industriestaat nach europäischem Vorbild, die Öffnung des Landes für den Tourismus und die stetige Schwächung der zensorischen Maßnahmen in Presse und Bildung ließen die Weiterführung des spanischen Sonderwegs nach Francos Tod als unmöglich erscheinen:
Das Ergebnis der franquistischen Politik widersprach in nahezu jedem Punkt den ursprünglichen Intentionen: Am Ende der Franco-Herrschaft war die spanische Gesellschaft politisierter, urbanisierter und säkularisierter denn je, die Arbeiter und Studenten waren so aufsässig wie noch nie, die Autonomie- und Selbstständigkeitsbewegungen der Regionen ausgeprägter als zu jedem anderen Zeitpunkt der neueren spanischen Geschichte, Sozialisten und Kommunisten bei den ersten Wahlen nach Francos Tod so erfolgreich wie nie zuvor, die spanische Wirtschaft finanziell und technologisch vom internationalen Kapitalismus in geradezu beängstigendem Ausmaß abhängig.11
Die politische Elite Spaniens war davon überzeugt, dass die Modernisierung des Landes sowie sozialökonomische und damit politische Stabilität nur durch die Integration in die Europäische Gemeinschaft (EG) funktionieren konnte. Nach einem gescheiterten, vom Opus Dei angestoßenen Mitgliedschaftsgesuch aus dem Jahr 1962 – Voraussetzung war eine demokratische Grundordnung – witterte man nun die Chance, diesem Gesuch erneut Ausdruck zu verleihen und Spanien auf diese Weise im Schoße Europas zu stabilisieren.12 Die Angst, diese historische Gelegenheit durch innenpolitische Konflikte zwischen franquistischem Establishment und den politischen Oppositionsgruppen zu gefährden, sollte in den Jahren nach 1975 zur Triebfeder des realpolitischen Handelns und bestimmend für den offiziellen Umgang mit den dunklen Kapiteln der Vergangenheit werden.13
In seiner Proklamationsrede am 22. November 1975 forderte König Juan Carlos I die Spanierinnen und Spanier dazu auf, ja er appellierte gewissermaßen an ihren Großmut, die eigene Person hinter die Sache der staatlichen Stabilisierung zu stellen: „Que todos entiendan con generosidad y altura de miras que nuestro futuro se basará en un efectivo consenso de concordia nacional.” Das sich hieraus ergebende komplexe Spannungsverhältnis zwischen der unabweisbaren Präsenz vergangener sowie gegenwärtiger Konflikte innerhalb der Zivilgesellschaft und der systemisch verordneten, auf eine stabile Zukunft gerichteten Maxime der Eintracht bildete zu diesem Zeitpunkt die fragile Basis für die politische Transition: „Nicht ideologische Maximalforderungen, sondern Konsensfindung (consenso) wurde zur Richtschnur der Politik und begründete die zentralen Weichenstellungen des demokratischen Übergangs“14, konstatieren Bernecker und Brinkmann. Weder ein Bruch noch eine Weiterführung des Franquismus waren die angestrebten Ziele. Vielmehr wurde ein langsamer Wandel eingeleitet, der die franquistische Legalität für ihre eigene Ersetzung instrumentalisieren sollte. Der consenso wurde zum politischen Leitmotiv erhoben, an dem sich die konkurrierenden Parteien in den folgenden Jahren zu orientieren hatten.15
Der Umstand, dass Francisco Franco eines natürlichen Todes starb, hatte zur Folge, dass jede Form der politischen Veränderung aus dem alten System heraus erwachsen musste.16 Mit Franco starb das Staatsoberhaupt, nicht der Franquismus. Die Tatsache, dass ein Systemwechsel nicht etwa durch politischen oder zivilgesellschaftlichen Druck, also durch Wahlen, Demonstrationen oder einen politischen Umsturz, sondern erst durch das Ableben des führenden Repräsentanten des Systems ermöglicht worden war, brachte eine personelle Kontinuität innerhalb des politischen Apparates sowie in weiten Teilen der öffentlichen Verwaltung und des Gerichtswesens mit sich.17
Franquisten und Oppositionelle waren angehalten, ideologische Grabenkämpfe zu vermeiden, um die systemische Stabilisierung nicht zu gefährden. Bis auf den rechtskonservativen búnker, den reaktionären Teil des herrschenden franquistischen Establishments, versuchten deshalb alle Gruppierungen, einen paktierten Weg in die Demokratie einzuschlagen. Der spanische Historiker Gregorio Morán betont in seiner Monographie El precio de la transición die sich durch den natürlichen Tod des Diktators ergebende Schwierigkeit, verfeindete Lager für eine einträchtige Transition innerhalb der alten Strukturen zu gewinnen: „Lo cierto es que el franquismo no se desmoronó, ni fue derribado, y que los planteamientos políticos del conjunto de las fuerzas democráticas hubieron de ser rápidamente adaptados […].“18 Der Weg in die Demokratie konnte angesichts der Konsenspolitik kaum über die intensive Beschäftigung mit den vergangenen Verbrechen sowie der raschen Thematisierung der Schuldfrage führen.19
Eine Schlüsselrolle kam in dieser transitorischen Phase dem Politiker Adolfo Suárez González zu, der kurz vor Francos Tod zum Generalsekretär des franquistischen Movimiento Nacional aufgerückt war. Adolfo Suárez löste auf Erlass des spanischen Königs den wenig reformerischen, in seiner franquistischen Solidarität stagnierenden Arias Navarro im Juli 1976 ab und bemühte sich im Anschluss, die Vertreter der unterschiedlichen politischer Lager mit diplomatischem Geschick für die allmähliche Reformierung des Systems zu gewinnen.20 Mit dem von ihm auf den Weg gebrachten und von den cortes im November 1976 ratifizierten ‚Gesetz für die politische Reform’ (Ley para la reforma política) wurde ein Jahr nach Francos Tod der Grundstein für den gemäßigten Demokratisierungsprozess gelegt. Diese Reform, die von der spanischen Bevölkerung im Rahmen eines Referendums angenommen wurde, sah die Ersetzung der cortes durch ein frei gewähltes Zweikammernparlament (Kongress und Senat) mit verfassungsgebenden Vollmachten vor. Schrittweise war es nun möglich, erste Gesetzesinitiativen zu verabschieden, ohne gegen die von Franco installierten Leyes fundamentales zu verstoßen.
Die Soziologin Laura Desfor Edles unterstreicht in ihrer Analyse der spanischen Transition die immense Bedeutung des Gesetzes im Hinblick auf den gemäßigten, radikale Brüche vermeidenden Abbau der franquistischen Strukturen: „The Law of Political Reform […] recognized the principles of popular sovereignty, universal suffrage, and political pluralism, and prepared for the legal abolition of the chief Francoist institutions.“21 Diese entscheidende Weichenstellung war, so der allgemeine Tenor, das Ergebnis der von der Zivilgesellschaft im Rahmen eines Referendums befürworteten Konsenspolitik. Die Vermeidung innenpolitischer Konflikte und die damit zusammenhängende Zurückstellung parteipolitischer Ambitionen zum Zwecke der Demokratisierung hatte sich offensichtlich als erfolgreiche Strategie für den Übergang bewährt. Aus heutiger Perspektive scheint dies den Beginn eines Paktes zwischen Politik und Zivilgesellschaft zu markieren, der im Hinblick auf die sozialen, kulturellen und ethischen Konsequenzen noch genauer zu untersuchen sein wird:
Spanish consensus was based on a general moderation in respect to the traditional political demands of the radicals and the commitment to a minimum of welfare state policies by the conservatives. In other words, both regime and opposition elites came to define democracy as their most important goal, and both regime and opposition elites – and the masses – came to define violence as an inappropriate means to achieve it.22
Die Vollendung des politischen Übergangs von der Diktatur zu einem demokratischen System sollte mit der Verabschiedung einer Verfassung geleistet werden, die Ergebnis des Willens aller im Parlament vertretenen Parteien sein sollte. Die gemeinsame Ausarbeitung der Verfassungstexte bot der politischen Elite die Möglichkeit, die Konstruktion der Konsensideologie innerhalb der spanischen Gesellschaft weiter zu festigen. Der Verzicht der Regierung, als alleinige verfassungsgebende Instanz aufzutreten und stattdessen die politische Opposition an diesem Prozess zu beteiligen, zielte laut Francisco Rubio Llorente darauf ab, „die Legalität und die Macht, die bei der Regierung und der Regierungspartei lagen, mit der demokratischen Legitimität in Übereinstimmung zu bringen, die trotz der Wahlergebnisse von der früheren antifranquistischen Opposition beansprucht wurde.“23 Der von einer Verfassungskommission vorgeschlagene Text wurde vom Parlament am 31. Oktober 1978 verabschiedet, am 6. Dezember desselben Jahres per Referendum vom Volk angenommen und trat schließlich am 29. Dezember in Kraft. Selbstverständlich wurde dieser historische Akt als Resultat der erfolgreichen Einigungspolitik gefeiert: „In den abschließenden Reden wurde vor allem der Gedanke der Eintracht und der paktierten Verfassung betont, die auf dem Weg des Konsenses erreicht worden sei.“24
Einen Tag nach dem Referendum sprach die spanische Tageszeitung El País vom erfolgreichen Abschluss des politischen Übergangs: „Los votos […] pusieron fin a la transición posfranquista.“25 Vor der Abstimmung hatten die politischen Verantwortlichen des Übergangsprozesses versucht, die Wähler zur Annahme der Verfassung zu bewegen, indem sie sich rhetorischer Schwarz-Weiß-Malerei bedienten. Gebetsmühlenartig wiederholten sie, dass die Entscheidung für die Verfassung das Ende der franquistischen Strukturen bedeuten und ihre Stimme somit gleichermaßen einen Beitrag zur endgültigen Demontage der Diktatur leisten würde. Die Dichotomie Diktatur-Demokratie hatte den offiziellen politischen Diskurs geprägt, der die Bedeutung des Referendums in seiner “heilsbringenden“ Funktion geradezu religiös stilisierte. Das folgende, am 26. November 1978 von der Zeitung El Socialista publizierte Zitat des Parteichefs der PSOE, Felipe Gonzalez, führt diesen rhetorischen Fatalismus deutlich vor Augen:
The choice today is Constitution or dictatorship; any other exposition is false, since the Constitution is the only path to democracy.
The enemies of democracy have made the Constitution the symbol of their ferocious attacks.
We in favor of democracy have the duty to make the Constitution the symbol of our fight for liberty.26
In der Tat schien der spanische Übergang geradezu vorbildlich vollzogen worden zu sein. Die im Jahr 1978 von Politik und Presse an den Tag gelegte Euphorie sowie die Überzeugung, mit der sie vom endgültigen Abschluss des Transitionsprozesses berichteten, ließ kaum Platz für Zweifel. Ein Blick in die Forschungswelt macht jedoch deutlich, dass weder in Bezug auf den Beginn noch hinsichtlich des Abschlusses der transición Einigkeit herrscht. Vielmehr scheinen der Tod Francos sowie das Inkrafttreten der neuen Verfassung heuristischen Wert zu haben, wenngleich die Wahl dieser Eckpunkte durchaus verständlich ist.27 Entsprechend formuliert der Journalist und Literaturwissenschaftler Ramon Buckley: „[…] la transición española tiene límites vaporosos, y sobre el principio y el final del proceso hay disparidad de opiniones.“28Aufgrund der einschneidenden gesellschaftlichen Transformationsprozesse datiert Buckley selbst den Beginn der Transition auf das Jahr 1968.
Nach Meinung der Historikerin Paloma Román Marugán wie auch des Politikers und Historikers Javier Tusell setzte der Übergangsprozess mit Francos Tod ein und endete mit dem symbolkräftigen Sieg der von Felipe Gonzalez angeführten Sozialistischen Partei (PSOE) im Jahr 1982. Der Sieg der antifranquistischen Opposition kann insbesondere vor dem Hintergrund des ein Jahr zuvor abgewehrten Putschversuchs des franquistischen Generals Tejero als entschiedene Absage der Bevölkerung an die reaktionären politischen Kräfte des Landes verstanden werden. Der Versuch, den Demokratisierungsprozess durch einen Staatsstreich zu ersticken, hatte nicht nur vor Augen geführt, welche Gefahr noch immer von den extremen, die Einigungspolitik ablehnenden Kräften ausging, sondern hatte zudem zur Folge, dass die Rhetorik der Versöhnung und des Konsenses den offiziellen Diskurs stärker denn je prägen sollte. Deutlicher als zuvor versuchte die politische Elite, ein Bild des Zusammenhalts zu vermitteln.29
Der Abschluss der Transition wird des Weiteren an die Aufnahme Spaniens in die Europäische Gemeinschaft (EG) im Jahr 1986 und der damit verbundenen Erfüllung des immer wieder betonten Wunsches nach Europäisierung gebunden, die im Falle Spaniens mit einer Überwindung des nationalen Rückständigkeitskomplexes, des sogenannten Tercermundismo, gleichgesetzt wurde. Die Kulturwissenschaftlerin Teresa Vilarós betrachtet diesen Europäisierungsprozess jedoch erst mit dem Inkrafttreten des Vertrags von Maastricht am 1. November 1993 als endgültig abgeschlossen, denn ab diesem Zeitpunkt war Spanien dazu angehalten, nationale Ambitionen vor der Folie der europäischen Idee zu denken.30
Die unterschiedlichen Forschungspositionen belegen die Komplexität des postdiktatorischen Übergangsprozesses, der nur durch einen differenzierteren Blick Rechnung getragen werden kann. In der Folge soll deshalb von einer politisch-historiographischen und eine kulturwissenschaftlich-soziologische Sichtweise ausgegangen und zwischen einer politischen und einer sozialen Transition unterschieden werden. Diese Differenzierung ist wegweisend für die vorliegende Studie, weil sie sich mit dem noch näher zu beleuchtenden, paradoxalen Spannungsverhältnis zwischen der Notwendigkeit des systemischen Vergessens und der Unabweisbarkeit individueller und sozialer Erinnerung in Beziehung setzen lässt.
Zweifelsohne findet der Übergang zur Demokratie mit der Verabschiedung einer demokratischen Verfassung einen formalen Abschluss31, jedoch impliziert die rein technische Etablierung eines Rechtsstaates keineswegs, dass die in der Verfassung verankerten Werte- und Normvorstellungen unmittelbar in den zivilgesellschaftlichen Strukturen und Denkweisen aufgehen. Vielmehr bildet die politisch-systemische Rahmung die Grundlage dafür, dass sich eine in den zu überwindenden Strukturen gewachsene Zivilbevölkerung überhaupt zu einer modernen, rechtsstaatlichen Gesellschaft entwickeln kann, denn erst die Achtung der bürgerlichen Grundrechte, die Gleichheit vor dem Gesetz und die Wahrung der Würde des Menschen ermöglichen die zivilgesellschaftliche Erlernung dessen, was aufgeklärte demokratische Rechtsstaatlichkeit bedeutet. Gary Smith unterstreicht die modellgebende Funktion der Jurisdiktion in diesem Zusammenhang: „Jede postautoritäre Justiz muß in ihrem Bemühen um einen Übergang in eine sittliche Gesellschaft versuchen, der noch jungen Demokratie Werte einzuprägen.“32 Es fällt deshalb mit Blick auf postdiktatorische Systeme schwer, die Inkraftsetzung einer demokratischen Verfassung – auch wenn dies die systemische Grundvoraussetzung darstellt – mit dem erfolgreichen Abschluss des Übergangsprozesses gleichzusetzen.
2Erinnern um des Vergessens willen – Spaniens Umgang mit der Vergangenheit
Spaniens Weg in die Demokratie brachte es mit sich, dass die politische Verantwortung nach 1975 in den Händen derer lag, die wie Juan Carlos I oder Adolfo Suárez entweder selbst Emporkömmlinge des franquistischen Systems waren oder zur clandestinen Opposition gehört hatten. Aus verfeindeten Lagern wurde also eine imaginierte Einheit geformt, die ihre ideologischen Differenzen zum Zwecke der systemischen Stabilisierung mithilfe einer Rhetorik des Konsenses und des Neubeginns diskursiv zu überspielen suchten. Gregorio Morán, dessen Monographie El precio de la transición eine kritische Analyse des Übergangsprozesses darstellt, verweist auf den erschwerenden Umstand, dass dem Systemwechsel kein radikaler Bruch vorausging, der eine eindeutige Positionierung zum Geschehenen ermöglicht hätte:
La estabilidad del sistema democrático estaba vinculada […] a una serie de falsedades consensuadas. O lo que es lo mismo, una clase política de doble procedencia – de la dictadura y de la oposición ilegal – interpretaba que solo ellos podían darle estabilidad al nuevo régimen, porque dado que la sociedad no había sido la que formalmente forzara el cambio, no había más remedio que construirle un mundo político paradisíaco. Todo para la sociedad, pero sin ella.1
Die Konsequenz der personellen Kontinuitäten sowie der diskursiven Konstruktion von innenpolitischer und gesellschaftlicher Einheit implizierte ein Nicht-Erinnern dessen, was diese innenpolitische Einheit oder den europäischen Anschluss hätte gefährden können. Der spanische Historiker Javier Rodrigo stellt im Hinblick auf die diskursive Verdrängung des spanischen Bürgerkriegs sowie der Franco-Diktatur fest, dass die Jahre der transición durch eine defizitäre Vergangenheitspolitik charakterisiert sind: „No hubo, de tal modo, una política de la memoria en sentido positivo tal y como hoy la entendemos, de ‘rehabilitación simbólica de las víctimas, reconocimiento público de su sufrimiento, construcción de monumentos y celebración de ceremonias‘.”2
Die politische Anerkennung der begangenen Verbrechen und des Leids der Opfer in Form symbolischer Akte wäre jedoch laut dem Historiker Albrecht Graf von Kalnein angesichts der bis 1975 bestehenden asymmetrischen Kräfteverhältnisse unerlässlich gewesen.3 Er verweist auf die von Spanien verpasste Chance, der gesellschaftlichen Spaltung mit der öffentlichen Aufarbeitung begangenen Unrechts zu begegnen. Diese Idee des transitorischen Erinnerns zum Zwecke der Überwindung bestehender Konfliktivität ist nach von Kalnein unverzichtbar, um eine soziale Veränderung herbeizuführen.
Die Literaturwissenschaftlerin Aleida Assmann unterstreicht in ihrem 2009 erschienenen Aufsatz mit dem Titel „Von kollektiver Gewalt zu gemeinsamer Zukunft“ die Wichtigkeit der öffentlichen Klärung und Anerkennung der Schuldfrage für die soziale Transition in postautoritären Systemen:
In Post-Diktatur-Gesellschaften gelten die Anerkennung und Erinnerung an das Leid der Opfer als wichtiger Teil einer sozialen Umwandlung, die auf den politischen Systemwandel folgen muss. Mit anderen Worten: Der politische Transitionsprozess muss durch einen gesellschaftlichen Transformationsprozess ergänzt und vertieft werden. Innerhalb des neuen kulturellen Rahmens können Erinnerungspraktiken und -rituale einen Prozess der Auseinandersetzung mit den Verbrechen der Vergangenheit einleiten und damit zu deren Anerkennung sowie zur Versöhnung im Sinne einer Überwindung der trennenden traumatischen Geschichte führen. […] Das Ziel besteht vorrangig darin, die Gewaltgeschichte hinter sich zu bringen und hinter sich zu lassen, um eine gemeinsame Zukunft zu gewinnen.4
Laut Aleida Assmann repräsentiert der offene Umgang mit schlimmen Geschehnissen eine Form der Vergangenheitspolitik, die insbesondere in „traumatisch gespaltenen Gesellschaften“5 zur Überwindung der Konflikte sowie zur notwendigen Stärkung zivilgesellschaftlicher Einheit führen und erinnerungskulturelle Ambivalenz und Spannung verhindern kann. Hervorzuheben ist, dass Assmann die Bedeutung der öffentlichen Erinnerung für die soziale Transition betont, die sich in bestimmten Praktiken und Ritualen vollziehen und zur wichtigen Korrespondenz und Projektionsfläche individueller Leiderfahrungen werden kann.
Auch der französische Philosoph Paul Ricœur, eine der Leitfiguren dieser Studie, spricht sich mit Blick auf Gesellschaften im Übergang dafür aus, bestehenden Dissens im öffentlichen Raum zuzulassen, da dieser ansonsten unter der Oberfläche der artifiziellen Einheit zu schwelen droht. Erinnerung werde durch ihre Verdrängung zur latenten Bedrohung für die Gegenwart. Ricœur betrachtet deshalb die Auseinandersetzung mit den dunklen Kapiteln der Vergangenheit als conditio sine qua non der gesellschaftlichen Transformation während des Übergangs von einer autoritären zu einer demokratischen Ordnung:
Aber besteht nicht der Fehler dieser imaginären Einheit genau darin aus dem offiziellen Gedächtnis die Beispiele von Verbrechen, die die Zukunft vor den Irrtümern der Vergangenheit schützen könne, zu streichen, die öffentliche Meinung der Wohltaten des Dissenses zu berauben und so die konkurrierenden Gedächtnisse zu einem ungesunden Leben im Untergrund zu verdammen?6
Dass die öffentliche Anerkennung des erfahrenen Leids nicht nur konstitutiv für zivile Versöhnung, sondern ebenso für die Etablierung eines Rechtsstaates ist, betont der amerikanische Philosoph Thomas Nagel, der in seinen ethischen Abhandlungen der Allgemeingültigkeit moralischer Prinzipien auf den Grund geht. Nagel nimmt an, dass das, was geschah, nur dann vor den Augen aller geschah, wenn es offiziell anerkannt und damit Teil des öffentlichen Bewusstseins wird.7 Eingang in das öffentliche Bewusstsein und damit in das kulturelle Gedächtnis erhalten Erfahrungen einzig und allein über Sprache und die darauf folgende mediale Fixierung dieser Erfahrungen. Das bedeutet, Anerkennung wird erst dann möglich, wenn Begriff und Gegenstand (bzw. Geschehenes) voneinander getrennt werden.8
Statt begangene Verbrechen nachträglich juristisch zu verhandeln, optierten die Politiker der spanischen Transition für die Verabschiedung eines Amnestiegesetzes, das den demokratischen Übergang konsolidieren sollte. Zwei Jahre nach Francos Tod verabschiedeten die cortes die Ley de Amnistía, durch das die Schuldfrage aus dem politischen Diskurs ausgenommen werden konnte. Das systemische Vergessen wurde auf diese Weise legitimiert, das politische Nicht-Erinnern des biographisch Erfahrenen hatte den Segen der Jurisdiktion erlangt, wodurch die Auseinandersetzung mit Schuld und Verbrechen nun nicht mehr nur als unvernünftig, sondern, unter Rekurs auf Justitia, nun ebenso als subversiv galt. „Había que garantizar que nadie pudiera utilizar el pasado para desentrañar el presente.“9 Das Gesetz amnestierte die Gewalttaten der unterschiedlichen politischen Lager sowie der Sicherheitskräfte des Franco-Regimes, was zur Freilassung zahlreicher Strafgefangener führte, in der Hoffnung, diese würden sich entweder ihrer politischen Überzeugungen entledigt haben oder sie würden zumindest darauf verzichten, diese öffentlich zu propagieren. Dass ein solcher Rechtsakt durchaus Einfluss auf den gesellschaftlichen Umgang mit Vergangenheit hat, stellt Ricœur kritisch heraus: „Die Amnestie grenzt so nahe an die Amnesie und setzt das Verhältnis zur Vergangenheit außerhalb des Feldes an, in welchem die Problematik des Vergebens zusammen mit dem Dissens ihren richtigen Platz fände.“10
Dass eine Mehrheit der Spanier einen politischen und gesellschaftlichen Neuanfang ohne gegenseitige Schuldaufrechnung befürwortete, wohl aus Angst vor dem erneuten Aufflammen der Konflikte, arbeitet Manuel Pérez Ledesma in seinem Aufsatz „Memoria de la guerra, olvido del franquismo“ aus dem Jahr 2002 heraus.11 Ein weiterer Grund für die bei einem Großteil der Bevölkerung festzustellende Akzeptanz des Ausbleibens erinnerungskultureller Bestrebungen könnte laut Walther L. Bernecker mit der starken Instrumentalisierung von Erinnerung während des Franquismus12 zusammenhängen, die zu einer zunehmenden politischen Indifferenz vor allem bei jüngeren Generationen geführt haben könnte.13 Der Erfolg postmoderner Kulturbewegungen wie der movida im Spanien der 80er Jahre kann hier durchaus als Beleg für den Wunsch der jungen Generationen nach einer weitgehend politikfreien Szene verstanden werden, deren avantgardistische Attitüde sich nicht zuletzt über einen ideologischen Relativismus definierte.14
Es verwundert angesichts dieser defizitären Vergangenheitspolitik, die augenscheinlich von einem signifikanten Teil der Bevölkerung hingenommen wurde, nicht, dass im historiographischen Diskurs über die spanische Transition nicht selten von einem pacto de silencio die Rede ist, einem informellen “Schweigepakt“ zwischen politischer Elite, einzelnen Medienhäusern sowie der Bevölkerung15:
La política de la memoria no ha reconstruido el pasado desde la verdad y el respeto de las diversas memorias colectivas que coexisten, sino desde la utilidad inmediata del olvido evasivo, que supone el silencio en la vida pública acerca de la guerra civil y, sobre todo, de la dictadura franquista.16
[… ] Alberto Reig Tapia denunció el silencio y el olvido del pasado inmediato que, en su opinión, era consecuencia de un «consensus político» implícitamente acordado para favorecer el cambio no traumático en el país […].17
Y, en lo referido a las políticas hacia el pasado, la ausencia de algún tipo de cultura oficial del homenaje hacia esas y esos vencidos, o su presunto eclipse en los medios de comunicación social, es juzgada como un reflejo consciente de un «pacto de olvido» y «pacto de silencio» de las elites políticas. Romperlo es lo que buscaría la “recuperación de la memoria”.18
Que la táctica del consenso, de la reforma y del olvido funcionó en el caso español a la vista está. España pasó nítidamente de la dictadura a la democracia de un modo ciertamente ejemplar […]. Pero sí, hay que insistir, sin embargo, en la voluntad de olvido, quizás necesidad, que tuvieron los años de la transición […].19
In den Jahren der Übergangsphase zur Demokratie, der sogenannten transición – so eine etablierte These – habe zumindest implizit ein ‚Pakt des Schweigens‘ geherrscht, in dessen Folge eine öffentliche Aufarbeitung der Vergangenheit auf unbestimmte Zeit vertagt worden sei. […] Letztlich wurden der Bürgerkrieg und die Franco-Diktatur in den öffentlichen Debatten jahrelang verdrängt, und der politische ‚Konsens‘ während der transición beruhte auch auf dem Verlust der historischen Erinnerung. Die ‚Tabuisierung‘ der Vergangenheit im öffentlichen Raum war der unausgesprochene ‚Preis‘ für den größtenteils friedlichen Übergangsphase von der Diktatur zur Demokratie, er wurde somit auf Kosten der Opfer der Diktatur erreicht.20
Diese Betrachtungsweise muss etwas differenziert werden. Denn bei dem Pakt handelte es sich nicht um das simple Beschweigen des Geschehenen, sondern vielmehr um eine bestimmte Form des Umgangs mit dem Geschehenen. Der Historiker Santos Juliá21 weist darauf hin, dass die Vergessensrhetorik der Transition keineswegs mit einem praktizierten Ausblenden der Vergangenheit gleichgesetzt werden kann.22 Tatsächlich redete und erinnerte die politische Öffentlichkeit unermüdlich, wenn auch mit dem Ziel, den Bürgerkrieg und seine Folgen von der politischen Debatte fernzuhalten. „Was heute wie ein Verzicht auf Erinnerung erscheinen mag, war der letztlich Versuch, die explosive Wirkungsmacht der Vergangenheit rhetorisch zu neutralisieren. Es handelte sich um ein Erinnern um des Vergessens willen.“23 Die vermeintliche Annäherung war somit eher Strategie der Distanzierung.24
Die von Bernecker und Brinkmann beschriebene „Sternstunde der Fachhistorie“, d. h. die von der politischen Elite initiierte Übertragung der Verantwortung für die Aufarbeitung und die Aufklärung der Vergangenheit in die Disziplin der Geschichtswissenschaften, erscheint vor diesem Hintergrund als Teil des politischen Kalküls interpretierbar zu sein. Unter Rekurs auf machttheoretische Überlegungen von Michel Foucault kann die Etablierung einer Disziplin nicht nur als Ordnungsgewinn, sondern ebenso als Kontrollprinzip der Produktion des Diskurses angesehen werden.25 Denn die Verwissenschaftlichung der Erinnerung durch die Historiographie ermöglicht nicht nur einen vermeintlich emotionsfreien Blick auf das Vergangene, sondern es reduziert aufgrund ihres memorialen Hoheitsrechts zudem die Wahrscheinlichkeit einer Thematisierung persönlicher Erlebnisse und individueller Schicksale in der öffentlichen Debatte. Die Instrumentalisierung der für jede Aufarbeitung essentiellen Beiträge der Historiker kann damit eine Degradierung individueller Erinnerung zur Folge haben, da diese im Gegensatz zur wissenschaftlichen Bewertung historischer Fakten doch keinen Anspruch auf Allgemeingültigkeit erheben kann. Auf diese Weise wird es im politischen Diskurs möglich, den empirischen Zugang zur Vergangenheit vor die affektbeladene Frage nach Schuld und Verantwortlichkeiten zu schieben.26
Im Rahmen ihrer Medienanalyse zeigt die spanische Soziologin Laura Desfor Edles auf, dass es an öffentlicher Thematisierung der konfliktiven Vergangenheit nicht mangelte. Allerdings dokumentiert sie eine im offiziellen Diskurs stattfindende Sakralisierung bestimmter Begriffe wie ‚consenso’, ‚reconciliación’, ‚dialogo’, ‚compromiso’ oder ‚tolerancia’ sowie eine Profanisierung von Begriffen wie ‚Guerra Civil’, ‚dictadura’, ‚confrontación’, ‚intolerancia’, ‚extremismo’, ‚dogmatismo’: „[…] the sacred new beginning meant the putting behind of the old francoist era, and setting out on a new course for the future.“27
Vor diesem Hintergrund scheint es, als hätte die unter Franco vollzogene Instrumentalisierung der Vergangenheit mit dem Beginn des Demokratisierungsprozesses kein Ende genommen. Im Unterschied zur franquistischen Erinnerungspolitik waren die Politiker der transición jedoch nicht auf den Erhalt von Feindbildern aus, sondern auf die Schaffung einer imaginären nationalen Einheit und Versöhnung. Diese Strategie war wider Erwarten nicht nur während der ausgehenden 1970er Jahre prägend. Auch der Wahlsieg der PSOE im Jahr 1982 ging keineswegs einher mit der zu erwartenden Auseinandersetzung mit dem Unrecht, unter dem nicht zuletzt diejenigen gelitten hatten, die dem linken politischen Spektrum angehört hatten oder immer noch angehörten:
Über den Bürgerkrieg, noch mehr sogar über die ersten Jahre der Franco-Ära, legte sich zumindest im politischen Diskurs für längere Zeit eine Decke des gesellschaftlichen Schweigens; wahrscheinlich erachteten es die Demokratisierungsgenerationen nicht für ratsam, auf eine derart konfliktbeladene Epoche zurückzublicken. Auf dem Altar der Ausgleichsmentalität wurden auch jene Gedenkveranstaltungen geopfert, die viele von der Regierung 1986 bzw. 1989 oder auch 1996 erwartet hätten. Stattdessen lautete die offizielle, nach beiden Seiten einigermaßen abgesicherte Parole: „Nie wieder!“28
Einen Beleg für das in Spanien festzustellende Spannungsverhältnis zwischen der unauslöschlichen Präsenz des Erfahrenen auf biographischer Ebene und dem krampfhaften Versuch der politischen Zukunftsgerichtetheit liefert die offizielle Stellungnahme der sozialistischen Regierung zum 50. Jahrestag des Bürgerkriegsbeginns. Der Textauszug dient als Exempel für die beschriebene Strategie, Themen wie den Bürgerkrieg lediglich als rhetorischen Impulsgeber für einen Diskurs des Konsenses zu instrumentalisieren, ohne dabei die Bestrebung intensiver Vergangenheitsaufarbeitung erkennen zu lassen. Am 18. Juli 1986 äußerte sich der spanische Präsident Felipe Gonzalez (PSOE) – nicht zuletzt aufgrund der wenige Monate später anstehenden Präsidentschaftswahlen – zur guerra civil. Dass nicht der Bürgerkrieg, sondern der Umgang mit dem Bürgerkrieg bzw. das Leid der Kriegsopfer in das Feld öffentlicher Wahrnehmung zu rücken hätte, wird vom spanischen Präsidenten Felipe Gonzalez (PSOE) rhetorisch überspielt.29
[…] Una declaración gubernamental no es el lugar para analizar las causas de un acontecimiento de la magnitud de la Guerra Civil, ni para valorar las consecuencias que de ella se derivaron. El Gobierno quiere, sin embargo, llevar al ánimo de todos una doble convicción. Primero, que por su carácter fratricida, una guerra civil no es un acontecimiento a conmemorar, por más que para quienes la vivieron y sufrieron constituyera un episodio determinante en su propia trayectoria biográfica. Segundo, que la Guerra Civil española es definitivamente historia, parte de la memoria de los españoles y de su experiencia colectiva. Pero no tiene ya – ni debe tenerla – presencia viva en la realidad de un país cuya conciencia moral última se basa en los principios de la libertad y la tolerancia […].
El Gobierna expresa su convicción de que España ha demostrado reiteradamente su voluntad de olvidar las heridas abiertas en el cuerpo nacional por la guerra civil, su voluntad de vivir en un orden político basado en la tolerancia y la convivencia, en el que la memoria de la guerra sea, en todo caso, un estímulo a la Paz y el entendimiento entre todos los españoles. Para que nunca más, por ninguna razón, por ninguna causa vuelva el espectro de la guerra civil y el odio a recorrer nuestro país, a ensombrecer nuestra conciencia y a destruir nuestra libertad. Por todo ello el Gobierno expresa también su deseo de que el 50 aniversario de la guerra civil selle definitivamente la reconciliación de los españoles y su integración irreversible y permanente en el proyecto esperanzado que se inició a raíz del establecimiento de la democracia en la Monarquía encabezada por el Rey Don Juan Carlos, proyecto que fue recogido en la Constitución de 1978 y fue refrendado por el pueblo español para el que consagra definitivamente la Paz.30
Erst Mitte der 1990er Jahre war seitens der Politik ein zunehmend offenerer Umgang mit den dunklen Kapiteln der Vergangenheit auszumachen. Die Kritik an der Ausklammerung der Opfererinnerungen aus dem öffentlichen Bewusstsein war allerdings nicht später Einsicht geschuldet; vielmehr schien das plötzliche Erinnern genauso wie das vorherige Vergessen politisch motiviert zu sein. Vor den Wahlen im Jahr 1996 griffen die Sozialisten auf die im kommunikativen Gedächtnis präsenten Erinnerungen an Diktatur und Bürgerkrieg zurück, um Wählerstimmen zu generieren. Sie warnten, ein möglicher Wahlerfolg des konservativen Partido Popular wäre gleichbedeutend mit einer Wiederkehr des Franquismus. Das auf diese Weise neu entfachte Interesse an der Vergangenheit führte nun auch jüngere Generationen, die die letzten Jahre des Franquismus als Kinder oder Jugendliche erlebt hatten, an die Thematik heran. Die Enkel blickten mit zeitlichem und emotionalem Abstand auf das, was insbesondere die Großvätergeneration unmittelbar erlebt hatte und in Bälde nicht mehr erzählen können würde.31
Vor diesem Hintergrund ist dem Historiker Santos Juliá zuzustimmen, wenn er die vereinfachende Annahme eines pacto de silencio ablehnt. Jedoch muss ebenfalls der Behauptung widersprochen werden, das Erinnern an den Bürgerkrieg sowie an die Diktatur seitens der politischen Elite käme in den ersten beiden Jahrzehnten nach Francos Tod einer umfassenden und tiefgreifenden Vergangenheitspolitik gleich. Mit A. Reig Tapia ist vielmehr davon auszugehen, dass zumindest in den ersten beiden Dekaden der im offiziellen Diskurs durchaus festzustellende Rückgriff auf Bürgerkrieg und Diktatur eher auf die historisierende Distanzierung sowie die Festigung der zu konstruierenden nationalen Einheit abzielte. Bürgerkrieg und Diktatur gerieten zur rhetorischen Kontrastfolie, vor der dem Erreichten wie dem noch zu Erreichenden der Schein des Sakralen anzuheften schien. Die partielle Integration schlimmer Vergangenheit in den offiziellen Diskurs diente somit eher ihrer Verdrängung als ihrer politisch-institutionellen Manifestierung. Selbst die von Santos Juliá angeführte Proliferation von Büchern über den Bürgerkrieg und den Franquismus während der Transition ist nicht gleichzusetzen mit der Objektivierung des subjektiven Leids in Form politisch-institutioneller Anerkennung und der Etablierung einer demokratischen Erinnerungskultur.
Das Ausbleiben offizieller erinnerungskultureller Bestrebungen mündete, davon ist angesichts der zitierten Stellungnahmen auszugehen, in eine die spanische Transition kennzeichnende Aporie des Nicht-Erinnerns des Un-Vergesslichen, in eine erinnerungskulturelle Ambivalenz, die sich dadurch ergab, dass auf politisch-institutioneller Ebene keine Korrespondenz für das geschaffen wurde, was die Biographien der Individuen, die das System konstituierten, prägte. Der spanische Historiker Javier Tusell hebt die negativen Implikationen dieser Politik der desmemoria im Hinblick auf die während der transición festzustellende Verunsicherung bezüglich einer kollektiven spanischen Identität hervor. Diese identitäre Orientierungslosigkeit war nicht zuletzt darauf zurückzuführen, dass das Geschehene keine Bestätigung in Form einer offiziellen Positionierung erfuhr:
Hoy mismo los españoles no disponemos apenas de signos de identidad colectiva con los que podamos identificarnos como colectividad (…) Comprender a cada uno de los bandos en la guerra civil y también a unos y otros durante el régimen posterior es una obligación intelectual. El reproche sistemático y global de una tendencia a la otra con las armas del pasado no tiene nada de constructivo y sólo puede envenenar la convivencia presente. Pero la pretensión de que es indiferente lo que se hizo en el pasado o de que todos fueron iguales resulta por completo injustificable.32
Tusells Behauptung, der Gedächtnisverlust verhinderte die Überwindung sozialer Gräben und vergiftete das Zusammenleben der spanischen Bevölkerung, wird von Teresa M. Vilarós’ Annahme gestützt, der zufolge die Jahre nach Francos Tod von Euphorie und Enttäuschung gleichermaßen geprägt waren. Die neu erworbene Freiheit implizierte nämlich eine durch diskursive Ausschließungsmechanismen bedingte Un-Freiheit, die solange Bestand haben würde, wie das Unterdrückte selbst.33
3Zum Konflikt zwischen biographischem Rückblick und systemischem Neuanfang in postdiktatorischen Übergangsgesellschaften
Postdiktatorische Übergangsgesellschaften scheinen sich durch eine Aporie zu charakterisieren, die sich in der Unvereinbarkeit politischer Konsolidierung und der gleichzeitigen Überwindung ziviler Konfliktpotentiale konkretisiert. Denn während die auf systemische Stabilisierung abzielenden Politiker des Übergangs den Blick zurück vermeiden, haben zivilgesellschaftliche Grabenkämpfe ihren Ursprung in der Vergangenheit und überdauern systemische Veränderungen. Während also die Lenker der politischen Transition die Erinnerung an Diktatur und/oder Bürgerkrieg als destabilisierend für den Demokratisierungsprozess wahrnehmen, bedarf es hinsichtlich der sozialen Transition der Thematisierung der Anfänge ziviler Konflikte, um diese zu überwinden.1 Folglich scheint es im Hinblick auf einen Ausweg aus dem autoritären oder totalitären System in Richtung Demokratie zwei mögliche Formen des vergangenheitspolitischen Agierens zu geben: das bewusste Ausklammern bestimmter Erinnerungsinhalte aus dem offiziellen politischen Diskurs zum Zwecke der systemischen Stabilisierung oder die Aufarbeitung des Geschehenen auf die Gefahr hin, zivilgesellschaftliche Konflikte neu zu befeuern und auf diese Weise den politischen Konsolidierungsprozess zu gefährden. Welcher Weg eingeschlagen wird, hängt zweifelsohne von Faktoren wie der Schwere des Geschehenen, personaler Kontinuität im politisch-administrativen Apparat, den Motiven des Systemübergangs, gegenwärtiger politischer Stabilität etc. ab. Dabei scheint zu gelten: Je schwerwiegender die begangenen Taten sind, desto heftiger prallt der politisch-systemische Wunsch des Vergessens auf die moralische Pflicht des Erinnerns.
Theodor W. Adorno lieferte in seinem im Jahr 1959 gehaltenen Vortrag „Was bedeutet: Aufarbeitung der Vergangenheit“, der als Aufforderung zur Auseinandersetzung mit den nationalsozialistischen Verbrechen in Deutschland zu verstehen ist, wohl eine der präzisesten Beschreibungen des unauflöslichen Spannungsverhältnisses zwischen den Polen des Vergessens und des Erinnerns:
Man will von der Vergangenheit loskommen: mit Recht, weil unter ihrem Schatten gar nicht sich leben läßt, und weil des Schreckens kein Ende ist, wenn immer nur wieder Schuld und Gewalt mit Schuld und Gewalt bezahlt werden soll; mit Unrecht, weil die Vergangenheit, der man entrinnen möchte, noch höchst lebendig ist. Der Nationalsozialismus lebt nach, und bis heute wissen wir nicht, ob bloß als Gespenst dessen, was so monströs war, daß es am eigenen Tode noch nicht starb, oder ob es gar nicht erst zum Tode kam; ob die Bereitschaft zum Unsäglichen fortwest in den Menschen wie in den Verhältnissen, die sie umklammern.2
Das „Gespenst dessen, was so monströs war“, überdauert den systemischen Neubeginn und konfrontiert das geschichtslose Handeln stets mit dem fauligen Grund, auf dem sich dieses Handeln vollzieht.
In seinem Aufsatz „Der Nationalsozialismus im deutschen Nachkriegsbewusstsein“ formulierte der deutsche Philosoph Hermann Lübbe eine Fragestellung, die sich zum politisch-kulturellen Paradigma bezüglich des Umgangs mit der traumatischen NS-Vergangenheit in der BRD entwickeln sollte. Der im Jahr 1983 anlässlich des 50. Jahrestags der nationalsozialistischen Machtübernahme entstandene Text befasst sich mit dem paradoxalen Nicht-Thematisieren des Omnipräsenten, dem Nicht-Sagen des endlich Sagbaren. Die Fragestellung lautet: „Wie erklärt es sich, dass […] im Schutz öffentlich wiederhergestellter, normativer Normalität das deutsche Volk zum Nationalsozialismus in temporaler Nähe zu ihm stiller war als in späteren Jahren unserer Nachkriegsgeschichte?“3
Dieses von Lübbe als ‚kommunikatives Beschweigen’ benannte Phänomen wird von ihm keineswegs als simpler Verdrängungsprozess beschrieben, sondern vielmehr als sozialpsychologisch notwendiges Ausklammern des Unerträglichen zum Zwecke der „Verwandlung unserer Republik in die Bürgerschaft der Bundesrepublik Deutschland.“4 Die Paradoxie des von Lübbe kreierten Ausspruchs besteht in der Kommuniziertheit des Nicht-Kommunizierens, wie sie sowohl im privaten als auch im institutionellen Bereich angenommen werden kann. Für das, was Lübbe „Nicht-Erinnern um der Demokratie willen“ nennt, findet der Zeithistoriker Norbert Frei unmissverständliche Worte: „Spätestens seit Anfang der achtziger Jahre […] bestand in der bundesdeutschen Öffentlichkeit ein breiter Konsens über die Auffassung, vor allem in den ersten beiden Nachkriegsjahrzehnten sei die NS-Vergangenheit weitgehend verdrängt worden.“5
Dass die politischen Protagonisten der Transitionsgesellschaften der politischen Konsolidierung Priorität vor der nachhaltigen Überwindung sozialer Konfliktivität und der damit einhergehenden Aufarbeitung der Vergangenheit einräumen, verdeutlichen die Historiker Alfons Kenkmann und Hasko Zimmer in ihrem 2006 erschienenen Sammelband Nach Kriegen und Diktaturen. Die Konstituierung demokratischer Rechtsstaatlichkeit geht in den ersten Jahren nach dem Ende eines autoritären Systems häufig weder mit einer Beschäftigung mit den Schicksalen der Opfer noch mit einer flächendeckenden juristischen Verfolgung der Täter einher.6 Mit Blick auf die demokratischen Gesellschaften, die sich im Laufe des 20. Jahrhunderts aus autoritären Regimen entwickelten, stellt Richard J. Goldstone fest: „In manchen Fällen stellte sich die Frage, ob gar die Stabilität der neuen und noch zerbrechlichen Demokratie durch das Bestreben, die Vergangenheit öffentlich zu dokumentieren und sich ihr zu stellen, bedroht war.“7
Während ein System gewissermaßen über den “Vorteil“ der Geschichtsvergessenheit verfügen kann und als manifest gewordene Reaktion auf das Überwundene zukunftsgerichtet ist, ist das Individuum stets das, wozu es wurde. Personale Identität ist das Ergebnis der Biographie, die zwar verdrängt oder abgelehnt, aber niemals gelöscht werden kann. Oder wie es Dieter Simon in seinem Aufsatz „Verordnetes Vergessen“ formuliert: „[…] außerhalb unserer Erinnerung sind wir nicht.“8 Wo also die Politik des Schlussstrichs (Juan Carlos: „Hoy empieza una nueva etapa en la historia de España.“) zum Heilmittel einer Übergangsgesellschaft wird, wo eine Grenze zwischen Gegenwart und Vergangenheit gezogen und im öffentlichen Diskurs zumindest vorläufig eine bewusste Trennung von all dem markiert wird, was vor einer vermeintlichen 'Stunde Null' lag,9 dort wird den leidvollen Erfahrungen derjenigen, die kriegerische Auseinandersetzung und diktatorische Repression miterlebt haben, der Zugang ins öffentliche Bewusstsein verwehrt und die politische Transition der sozialen Transformation der Gesellschaft vorangestellt.
Das Ausbleiben staatlich initiierter, erinnerungskultureller Maßnahmen bringt es in diesem Fall mit sich, dass die Erinnerungen im Bereich der Subjekte verortet bleiben müssen. Die Aussetzung der nachträglichen Wiederherstellung von Gerechtigkeit durch die Anerkennung des Geschehenen und die Positionierung zur Schuldfrage scheint in manchen Fällen durch ein kollektives Streben nach systemischer Ordnung gerechtfertigt zu werden. Die Konstruktion eines angestrebten Rechtsstaates stützt sich dann paradoxerweise auf die Absenz der diesen Staat doch eigentlich konstituierenden Grundüberzeugungen.10 Das Ergebnis ist, so Jürgen Vogt in Anlehnung an Theodor W. Adornos Überlegungen zur Aufarbeitung deutscher NS-Vergangenheit und am Beispiel des unmittelbaren deutschen Erinnerungsdiskurses nach 1945, die latente Anwesenheit des Abwesenden in der jungen Demokratie: „Daß die massive Abwehr der peinlichen und peinigenden Erinnerung, die Leugnung eigener Mitschuld nicht nur das Verhalten vieler Menschen, sondern auch das Klima von Öffentlichkeit, Politik, Justiz dominiert hat, dürfte allen noch gegenwärtig sein, die […] die fünfziger Jahre bewußt erlebt haben.“11
Die entstehende Diskrepanz zwischen der systemischen Möglichkeit des Vergessens und der menschlichen Unabweisbarkeit des Erinnerns erzeugt ein Spannungsverhältnis, das in einer Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen bzw. einer Anwesenheit des Abwesenden aufzugehen und damit ein paradoxales Grundmuster aufzuweisen scheint. Trotz der Unmöglichkeit einer schablonenhaften Analyse kann davon ausgegangen werden, dass die aus repressiven Regimen hervorgehenden sich demokratisierenden Transitionsgesellschaften ein gemeinsames Schicksal teilen, denn sie alle müssen die Säulen der Demokratie auf einem Grund errichten, der gepflastert ist von zivilgesellschaftlicher und politischer Konfliktivität, staatlicher Willkür, Ungerechtigkeit, Einschränkung und Verletzung der Menschenrechte, Repression und Verfolgung, Gewalt o.ä., ganz gleich in welchem Ausmaß.12 Der Historiker Reinhard Rürup verweist auf den Umstand, dass keine Diktatur ohne den Einsatz von Gewalt und Terror auskommt, selbst wenn sich die Machthaber mitunter auf eine breite Zustimmung der Bevölkerung – die sich meist aus der Ablehnung vorheriger Verhältnisse ergibt – stützen können.13 Entsprechend bedeutet für Teresa M. Vilarós der Tod Francisco Francos das Ende „de un régimen autoritario y represivo, el fin de la tiranía, de la censura social, ideológica y política […].“14
Um das im Rahmen einer Diktatur – von Rürup allgemein als „Willkür- und Gewaltherrschaft“15 definiert – begangene Unrecht im Hinblick auf das hier zugrunde liegende gedächtnistheoretische Forschungsinteresse terminologisch zu fassen, soll daher zunächst auf den von Christian Meier formulierten, weitgefassten Begriff der ‚schlimmen Erinnerung’ rekurriert werden. Der Althistoriker verwendet diesen Terminus in seinen unter dem Titel Das Gebot zu Vergessen und die Unabweisbarkeit des Erinnerns (2010) veröffentlichten, komparatistisch angelegten Studien zum öffentlichen Umgang mit kriegerischer oder diktatorischer Vergangenheit:
Schlimmes – dieses Wort soll hier und im folgenden ganz formal gebraucht werden: das heißt unabhängig vom absoluten Ausmaß und der Qualität dessen, was jeweils angerichtet worden ist. Die willkürliche Tötung einiger hundert Griechen [unter der Herrschaft der „dreißig Tyrannen“ in Athen in den Jahren 404/403 v. Chr., D. H.] soll also ebenso darunter fallen wie der weitgehend fabrikmäßige Mord an 6 Millionen Juden im Zeiten Weltkrieg. Wichtig ist nur, daß es um den Umgang mit sehr störender, zu schaffen machender Erinnerung gehen soll, und zwar für das Gemeinwesen. Die Frage ist, wie die [sic] damit fertig werden.16
Entscheidend ist die Feststellung, dass es sich um stark konfliktive Erinnerungsinhalte handelt, die das zivilgesellschaftliche Zusammenleben in der Demokratie aufgrund ihrer nicht schwindenden Bedrängnis für die Gegenwart nachhaltig negativ beeinflussen können. Die von Meier hervorgehobene Beeinträchtigung der gegenwärtigen zivilen Gemeinschaft rückt den Begriff der ‚schlimmen Erinnerung’ in die Nähe des pathologischen Trauma-Begriffs. Der Etymologie entsprechend manifestiert sich das Trauma, das traumatisierende Nicht-Mehr-Seiende, als gegenwärtige Wunde für das Individuum, was die zeitliche Grenze zwischen Gegenwart und Vergangenheit unter der Last des Erlebten zusammenbrechen lässt. Die Gegenwärtigkeit des Vergangenen ist es, welche den Trauma-Begriff für die Textanalysen in dieser Studie noch besonders brauchbar werden lässt. Ein Trauma bezeichnet „ein Erlebnis, das von solcher Intensität ist, dass es die psychischen Verarbeitungsmöglichkeiten des Betroffenen überschreitet“ und dadurch „Angst, Schrecken und völlige Hilflosigkeit“17 in der Gegenwart auslösen kann. Zweifelsohne können Erfahrungen, die während eines Krieges oder unter einem repressiven Regime gemacht wurden, traumatisierend wirken.18
Unter Rekurs auf Ausführungen des Psychoanalytikers Sigmund Freud rechtfertigt Paul Ricœur die Übertragung des der Psychoanalyse entstammenden Trauma-Begriffs auf Kollektive. Grundlage ist für ihn die unauflösliche Interdependenz individueller und kollektiver Identität, aus der die Möglichkeit der Anwendung pathologischer Kategorien auf die historisch-gesellschaftlicher Ebene erwächst: „Es ist die Bipolarität von persönlicher und gemeinschaftlicher Identität, die letzten Endes die Ausweitung der Freudschen Analyse der Trauer auf das Trauma der kollektiven Identität rechtfertigt.“19 Wie von individuellen Traumata ließe sich gemäß Ricœurs Überlegungen demnach von „kollektiven Traumen oder Verletzungen“20 sprechen. Führt man diesen Gedanken weiter, so wäre zudem die Rede von der “Erkrankung des kollektiven Gedächtnisses“ möglich, dessen pathologisches Leiden das Resultat einer schlimmen Vergangenheit ist, die von den das Kollektiv konstituierenden Individuen unmittelbar oder mittelbar erlebt und nicht überwunden wurde. Dem inneren Konflikt auf der Ebene des Individuums entspräche das konfliktive Zusammenleben auf der Ebene des Kollektivs. Mit Blick auf die europäische Diktaturgeschichte des 20. Jahrhunderts stellt Rürup heraus, dass die wie auch immer gearteten Bemühungen, diese traumatischen Erlebnisse zu übergehen, zum Scheitern verurteilt sind: „Die Diktaturerfahrungen, insbesondere die Erfahrungen der totalitären Regime, sind so tiefgreifend, ja so existentiell, dass sie sich nicht einfach abstreifen lassen“21, weder vom Individuum und noch von Kollektiven.
Die Frage nach dem „Wer?“ der Erinnerung war bis in die Moderne eine beinahe ausschließlich individualpsychologische und erfuhr erst durch die sozial-konstruktivistischen Theorien des kollektiven Gedächtnisses, die in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts vom französischen Soziologen Maurice Halbwachs formuliert und durch den Ägyptologen Jan Assmann sowie die Literaturwissenschaftlerin Aleida Assmann für kulturwissenschaftliche Untersuchungen brauchbar gemacht wurden, eine konzeptionelle Erweiterung.22 In Les cadres sociaux de la mémoire (1925), La topographie légendaire des évangiles en terre sainte. Étude de mémoire collective (1941) und in den im Nachlass La mémoire collective (1950) zusammengefassten Studien richtet sich der französische Soziologen Maurice Halbwachs gegen Gedächtnistheorien, die das Erinnern als einen rein individualpsychologischen Vorgang ansahen. Mit der Öffnung der Gedächtnistheorie für das Kollektiv überwindet er gewissermaßen den Subjektivismus seines Lehrers Henri Bergson und markierte damit gleichermaßen einen Forschungsschwerpunkt, der sich von den Theorien seines Zeitgenossen Sigmund Freud unterschied. Jede persönliche Erinnerung, so Halbwachs’ durchaus radikale Annahme, sei von sozialen Bezugsrahmen (les cadres sociaux) bedingt und durch Interaktion und Kommunikation geprägt. Astrid Erll zufolge bilden diese Bezugsrahmen „den umfassenden, sich aus der materialen, mentalen und sozialen Dimension kultureller Formationen konstituierenden Horizont, in den unsere Wahrnehmung und Erinnerung eingebettet ist.“23 Halbwachs' Leistung lag in der Zuordnung von Gedächtnis und sozialer Gruppe. Genauso wie Individuen bewohnen auch Gruppen ihre Vergangenheit und formen daraus ihre Gruppen-Identität.24 Dabei verfahren sie selektiv, konstruktiv und stets in Abhängigkeit von gegenwärtigen Bedürfnissen.25
An Halbwachs anknüpfend setzten sich Aleida und Jan Assmann intensiv mit der Unterscheidung zwischen vom Subjekt kommunizierter und institutionalisierter Erinnerung, d. h. Erinnerung, die nicht mehr an Subjekte gebunden ist, auseinander und erweiterten die Gedächtnistheorie Halbwachs' zu einer Kulturtheorie. Die Assmanns führten in ihrem 1988 publizierten Aufsatz „Schrift, Tradition, Kultur“ zwei Gedächtnisrahmen ein, die sie „kommunikatives“ und „kulturelles Gedächtnis“ nannten. Das kommunikative Gedächtnis entspricht dabei im Grunde dem, was Halbwachs unter mémoire collective verstand:
Das kommunikative Gedächtnis umfaßt Erinnerungen, die sich auf die rezente Vergangenheit beziehen. Es sind Erinnerungen, die der Mensch mit seinen Zeitgenossen teilt. Der typische Fall ist das Generationen-Gedächtnis. Dieses Gedächtnis wächst der Gruppe historisch zu; es entsteht in der Zeit und vergeht mit ihr, genauer: mit seinen Trägern. Wenn die Träger, die es verkörpern, gestorben sind, weicht es einem neuen Gedächtnis.26
Dieser von Jan Assmann beschriebene Gedächtnishorizont umfasst drei bis vier Generationen bzw. ca. 80 Jahre. Im Anschluss daran entsteht eine Lücke, das sog. floating gap, ehe bestimmte Erinnerungen an neue, symbolische, objektive Träger geheftet werden können.27 Diese symbolischen Träger bzw. Medien fungieren schließlich als Träger des kulturellen Gedächtnisses:
Unter dem Begriff kulturelles Gedächtnis fassen wir den jeder Gesellschaft und jeder Epoche eigentümlichen Bestand an Wiedergebrauchs-Texten, -Bildern und -Riten zusammen, in deren >Pflege< sie ihr Selbstbild stabilisiert und vermittelt, ein kollektiv geteiltes Wissen vorzugsweise (aber nicht ausschließlich) über die Vergangenheit, auf das eine Gruppe ihr Bewusstsein von Einheit und Eigenart stützt.28
Das kulturelle Gedächtnis wirkt aufgrund seiner normativen und formativen Kraft als Identität und Einheit stiftend für große Gemeinschaften und kann sowohl auf faktischer Vergangenheit als auch auf Mythen basieren; entscheidend ist demnach nicht die Wahrhaftigkeit des Geschehenen, sondern vielmehr der fundierende Wert des Erinnerten für die dauerhafte kulturelle Stabilisierung einer Gemeinschaft; Assmann spricht in diesem Zusammenhang von Identitätskonkretheit.29 Als symbolische, objektivierte Träger bzw. Medien des kulturellen Gedächtnisses können somit Zeichensysteme aller Art in Frage kommen, solange sie mnemotechnische Funktion erfüllen, d. h. Erinnerung und Identität stützen.30 Ein historisches Dokument kann demnach ebenso als Erinnerungsort dienen wie ein Roman oder ein Dramentext.
Jan Assmann relativiert die scheinbar klare zeitliche Trennung zwischen kommunikativem und kulturellem Gedächtnis, wenn er sagt, dass es sich bei den beiden Gedächtnisrahmen um „zwei Modi des Erinnerns“ handelt, „die man zunächst sorgfältig unterscheiden muß, auch wenn sie in der Realität einer geschichtlichen Kultur sich vielfältig durchdringen.“31 Entscheidender als die Frage nach dem zeitlichen Abstand zum Erinnerten ist demnach die Frage nach dem Modus des Erinnerns, dem modus memorandi bzw. der Art der Rezeption. Wirkt die Erinnerung an ein Ereignis für größere Gruppen „fundierend“, d. h. hat sie weitreichende Bedeutung für das kulturelle Selbstbild, oder ist sie nur von biographischem Interesse?32 Beides kann der Fall sein. Der Zweite Weltkrieg stellt ein Ereignis dar, welches sowohl im Modus des kommunikativen Gedächtnisses, beispielsweise im Gespräch mit den Großeltern, als auch im fundierenden Modus des kulturellen Gedächtnisses erinnert wird, z. B. durch das Berliner Shoa-Mahnmal oder offizielle Gedenkakte.
Wenn an dieser Stelle von der Einheit stiftenden Funktion der fundierenden Erinnerung gesprochen wird, so impliziert dies jedoch keinesfalls, dass die Vergangenheitsbezüge großer Kollektive stets homogenen und einmütig ausfallen. Stattdessen ist von einer „Pluralität von Vergangenheitsbezügen, die sich nicht nur diachron in unterschiedlichen Ausgestaltungen des kulturellen Gedächtnisses manifestiert, sondern auch synchron in verschiedenen Modi der Konstitution der Erinnerung, die komplementäre ebenso wie konkurrierende, universale wie partikulare, auf Interaktion wie auf Distanz- und Speichermedien beruhende Entwürfe beinhalten können.“33
Wo liegt nun der Keim für die für Postdiktaturen potentiell anzunehmende, erinnerungskulturelle Ambivalenz, die in den hiesigen Ausführungen als Paradoxie der Anwesenheit des Abwesenden bzw. des Nicht-Erinnerns des Unvergesslichen verstanden wird? Der Ursprung des memorialen Konflikts liegt in den unterschiedlichen Interessen und Bedürfnissen der erinnernden Instanzen zum Zeitpunkt der Transition, oder, um mit Halbwachs zu sprechen, in den cadres sociaux begründet. Ohne das Risiko eines allzu vereinfachenden Blicks einzugehen, lässt sich behaupten, dass sich Übergangsgesellschaften, die den Ausgang aus einem autoritären System vollziehen und den Weg in die demokratische Rechtsstaatlichkeit einschlagen, vor der Herausforderung der scheinbaren Unvereinbarkeit zwischen politischen und sozialen Bedürfnissen und Zielsetzungen stehen. Und, dass der Wunsch, die Vergangenheit öffentlich zu dokumentieren und sich zu ihr zu positionieren, eine Bedrohung für das realpolitische Ziel der systemischen Stabilisierung innerhalb junger Demokratien darstellt.34
Der im öffentlichen Raum stattfindende Umgang mit schlimmer Vergangenheit, also die für alle sichtbare Manifestierung des im kommunikativen Gedächtnis Präsenten in Praktiken und Objektivationen des kulturellen Gedächtnisses stellt zur selben Zeit eine Notwendigkeit der sozialen wie auch eine Gefahr für die politische Transition dar. Die Neubildung einer kulturellen und nationalen Identität auf rechtsstaatlicher Basis scheint deshalb vielfach auf Kosten öffentlicher Erinnerung an das vorangegangene Unrecht angestrebt zu werden, droht sich diese doch wie ein Keil in die Homogenisierungs- und Stabilisierungsbestrebungen der Repräsentanten des neuen Systems zu bohren. Die Angst vor der destabilisierenden Wirkung des Vergangenheitsbezugs kann somit zum handlungsbestimmenden Motiv politischer Entscheidungsträger und Repräsentanten des offiziellen Diskurses werden.35
Die Paradoxie des Nicht-Erinnerns des Unvergesslichen in postdiktatorischen Übergangsgesellschaften scheint somit an der Schwelle zwischen kommunikativem und kulturellem Gedächtnis verortet werden zu können. Das, was im kommunikativen Gedächtnis anwesend ist, kann im kulturellen Gedächtnis gleichzeitig weitestgehend absent bleiben, was zur Folge hat, dass die von Individuen gespeicherten und von sozialen Gruppen geteilten Erinnerungen an kriegerische Auseinandersetzungen und/oder diktatorische Repression in der Latenz des kommunikativen Gedächtnisses (individuelles und soziales Gedächtnis) verharren und nur bedingt symbolische Repräsentation im öffentlichen Raum erfahren (kulturelles Gedächtnis).
Der Umstand, dass sich Erinnerungen medial veräußern – z. B. in Form von Romanen, historischer Fachliteratur oder TV-Diskussionsrunden – ist zwar durchaus Teil der Objektivierung der Erinnerungen, darf allerdings keineswegs gleichgesetzt werden mit der wirkmächtigen Symbolik des politisch-institutionellen Vergangenheitsbezugs. Mediale Präsenz der Vergangenheit in Form von Romanen, Geschichtsbüchern und TV-Talkrunden kann somit nicht als Argument gegen den Vorwurf der Ausklammerung schlimmer Erinnerung aus dem kulturellen Gedächtnis dienen. Zwar ist die Wichtigkeit der medialen Thematisierung im Hinblick auf die Formung des kulturellen Gedächtnisses anzuerkennen, jedoch ist diese nicht gleichbedeutend mit dessen Etablierung. Denn für die Verankerung im kulturellen Gedächtnis bedarf es eines hohen Grades an Geformtheit bzw. zum Zwecke der Langlebigkeit vorgenommenen Kodierung der Erinnerung, die sich entweder durch politisch-institutionelle Verankerung oder durch die gesellschaftliche Mythisierung eines Erinnerungsortes vollziehen kann.
Erinnerungskultur und individuelle Erfahrungen müssen demzufolge nicht korrespondieren, vor allem dann nicht, wenn die biographische Erinnerung alles andere als systemisch fundierend wirkt. Um diese mögliche Diskrepanz nicht terminologisch zu verwässern, wird der Begriff der Erinnerungskultur unter Rekurs auf den Historiker Hans Günter Hockerts von den Primärerfahrungen sowie von der zeitgeschichtlichen Forschung abgegrenzt:
‚Primärerfahrung‘ bezieht sich auf die selbst erlebte Vergangenheit […]. Was man […] ‚Erinnerungskultur‘ nennt, dient als lockerer Sammelbegriff für die Gesamtheit des nicht spezifisch wissenschaftlichen Gebrauchs der Geschichte in der Öffentlichkeit – mit den verschiedensten Mitteln und für die verschiedensten Zwecke, von der Gedenkrede des Bundespräsidenten über die Denkmalpflege bis zum Fernseh-Infotainment […]. Davon wird schließlich die zeitgeschichtliche Forschung abgegrenzt, in der Annahme, dass es charakteristische Unterschiede gibt zwischen Zeitgeschichte als persönlicher Erinnerung, als öffentlicher Praxis und als wissenschaftlicher Disziplin.36
Der Eingang bestimmter Primärerfahrungen, seien diese am eigenen Leib erfahren oder vermittelt, in das kulturelle Gedächtnis ist an Autoritäten des öffentlichen Raums gebunden. Diese werden in erster Linie von politischen und medialen Entscheidungsträgern repräsentiert, die aufgrund ihrer gesellschaftlichen Funktion über die symbolische Repräsentation von Vergangenheit verfügen, d. h. darüber bestimmen können, was im öffentlichen Raum wahrnehmbar wird.37
4Forschungsfrage: Zur Darstellbarkeit der Diskrepanz zwischen gemachter Erfahrung und memorialer Erwartung
Das beschriebene konfliktive Verhältnis zwischen kommunikativem und kulturellem Gedächtnis innerhalb postdiktatorischer Übergangsgesellschaften ergibt sich aufgrund der potentiell unterschiedlichen Präsenz, d. h. des divergierenden Fortbestehens von vergangenen Geschehnissen innerhalb der differenzierten Gedächtnisrahmen. Während auf der Ebene des kommunikativen Gedächtnisses in der Regel von einer Präsenz der Vergangenheit in Form subjektiver Erinnerung ausgegangen werden kann, ja muss – ganz unabhängig von etwaigen Versuchen individueller Verdrängung oder sozialer Tabuisierung1 – so bedarf es im Hinblick auf den Eingang schlimmer Erinnerung in den Rahmen des kulturellen Gedächtnisses institutionalisierter Praktiken, die entweder ausgeführt werden oder nicht. Zwar wurde verdeutlicht, dass die Integration dunkler Kapitel der Vergangenheit in die gegenwärtige Erinnerungskultur konstitutiv für den sozialen Transformationsprozess sowie die individuelle und kollektive Identitätsbildung in Übergangsgesellschaften zwischen autoritären und demokratischen Systemen ist. Jedoch liefert die empirisch belegte Tatsache, dass sich in der Geschichte des 20. Jahrhunderts die politischen Lenker junger Demokratien nicht selten für ein vorübergehendes Ausklammern destabilisierender Erinnerung aus dem offiziellen Diskurs sowie der öffentlichen Wahrnehmung entschieden haben, eine Erklärung für das temporäre erinnerungskulturelle Spannungsverhältnis. Erhalten die von Individuen und Gruppen vollzogenen Veräußerungen schlimmer Erinnerungen trotz ihrer überindividuellen Tragweite keine dazu korrespondierende Repräsentanz auf der Ebene des kulturellen, das heißt institutionalisierten Gedächtnisses, steht die Anwesenheit der Vergangenheit auf Subjektebene der in den Jahren des Übergangs festzustellenden Abwesenheit selbiger im kulturellen Gedächtnis gegenüber. Anders gewendet, es kommt zur Gleichzeitigkeit des Nicht-Erinnerns auf politisch-institutioneller Ebene und der Präsenz des Unvergesslichen auf sozial-subjektiver Ebene.
Aus dieser historischen Lebenswirklichkeit leiten sich die diese Studie prägenden literatur- und theaterwissenschaftlichen Forschungsfragen ab: Wie lässt sich die erinnerungskulturelle Realität des Postfranquismus ästhetisch verarbeiten? Welcher Wirklichkeitsbegriff muss einer ästhetischen Darstellung von erinnerungskultureller Paradoxie zugrunde gelegt werden? Auf welche Weise lässt sich die Gleichzeitigkeit von systemischem Verdrängen und der Notwendigkeit des subjektiven Erinnerns dramatisch ausgestalten? Und: Über welche Möglichkeiten verfügt das Theater, nicht nur den Akt des Verdrängens mimetisch darzustellen, sondern als Medium der gemeinsamen Rezeption einen Akt des kollektiven Erinnerns innerhalb des theatralischen Raums zu initiieren, der sich in die Leerstellen der defizitären Erinnerungspolitik des Postfranquismus einschreibt? Um diesen Fragen auf den Grund zu gehen, ist es an dieser Stelle zunächst notwendig, die paradoxe erinnerungskulturelle Wirklichkeit begrifflich zu fassen, um im Anschluss nach den Möglichkeiten der Darstellung dieser Wirklichkeit zu fragen.





























