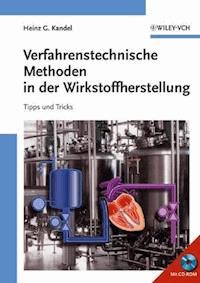
74,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Wiley-VCH
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Bei der Herstellung von pharmakologischen Wirkstoffen kommen eine Vielzahl verfahrenstechnischer Grundoperationen zur Anwendung. Dies sind beispielsweise Zentrifugation, Filtration und Ultrafiltration, Chromatographie und Gefriertrocknung. Insbesondere zur Herstellung von Produkten aus Blutplasma gelten besondere Anforderungen wie Steril- und Reinraumtechnik und schonende Weiterverarbeitung. Das vorliegende Buch gibt einen praktischen Überblick über verfahrenstechnische Methoden und bewährte Lösungen in der pharmazeutischen Wirkstoffherstellung und beschreibt erstmals die Besonderheiten und verfahrenstechnischen Modifikationen in der Blutplasma-Industrie. Neben Hilfestellungen, Tipps und Tricks für Ingenieure, Praktiker und Berufseinsteiger beinhaltet das Buch bislang unveröffentlichte Stoffwerte von Blutplasma und Blutproteinen. Die beiliegende CD-ROM enthält 30 praxisorientierte Berechnungsprogramme, mit deren Hilfe der Leser sehr schnell zu Lösungen eigener Fragestellungen kommen kann.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 177
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
1 Einleitung
2 Der Rohstoff: Blut, Blutplasma
3 Besondere Spezifitäten für die Verfahrenstechnik
3.1 Molekülgröße und Struktur
3.2 Anzahl der Prozessstufen
3.3 Analytik, Messmethoden
3.4 Zulassungsproblematik
4 Blutplasmafraktionierung
4.1 Beschreibung des Prozesses
4.2 Verfahrenstechnische Gesichtspunkte
5 Support-Bereiche für die Produktion
5.1 Wasseraufbereitung
5.2 Reindampf, Sterilisation, Sanitisierung
5.3 „Cleaning in Place“ (CIP)-Systeme
5.4 Reinraumtechnik, Lüftungstechnik
6 Tipps und Tricks, Berechnungsprogramme
6.1 Sanitisieren von Behältern, Entlüftung
6.2 Platzen von Berstscheiben an Druckbehältern
6.3 Vorausberechnung von Partikelzahlen in Reinräumen
6.4 Berechnung der Partikelzahlen eines Reinraumes „at rest“
6.5 Scale-up von Zentrifugen aus Labor- oder Produktionsläufen
6.6 Schubspannungen in Rohrleitungen
6.7 Scale-up von Ultrafiltrationskassetten
6.8 Scale-up von Filtern
6.9 Berechnung der maximal möglichen Dosiergeschwindigkeiten von Äthanol bei der Fällung
6.10 Schnelle Dimensionierung eines Behälters
6.11 Instationäre Aufheiz- und Abkühlvorgänge in einem Rührbehälter
6.12 Temperierung eines Behälters durch externen Produktkreislauf
6.13 Temperierung eines Behälters mittels eines
6.14 Wärmeverlust einer isolierten Rohrleitung
6.15 Darstellung eines Prozesses mittels automatisiertem „Gant-Schema“
6.16 Kühlung eines Separators
6.17 Einfluss von Inertgasen auf die Temperatur bei der Sanitisierung
6.18 Entstehender Druck beim Schließen von Ventilen
6.19 Entleerungszeit eines Behälters
6.20 Ausfluss aus einem unter Druck stehenden Behälter
6.21 Chromatographiezyklus
6.23 Dampf-Flüssigkeits-Gleichgewichte
6.24 Wärmeübergang bei Kondensation
6.25 Berechnung der Rührerleistung, der Mischzeit und des Wärmeüberganges
6.26 Berechnung der notwendigen Kühlleistung in Kühlräumen
6.27 Diffusion
6.28 Dialyse
6.29 Auslegung von Rohrbündelwärmeaustauschern
6.30 Druckverlust einer Rohrwendel
6.31 Schaltungsmöglichkeiten bei CIP-Anschlüssen
6.32 Wärmebilanz eines Raumes
7 Stoffwerte
8 Verzeichnis der Berechnungsprogramme auf der anliegenden CD
9 Literaturverzeichnis
Stichwortregister
Beachten Sie bitte auch weitere interessante Titel zu diesem Thema
Kutz, G., Wolff, A. (Hrsg.)
Pharmazeutische Produktionsanlagen
Prozesse und technische Umsetzung
2006HardcoverISBN 3-527-31222-6
Gengenbach, R.
GMP-Qualifizierung und Validierung von Wirkstoffanlagen
Ein Leitfaden für die Praxis
2006HardcoverISBN 3-527-30794-X
Kayser, O., Müller, R. H. (Hrsg.)
Pharmaceutical Biotechnology
Drug Discovery and Clinical Applications
2004HardcoverISBN 3-527-30554-8
Oetjen, G.-W., Haseley, P.
Freeze-Drying
2004HardcoverISBN 3-527-30620-X
Schubert, H. (Hrsg.)
Handbuch der Mechanischen Verfahrenstechnik
2003HardcoverISBN 3-527-30577-7
Autor:
Heinz G. KandelGartenweg 1335083 Wetter
1. Auflage 2006
Bibliografische Information der Deutschen Bibliothek
Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über <http://dnb.ddb.de> abrufbar.
© 2006 WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim, Germany
Gedruckt auf säurefreiem Papier.
Alle Rechte, insbesondere die der Übersetzung in andere Sprachen, vorbehalten. Kein Teil dieses Buches darf ohne schriftliche Genehmigung des Verlages in irgendeiner Form – durch Photokopie, Mikroverfilmung oder irgendein anderes Verfahren – reproduziert oder in eine von Maschinen, insbesondere von Datenverarbeitungsmaschinen, verwendbare Sprache übertragen oder übersetzt werden. Die Wiedergabe von Warenbezeichnungen, Handelsnamen oder sonstigen Kennzeichen in diesem Buch berechtigt nicht zu der Annahme, dass diese von jedermann frei benutzt werden dürfen. Vielmehr kann es sich auch dann um eingetragene Warenzeichen oder sonstige gesetzlich geschützte Kennzeichen handeln, wenn sie nicht eigens als solche markiert sind.
Satz K+V Fotosatz GmbH, BeerfeldenDruck Strauss GmbH, MörlenbachBindung J. Schäffer GmbH, GrünstadtUmschlaggestaltung Grafik-Design Schulz, Fußgönheim
Print ISBN 9783527313662
Epdf ISBN 978-3-527-66096-4
Epub ISBN 978-3-527-66042-1
Mobi ISBN 978-3-527-66041-4
Vorwort
Der Verfasser wurde 1943 in Graudenz/Westpreußen geboren, wuchs in der Nachkriegszeit in Berlin auf, wo er 1962 die Schule mit dem Abitur abschloss. Anschließend folgte Studium des allgemeinen Maschinenbaus an der Technischen Universität Berlin und Spezialisierung auf Verfahrenstechnik. Die Studien- und Diplomarbeit absolvierte er am Lehrstuhl von Prof. Dr. Brauer. Nach dem Diplom 1968 startete er sein Berufsleben in der verfahrenstechnischen Berechnungsgruppe der Hoechst AG in Frankfurt. Das Jahr 1974 diente als Ausbildungs- und Vorbereitungsjahr für eine Gruppenleitertätigkeit in den Behringwerken in Marburg. Er wurde durch sämtliche Abteilungen der Hoechster Pharmabetriebe geleitet und erhielt dort einen guten Überblick über die Spezialitäten der Pharmaindustrie. Im Jahr 1975 begann er dann in Marburg als Leiter einer Gruppe von Betriebsingenieuren. 1987 wurde er Leiter der Abteilung Verfahrenstechnik und später, nach der unglückseligen Auftrennung der Behringwerke in viele Bruchstücke, Leiter der Planungsabteilung bei Aventis-Behring (Director Project and Process Engineering).
Warum schreibt ein fast pensionierter Ingenieur ein Buch über „Verfahrenstechnische Methoden in der pharmazeutischen Wirkstoffherstellung“, speziell der Blutplasmaindustrie?
Vermutlich, weil er sich 29 Jahre lang mit einem Thema beschäftigt hat und es nicht plötzlich beiseite legen kann, weil es ihn drängt, das angesammelte Know-how weiterzugeben.
Weil jetzt Zeit dafür zur Verfügung steht.
Weil er während seiner Berufszeit gesehen hat, dass junge Ingenieure gerne Hilfestellungen annehmen.
Es sind in den vielen Jahren immer wiederkehrende Fragestellungen aufgetaucht, für die der Verfasser kleine Excel-Rechenprogramme geschrieben hat, um schnell zu einer Lösung zu kommen. Aus Zeitgründen – das Tagesgeschäft ging vor – wurden diese Programme nie richtig dokumentiert, so dass ein Außenstehender kaum in der Lage war, diese zu benutzen. Dies soll hier nachgeholt werden. Die Programme sind im Anhang auf einer CD zu finden.
Nicht zuletzt, weil der Verfahrenstechnik speziell in der Blutplasmaindustrie eine besondere Rolle zukommt, die in anderen Fachbüchern nicht beschrieben wurde.
Somit soll dieses Buch eine fachliche Ergänzung zu den vorhandenen sein.
Wetter, August 2005
Heinz G. Kandel
1
Einleitung
Warum noch ein weiteres Buch über die Verfahrenstechnik? Gibt es nicht genug Fachbücher, Fachzeitschriften, Formelwerke und populärwissenschaftliche Berichte über die Bio- und Pharmatechnik? Alle drei Jahre findet die Achema statt, es gibt diverse Pharma-Fachmessen, mit wissenschaftlichen Symposien und entsprechenden Veröffentlichungen. Es gibt viele Consultant Firmen, die Fachtagungen veranstalten (gegen teures Geld), auf denen die Firmen sich gegenseitig übertrumpfen mit immer neuen „Verbesserungen“ und damit die Anforderungen immer höher schrauben (die Behörden hören aufmerksam zu). Warum also noch ein Buch über das Thema? Was ist der Zweck?
Meine Erfahrung ist, dass – trotz aller dieser Angebote – der junge Verfahrensingenieur in der Pharmaindustrie und speziell in der Blutplasma verarbeitenden Industrie für Tipps und Tricks, die aus der Praxis kommen, dankbar ist.
Junge Ingenieure, die frisch von der Ingenieurschule kommen und in einer Planungsabteilung arbeiten, haben zwar irgendwann während ihrer Ausbildung die Grundoperationen der Verfahrenstechnik wie Mischen, Trennen, Fördern kennen gelernt. Doch fehlt natürlich die Erfahrung, diese Kenntnisse optimal einzusetzen. Man lernt an der Schule nicht, wie man einen Behälter richtig sterilisiert, welche Anschlüsse notwendig sind und welche Ventilschaltungen erfolgen müssen. Man weiß theoretisch, wie man die Aufheiz- oder Abkühlzeit eines Kessels berechnet, wie eine Chromatographieanlage funktioniert oder wie man eine Zentrifuge mit Hilfe von Versuchen auslegt. Bei der Anwendung hapert es jedoch bzw. dauert es sehr lange, bis man sich durch den Wärmeatlas oder andere Handbücher hindurchgekämpft hat. Man lernt aus Fehlern. Das Buch soll jungen Ingenieuren eine Hilfestellung sein.
Auch auf dem Gebiet der Qualitätssicherung ist es wichtig, dass die Verantwortlichen ein grundlegendes Verständnis für die physikalischen Vorgänge der Prozesse haben, um den Einfluss der verschiedenen Parameter beurteilen zu können. Der Ingenieur lernt auf der Fachschule zwar, was „GMP“ bedeutet und bekommt auf allen Tagungen und Kongressen gesagt, wie man eine Produktion in „Compliance“ mit den Forderungen der Behörden bringt. Er lernt, wie man eine „Standard Operation Procedure“ (SOP) aufbaut, wie man qualifiziert und validiert, welche Qualität produktberührende Oberflächen haben müssen, wie hoch die Partikelzahlen in „water for injection“ und in Reinräumen sein dürfen. Die Qualitätsorganisationen sagen ihm, dass er in der Anlage nichts verändern darf, ohne einen „Change-Control“-Antrag zu schreiben.
Er muss aber zusätzlich auch fachlich beurteilen können, welche Parameter wichtig für die Produktqualität sind und ob Abweichungen dieser Parameter während der Produktion einen Einfluss auf die Produktqualität haben. Daher sollte bei der Festlegung der Toleranzgrenzen immer ein kompetenter Ingenieur sein Wissen einbringen. Dies setzt eine sehr gute Kenntnis der Zusammenhänge voraus. Aus diesem Grund bilden viele Pharmafirmen Qualitätsteams, die aus erfahrenen Produktionsleuten und Ingenieuren zusammengesetzt sind, die die aufgetretene Abweichung in ihrer Tragweite beurteilen und die entsprechenden Maßnahmen einleiten können.
Der Schwerpunkt dieses Buches soll auf der Technik liegen, nicht in der Biochemie. Daher wird auf die speziellen Probleme der Proteinchemie nicht eingegangen und die Prozesse nur so weit beschrieben, dass die technischen Maßnahmen im Zusammenhang deutlich werden. Beschrieben wird das erforderliche Equipment, das zur Herstellung der Produkte notwendig ist. Weiterhin werden Tipps und Tricks aufgezeigt, die in keinem Lehrbuch stehen, die aber beim Betrieb bzw. der Inbetriebnahme von Anlagen dem jungen Ingenieur nützlich sein können.
2
Der Rohstoff: Blut, Blutplasma [1]
Am Anfang sollen einige Zitate zum Gegenstand „Blut“ stehen, die deutlich machen, wie wichtig den Menschen zu allen Zeiten das Blut war und ist.
Goethe: „Blut ist ein ganz besonderer Saft“, dieser Spruch wurde geprägt, als Faust mit Mephisto den Bündnispakt abschließt. Blut gilt in alten Mythologien als der Sitz der Seele und des Lebens.
Bei Naturvölkern war es üblich, durch Vermischen des Blutes und Trinken der Mischung „Blutsbruderschaft“ zu stiften, so sollte eine Verschmelzung der Seelen stattfinden. (Dies ist nicht mit dem heutigen „Bruderschafts“-Trinken zu verwechseln, das unter Einnahme größerer Mengen Alkohol erfolgt und lediglich einen Einfluss auf die zukünftige Anrede der Betreffenden hat.)
Kaiser Wilhelm II.: „Blut ist dicker als Wasser“. Dieser Spruch soll zum Ausdruck bringen, dass das Meer zwischen England und Deutschland die „Blutsverwandtschaft“ nicht trennen kann (das war vor dem Ersten Weltkrieg).
Churchill: „I have nothing to offer but blood, toil, tears and sweat“. Rede vor dem Unterhaus 13. 5. 1940.
Bismarck: „Nicht durch Reden und Majoritätsbeschlüsse werden die großen Fragen der Zeit entschieden, sondern durch Eisen und Blut.“
Was ist nun Blut wirklich, also naturwissenschaftlich gesehen? Es soll hier keine genaue Analyse erfolgen, die man jedem besseren Lexikon entnehmen kann, sondern die Bemerkungen sollen nur dem weiteren Verständnis dienen.
Blut besteht aus dem Blutplasma (ca. 55%) und den Blutzellen (ca. 45%). Seine Aufgaben sind:
Transport von Sauerstoff (Atmung) und CO
2
(Entsorgung)
Transport von Nährstoffen (Versorgung) und Abbauprodukten (Entsorgung)
Aufbau von Immunität, Abwehrreaktion
Blutgerinnung bei Verletzungen
Wärmehaushalt zur Aufrechterhaltung der Körpertemperatur
Aufrechterhaltung eines konstanten Ionenmilieus
Außer niedermolekularen Stoffen enthält Blutplasma etwa 7% Proteine, wie Albumine, Globuline und Gerinnungsfaktoren.
Die Blutzellen setzen sich zu 99% aus roten Blutkörperchen (Erythrozyten) zusammen, den Rest bilden weiße Blutkörperchen (Leukozyten) und Blutplättchen (Thrombozyten).
Eine weitere Differenzierung der verschiedenen Proteine und Zelltypen soll nicht Gegenstand dieser Betrachtung sein. Doch selbst diese kurze laienhafte Zusammenstellung macht deutlich, wie wichtig das Blut für den Körper und den Menschen ist. Somit wird es verständlich, wenn manche das Blutspenden als ethisches Problem ansehen. Blut ist eben wirklich ein besonderer Saft und nicht ein beliebiger Rohstoff. Warum braucht man diesen Rohstoff überhaupt? Die Antwort ist ganz einfach: Weil man viele körpereigenen Proteine eben noch nicht synthetisch oder biosynthetisch herstellen kann. Man ist auf Blutspenden angewiesen.
Um aus dem Blut die gewünschten Proteine großtechnisch herstellen zu können, benötigt man große Mengen an Blut und damit einen großen Spenderkreis. In den meisten Fällen wird eine Plasmapherese durchgeführt, d. h. dem Spender wird Blut abgezogen, die Blutzellen durch Ultrafiltration oder Zentrifugation vom Plasma abgetrennt und dem Spender sofort wieder zurückgegeben. Das zellfreie Plasma wird tiefgefroren und gelangt mit Hilfe von überwachten Kühlketten zu den Plasmafraktionierungsanlagen.
Die Spender müssen gesund sein, was ständig kontrolliert wird. Die aufzubauende Logistik ist enorm. Neben den Sammelstationen muss auch der Tiefkühltransport organisiert, kontrolliert und validiert werden.
3
Besondere Spezifitäten für die Verfahrenstechnik
In der Plasmaindustrie finden generell keine Synthesen statt, da es sich bei den gewünschten Produkten, den Plasmaproteinen, ausschließlich um Naturstoffe handelt, die bereits in ihrer wirksamen Struktur im Plasma vorhanden sind. Diese müssen „lediglich“ aus dem Plasma durch Konzentrierungs- und Reinigungsverfahren gewonnen werden. Das klingt sehr einfach, jedoch sind bei der Gewinnung der Präparate einige wesentliche Randbedingungen zu beachten, die es der Verfahrenstechnik nicht leicht machen.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!





























