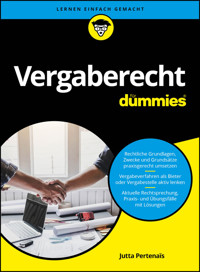
24,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Wiley-VCH
- Kategorie: Fachliteratur
- Serie: Für Dummies
- Sprache: Deutsch
Das Einmaleins des Vergaberechts
Das Vergaberecht kann wie eine hohe Hürde wirken, wenn Sie Aufträge von der öffentlichen Hand erhalten wollen. Jutta Pertenaïs nimmt Ihnen die Furcht vor diesem Gesetzeskonvolut. Sie erklärt zuerst die Grundlagen des Vergaberechts, den Zweck, die Grundsätze und die Anwendungsbereiche. Danach erläutert sie notwendige Formalitäten und die Struktur des Vergabeverfahrens. Sie erfahren, was Sie bei der Angebotserstellung beachten müssen und was Sie über Haftung und strafrechtliche Konsequenzen wissen müssen. Anhand von Beispielfällen mit Lösungen können Sie Ihr frisch erworbenes Wissen prüfen.
Sie erfahren
- Was das Vergaberecht überhaupt regelt
- Was es mit Unter- und Oberschwellenbereichen auf sich hat
- Welche Konsequenzen die unsachgemäße Durch-führung eines Vergabe-verfahrens haben kann
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 308
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Vergaberecht für Dummies
Schummelseite
VERGABESTELLENTIPPS ZUM UMGANG MIT BIETERN UND ZUR ERSTELLUNG VON VERGABEUNTERLAGEN
So früh wie möglich den Fachbereich fürs Vergaberecht sensibilisieren und auf Vorteile aufmerksam machen.Frühzeitig ausführliche Markterkundungen machen und dokumentieren.Internes Team bilden und externe Hilfe holen, zum Beispiel Unterstützung durch Rechtsanwaltskanzleien und Beratungsunternehmen. Wichtig: Die Externen müssen koordiniert werden, ansonsten droht hier eine riesige Kostenfalle!Bei der Auswahl der Vergabeplattform und Erstellung der Vergabeunterlagen auf Anwender- und Nutzerfreundlichkeit achten. Aufwände für beide Seiten reduzieren.Anzahl und Inhalt der Ausschlusskriterien hinterfragen.Bekannte Unternehmen über kommende Ausschreibung in Kenntnis setzen.Es sportlich nehmen, wenn man vor der Vergabekammer nicht gewinnt. Eine Fehleranalyse im Team gemeinsam erstellen und besprechen. Chance der Neuausschreibung nutzen.BIETERTIPPS ZUM UMGANG MIT VERGABESTELLEN UND ZUR ERSTELLUNG VON ANGEBOTEN
Bieter sollten frühzeitig anfangen, die Vergabeunterlagen zu sichten und zu sortieren. Unterlagen auf Vollständigkeit prüfen.Im Zweifel sollten Bieter immer fragen, auch wenn eine ähnliche Frage bereits gestellt wurde. Nuancen in der Formulierung können zu großen Unterschieden führen.Hilfe holen (zum Beispiel Unterstützung durch Rechtsanwaltskanzlei und Beratungsunternehmen) und Vergabeverfahren zur Chefsache machen.Sich frühzeitig mit der Vergabeplattform vertraut machen. Man kann auch ein Testangebot einreichen und dieses wieder zurückziehen. Die Servicehotlines bei Fragen kontaktieren.Freundlich sein. Man sieht sich immer mindestens zweimal im Leben.Rechtsschutzmöglichkeiten nutzen. Wenn alle Bieter sich wehren, dann müssen sich auch die Vergabestellen anpassen.Es sportlich nehmen, wenn man nicht gewinnt. Eine Fehleranalyse im Team gemeinsam erstellen und besprechen.DIE WICHTIGSTEN PUNKTE IN KÜRZE
Art und Größe des Ausschreibungsgegenstands beeinflussen den zu beachtenden Gesetzesrahmen.Die Vergabegrundsätze/-gebote müssen eingehalten werden.Datenschutz und IT-Sicherheit müssen auch bei Vergabeverfahren berücksichtigt werden. Bieter sollten nicht allein auf die IT-Systeme von öffentlichen Auftraggebern zum Schutz ihrer Unterlagen vertrauen.
Vergaberecht für Dummies
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
1. Auflage 2025
© 2025 Wiley-VCH GmbH, Boschstraße 12, 69469 Weinheim, Germany
All rights reserved including the right of reproduction in whole or in part in any form. This book published by arrangement with John Wiley and Sons, Inc. Alle Rechte vorbehalten inklusive des Rechtes auf Reproduktion im Ganzen oder in Teilen und in jeglicher Form. Dieses Buch wird mit Genehmigung von John Wiley and Sons, Inc. publiziert.
Wiley, the Wiley logo, Für Dummies, the Dummies Man logo, and related trademarks and trade dress are trademarks or registered trademarks of John Wiley & Sons, Inc. and/or its affiliates, in the United States and other countries. Used by permission.
Wiley, die Bezeichnung »Für Dummies«, das Dummies-Mann-Logo und darauf bezogene Gestaltungen sind Marken oder eingetragene Marken von John Wiley & Sons, Inc., USA, Deutschland und in anderen Ländern.
Alle Rechte bezüglich Text und Data Mining sowie Training von künstlicher Intelligenz oder ähnlichen Technologien bleiben vorbehalten. Kein Teil dieses Buches darf ohne die schriftliche Genehmigung des Verlages in irgendeiner Form – durch Photokopie, Mikroverfilmung oder irgendein anderes Verfahren – in eine von Maschinen, insbesondere von Datenverarbeitungsmaschinen, verwendbare Sprache übertragen oder übersetzt werden.
Das vorliegende Werk wurde sorgfältig erarbeitet. Dennoch übernehmen Autoren und Verlag für die Richtigkeit von Angaben, Hinweisen und Ratschlägen sowie eventuelle Druckfehler keine Haftung.
Coverillustration: amnaj - stock.adobe.comKorrektur: Jürgen Benvenuti
Print ISBN: 978-3-527-72049-1ePub ISBN: 978-3-527-84162-2
Über die Autorin
Jutta Pertenaïs ist selbstständige Rechtsanwältin und Partnerin einer Technologie- und Managementberatung (Valora Consulting GmbH) in Berlin. Ihr Schwerpunkt liegt im IT-Recht und Vergaberecht. Sie ist eine absolute Technik-Enthusiastin.
Kontakt: [email protected] und [email protected]
Danksagung
Ich möchte diese Gelegenheit nutzen, um meinen aufrichtigen Dank all jenen auszudrücken, die mich während der Erstellung dieses Buchs unterstützt und inspiriert haben, sei es mit sehr guten, sei es mit sehr schlechten Vergabeunterlagen, Ansichten und Äußerungen.
Ein besonderer Dank gebührt auch meinem Mann Martin Pertenaïs. Seine Geduld und wertvollen Ratschläge waren von unschätzbarem Wert für die Erstellung dieses Buchs.
Auch meiner Familie in Deutschland und in Frankreich möchte ich für die starke Unterstützung und Ermöglichung dieses Buchs danken.
Un grand merci également à ma famille française, pour leur soutien et distraction me permettant de refaire le plein d’énergie et de motivation.
Ein herzliches Dankeschön gilt auch meinem Vorgesetzten Prof. Dr. Gora für seine jahrelange Unterstützung und Förderung.
Inhaltsverzeichnis
Cover
Titelblatt
Impressum
Über die Autorin
Danksagung
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
Über dieses Buch
Törichte Annahmen über die Leser
Konventionen in diesem Buch
Was Sie nicht lesen müssen
Wie dieses Buch aufgebaut ist
Symbole, die in diesem Buch verwendet werden
Wie es weitergeht
Teil I: Grundlagen des Vergaberechts
Kapitel 1: Grundlagen der Ausschreibungspflicht
Was regelt eigentlich das Vergaberecht?
Vergaberecht im Wandel der Zeit
Anwendungsbereiche des Vergaberechts
Grundsätze der Vergabe
Lenkungsvorschriften/Aspekte
Treu und Glauben
Grundsatz der Produktneutralität
Kapitel 2: Rechtliche Grundlagen des Vergaberechts
Das deutsche Vergaberecht
Schwellenwerte
Kapitel 3: Vergabearten
Vergabeverfahrensarten unterhalb des Schwellenwerts
Vergabeverfahren oberhalb des Schwellenwerts
De-Facto-Vergabe
Dringlichkeitsvergabe
Interimsvergaben
Dynamisches Beschaffungssystem
Rahmenvereinbarung
Teil II: Erstellung der Vergabeunterlagen
Kapitel 4: Dokumentationspflicht
Kapitel 5: Kommunikation inklusive E-Vergabe
Unterschwellenbereich
Oberschwellenbereich
Kapitel 6: Vorbereitungsphase
Bedarfsermittlung und Markterkundung
Zeitplanung
Fristen
Auftragswertschätzung
Haushaltsmittel und Fördermittel
E-Vergabe
Vertragswahl: Vertrag oder Rahmenvereinbarung
Losvergabe
Optionen
Beauftragung von externen Beratern
Kapitel 7: Die Vergabeunterlagen
Struktur der Vergabeunterlagen
Anschreiben
Bewerbungsbedingungen
Risikoanalyse
Vergabereife
Vertragsunterlagen
Leistungsbeschreibung
Kriterienkatalog
Preisblatt
Unterlagen, die vom Bieter erstellt werden müssen
Teil III: Durchführung des Vergabeverfahrens
Kapitel 8: Bekanntmachung
Fehler in der Bekanntmachung
Bereitstellung der Vergabeunterlagen
Vorinformationen
Kostenlose Vergabeunterlagen
Ausschreibungsportale
Exkurs: Freiwillige Ex-Ante-Bekanntmachung
Exkurs: Vergebener Auftrag
Kapitel 9: Der Teilnahmewettbewerb
Ablauf
Präqualifizierung
Bieterfragen und Fehler in den Vergabeunterlagen
Nachforderungen und Aufklärung im Teilnahmewettbewerb
Kapitel 10: Angebotsphase
Verwahrung und Öffnung der Angebote
Prüfung der Angebote
Nachforderung und Aufklärung in der Angebotsphase
Angebotspräsentation/Bieterpräsentation
Verhandlungsrunden
Teststellung
Ortsbesichtigung
BAFO
Zuschlag
Information nicht berücksichtigter Bieter
Aufhebung
Kapitel 11: Umgang mit Bieterfragen
Kapitel 12: Angebotserstellung
Das Finden der Ausschreibung
Prüfung der Vergabeunterlagen
Angebotserstellung
Kapitel 13: Vergabestatistik
Die Vergabestatistik
Die Nach-Zuschlagsphase
Teil IV: Sonderthemen
Kapitel 14: Datenschutz in Vergabeverfahren
Personenbezogene Daten
Grundsätze für die Verarbeitung personenbezogener Daten
Ermächtigungsgrundlagen
Kapitel 15: EVB-IT Verträge und AGB
Auswahl des EVB-IT
Die EVB-IT Rahmenvereinbarung
Kapitel 16: Altverträge
Kapitel 17: Nachhaltige Beschaffung
Lebenszykluskosten
Lieferkettengesetz
Teil V: Rechtsschutz, Schadensersatz, Haftung und Strafrecht
Kapitel 18: Rechtsschutz – Umgang mit Rügen
Was ist eine Rüge?
Präklusion
Rügerücknahme
Kapitel 19: Nachprüfungsverfahren und Schadensersatzansprüche
Ablauf eines Nachprüfungsverfahrens
Schadensersatzansprüche
Kapitel 20: Haftung
Haftungskonstellationen
Haftungsregelungen in Vergabeunterlagen
Kapitel 21: Strafrechtliche Konsequenzen
Strafrechtliche Grundlagen
Korruptionspräventionsmaßnahmen
Verhaltensempfehlung als Beschuldigter
Teil VI: Fälle und Lösungen
Kapitel 22: Hilfe zur Selbsthilfe
Fall 1: Die Vergabe einer Bierlieferungssoftware
Fall 2: Nur Berliner Unternehmen
Fall 3: Plötzlich öffentlicher Auftraggeber?
Fall 4: Wissensvorsprung ausgeglichen?
Fall 5: Die externen Berater
Fall 6: Baumpflege: Bau- oder Dienstleistungsvergabe?
Fall 7: Funktionaler Auftraggeber
Fall 8: Sektorenauftraggeber
Fall 9: Konzession
Fall 10: Auftragswertschätzung
Fall 11: Inhouse-Vergabe versus Verwaltungskooperation
Fall 12: Aufhebung
Lösung Fall 1
Lösung Fall 2
Lösung Fall 3
Lösung Fall 4
Lösung Fall 5
Lösung Fall 6
Lösung Fall 7
Lösung Fall 8
Lösung Fall 9
Lösung Fall 10
Lösung Fall 11
Lösung Fall 12
Teil VII: Der Top-Ten-Teil
Kapitel 23: Die zehn häufigsten Fehler von Vergabestellen
Zu kurze Vorbereitungsphase
Zu wenig Fachwissen
Ressourcen (Stakeholder) werden nicht genutzt beziehungsweise nicht miteinbezogen
Bieterfragen werden nicht ernst genommen
Die Dokumentation wird nicht fortlaufend erstellt
Unvollständige Vergabeunterlagen
Wahl der falschen Vergabeverfahrensart
Übertriebenes Sicherheitsbedürfnis
Übertriebene Sparmaßnahmen und unnötige Ausgaben
Zu kurze Fristsetzung
Kapitel 24: Die zehn häufigsten Fehler von Bietern
Angebotsunterlagen werden zu spät erstellt
Hochladen des Angebots in letzter Minute
Bieterfragen werden zu selten und zu spät eingereicht
Unwahre Kommunikation
Fehlkalkulationen
Zu günstige Angebote
Angebotsersteller kennt eigenes Leistungsangebot nicht
Kommunikation mit der Konkurrenz beziehungsweise mit anderen Bietern
Zu wenig Rügen
Zu wenig Nachprüfungsanträge
Glossar
Abbildungsverzeichnis
Stichwortverzeichnis
End User License Agreement
Tabellenverzeichnis
Kapitel 1
Tabelle 1.1: Öffentliche Auftraggeber
Kapitel 2
Tabelle 2.1: Quellen der jeweiligen Wertgrenzen
Tabelle 2.2: Schwellenwerte ab 01.01.2024
Kapitel 3
Tabelle 3.1: Zeitplan einer Dringlichkeitsvergabe (offenes Verfahren nach VgV)
Kapitel 6
Tabelle 6.1: Verfahrensarten und Fristen
Kapitel 7
Tabelle 7.1: Themenübersicht Vertragsgestaltung
Illustrationsverzeichnis
Kapitel 1
Abbildung 1.1: Verfahrenslandkarte
Abbildung 1.2: Prüfungsprozess – Prüfungsschritt 1
Kapitel 3
Abbildung 3.1: Öffentliche Ausschreibung
Abbildung 3.2: Beschränkte Ausschreibung
Abbildung 3.3: Verhandlungsvergabe ohne Teilnahmewettbewerb
Abbildung 3.4: Verhandlungsvergabe mit Teilnahmewettbewerb
Abbildung 3.5: Offenes Verfahren
Abbildung 3.6: Nicht offenes Verfahren
Abbildung 3.7: Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb
Abbildung 3.8: Verhandlungsverfahren ohne Teilnahmewettbewerb
Abbildung 3.9: Wettbewerblicher Dialog
Abbildung 3.10: Innovationspartnerschaft
Kapitel 4
Abbildung 4.1: Formblatt Nr. 111 – Vergabevermerk – Wahl der Vergabeart
Kapitel 6
Abbildung 6.1: Prüfungsprozess – Prüfungsschritt 2
Abbildung 6.2: Phasen des Vergabeverfahrens
Abbildung 6.3: Prüfungsprozess – Prüfschritt 3
Abbildung 6.4: Fach- und Teillose
Kapitel 7
Abbildung 7.1: Eignungs- und Zuschlagskriterien
Abbildung 7.2: Prüfungsprozess – Prüfungsschritt 4
Kapitel 8
Abbildung 8.1: Ablauf eines Vergabeverfahrens (vereinfacht)
Kapitel 9
Abbildung 9.1: Einstufige und zwei- beziehungsweise mehrstufige Vergabeverfahren
Abbildung 9.2: Verfahrenslandkarte
Abbildung 9.3: Bekanntmachung eines Präqualifizierungsverfahren
Abbildung 9.4: Nachforderung von Eignungskriterien
Kapitel 10
Abbildung 10.1: Verfahrenslandkarte
Abbildung 10.2: Angebotsprüfung
Abbildung 10.3: Nachforderung/Aufklärung Angebotsphase gemäß § 56 VgV
Abbildung 10.4: Fehler in Vergabeverfahren
Kapitel 13
Abbildung 13.1: Abschluss der Dokumentation mit IDEV
Orientierungspunkte
Cover
Titelblatt
Impressum
Über die Autorin
Einleitung
Inhaltsverzeichnis
Fangen Sie an zu lesen
Glossar
Abbildungsverzeichnis
Stichwortverzeichnis
End User License Agreement
Seitenliste
1
2
5
6
7
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
171
172
173
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
219
220
221
222
223
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
253
254
255
256
257
259
260
261
263
265
267
268
269
270
Einleitung
Das Vergaberecht nimmt in der heutigen Wirtschafts- und Rechtslandschaft eine zentrale Rolle ein. Es regelt die Vergabe öffentlicher Aufträge und stellt sicher, dass diese fair, transparent und wettbewerbsorientiert vergeben werden. Angesichts des enormen wirtschaftlichen Potenzials, das mit öffentlichen Aufträgen verbunden ist, ist es von entscheidender Bedeutung, dass sowohl die öffentlichen Auftraggeber als auch die potenziellen Bieter die grundlegenden Prinzipien und Verfahren des Vergaberechts verstehen und anwenden können.
Häufig wird man mit dem Vergaberecht etwas überraschend konfrontiert: Eigentlich will man nur eine kleine Beschaffung tätigen und plötzlich muss man sich mit den Untiefen des Vergaberechts beschäftigen. Sei es das kleine Catering-Unternehmen, das von der Stadt aufgefordert wird an einem Vergabeverfahren teilzunehmen, um die nächste Veranstaltung mit Leckereien versorgen zu dürfen, oder das örtliche Putzunternehmen, das um seinen bereits jahrelang bestehenden Auftrag kämpfen muss.
An Vergabeverfahren hängen häufig Existenzen. Wenn beispielsweise ein Sicherheitsunternehmen immer im Dezember Hochsaison hat, da es die lokalen Weihnachtsmärkte bewacht, dann ist es schwer das nächste Jahr zu überleben, wenn einmal ein Auftrag an ein anderes Unternehmen erteilt wird.
Auch Mitarbeiter von Behörden und sonstigen öffentlichen Auftraggebern kann es unverhofft treffen. So muss der IT-Leiter eines Krankenhauses häufig auch Vergaberecht beachten, wenn er eine neue Personalmanagementsoftware anschaffen möchte oder eine SAP-Migration notwendig wird. Auch Polizei und Feuerwehr müssen häufig Vergaberecht einhalten. Es ist für viele Bereiche eine große zusätzliche Hürde, die im Berufsalltag plötzlich »mal so nebenbei« auftritt und zu überwinden gilt.
Das Vergaberecht bietet ein hohes Frustrationspotenzial, wenn ein Vergabeverfahren nicht auf Anhieb rund läuft. Man wird jedoch umso mehr belohnt, desto besser man die Spielregeln kennt und so die Chance auf die Durchführung eines erfolgreichen Vergabeverfahrens vervielfacht. Aber genauso gilt: Vergabeverfahren werden unnötig komplex, zeitaufwändig und teuer, wenn man nicht wirklich weiß, was man eigentlich macht. Viele Fehler sind vermeidbar.
Auch als Unternehmen lohnt es sich, die Mitarbeiter im Vergaberecht zu schulen. Häufig haben Unternehmen von Anfang an keine Chance auf den Zuschlag und somit den Gewinn des Auftrages, weil sie sich ohne Strategie oder Rechtskenntnisse einfach treiben lassen. Gute Angebote hingegen gehen auf die Bedürfnisse und Ziele des öffentlichen Auftraggebers ein und umschiffen rechtliche Probleme souverän.
Wenn ein Unternehmen sich zudem nie aktiv mit Vergabeverfahren beschäftigt, bekommt es von dem Milliardenmarkt auch nur Bruchteilhaft – wenn überhaupt – etwas mit. Wer jedoch die Kraft und Zeit aufbringt, das Vergaberecht zu durchblicken, der wird mit einem der schönsten und vielseitigsten Rechtsgebieten belohnt.
Das Thema ist schwierig und kompliziert, aber ich lotse Sie sicher durch diesen Paragrafendschungel und gebe Ihnen Tipps zur Selbsthilfe.
Da es sich bei dem Vergaberecht um ein Rechtsgebiet handelt, werden relativ viele Normen in diesem Buch zitiert. Diese finden Sie im Internet mithilfe von Suchmaschinen (wie zum Beispiel Google). Außerdem können Sie auf folgenden Seiten nachschauen:
die offizielle Seite des Bundesministeriums der Justiz: www.gesetze-im-internet.de – zum Beispiel für die Verordnung über die Vergabe öffentlicher Aufträge (VgV): https://www.gesetze-im-internet.de/vgv_2016/die offizielle Seite der Bundesregierung: www.verwaltungsvorschriften-im-internet.de – zum Beispiel für die Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen Teil A (VOB/A) – Ausgabe 2019: https://www.verwaltungsvorschriften-im-internet.de/bsvwvbund_31012019_BWI781063060120180001604634.htmRichtlinien sind abrufbar unter der offiziellen Seite der Europäischen Union: https://eur-lex.europa.eu – zum Beispiel für die Richtlinie über die öffentliche Auftragsvergabe (Richtlinie 2014/24/EU): https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex%3A32014L0024Über dieses Buch
Dieses Buch widmet sich dem Vergaberecht in all seinen Facetten und richtet sich sowohl an öffentliche Auftraggeber als auch an Unternehmen, die an öffentlichen Ausschreibungen teilnehmen möchten. Es bietet eine umfassende Einführung in das Thema und erläutert die relevanten rechtlichen Rahmenbedingungen, die Verfahrensschritte bei der Vergabe öffentlicher Aufträge sowie die verschiedenen Aspekte der Vertragsabwicklung. Es vermittelt das erforderliche theoretische Wissen und unterstützt gleichzeitig die praktische Anwendung dieses komplexen Rechtsgebiets.
Darüber hinaus wendet sich dieses Buch auch an Studierende und Auszubildende, die sich mit dem Vergaberecht vertraut machen möchten. Es bietet eine didaktisch aufbereitete Darstellung des Themas und ermöglicht einen leicht verständlichen Zugang zu den rechtlichen Grundlagen und Verfahren im Vergaberecht. Dieses Buch dient sowohl angehenden Juristinnen und Juristen als auch Studierenden anderer Fachrichtungen, die sich mit öffentlichen Aufträgen und der Vergabepraxis auseinandersetzen, als wertvolle Lernressource. Es vermittelt nicht nur theoretisches Wissen, sondern stellt auch praktische Anwendungsfälle und Fallbeispiele vor, um das Verständnis und die Anwendung des Vergaberechts zu erleichtern.
Es ist mein Ziel, mit diesem Buch einen umfassenden Leitfaden zum Vergaberecht zu bieten, der sowohl für Einsteiger als auch für erfahrene Praktiker von Nutzen ist. Ich hoffe, dass die Leserinnen und Leser von den detaillierten Erklärungen, praxisorientierten Beispielen und nützlichen Tipps profitieren.
Törichte Annahmen über die Leser
… für Dummies-Leser sind weder ungebildet, noch mangelt es ihnen an Intelligenz. Etwas anderes anzunehmen, wäre töricht. Ihr Interesse an diesem Buch beweist, dass Sie nach einem für Sie geeigneten Einstieg in eine der komplexesten Materien des Rechts suchen.
Für dieses Buch benötigen Sie keine besonderen rechtlichen Vorkenntnisse, wohl aber gesunden Menschenverstand und die Bereitschaft, sich schrittweise in die zunächst ungewohnte Gedankenwelt des Vergaberechts einführen zu lassen.
Konventionen in diesem Buch
»Vergaberecht für Dummies« verzichtet zugunsten der Verständlichkeit auf Vollständigkeit. Es unterscheidet sich dadurch von den klassischen Lehrbüchern zum Vergaberecht, die einen wissenschaftlichen Anspruch verfolgen und dazu dienen, das Rechtsgebiet möglichst lückenlos zu vermitteln. »Vergaberecht für Dummies« nimmt weder die theoretischen Streitfragen auf, die in Rechtsprechung und Literatur teilweise schon seit Jahrzehnten diskutiert werden, noch geht es auf die Besonderheiten ein, die nur für bestimmte Fallkonstellationen gelten. Ferner bleiben Fragestellungen außer Betracht, die sich nur bei erheblichen Vorkenntnissen zu Spezialgebieten des Vergaberechts erschließen.
Schließlich kann und will dieses Buch auch die Rechtsberatung durch einen Anwalt im konkreten Einzelfall nicht ersetzen.
Was Sie nicht lesen müssen
Das Buch ist so aufgebaut, dass der Leser es nicht chronologisch lesen muss. Wenn Vorwissen notwendig wird, dann finden sich Verweise zu den entsprechenden Kapiteln.
Wie dieses Buch aufgebaut ist
Wie alle … für Dummies-Bücher gliedert sich auch dieses in verschiedene Themenbereiche auf. So erkennen Sie schnell die thematisch zusammengehörenden Aspekte des Vergaberechts.
Teil I: Grundlagen des Vergaberechts
Das Buch beginnt mit einer grundlegenden Definition und Erklärung des Vergaberechts und seiner Bedeutung für den öffentlichen Sektor und die Wirtschaft insgesamt. Es beleuchtet die rechtlichen Grundlagen auf nationaler und europäischer Ebene und erläutert die wichtigsten Prinzipien, die bei der Vergabe öffentlicher Aufträge zu beachten sind, wie etwa das Prinzip der Gleichbehandlung, der Transparenz und des fairen Wettbewerbs. Hier werden zudem die einzelnen Vergabeverfahrensarten dargestellt und erklärt. Auch auf Sonderthemen wie De-Facto-Vergabe, Dringlichkeitsvergabe sowie Interimsvergabe wird eingegangen. Am Ende sollte der Leser gut gewappnet sein, um mit der Erstellung der Vergabeverfahren beginnen zu können.
Teil II: Erstellung der Vergabeunterlagen
Im zweiten Teil des Buchs steht die Erstellung der Vergabeunterlagen im Vordergrund. Der Leser erfährt, wie er ein Vergabeverfahren – fortlaufend! – rechtssicher dokumentiert sowie, was er bei der E-Vergabe zu beachten hat. Es wird erläutert, worauf man alles bei der Vorbereitung eines Vergabeverfahrens achten muss. Von der Bedarfsermittlung über die Markterkundung bis zur Zeitplanung wird er hier fündig. Natürlich erfährt er auch alles Wissenswerte zu den einzuhaltenden Fristen. Ein wichtiger Teil sind zudem die Ausführungen zur Auftragswertschätzung, die gern nur stiefmütterlich behandelt wird, aber von enormer Wichtigkeit ist – insbesondere auch bei dem in diesem Teil behandelten Thema Haushaltsmittel und Fördermittel.
Teil III: Durchführung des Vergabeverfahrens
Der dritte Teil des Buchs behandelt die Durchführung des Vergabeverfahrens. In diesem Teil wird jeder Abschnitt in seiner chronologischen Reihenfolge behandelt. Zunächst wird das Thema Bekanntmachung behandelt, danach folgen der Teilnahmewettbewerb sowie die Angebotsphase. Anschließend wird das Verhandlungsverfahren behandelt und es finden sich Informationen zur Angebotsbewertung sowie auch zur Angebotserstellung. Es lohnt sich für öffentliche Auftraggeber, auch die Ausführungen zum Thema Angebotserstellung zu lesen, da die Erstellung deutlich komplexer ist, als man annehmen könnte. Es soll auch Inspiration für simple Vergabeunterlagen bieten. Zudem finden sich auch Ausführungen zum Ende des Vergabeverfahrens, unabhängig davon, ob es erfolgreich oder nicht erfolgreich war: die Themen Zuschlag und Verfahrensaufhebung werden behandelt. Aufgrund der enormen Wichtigkeit von Bieterfragen findet der Leser am Ende dieses Teiles noch ein FAQ zu dem Umgang mit Bieterfragen.
Teil IV: Sonderthemen
In diesem Teil werden Sonderthemen behandelt wie der seit 2018 von enormer Bedeutung gewordene Datenschutz während Vergabeverfahren, die Nutzung der EVB-IT Vertragswerke sowie der Umgang mit Altverträgen. Zudem finden sich hier auch Informationen zum Thema nachhaltige Beschaffung, welches in den letzten Jahren ebenfalls an enormer Bedeutung gewonnen hat.
Teil V: Rechtsschutz, Schadensersatz, Haftung und Strafrecht
In dem fünften Teil des Buchs sind die wichtigsten Grundlagen zum Thema Rechtsschutz enthalten. Die Bieter haben das Recht, zu rügen und Nachprüfungsanträge zu stellen. Die Kapitel dienen insbesondere dazu, in der Situation als öffentlicher Auftraggeber einen kühlen Kopf zu bewahren. Außerdem wird auf das angsteinflößende, aber leider immer wieder relevante Thema Schadensersatz eingegangen. Anschließend wird auf ein weiteres schwieriges Thema eingegangen: die Haftung. Der fünfte Teil schließt mit spannenden Ausführungen zum Thema Strafrecht und soll dem Leser helfen, auf dem richtigen Pfad zu bleiben.
Teil VI: Fälle und Lösungen
Der vorletzte Teil soll dem Leser helfen, sich selbst fortzubilden. Es wird aufgezeigt, wie man an passende Informationen und Unterlagen gelangt. Zudem kann der Leser sein erlerntes Wissen anhand der Übungsfälle samt Lösungen testen.
Teil VII: Der Top-Ten-Teil
Im letzten Teil werden die zehn häufigsten Fehler von Vergabestellen sowie von Bietern dargestellt. Vieles sollte bekannt und daher leicht zu vermeiden sein. Aber die Autorin hofft, dass sie somit beide Seiten vor schlechten Entscheidungen schützen kann.
Symbole, die in diesem Buch verwendet werden
Aufgepasst, hier finden Sie wichtige Informationen, die Sie unbedingt beachten sollten.
Hier finden Sie Begriffserklärungen und Details zu einzelnen Themen.
Mit diesem Symbol sind Beispiele markiert, die Ihnen helfen, die Zusammenhänge zu verstehen.
Tipps und Tricks für Sie!
Hier finden Sie weitere Informationen zu einem Thema.
Wie es weitergeht
Das Buch kann von vorn bis hinten oder auch kapitelweise gelesen werden. Das Ziel ist es, dass der Leser sich in jeder vergaberechtlichen Situation orientieren und wohlfinden kann. Vergaberecht mag ein Dschungel sein, aber bekanntlich sind Dschungel auch voller Leben und Vielfalt.
Ich hoffe, dass der Leser zu all seinen Problemstellungen Antworten findet und am Ende meine Liebe zum Vergaberecht teilt oder zumindest nachvollziehen kann. Nun wünsche ich viel Spaß beim Lesen!
Zusatzmaterial online
Auf der Website zum Buch www.wiley-vch.de/ISBN9783527720491 oder unter www.downloads.fuer-dummies.de finden Sie drei Textvorlagen zum Download.
Eine ChecklisteBewerbungsbedingungen für ein offenes VergabeverfahrenErweiterter Vergabevermerk zur Ergänzung der FormblätterAufgrund der politischen Lage ist derzeit nicht abschätzbar, ob und wann das Vergabetransformationspaket umgesetzt wird. Sobald es umgesetzt wurde, finden Sie auf der Website zum Buch www.wiley-vch.de/ISBN9783527720491 oder unter www.downloads.fuer-dummies.de ein Zusatzkapitel.
Teil I
Grundlagen des Vergaberechts
IN DIESEM TEIL …
Was regelt eigentlich das Vergaberecht?Die Geschichte des VergaberechtsGrundlagen der Ausschreibungspflicht und AusnahmenRechtliche Grundlagen des VergaberechtsVergabeverfahrensartenDe-Facto-VergabeDringlichkeitsvergabeDynamisches BeschaffungssystemRahmenvereinbarungKapitel 1
Grundlagen der Ausschreibungspflicht
IN DIESEM KAPITEL
Grundlagen des VergaberechtsGrundprinzipien des VergaberechtsVergabeverfahrensartenIn diesem Kapitel wird ein Überblick über das Vergaberecht gegeben. Es werden die zentralen Ziele und Prinzipien des Vergaberechts erläutert, wie beispielsweise Transparenz, Gleichbehandlung und Wettbewerb. Zudem werden die Bedeutung und der Anwendungsbereich des Vergaberechts erläutert.
Was regelt eigentlich das Vergaberecht?
Das Vergaberecht ist ein Teilbereich des öffentlichen Rechts. Es umfasst alle Regeln und Vorschriften, die öffentliche Einrichtungen beachten müssen, wenn sie Güter und Leistungen einkaufen. Es ist Verfahrensrecht, das sehr stark vom europäischen Recht beeinflusst wurde. Es wirkt manchmal komplizierter, als es ist, weil viele den Fehler machen, es von »oben« – aus der Adlerperspektive – zu betrachten. Dabei ist es deutlich einfacher, sich auf jeden einzelnen Vorgang zu konzentrieren und schrittweise vorzugehen.
Die in Abbildung 1.1 dargestellte Verfahrenslandkarte wird Ihnen helfen, immer wieder zu sehen, wie weit Sie bereits vorwärtsgekommen sind.
Vergaberecht im Wandel der Zeit
Die Entwicklung des modernen Vergaberechts hat eine lange geschichtliche und rechtliche Tradition, die bis in die Antike zurückreicht.
Bereits im alten Rom gab es erste Regelungen für öffentliche Beschaffungen. Der Staat vergab Aufträge für den Bau von Infrastrukturprojekten wie Straßen, Aquädukten und öffentlichen Gebäuden. Diese Vergabeverfahren waren jedoch häufig von Korruption und Vetternwirtschaft geprägt. Aber bereits die alten Römer erkannten, dass dies ein Bereich ist, der geregelt werden muss, damit nicht immer der Römer mit dem besten Wein die besten Aufträge gewinnt, obwohl er zum Weinanbau besser geeignet ist als zum Straßenbau.
Abbildung 1.1: Verfahrenslandkarte
Im Laufe der Geschichte haben verschiedene Kulturen und Rechtssysteme eigene Regeln und Praktiken für öffentliche Beschaffungen entwickelt. Im mittelalterlichen Europa spielten Gilden und Zünfte eine Rolle bei der Organisation von Bauprojekten und der Vergabe von Aufträgen.
Die moderne Entwicklung des Vergaberechts begann jedoch erst in den letzten Jahrhunderten. Insbesondere im 20. Jahrhundert wurden vermehrt Regelungen geschaffen, um fairen Wettbewerb und Transparenz bei öffentlichen Auftragsvergaben zu gewährleisten.
In Europa hatte die Schaffung eines gemeinsamen Binnenmarkts nach dem Zweiten Weltkrieg einen maßgeblichen Einfluss auf das Vergaberecht. Mit dem Ziel des freien Waren- und Dienstleistungsverkehrs wurden Richtlinien erlassen, die die Vergabe öffentlicher Aufträge harmonisieren und die Diskriminierung von Unternehmen aus anderen EU-Mitgliedsstaaten verhindern sollten.
Ein Meilenstein war die Verabschiedung der ersten Vergaberichtlinie im Jahr 1971 durch die Europäische Gemeinschaft. Diese Richtlinie zielte auf die Harmonisierung der Vergabe öffentlicher Bauaufträge ab. Sie war stark am französischen Recht orientiert und enthielt insbesondere Bestimmungen über die bei der Vergabe öffentlicher Aufträge einzuhaltenden Formerfordernisse.
In den folgenden Jahrzehnten wurden weitere Richtlinien erlassen, die den Anwendungsbereich des Vergaberechts auf Liefer- und Dienstleistungsaufträge ausweiteten.
Die Vergaberichtlinien der Europäischen Union legten die Grundprinzipien des modernen Vergaberechts fest, darunter die Grundsätze der Gleichbehandlung, Transparenz, Nichtdiskriminierung und des freien Wettbewerbs. Die Mitgliedsstaaten waren verpflichtet, diese Richtlinien in nationales Recht umzusetzen.
Im Laufe der Zeit wurden die Vergaberichtlinien mehrfach überarbeitet, um den sich ändernden Anforderungen und Entwicklungen im öffentlichen Auftragswesen gerecht zu werden. Insbesondere die Digitalisierung und der Einsatz elektronischer Vergabeverfahren haben das Vergaberecht beeinflusst und zu effizienteren und transparenteren Vergabeprozessen geführt.
Auch auf nationaler Ebene haben die einzelnen Länder ihre eigenen Vergabegesetze und -vorschriften entwickelt, um die europäischen Richtlinien umzusetzen und spezifische nationale Anforderungen zu berücksichtigen.
Die Vergaberechtsreform von 2016 markierte einen Meilenstein in der Entwicklung des Vergaberechts in Deutschland. Das Ziel der Reform war es, das Vergabeverfahren effizienter, transparenter und rechtssicherer zu gestalten und gleichzeitig den Zugang für kleine und mittlere Unternehmen zu erleichtern.
Zu den wichtigsten Änderungen, die im Rahmen der Reform umgesetzt wurden, zählen:
Die Vereinfachung und Flexibilisierung der Vergabeverfahren: Die Reform führte zu einer größeren Auswahl an Vergabeverfahren, wie beispielsweise dem Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb oder dem innovativen Dialogverfahren. Dies ermöglichte den öffentlichen Auftraggebern, das am besten geeignete Verfahren für ihre Bedürfnisse auszuwählen und den Wettbewerb zu fördern.
Die Einführung der elektronischen Vergabe: Die Reform führte die verpflichtende elektronische Kommunikation und Abwicklung von Vergabeverfahren ein. Dies vereinfachte und beschleunigte den gesamten Vergabeprozess und trug zur Transparenz und Effizienz bei.
Die Stärkung der Berücksichtigung sozialer und ökologischer Aspekte: Die Reform forderte eine stärkere Berücksichtigung sozialer und ökologischer Kriterien bei der Vergabe öffentlicher Aufträge. Dies ermöglichte es den öffentlichen Auftraggebern, nicht nur den Preis, sondern auch qualitative Aspekte wie Umweltverträglichkeit, Arbeitsbedingungen oder Innovationen in ihre Entscheidungen einzubeziehen.
Der erleichterte Zugang für kleine und mittlere Unternehmen: Die Reform enthielt Maßnahmen zur Förderung der Teilnahme von kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) an Vergabeverfahren. Hierzu gehörten beispielsweise die Aufteilung von Aufträgen in Lose, um KMU eine Beteiligung zu ermöglichen, sowie die Vereinfachung der Nachweis- und Eignungskriterien, um die administrativen Hürden für KMU zu verringern.
Die Stärkung der Rechtsschutzmöglichkeiten: Die Reform stärkte die Rechtsschutzmöglichkeiten für Bieter, indem sie das Instrument der Rüge und die Möglichkeit der Durchführung von Nachprüfungsverfahren ausweitete. Dadurch sollten Fehler oder Verstöße im Vergabeverfahren besser erkannt und behoben werden können.
Die Vergaberechtsreform von 2016 trug maßgeblich zur Modernisierung des Vergaberechts in Deutschland bei. Sie führte zu einem transparenteren und effizienteren Vergabeverfahren, erleichterte den Zugang für KMU und legte einen verstärkten Fokus auf soziale und ökologische Aspekte. Die Reform sollte dazu beitragen, das Vertrauen in das Vergabesystem zu stärken und eine wirtschaftliche und nachhaltige Beschaffung von öffentlichen Aufträgen zu gewährleisten.
Die Geschichte des Vergaberechts zeigt, dass der Wunsch nach fairem Wettbewerb, Transparenz und Effizienz bei öffentlichen Auftragsvergaben schon lange besteht. Das moderne Vergaberecht ist das Ergebnis einer langen Entwicklung und hat zum Ziel, gleiche Chancen für Bieter zu gewährleisten und den bestmöglichen Wert für die öffentliche Hand zu erzielen. Es bleibt ein dynamisches Rechtsgebiet, das sich weiterentwickelt, um den aktuellen Herausforderungen im öffentlichen Auftragswesen gerecht zu werden.
Eine nicht zu unterschätzende Rolle im Vergaberecht spielt auch die Politik. Dazu zählen insbesondere ökologische, sozialpolitische und wirtschaftspolitische Aspekte. Man sollte aufpassen, dass man nicht zum Spielball wird, und überlegen, ob und wie das eigene Unternehmen auch mit plötzlichem öffentlichem Interesse umgehen kann.
Anwendungsbereiche des Vergaberechts
Der Anwendungsbereich des Vergaberechts ist durch Gesetze und Verordnungen geregelt.
Für Privatpersonen gilt das Vergaberecht nicht. Daher ist zunächst zu klären, wer eigentlich eine Beschaffung durchführen möchte. Der persönliche Anwendungsbereich des Vergaberechts ist in dem § 98 GWB (Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen) geregelt und der sachliche Anwendungsbereich ist in § 103 GWB definiert.
Abbildung 1.2 wird an mehreren Stellen des Buchs wieder auftauchen. Sie soll dem Leser eine Orientierung bieten bei der Feststellung der Vergabereife. Der orangene Kasten zeigt immer an, bei welchem Hauptthema wir gerade sind. Es ist anzuraten, die Prüfungsschritte hintereinander zu prüfen, da sie aufeinander aufbauen.
Abbildung 1.2: Prüfungsprozess – Prüfungsschritt 1
Grundsätzlich gelten die Regeln des Vergaberechts nur für öffentliche Aufträge, welche durch öffentliche Auftraggeber durchgeführt werden. Öffentliche Auftraggeber sind zum Beispiel:
Bundesbehörden
Landesbehörden
Gemeinden
öffentliche Unternehmen
In der Regel sind auch Aufträge, die von EU-Organisationen vergeben werden, von den Regeln des Vergaberechts betroffen.
Es gibt auch Ausnahmen vom Anwendungsbereich des Vergaberechts. Zum Beispiel können bestimmte Aufträge, die aufgrund ihrer geringen Größe oder ihres besonderen Charakters von den Regeln des Vergaberechts ausgenommen sind, direkt vergeben werden.
In §§ 107 bis 109 GWB finden sich allgemeine Ausnahmetatbestände vom GWB-Vergaberecht für alle Vergabearten. Diese sind abschließend und eng auszulegen. Damit ist gemeint, dass wenn ein Ausnahmetatbestand vorliegt, kein Vergaberecht gemäß §§ 97 GWB einzuhalten ist. Mit »enger Auslegung« ist gemeint, dass es keinen großen Interpretationsspielraum gibt.
Gemäß § 107 GWB ist kein Vergabeverfahren durchzuführen, wenn ein Arbeitsvertrag abgeschlossen werden soll. Zum Beispiel, wenn ein IT-Leiter oder eine andere Fachkraft für eine Behörde intern gesucht wird.
Wenn jedoch ein Dienstleister gesucht wird – hier zum Beispiel ein IT-Leiter für ein bestimmtes Projekt – ohne das mit der einzelnen Person ein Arbeitsvertrag abgeschlossen werden soll, dann liegt der Ausnahmetatbestand gemäß § 107 GWB nicht vor.
Der öffentliche Auftraggeber
Wer als Auftraggeber Vergaberecht zu beachten hat, ergibt sich aus §§ 98 ff. GWB. Man unterscheidet zwischen öffentlichem Auftraggeber (§ 99 GWB), Sektorenauftraggeber (§ 100 GWB) und Konzessionsgeber (§ 101 GWB), siehe Tabelle 1.1.
Öffentliche Auftraggeber im Sinne von § 99 GWB sind:
Gebietskörperschaften sowie deren Sondervermögen (auch als »klassische« öffentliche Auftraggeber bezeichnet),juristische Personen, die aufgrund ihrer Funktion und ihrer besonderen Staatsgebundenheit unter den öffentlichen Begriff des öffentlichen Auftraggebers fallen (funktionaler Auftraggeber),Verbände der Gebietskörperschaften oder des funktionalen Auftraggebers undPrivatpersonen sowie juristische Personen bei bestimmten Bauvorhaben (zum Beispiel der Errichtung von Krankenhäusern, Schul- oder Verwaltungsgebäuden), sofern das Vorhaben überwiegend durch den Staat subventioniert wird.Eine öffentliche Gebietskörperschaft ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts, deren Hoheitsgebiet durch einen räumlich begrenzten Teil des Staatsgebietes bestimmt wird. Öffentliche Gebietskörperschaften in Deutschland sind der Bund, die Bundesländer und die Kommunen.
Anhang III der Vergabekoordinierungsrichtlinie enthält eine Auflistung der in Deutschland zur Anwendung des Vergaberechts verpflichteten Rechtssubjekte.
Beispiel funktionaler Auftraggeber:
Ein funktionaler Auftraggeber ist ein originär nicht öffentlicher Auftraggeber, der für die Vergabe von Aufträgen an Dritte verantwortlich ist, obwohl er selbst nicht der Auftraggeber im engeren Sinne ist.
Öffentlicher Auftraggeber (ÖAG)
Erläuterung
Beispiele
»klassische« ÖAG § 99 Nr. 1 GWB
Gebietskörperschaften sowie deren Sondervermögen
Bund, Länder, Regierungsbehörden, Landkreise, Gemeinden und Eigenbetriebe (= Sondervermögen)
»funktionale« ÖAG § 99 Nr. 2 GWB
Juristische Personen des öffentlichen Rechts sowie des Privatrechts
Anstalten, Körperschaften, Stiftungen, kommunale Krankenhäuser, kommunale Entsorgungsunternehmen
Verbände § 99 Nr. 3 GWB
Verbände, deren Mitglieder unter § 99 Nr. 1 und Nr. 2 GWB fallen.
Zweckverbände, Spitzenverbände
Projektfinanzierte AG § 99 Nr. 4 GWB
Natürliche oder juristische Personen des privaten Rechts sowie juristische Personen des öffentlichen Rechts, soweit sie nicht unter Nummer 2 fallen, in den Fällen, in denen sie für Tiefbaumaßnahmen, für die Errichtung von Krankenhäusern, Sport-, Erholungs- oder Freizeiteinrichtungen, Schul-, Hochschul- oder Verwaltungsgebäuden oder für damit in Verbindung stehende Dienstleistungen und Wettbewerbe von Stellen, die unter die Nummern 1, 2 oder 3 fallen, Mittel erhalten, mit denen diese Vorhaben zu mehr als 50 Prozent subventioniert werden.
Tiefbaumaßnahmen (zum Beispiel Straßenbau, Brückenbau, Tunnelbau), Kläranlagenbau, Krankenhausbau, Schulgebäudebau
Sektorenauftraggeber § 100 GWB
Sektorenauftraggeber
Stadtwerke, Wasserversorgungsunternehmen, Energieversorgungsunternehmen
Konzessionsgeber § 101 GWB
Konzessionsgeber
ÖAG nach §§ 99 Nr. 1–3, 100 GWB
Tabelle 1.1: Öffentliche Auftraggeber
Das kann etwa eine GmbH sein, die von der Stadt beauftragt wird, eine öffentliche Einrichtung zu betreiben. Häufig sind das etwa Stadtwerke, die auch Bäder betreiben oder die Einwohner mit Energie versorgen.
Sektorenauftraggeber im Sinne von § 100 GWB sind öffentliche Auftraggeber, die eine Sektorentätigkeit ausführen. Als Sektorentätigkeit wird eine Tätigkeit in den Bereichen Trinkwasserversorgung, Elektrizität, Gas, Wärme und Verkehr bezeichnet (siehe auch § 192 GWB).
Konzessionsgeber im Sinne von § 101 GWB sind öffentliche Auftraggeber oder Sektorenauftraggeber, die eine Konzession vergeben. Eine Konzession ist das Nutzungsrecht an einem Gemeingut, welches durch die staatlichen Behörden übertragen wird.
Als »öffentliche Hand« bezeichnet man umgangssprachlich auch den kompletten öffentlichen Sektor, vor allem die Gebietskörperschaften (Bund, Länder und Gemeinden) und Körperschaften des öffentlichen Rechts.
Die »öffentliche Hand« unterliegt grundsätzlich dem Vergaberecht.
Der öffentliche Auftrag
Wortlaut des § 103 Abs. 1 GWB: Öffentliche Aufträge sind entgeltliche Verträge zwischen öffentlichen Auftraggebern oder Sektorenauftraggebern und Unternehmen über die Beschaffung von Leistungen, die die Lieferung von Waren, die Ausführung von Bauleistungen oder die Erbringung von Dienstleistungen zum Gegenstand haben.
Alles, was der öffentliche Auftraggeber benötigt, ist somit ein öffentlicher Auftrag. Auch die Beschaffung von Alltagsgegenständen, wie zum Beispiel der Einkauf von Toilettenpapier.
Besonders wichtig ist hier das Wort »entgeltlich«, welches klarstellt, dass der öffentliche Auftraggeber eine Gegenleistung im Sinne einer eigenen Zuwendung geben muss.
Entgelt bedeutet jedoch nicht zwingend nur Geld. Der Begriff des »Entgelts« ist weit auszulegen. Er umfasst jede Art von Vergütung, die einen Geldwert haben kann. Das kann zum Beispiel auch eine Nennung sein, die als Werbung geeignet ist, oder der Tausch von Gegenständen.
Ein bekanntes Beispiel ist die Entsorgung von Altpapier. Die Überlassung des Sekundärrohstoffes zur eigenständigen wirtschaftlichen Verwertung hat dem BGH (BGHZ 162, 116) bereits ausgereicht, und das, obwohl der Auftragnehmer sogar selbst das Papierentgelt bezahlt hat.
Die Ausnahmetatbestände
Nicht immer muss Vergaberecht angewandt werden. Je nach Auftragsart kann ein Ausnahmetatbestand vorliegen. Die Ausnahmetatbestände finden sich in den §§ 107 ff., 116 f., 137 ff. und 144 ff. GWB.
Die Ausnahmetatbestände sind eng auszulegen und können nicht analog auf andere Fälle angewendet werden. In § 107 GWB sind die allgemeinen Ausnahmetatbestände geregelt. Demnach muss Vergaberecht nicht bei der Bestellung
von Schiedsgerichts- und Schlichtungsleistungen;
bei Immobiliengeschäften;
bei Arbeitsverträgen sowie hinsichtlich einzelner Dienstleistungen des Katastrophenschutzes, des Zivilschutzes und der Gefahrenabwehr und
im Anwendungsbereich der VSVgV zudem bei bestimmten Aufträgen für Militärprodukte
beachtet werden.
In §§ 116 f., 137 ff. und 144 ff. GWB finden sich zudem besondere Ausnahmetatbestände. So gibt es Ausnahmen in § 116 GWB für zum Beispiel:
Rechts-, Forschungs- und Entwicklungsleistungen,
Rundfunk- und Mediendienste
sowie Finanzierungsverträge.
Für besondere Bereiche, wie zum Beispiel den Bereich der verteidigungsspezifischen Vergaben (§ 107 Abs. 2 GWB), den Bereich internationaler Organisationen (§ 109 GWB) sowie die Telekommunikation in ihrem Kern (§ 116 Abs. 2 GWB), gibt es zudem Bereichsausnahmen.
Zudem muss in den Fällen der öffentlich-rechtlichen Zusammenarbeit – den sogenannten Inhouse-Geschäften – oder der interkommunalen Zusammenarbeit (in-state) gemäß § 108 GWB unter den dort normierten Voraussetzungen kein Vergabeverfahren durchgeführt werden.
Eine weitere Ausnahme ist das Open-House-Modell





























