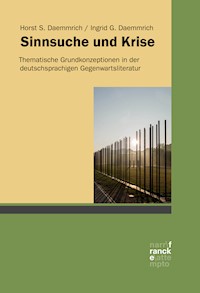Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Narr Francke Attempto Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Ein zentrales Thema in der deutschsprachigen Literatur seit 1945 ist die Aufarbeitung und Deutung der Vergangenheit. Sie umfasst Beispiele erfolgreicher Sinnsuche ebenso wie Fälle katastrophalen Scheiterns und spiegelt in diesen unterschiedlichen, oft unvereinbaren Auslegungen unmittelbarer Erlebnisse und Erinnerungsdiskurse die Zerrissenheit der deutschen Nachkriegsgesellschaft. Literarische Auseinandersetzungen mit der Vergangenheit finden sich sowohl in novellistischen Skizzen, knappen faktisch orientierten Reportagen, Kriegsberichten, autobiographisch angelegten, aber fiktiv erweiterten Erzählungen, Chroniken deutscher Geschichte und Rückgriffen auf die Antike als auch in künstlerisch anspruchsvollen, großangelegten Romanen und fantasievollen Erkundungen eines historischen Verlaufs, der im Gegensatz zu geschichtlichen Ereignissen nur im Märchenland des Denkbaren existiert. Die repräsentativen Texte verdeutlichen eine Grundkonzeption, in der Erleben, Erinnern, Deuten und Gestalten der Vergangenheit den Gesichtskreis bestimmen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 512
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Horst Daemmrich
Vergangenheit
Narr Francke Attempto Verlag Tübingen
© 2017 • Narr Francke Attempto Verlag GmbH + Co. KG Dischingerweg 5 • D-72070 Tübingen www.francke.de • [email protected]
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
E-Book-Produktion: pagina GmbH, Tübingen
ePub-ISBN 978-3-7720-0028-7
Inhalt
Vorwort
Die deutschsprachige Gegenwartsliteratur vergegenwärtigt sowohl Anschlüsse an die literarische Tradition, erzähltechnische Neuansätze und postmoderne Erzählungen als auch stilistische Eigenheiten des sozialistischen, klinischen und magischen Realismus. Sie zeigt Eigenheiten, die einige Literaturkritiker davon überzeugten, von Literaturen im getrennten und wiedervereinigten Gesamtdeutschland zu sprechen. So kritisiert Fritz J. Raddatz die Konzentration der „westdeutschen“ Literatur auf subjektive Nuancen in der Figurengestaltung, die Ich-Suche und die Nichtbeachtung des politischen Horizonts. Im Gegensatz dazu findet er in den Schriften übergesiedelter DDR-Autoren und Autorinnen die bewusste Auseinandersetzung mit den wesentlichen Fragen der Zeit: „Es gibt eine dritte deutsche Literatur. Nach Jahren, in denen von einer ‚zweiten deutschen Literatur‘ – also der DDR-Literatur – gesprochen und in denen die Abgrenzungen der beiden Literaturen wie ihre gegenseitige Durchdringung, auch Befruchtung diagnostiziert wurde, kann über den aktuellen Stand der literarischen Szene gesagt werden: Die zeitgenössische westdeutsche Literatur sieht den Menschen als genetischen Code, die Welt als ein System ohne Zukunft, die Kunst als Rätsel. Beide deutsche Literaturen bestimmen wesentlich Verkrochenheit, Ich-Bezogenheit und Aufarbeiten von Mythen und Träumen. Zwischen ihnen hat sich als besondere Kraft ‚eine dritte deutsche Literatur‘ etabliert – es ist die jener Autoren, die aus der DDR in die Bundesrepublik übergesiedelt sind … es sind Schriftsteller, die ihre historische Erfahrung, ihre politische Bildung und ihre moralische Interventionslust nicht als Gepäck an der Mauer abgegeben haben.“1
Der für das kommende Jahr geplante zweite Band erläutert maßgebende Themen und Motive in der thematisierten Gegenwart und Zukunft. Gemeinsam ermöglichen die Bände aufschlussreiche Einblicke in Texte, die sonst selten verglichen werden. Die Gegenüberstellung von einem Gartenhaus in der Schweiz (Thomas Hürlimann, Das Gartenhaus.1989. 2001) und einem Tag in Berlin (Christa Wolf, Juninachmittag.1967) erschließt thematische Entsprechungen. Geschichten aus dem Alltag akzentuieren in einer kunstvoll, feinfühlig psychologisch motivierten Schilderung die Leiden und Selbsterkenntnis einer Frau (Sibylle Knauss, Die Nacht mit Paul.1994), eine medientechnologisch gleichgeschaltete Gesellschaft (Martin Grzimek, Die Beschattung.1989), die innere Brüchigkeit in einer scheinbar heilen bürgerlichen Familie (Marlen Haushofer, Wir töten Stella.1958. 1991), den absoluten Liebesverlust in einer dumpfen, erschreckenden Welt (Evelyn Grill, Wilma.1994), die Flucht vor jeder möglichen Selbsterkenntinis (Peter Rosei, Von Hier nach Dort.1978), und positive Sinnstiftungen in der Suche nach Orientierung (Jurek Becker, Bronsteins Kinder. 1986; Klaus Hoffer, Bei den Bieresch. 1983).
Die Darstellung verfolgt besonders folgende wiederkehrende Kontraste und Grundkonstellationen: Anpassung/Auflehnung, Liebe/Liebesverlust, politisches Engagement/Flucht ins Abseits, Jugend und Bejahung des Lebens/schwerdepressive Pyjamaexistenzen im Vorzimmer des Todes, in der Irrenanstalt und im Altersheim, Ich-Suche und Kontaktverlust, Ich-Suche und Selbsterkenntnis. Die Themenforschung beleuchtet Gemeinsamkeiten im Rahmen kompositorischer Differenzen. Die vorliegende Darstellung untersucht die thematisierte Vergangenheit und ist der erste Band der Bestandsaufnahme „Sechs Jahrzehnte. Grundkonzeptionen und wegweisende thematische Entwürfe in der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur unserer Zeit“.
Die vorliegende Untersuchung entwickelt, erweitert und vertieft Überlegungen, die ich zuerst in Konferenzbeiträgen, Festschriften und Sammelbänden vorgelegt habe.2 Ich danke meinen Kollegen Karl. F. Otto jr., Frank Trommler und Volker Wehdeking für ihre langjährige Unterstützung. Ich bin besonders Dr. Valeska Lembke für die sorgfältige Überarbeitung des Manuskripts dankbar.
1.Einführung
Die NS-Zeit ist eine Zäsur in der deutschen Geschichte, die auch die Literatur stark beeinflusst hat. Die Sicht auf die und der Umgang mit der Vergangenheit und besonders der NS-Vergangenheit, den Jahren des getrennten Deutschlands und des Mauerfalls wird zum wichtigen literarischen Thema. Die Auseinandersetzung mit der Vergangenheit setzt sofort nach 1945 mit Kurzgeschichten, Erzählungen, Hörspielen und Schauspielen ein. Sie führt in die Gegenwart und besteht fort in der jüngsten Literatur, in Aufarbeitungen der DDR-Zeit, in Schilderungen des Mauerfalls und in Ortungen des durch ein vereintes Deutschland bedingten Mentalitätswandels. Die Auslegungen reichen von novellistischen Skizzen, knappen faktisch orientierten Reportagen, Kriegsberichten, autobiographisch angelegten, aber fiktiv erweiterten Erzählungen, Chroniken deutscher Geschichte und Rückgriffen auf die Antike bis zu künstlerisch anspruchsvollen, großangelegten Romanen und fantasievollen Erkundungen eines historischen Verlaufs, der im Gegensatz zu geschichtlichen Ereignissen nur im Märchenland des Denkbaren existiert. Die im Einzelnen besprochenen Texte, die sowohl allen Lesern und Leserinnen vertraute als auch unbekannte Werke einschließen, sollen die Diskussion vertiefen.
Im Umgang mit der Vergangenheit setzen nach 1945 die Autor(inn)en, besonders Ilse Aichinger, Jurek Becker, Heinrich Böll, Wolfgang Borchert, Willi Bredel und Elisabeth Langgässer, Akzente, die bis heute wirksam sind. Sie erneuern die in der Neuen Sachlichkeit ausgeprägte Tendenz, der realistisch-sachlichen Gestaltung von historischen und gesellschaftlichen Entwicklungen Priorität einzuräumen. Darüber hinaus befragen und präzisieren sie eine in der Nachkriegsliteratur des Ersten Weltkrieges ersichtliche Grundform des Denkens, die sowohl ein Urteil über als auch ein Verhältnis zur Vergangenheit einschließt. Sie ist deutlich ausgeprägt in Werken, in denen die verflossenen Kriegsereignisse ihren Schatten über das Denken und Handeln der Figuren werfen. Sie kommt selbst dann unvermittelt zu Wort, wenn die Texte den Krieg keineswegs thematisieren. In der Erzählhaltung, im Denken der Figuren und in eingeflochtenen Reflexionen der Erzähler wird einerseits ein eindeutiges ethisches und politisches Engagement erkennbar. Andererseits zeichnen sich Tendenzen ab, die sowohl Resignation ausdrücken als auch die Ohnmacht angesichts historischer Abläufe, die sich dem Eingriff Einzelner entziehen.
Aichinger, Böll und Grass erweitern und vertiefen die Fragestellung von Schuld und Sühne. Wiederkehrende, aus wechselnder Perspektive entwickelte Motive und Themen, die zuweilen Vorstellungen aus den Entnazifizierungsprozessen übernehmen, erwecken den Eindruck einer umfassenden Bestandsaufnahme. Die Texte schildern Täter und Opfer, willige Helfer und Mitläufer, Anpassung und aktiven oder inneren Widerstand, aber auch Pflichterfüllung und verfehltes Vertrauen auf eine neue Ordnung. Die Gemeinsamkeiten und gravierenden Unterschiede in der Einstellung zur Schuldfrage verleihen der Literatur einzelne scharf profilierte Züge. In der erzählenden Literatur herrschen zuerst Anklage und Richten vor, später Aufarbeitung und Versuche, die Einstellung und das Verhalten Einzelner oder einer Gruppe zu verstehen. In der militärischen Erinnerungsliteratur setzt sich sofort die Berufung auf den Ausnahmezustand und die mit ihm verbundenen Fragen von Pflichterfüllung und dem kriegsbedingten Handeln Einzelner durch.
Die frühen Auseinandersetzungen mit der besonderen historischen Entwicklung in Deutschland, den kollektiven wie auch individuellen Verhaltensweisen und dem Wirken Einzelner während der NS-Zeit und im Krieg erwecken erzähltechnisch den Eindruck dokumentarischer Treue. Sie vereinheitlichen die Fülle realistisch geschilderter Einzelheiten durch die Konzentration auf die inneren und äußeren Konflikte, die Entscheidungen, das Handeln und die Unterlassungen von Einzelfiguren. Auf diese Art entstehen Erzählungen, in denen qualvoll leidende Verfolgte und Widerstandskämpfer, gewalttätige Offiziere und unentschieden zögernde Landser zu Wort kommen.
Die Darstellungen setzen ein Verhalten voraus, das nicht ableitbar ist von zeitbedingtem Handeln der Menschen, die die Orientierung verloren haben, keine sicheren Maßstäbe für ihre Entscheidungen finden und sich dem kollektiven Interesse fügen. Zuweilen unausgesprochen, zunehmend häufig in Dialogen und Selbstgesprächen der Figuren zeichnet sich eine ethisch verankerte, zeitlose Deutung des verantwortlichen Handelns ab. Der Blick zurück, sei er von Beteiligten, Überlebenden, Kindern oder Enkeln, erfasst die Vergangenheit aus einer Sicht des richtigen und falschen, sittlichen und unsittlichen Handelns. Alle Nachkriegsautoren, die sich mit der NS-Zeit und dem Krieg auseinandersetzten, trugen zu einem wachsenden historischen Bewusstsein bei und haben maßgeblichen Anteil an der Entwicklung eines kollektiven Selbstverständnisses. Sie betrachten die Vergangenheit als ein unabgeschlossenes Kapitel, als einen im Entstehen begriffenen Entwurf einer umfassenden Dokumentation.
Was ist das, die Vergangenheit? Der Begriff kennzeichnet geschichtlich überlieferte Ereignisse aus einer zurückliegenden Zeit. Die Überlieferung umfasst jedoch ein weites Feld: Quellen, historische Darstellungen, die zugleich Interpretationen sind, Tatsachenberichte, soziologische, politische, philosophische Auslegungen und literarische Konzeptionen.Historische Ausführungen teilen gewöhnlich Geschichte in zusammenhängende Abschnitte ein, die eine Verstehenseinheit bilden. Jeder Abriss enthält eine der Schilderung angemessene Abstraktionsebene. Für die Beurteilung historischer Prozesse bleiben die im Schnittpunkt literarischer Schilderungen liegenden Schicksale, Freuden und Leiden, Erfolge und Misserfolge Einzelner im Hintergrund. Deshalb besteht grundsätzlich eine tiefgreifende Spannung zwischen dem Kollektivgeschehen und dem Schicksal Einzelner. Literarische Texte konzentrieren sich auf diesen Schnittpunkt zwischen kollektiven und persönlichen Erfahrungen und versuchen, im individuellen Erlebnis die geschichtliche Dimension anzudeuten und ein Geschichtsbewusstsein zu vermitteln, das im Konkreten das Allgemeine erfasst.
Historiker konstatierten, dass es nach dem Ende des Ersten Weltkrieges im November 1918 keine Möglichkeit gab, sinnvoll an die vorausgegangenen Zeiten anzuknüpfen.3 Kulturgeschichtlich orientierte Untersuchungen verdeutlichen jedoch tiefgreifende Verflechtungen und Traditionen, die Schwerpunkte für das Verständnis eines historischen Ablaufs formen.4 Die Literatur verdeutlicht die Problematik in historischen Untersuchungen, die sich mit der Frage auseinandersetzen, inwiefern objektive, faktische Darstellungen der Vergangenheit überhaupt möglich sind oder ob jedes Urteil von persönlichen Erfahrungen der Wissenschaftler beeinflusst wird.5 Die kritische Aneignung, Distanzierung und tiefgreifende Umwertung der historischen Bewusstseinslage verläuft in drei Phasen. In ihrem Ablauf setzt sich die Erkenntnis durch, dass jede Erinnerung an und Auseinandersetzung mit der Vergangenheit von der jeweils gegenwärtigen gesellschaftlichen Umwelt mitbestimmt wird. Individuelle und kollektive Erinnerungen hängen von den zeitbedingten, zurückliegenden und gegenwärtigen Umständen ab. Die Entwicklung setzt nach 1945 in den Auseinandersetzungen mit der deutschen NS-Vergangenheit ein, wird in der Literatur der sechziger bis achtziger Jahre in der Fragestellung erweitert und prägt literarische Ortungen und möglicherweise das Selbstverständnis einzelner Autor(inn)en bis heute. Begrifflich schließt die Denkform Fragen von persönlicher Verantwortung, sittlichem Handeln wie auch Schuld und Sühne ein. Die Entwicklung mündet schließlich in die eigenartige Situation, in der die Vergangenheit scheinbar unvermittelt in die Texte hineinredet, zur Kurzformel für eine alle Deutschen belastende Erbsünde geworden ist, aber zugleich im Blick zurück zum Ausgangspunkt einer kritischen Auseinandersetzung mit der eigenen Zeit wird.
Die Vergangenheit lebt auf, sobald Autor(inn)en Figuren entwerfen, die über sich nachdenken und ihr persönliches Selbstverständnis entwickeln, das sich nicht von dem nationalen Selbstverständnis trennen lässt. Diese Vergegenwärtigungen haben eine gemeinsame historische Substanz. Sie sind einerseits individualisiert, da Erzählungen die Ereignisse aus der Perspektive und Erlebnissphäre Einzelner gestalten. Andererseits erhalten sie eine Abstraktion des Allgemeinen oder Typischen durch die unterschiedlichen Erzählverfahren, durch eingeflochtene Kommentare und Fragen an die vorausgegangene Generation, die manchmal zu Familienzerwürfnissen führen. Fragen, Dialoge und Selbstgespräche erweitern die historische Sicht, in der sich dann ein mögliches Verstehen der Geschichte anbahnt. Darüber hinaus stoßen die Darstellungen auf schwer zu beantwortende Fragen, die die nationalsozialistische Vergangenheit betreffen. Die gegenwärtigen politischen Debatten über Schuld, Verbrechen, Nazi-Opfer, Holocaust, aber auch Schlussstrich, einseitige Stilisierung und Anklagen gegen die Tätergeneration, sowie Erkundung der Leiden einer verführten Generation wiederholen sich in den Erzählungen.
Die Befragung der Vergangenheit nimmt vielfältige Formen an. Sie kann direkt erfolgen, indem die Handlung in die Vergangenheit verlegt wird. Darstellungen erwecken zuweilen, besonders wenn sie auf historisch belegbare Ereignisse zurückgreifen, den Eindruck realistischer Berichterstattungen. Deutlich erkennbar sind markante stilistische Unterschiede zwischen kritisch reflektierten Auseinandersetzungen und Schilderungen von Kriegserlebnissen, die versuchen, authentisch überzeugend, aus der Nahperspektive Ereignisse festzuhalten. Die Nahperspektive verwickelt Leser. Der Anspruch auf Authentizität – ich sehe, fühle, spüre – ist besonders deutlich ausgeprägt in der Kriegsliteratur. Er verbürgt, dass das Vergangene im Text, belegt durch Dokumentationen, die sich auf eigene Erlebnisse, Aussagen von Zeitzeugen, Briefe und Nachrichten aller Art (Zeitungen, Radio, Wochenschauen) stützen, zuverlässig und glaubwürdig festgehalten ist. Die eingehende Untersuchung der Kriegsliteratur zeigt jedoch einerseits Rückgriffe auf tradierte Motive in der Kriegsthematik, andererseits dass das Gedächtnis der Autoren nachhaltig individuell gefärbt ist. Die Befragung ist ferner integriert in Generationskonflikten, die ihren Ursprung in der Sensibilisierung für die politische Vergangenheit haben; sie kann im Mittelpunkt von Identitätskrisen stehen; sie bildet den Rahmen für autobiographische Darstellungen, die das Verhältnis Einzelner zum historischen Geschehen thematisieren; sie ist oft verknüpft mit primären Themen (Anpassung; Entwicklungsthematik; Holocaust; Reifung; Selbst- und Welterkenntnis) und Motiven (Konflikte zwischen Eltern und Kindern bzw. zwischen Vater und Sohn oder Tochter). In Auseinandersetzungen mit der jüngsten Vergangenheit des geteilten Deutschlands kommen hinzu: Utopie und Verlust der utopischen Vision; alle Bereiche des Alltagslebens im sozialistischen Staat; Stasi und Spitzelunwesen. Die erstaunliche Sensibilität für die politische Vergangenheit ist nicht auf deutsche Autoren und Autorinnen begrenzt, sondern gehört zum Gesamtbild der deutschsprachigen Literatur. Einerseits regt die Bestandsaufnahme der gegenwärtigen Situation zur Befragung der Vergangenheit an. Andererseits entwerfen zahlreiche Autoren Erzählungen, in denen die Vergangenheit als wirksames Kolorit für das Geschehen dient.
Der Anspruch, authentisch zu berichten, ist außerdem besonders ausgeprägt in fiktiven historischen Erzählungen, die sich auf Lebensläufe unbekannter, vergessener oder umgedeuteter „Personen“ konzentrieren. Das Verfahren, klar ersichtlich in Geschichten von Wolfgang Hildesheimer (Marbot. Eine Biographie.1981), Christoph Ransmayr (Die Schrecken des Eises und der Finsternis.1984) und Horst Stern (Mann aus Apulien. Die privaten Papiere des italienischen Staufers Friedrich II.1986), stellt eine Figur in den Schnittpunkt des Geschehens, die keine Spuren hinterließ und deshalb von Historikern übersehen wurde. Diese Erzählungen verwischen bewusst die Grenze zwischen Geschichte, Vergangenheit und Fiktion.
In anderen Darstellungen erscheint zuweilen die Gegenwart aus der Perspektive einer erstrebenswerten ausgeglichenen Gesellschaftsordnung. Die Vergangenheit dagegen erweckt den Eindruck einer unabgeschlossenen Akte. Sie prägt die Gegenwart und kommt deshalb in manchen Texten in Ereignissen oder Reflexionen der Erzählstimmen unvermittelt zu Wort. So entsteht der Eindruck, die Geschichte rede noch immer in alles Geschehen hinein. Die Gespräche verleihen den Figuren aus der Vergangenheit plastisch-realistisches Sein. Sie geben den Verstorbenen, den Stummen und denen, die zum Schweigen verurteilt waren, die Stimme zurück. Die Autor(inn)en versetzen sich in die Lage der direkt Beteiligten, der Opfer, Täter, Mitläufer und aller, die innerlich das Regime ablehnten, aber den Umständen erlagen. Sie verfolgen den eigentümlichen Sachverhalt, dass die Vergangenheit selbst früher für die damals Lebenden Zukunft und Gegenwart war. Der Dialog mit der Vergangenheit vermittelt Eigenheiten des Denkens, die dem Erkenntnisvermögen des Publikums entgegenkommen. Es erkennt im Lesevorgang seine eigenen Bemühungen, historische Entwicklungen zu begreifen. Darüber hinaus schließt der Appell an verantwortliches Handeln in der Andeutung, dass das Leben Einzelner in der sozialen und historischen Vernetzung letztlich sinnvoll sein kann, sowohl Sinnsuche und Sinnstiftung ein.
Rückblenden, besonders in Texten, in denen die Figuren mit Fragen des Selbstverständnisses ringen, erwecken zuweilen den Eindruck der Zwangsfixierung. In Wolfgang Bächlers Erzählung Im Schlaf. Traumprosa (1988) greifen Entsetzen und Angst vor dem Terror auf die Gegenwart über und werden zur permanenten Bewusstseinslage. Der Träumende fürchtet Beamte, Funktionäre, sterbende Menschen und die verrinnende Zeit. Er spürt wie er erst in eine Uniform gesteckt und dann ins KZ verschleppt wird. Er ist auf der Flucht, irrt hilflos umher und wird beraubt und gefoltert. Schließlich schlagen ihm Soldaten einer Besatzungstruppe die Zähne aus. Die Vergangenheit wird zum Bild des Schreckens, das sich zeitlos wiederholt. In anderen Texten kommt es unvermittelt zu Beobachtungen, die an Tagesnachrichten und vorausgegangene Literaturdiskussionen anschließen oder Familiengeschichten aufgreifen. So stolpert beispielsweise Ersiës in Matthias Zschokkes Erzählung ErSieEs über die Schwelle eines Süßwarengeschäfts und muss an den stolpernden Großvater denken. Die Vergangenheit infiziert den Sprecher; der elliptische Abriss der Vergangenheit mündet in ein eigenes Schuldgefühl. „Großvater hat trübe Augen Großvater war im Widerstand Großvater furzt bei jedem Schritt Großvater braucht zwei Stöcke zum Gehen So ein vierfüßiger Schritt braucht seine Zeit Großvater war Oberarzt im Untergrund Großvater hat noch Paul Lincke kennengelernt Großvater ist ein Original Großvater besitzt ein Original Großvater fährt einen Thunderbird Großvater war ein Arbeiter Ich stamme aus richtigem Arbeitermilieu Großvater hat sich beinahe verschworen Großmütterlein ward umgebracht von eurer bösen Nazimacht damit verdien ich Geld denn ich erzähl’s der Welt … / Hoppla. / Eben wollte sie ‚ihrer Betroffenheit Ausdruck verleihen bezüglich Kollektivwahnsinn, geknechtetgefoltertgekettetgegeißeltgedemüdigt, Auflehnung, Empörung, Verzweiflung, Anklage‘.“ Zschokke fährt fort mit der Feststellung, dass immer Dolmetscher zur Stelle sind, die „übersetzen und verzeihen“ werden.6
Sicherlich gab und gibt es für die Literatur nie absolute Zäsuren und für thematisierte Geschichtsereignisse keine Nullpunkte. Die Literatur nimmt Stellung, verarbeitet und gestaltet die Weltkriege, die Weimarer Republik, Hindenburg, Hitler, Gleichschaltung, Kristallnacht, das Dritte Reich, Holocaust, Nürnberg, das geteilte Deutschland, die neue Welt. Christoph Hein konstatiert in seinem Essay „Die Zeit, die nicht vergehen kann oder Das Dilemma des Chronisten“, dass das Vergangene beständig gegenwärtig ist. „Ich jedenfalls bezweifele, daß es das Wesen der Vergangenheit ist, nicht Gegenwart zu sein. Im Gegenteil: Vergangenheit ist der unveränderbare, sichere und weitgehend auch gesicherte Teil unserer Gegenwart, freilich auch der durch seine Unveränderbarkeit, durch die Unmöglichkeit jeder nachträglichen Korrektur beunruhigendste und verstörendste Teil unserer Gegenwart. Denn Vergangenheit vergeht nicht, kann nicht vergehen, so wie die Toten nicht sterben und kein zweites Mal begraben werden können.“7 Die Befragung der Eigenart des Vergangenen steht mitunter im Mittelpunkt einzelner Erzählungen, die Lebensläufe in auf- oder absteigender Linie aus den dreißiger, den vierziger und den Kriegsjahren schildern. Sie taucht sporadisch in der Kriegsliteratur auf. Sie klingt im Schrifttum an, das sich mit der deutschen Vergangenheit auseinandersetzt oder alternative Geschichtsabläufe schildert. Die Antworten vermitteln einen ausgezeichneten Einblick in die wechselnde geistige Verfassung der Autoren und Autorinnen seit 1945. Sie sind vereinzelt als Augenzeugenberichte simplifiziert. Sie schwingen gelegentlich mit in der Reaktion von Figuren, die entweder verstummen oder Fragen kopfschüttelnd mit dem Hinweis ablehnen: „das können nur die verstehen, die das selbst erlebt haben.“ Die Hinweise und Erklärungen erhöhen durch die Verknüpfung von Vergangenheitsbewältigung, Schuld, möglicher Sühne und Vergebung die Spannung in vielen Texten. Sie durchkreuzen literaturkritische Urteile. Sie fordern das Lesepublikum zur Stellungnahme auf. Sie regen an, belasten und verlangen ethische Entscheidungen.
Die Literatur beleuchtet die Verflechtung von Stoff, Sujet, Thema und Motiv.8 Dieser Sachverhalt ist deutlich in Texten, die in der Vergangenheit verankert sind. In einigen überwiegen die mit der stofflichen Substanz verknüpften Vorstellungen, beispielsweise Krieg, Heimkehrer, der gute Kamerad, der böse Feind, Seeschlacht, Auschwitz, Stalingrad, Leningrad oder Dresden. In anderen wird ein klar umrissenes Sujet (Heimkehr ins Reich, Holocaust) zum dominanten Funktionsträger. Die Gegenwartsliteratur verdeutlicht: das Thema Vergangenheit umfasst eine enge, möglicherweise unlösbare Bewusstseinslage, in der Verirrung, Verneinung, individuelle und kollektive Schuld, Bewältigung, fiktive Darstellung und selbst ins mythische gesteigerte Konzeptionen anklingen. Die literarische Dokumentation und die „authentische“, fiktiv verarbeitete Vergangenheit setzen dem Text angemessene Akzente und berücksichtigen „tatsächliche“ Ereignisse primär, wenn sie die im Text gestalteten Verhaltensweisen motivieren. Jeder historische Ausschnitt enthält in der konkreten Darstellung eine angemessene Abstraktionsebene. Detaillierte Rekonstruktionen der Leiden und Freuden, der Erfolge und Misserfolge und der wechselnden Vorstellungen geschichtlicher Ereignisse verleihen den Darstellungen nicht nur große Anschaulichkeit, sondern vermitteln auch Einblicke in das Verstehen historischer Prozesse der direkt Beteiligten. Außerdem lassen Texte Rückschlüsse auf das geschichtliche Verständnis der Autor(inn)en zu. Die Untersuchungen von Texten in den folgenden Kapiteln belegen drei Aussageformen: (1) das Verständnis der Figuren in Texten und das der Autor(inn)en bilden eine Einheit; (2) unterschiedliche und widersprüchliche Vorstellungen veranschaulichen ungelöste Widersprüche; (3) das Dialogverfahren im Erinnerungsdiskurs verweist auf den Sachverhalt, dass historische Prozesse aus der Sicht der Beteiligten kaum durchschaubar wirken, aus der Perspektive der Erzähler jedoch erklärbar sind.
In Texten der Gegenwartsliteratur, in denen der Zweite Weltkrieg entweder das Geschehen maßgebend bestimmt oder in direkten und verhüllten Hinweisen anklingt, bestehen weiterhin gravierende Unterschiede, da diese von ehrenden Erinnerungen bis zu kritischen Abrechnungen reichen. Für den Abriss der Tendenzen in Schilderungen des Krieges und der Kriegsjahre sind drei Aspekte der vorausgegangenen Literatur relevant. Eine beachtliche Reihe von Kriegserzählungen vermittelte positive Vorstellungen heroischer Leistung, des guten Kameraden und der Verteidigung der Heimat. Vergleichbare Darstellungen bestehen nach 1945 fort in Erzählungen, die das Leid der Kriegsgefangenen, der Flüchtlinge und der Bevölkerung in den bombardierten Städten beleuchten. Zugleich entsteht eine Denkform, die im historischen Geschehen des Krieges ein Verhängnis für alle Beteiligten sieht, und in der Mahnung, das dürfe sich nicht wiederholen, einen Appell an das Gewissen enthält. Drittens verfolge ich die Richtung der Objektivierung dieses Denkens im Zusammenspiel der Forderung nach persönlicher Verantwortlichkeit und dem Anspruch auf Authentizität der biographischen und literarischen Darstellung. Der Anspruch wird deutlich in den Spielarten dokumentarischer Literatur, in der Beglaubigung durch Augenzeugen, in eingeflochtenen Tatsachenberichten und historisch belegbaren Fakten, die die Fiktionalität der Texte bewusst verwischen.
Aufarbeitungen der Vergangenheit nehmen vielfältige Formen an. Vergangenheit bedeutet nicht nur das historische Geschehen, sondern auch Kindheitseindrücke und das Leben im kleinen Kreis. In den Erzählungen von Bernhard, Burger und Monioudis erscheint die große Welt im Spiegel der Ereignisse in Ortschaften, die die Größe einer Briefmarke haben. Regionale Landschaften oder Städte in Erzählungen von Horst Bienek (Gleiwitz), Uwe Johnson (Mecklenburg), Siegfried Lenz (Ostpreußen) und Günter Grass (Danzig) sind gleichzeitig Schwerpunkte der historischen Ereignisse und Symbolträger für existenzielle Grunderfahrungen. Die Autoren geben der Zeitperspektive einen typischen Gehalt und verwandeln zugleich einzelne Regionen in exemplarisch literarische Landschaften, in denen Menschen die historischen Ereignisse erfahren, die das Jahrhundert prägten. Die einzelnen Erlebnisse der Personen werden zu kollektiven Erfahrungen stilisiert.
In Texten, die zu uns sprechen, ist die Vergangenheit immer auf die Gegenwart und Zukunft bezogen. Beim Nachdenken darüber, wie es möglich sei, die Kindheitsperspektive zu erfassen, beobachtet Burger: „Auch die drei Komponenten, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, was autobiographisch wahr und somit richtig, oder sagen wir etwas modester rückblickend überhaupt erkennbar ist, hängt davon ab, wie ich heute lebe und was mich morgen erwartet …“9
In Rückblicken auf die jüngste Vergangenheit zeichnet sich das Bestreben ab, das Wesen der Erinnerung, den Vorgang des Erinnerns, zu präzisieren. In jeder erweiterten Perspektive umfasst das Erinnern Fragen persönlicher Verantwortung, von Verschuldung und Verjährung, von möglicher Sühne und einem wünschenswerten Vergeben. Die Voraussetzung für jede Erkundung der Vergangenheit ist und bleibt, wie Hanns-Josef Ortheil feststellt, die Präzision des Schreibens. Die Aufgabe ist „der Sprachlosigkeit das präzise Wort, den ungeordneten die geordneten Bilder“ gegenüber zu stellen.10 Diese Gewissenhaftigkeit in der Auslegung des „real-fiktiven“ Raumes bestimmt gleichermaßen das Geschehen in Erzählungen und Stücken, die auf die Antike zurückgreifen oder alternative Vergangenheitsbilder entwerfen. Die Rückgriffe auf die Antike umfassen unter anderem Nachdichtungen, Neuschöpfungen und Wiederbelebungen. Außerdem lassen sich in der Gegenwartsliteratur Versuche nachweisen, Figuren wie etwa Galatea, Kassandra, Laokoon, Odysseus, Medea, Medusa, Pasiphae oder Priapos auf die Gegenwart zu beziehen und umzudeuten. Besonders aufschlussreich sind Auslegungen der menschlichen Gegenwartssituation im Spiegel der Vergangenheit. Von besonderer Bedeutung ist die Tatsache, dass es sich bei diesem Vorgang nicht nur um Anschluss und Erneuerung einer Tradition handelt. Stattdessen dienen die Rückgriffe dazu, in symbolisch mythischen Handlungsräumen gegenwärtige politische und gesellschaftliche Krisen in der Form existenzieller Entscheidungen zu gestalten.
Antike und Gegenwart, Cotta, Ovid, Fontane und eine alte Frau, Rom und Preußen: die Vergangenheit ist Gegenwart, sie ist ein weites Feld, ein unabgeschlossenes Kapitel. Die Erzählungen von Christoph Ransmayer und Günter Grass beleuchten diesen Sachverhalt. Als Mein Jahrhundert1999 erschien, betonte Grass in einem Interview: „Ja, nehmen Sie den ersten Satz des Buches: ‚Ich, ausgetauscht gegen mich, bin Jahr für Jahr dabeigewesen.‘ Das heißt, ich schlüpfe in Rollen, ganz verschiedene: männlich, weiblich, alt, jung. Ich blicke auf dieses Jahrhundert aus der Perspektive von Menschen, denen Geschichte widerfährt. Es sind nicht die großen Handelnden, von denen ich erzähle, sondern die Mitläufer und Opfer.“11 Diese Perspektive verwandelt schließlich die Erzähler in Historiker, welche die Vergangenheit im Alltag beleben und selbst das kaum Denkbare schildern. Gemeinsamkeiten und Divergenzen bestimmen Rückblick und Ausblick. Die gravierenden Unterschiede in Gestaltungen der Gegenwart und der Vergangenheit sind offensichtlich im Erfahrungshorizont der Figuren in Erzählungen von Ransmayr und Grass.
Die Erzählung Morbus Kitahara (1995) von Christoph Ransmayr schildert die Verfinsterung, die sich nach dem „Frieden von Oranienburg“ über die Ortschaft Moor, die Bevölkerung, den großen Steinbruch nahebei und das Niemandsland des Steinernen Meers ausbreitet.12 Es ist endlich Frieden, nachdem „die halbe Menschheit in der Erde und im Feuer verschwunden ist.“ Im Schnittpunkt der Handlung stehen der Schmied Bering, zum Ende des großen Krieges geboren, Ambras, der Fotograf und ehemalige Häftling Nr. 4273 eines Konzentrationslagers, und das Mädchen Lily, die überlebende Tochter eines zu Tode geprügelten Bewachers. Die Einwohner von Moor, ehemals ein malerischer Badeort, haben keinen Zugang zur Außenwelt, denn die einzige bestehende Bahnverbindung wurde abgerissen. Alle müssen für sich selbst sorgen. Die existenzielle Situation der Menschen und das Zeitgeschehen werden bestimmt durch Auswirkungen des „Stellamour-Plans“, eine Anspielung auf den Morgenthau-Plan, der das besetzte Land in die Steinzeit zurückwirft, eine Steinzeit, in der jedoch Besatzungstruppen die Menschen bewachen und organisierte Banden, kahlköpfige Schläger und Guerillas die Welt verunsichern. Das Milieu determiniert die Entwicklung der Figuren, in denen jedoch wiederholt eine wilde, unbezähmbare Sehnsucht nach Entgrenzung aufflackert. Arbeitsfähige (jeder, der noch gehen kann, ist arbeitsfähig) werden zur Arbeit im Steinbruch verpflichtet. Alle sind gezwungen, an den von Major Elliot veranstalteten Erinnerungsfeiern für die Opfer der jüngsten Vergangenheit teilzunehmen. „HIER LIEGEN / ELFTAUSENDNEUNHUNDERTDREIUNDSIEBZIG TOTE / ERSCHLAGEN / VON DEN EINGEBORENEN DIESES LANDES / WILLKOMMEN IN MOOR“ (33). Zum Sommerfest ersteigen die Einwohner die berüchtigte Stiege, auf der die meisten Häftlinge umkamen. Die Gefangenen schleppten riesige Steinquader nach oben und brachen häufig unter der Last zusammen. Der Kommandant verlangt nur, dass die Bewohner Attrappen transportieren, die sie an die Vergangenheit erinnern sollen. Major Elliot besteht nicht auf krasser Wirklichkeit, aber darauf, dass der Schein gewahrt wird und die Tätigkeit die Umerziehung fördert. Er will die Illusion einer zivilisierten Besatzung bewahren, hat aber die Ausführung aller Anordnungen und selbst der alltäglichen Arrangements Ambras übertragen.
Ambras, der ehemalige Gefangene des Schotterwerk-Konzentrationslagers, hat die gesamten Machtbefugnisse über die Arbeiter und zwingt alle unnachgiebig zur Erfüllung der ständig gesteigerten Norm. Er rächt sich an der Gesellschaft in seiner Rolle des Lageraufsehers. Er spielt den Giganten und verkörpert zugleich eine unerhörte Brutalität. Die charakteristischste Szene für seine Einstellung zur Welt ist sein Einzug in die von ihm ausgesuchte Wohnung, eine mit Stacheldraht umgebene Villa, in deren Garten ein Rudel verwilderter, aggressiver Hunde haust. Er betritt den Garten, wirft den vierzehn Hunden rohes Fleisch zu, spricht beschwörend auf sie ein, erschlägt den ersten, der ihn anspringt, mit einem Eisenrohr, jagt einem großen irischen Rüden das Eisen in den Schlund, springt auf ihn, verbeißt sich in das Tier und bricht ihm das Genick. Daraufhin zieht er ein. Das Rudel folgt dem Meister gehorsam, der seitdem vom Volk „Hundekönig“ genannt wird. Sein Umgang mit Menschen folgt demselben Muster: Sie müssen dienen; jeder Widerstand wird gebrochen. Bering, zu der Zeit ein Neunjähriger, beobachtet den Vorfall und umgibt den Hundekönig in seiner Erinnerung mit dem Nimbus eines „biblischen Helden“, eines „unbesiegbaren Königs“, der seine Feinde „in die Wüste jagte und in den Tod.“ (81)
Bering verbringt seine früheste Kindheit in einem Kellergewölbe in einem von der Decke hängenden Korb. Unter ihm scharren Hühner auf der Erde, Hühner, deren Gackern er nachahmt und unter sein Schreien mischt. Geflügel und Vögel bestimmen seinen Erfahrungshorizont. Er lebt sich ein in ihre Welt, ahmt ihre Rufe nach und versucht zu fliegen. Selbst diese Empfindungen sind ambivalent: „Noch Jahre später bedurfte es bloß eines Hahnenschreis, um in ihm rätselhafte Empfindungen wachzurufen. Oft war es ein melancholischer, ohnmächtiger Zorn, der keinen bestimmten Gegenstand hatte und ihn doch mehr als jeder tierische Laut mit dem Ort seiner Herkunft verband.“ (19) Unvereinbare Tendenzen bestimmen seine Entwicklung von früher Verehrung bis zum Hass auf den Hundekönig. Als Dreiundzwanzigjähriger erlebt er, wie Ambras sein von Elliot erhaltenes Fahrzeug schwer beschädigt und bietet ihm an, den Wagen völlig neu herzustellen. Er verwandelt den Studebaker in einen mythologischen Wagen: eine Krähe im Sturzflug, am Kühler „zwei zum Fangschlag geöffnete Krallen.“ (96) Daraufhin ernennt Ambras Bering zu seinem Vertreter, befiehlt ihm in die Villa zu ziehen und fortan sein Leben zu teilen. Das Verhältnis der beiden wird bestimmt von den kurzen, fast bellenden Befehlen, die Ambras erteilt. Das grausame Zusammenleben beeinflusst Berings Handeln. Er tötet zuerst in Notwehr, dann aus Hass auf die Welt. Sein Verhältnis zu Ambras, den er sowohl fürchtet als auch bewundert, ablehnt und anerkennt, zwingt ihn in eine Abhängigkeit, die schließlich dazu führt, dass er seinen Beherrscher nachahmt und Freude an der Unterdrückung anderer verspürt. Ambras beansprucht für sich nichts, außer Gehorsam. Er lebt in einem verwahrlosten Zimmer der Villa und überlässt den Rest des Hauses den Hunden. Er zeigt eigentlich nur ein Interesse, das nicht mit seiner Arbeit verbunden ist, wenn ihn Lily besucht und ihm seltene Steine und Smaragde aus dem Hochgebirge bringt.
Lilys Gefühle spiegeln die gegensätzlichen Tendenzen der Umwelt wider. Sie hasst Gewalt, besitzt jedoch ein verstecktes Waffenlager und geht zweimal, auch dreimal im Jahr auf Menschenjagd. Sie spürt dann den Banditen nach, die die Bevölkerung angreifen, und tötet sie, während ein überwältigendes Gefühl von „Angst, Triumph und Wut“ in ihr aufsteigt. Plötzlich will sie ausbrechen und frei sein. Dann wieder passt sie sich an die Umstände an. Sie hat Mitleid mit Ambras und Bering, übernachtet zuweilen mit Ambras, scheint einmal Bering zu lieben, verstößt ihn aber, als er in rasendem Zorn einen Räuber tötet, der Hühner mit sich schleppt.
Handlungsverlauf und Figurenzeichnung werden intensiviert, als das Bergwerk demontiert und nach Brasilien verfrachtet wird. Bering sorgt dafür, dass jedes Rädchen der rostigen Maschinerie sorgfältigst verpackt wird. Er erblindet langsam, hofft jedoch auf einen neuen Anfang in der Fremde und verspürt wie Lily Freude während der Übersiedlung. Auf der Fahrt nach Brasilien nehmen die körperlichen Leiden von Ambras ständig zu. Die Welt verdunkelt sich. Bering, Ambras und Lily fahren schließlich zur Hundeinsel, einem ehemaligen verlassenen Gefängnis, dem Ziel und Ende von Lebensfahrten in einer Welt, in der das Licht verbleicht. Lily schenkt der Brasilianerin Myra ihren Mantel und verlässt die Insel. Die Geste besiegelt Myras Tod, denn Bering ermordet sie im Glauben, Lily vor sich zu haben. Am Ende stürzt er blindlings vom Berg und reißt Ambras mit sich in die Tiefe. Die konsequente Handlungsführung aus Lager und Moor in die sumpfige Wildnis der neuen Welt, einer unbehausten Insel mit drei Toten, verdeutlicht die völlige Hoffnungslosigkeit der Welt nach dem Krieg.
Dagegen nuanciert Grass in der Novelle Im Krebsgang (2002) unterschiedliche und unvereinbare Einstellungen zum Zeitgeschehen und historischen Ablauf, die zu Auseinandersetzungen führen und die Vergangenheit als unabgeschlossenes Kapitel deuten.13 Der Erinnerungsdiskurs in der Novelle sichtet den Erfahrungshorizont, die persönlichen Erlebnisse, die Haltung zum Zeitgeschehen und das historische Erkenntnisvermögen von Figuren aus drei Generationen: Ursula Pokriefke, deren Sohn Paul und ihres Enkels Konrad (Konny). Paul ist Journalist und schildert die Ereignisse als Ghostwriter für einen im Hintergrund bleibenden, vom Schreiben ermüdeten Autor, der hin und wieder Anregungen gibt. Die Konturen des Geschehens, durch ständige Reflexion, Rückwendung, Blicke auf das Internet und Einschübe von kontrastierenden oder sich ergänzenden Handlungszügen retardiert, sind zeitlich verankert im Mord an Wilhelm Gustloff am 4. Februar 1936 in Davos, der Torpedierung der „Wilhelm Gustloff“ durch das russische U-Boot „S 13“ am 30. Januar 1945 in der Nähe der Stolpebank und der vorsätzlichen Tötung Wolfgang (David) Stremplins durch Konrad am 20. April 1997. Der Erzähler betont mehrmals das von ihm geschaffene Netz historischer Bezüge auf Hitlers Leben (*20.4.1889; Reichskanzler 30.1.1933; Selbstmord 30.4.1945).
Die Erzählung versucht die Ursachen von Ereignissen zu verstehen, die sich immer wieder der Sinndeutung entziehen. Der Erzähler unterbricht seinen Bericht deshalb ständig mit Hinweisen auf seine Verunsicherung. Das historische Geschehen überfordert das Aufnahmevermögen: „ich stelle mir vor – nicht faßbar – niemand weiß, was endgültig geschah – muß eine Legende einschieben – was ich von mir weg krebsend tue, ziemlich nahe der Wahrheit beichte – so ungefähr ist es gewesen – mit der Flucht auf dem Landweg begann das Sterben am Straßenrand – ich kann es nicht beschreiben. Niemand kann das beschreiben – über 4500 Kinder, Säuglinge, Jugendliche, Köpfe im Wasser, Beinchen in der Luft – eine Null am Ende mehr oder weniger, was sagt das schon – in Statistiken verschwindet hinter Zahlenreihen der Tod – ich kann nur berichten, was von Überlebenden an anderer Stelle als Aussage zitiert worden ist.“ Im Verlauf solcher Beobachtungen, die den Wahrheitsgehalt authentischer Berichte befragen, entsteht ein Gespräch mit der Vergangenheit, der Gegenwart und dem Lesepublikum. Außerdem vertieft Grass das abgestufte, krebsende Erzählverfahren, indem er die Figur des „Alten“ einführt. Der Alte bleibt im Hintergrund. Er hat Paul als Ghostwriter angestellt, der „stellvertretend“ ein Geschehen berichtet, über das die Beteiligten schwiegen. Der Alte hat sich „müdegeschrieben“ und gesteht, dass er sich dieser Aufgabe „seiner Generation“ entzogen hat. „Niemals, sagte er, hätte man über so viel Leid, nur weil die eigene Schuld übermächtig und bekennende Reue vordringlich gewesen sei, schweigen … dürfen.“ (99)
Neben dem Alten führt Grass Figuren ein, die im Text durch ihre Verwicklung in das Zeitgeschehen von 100 Jahren und ihre persönliche Entwicklung repräsentativ wirken, aber keineswegs „außergewöhnlich“ sind. Wir hören von Wilhelm Gustloff, der 1895 in Schwerin zur Welt kommt, 1917 nach Davos reist, um ein Lungenleiden zu kurieren, dann in der Schweiz bleibt und scheinbar bürgerlich bescheiden lebt. Er tritt in die NSDAP ein, wird Landesgruppenleiter, wirbt in der Schweiz unter den dort lebenden Deutschen und Österreichern für die Partei und wird am 4. Februar 1936 in seiner Wohnung in Davos von dem Juden David Frankfurter erschossen. Die Entrüstung in der deutschen Presse ist enorm; die deutsche Regierung sendet einen Sonderzug, der Gustloff nach Schwerin „heimführt“. Fortan wird er als Opfer jüdischer Meuchelmörder hoch geehrt; ein Denkmal wird gebaut und ein KDF-Schiff nach ihm benannt. David Frankfurter, 1909 in Serbien geboren, lebt und studiert in Deutschland, befindet sich aber zeitweilig in der Schweiz zur Kur seiner chronischen Knochenmarkvereiterung. Er begründet seine Tat mit der Feststellung: „ich bin Jude.“ Er wird im Gerichtsverfahren zu 18 Jahren Zuchthaus und anschließendem Landesverweis verurteilt. Er gesundet im Gefängnis und wandert nach dem Kriegsende nach Israel aus.
Der Erzähler Paul Pokriefke kommt am 30. Januar 1945 zur Welt. Die „dramatisch-alltägliche“ Geburt, Minuten nachdem seine hochschwangere Mutter von dem torpedierten Schiff „Wilhelm Gustloff“ gerettet wurde, verknüpft sein Leben mit der Gustloff-Legende. Sein Vater bleibt unbekannt; die Mutter hat ihn vergessen, will nicht über ihn sprechen und verwechselt ihn möglicherweise mit einem anderen Mann. Paul wächst in der DDR auf, setzt sich aber nach Westberlin ab und studiert Germanistik. Er wird von seinem „möglichen“ Vater finanziell unterstützt und arbeitet als Journalist für Springers „Morgenpost“. Paul verfertigt Sachberichte und schreibt über alles, auch über „Nie wieder Auschwitz“, aber nie über die „Gustloff“, denn das Thema war jahrelang nicht diskussionswürdig. Paul heiratet und hat einen Sohn. Seine Frau trennt sich von ihm und zieht mit dem Sohn Konrad in den Westen. Nach der Scheidung betrachtet sich Paul als „lebensversehrten“ Versager.
Die Mutter, Konrads Großmutter, Ursula (Tulla) Pokriefke ist eine Virtuosin der Anpassung an politische und gesellschaftliche Umstände. Sie überlebt; ist zufrieden und voller Widersprüche, die sie selbst nicht empfindet. Sie erinnert sich an die Nazizeit, die „gute Seiten“ hatte und denkt mit Freude an die „schöne“ Fahrt auf dem KDF-Schiff „Gustloff“. Sie wird Tischlerin und Leiterin einer Tischlerbrigade in der DDR. Sie ist überzeugte Kommunistin und zündet eine Trauerkerze an, als Stalin stirbt. Trotzdem macht sie keine Schwierigkeiten, als sich Paul nach Westberlin absetzt. Sie hat außergewöhnlichen Einfluss auf Konrad und vermittelt ihm Ansichten über die Vergangenheit, die der Erzähler als „das unbeirrbare Gequassel des Ewiggestrigen“ charakterisiert. Aber Tullas Gerede, das ihre enge Verflechtung mit dem Schiff, der Torpedierung und der Schiffslegende herausstellt, beeinflusst nachdrücklich Konrads Leben. Als Konrad (Konny) seine Großmutter nach dem Mauerfall in Schwerin besucht, erzählt sie ihm erregende Geschichten aus der Vergangenheit.
Für Konrad lebt die Vergangenheit nicht nur auf, er will sie rehabilitieren. Nachdem ihm Tulla einen Computer schenkt, konzentriert er sich auf den Fall Gustloff, den er „richtig stellen“ muss. Durch sein unablässiges Bemühen wird „Gustloff“ eine Internet-Sensation. Die Berichterstattung schließt ein: Stapellauf, Lobesreden, Nachrichten über Robert Ley, Urlauber- (Kraft durch Freude), Lazarett-, Ausbildungs-, Truppentransport- und schließlich Flüchtlingstransportschiff, Torpedierung durch ein russisches U-Boot, dessen Kapitän Alexander Marinesko kurz erwähnt wird, und schließlich Erinnerungsfeiern der Überlebenden. Währenddessen debattieren zwei junge Menschen auf der Website www.blutzeuge.de alle mit dem Untergang der „Gustloff“ verknüpfbaren Gedanken. Ihre Meinungen sind hart, kompromisslos und unvereinbar. Konny vertritt die Ehre deutscher Vergangenheit; sein Gesprächspartner David ist Fürsprecher des Judentums und versucht, Konnys Ansichten zu widerlegen. Paul verfolgt die Debatten und erkennt, dass sein Sohn der „schiffskundige“ Germane ist, beurteilt aber das Schreiben Konnys als „harmlos kindisches Zeug, das er als Cyberspace-Turner von sich gab“ (88). Er erkennt auch hinter Konnys Feststellungen das Gerede Tullas. Was er nicht erwartet, was niemand ahnt, ist das unerhörte Ereignis der Novelle. Konrad schlägt David vor, sich zu treffen. Er erschießt David bei der Begegnung am 20. April 1997. Er handelt aus innerer Notwendigkeit: Die Stimme des Feindes muss zum Schweigen gebracht werden. Das Gerichtsverfahren ergibt, dass David eigentlich Wolfgang heißt, kein Jude ist, aber alles Jüdische hoch verehrt. Er leidet unter schweren Schuldvorstellungen und verlangt Sühne vom deutschen Volk. Er hat kein Verständnis für die Meinung seiner Eltern, die finden, „irgendwann müsse Schluß sein mit den ewigen Selbstanklagen.“ Dieser Sachverhalt ändert Konnys Meinung nicht. Er wird mit 7 Jahren Jugendhaft bestraft. Die Eltern können Konrad nicht verstehen. Dagegen debattieren andere die Schuldfrage weiterhin auf einer neuen Webseite Kameradschaft-konrad-pokriefke.de. Sie kennzeichnen seine Haltung als vorbildlich.
Was bleibt: eine unabgeschlossene Auseinandersetzung, an der jede Generation mitwirkt und in der alle ihren Erfahrungshorizont erweitern. Die Gegensätze bestehen fort. Die Unfähigkeit, aus der Geschichte zu lernen, stößt auf das ständige Bemühen, die Vergangenheit zu begreifen.
2.Vergangenheit: Erinnern – Wiederherstellen – Deuten
2.1.Wahrnehmung, Gedächtnis, Erinnerung, Retrospektive
Fragen der Begriffsbestimmung von Wahrnehmung, Gedächtnis und Erinnerung führen in Literatur und Kritik seit 1945 zu theoretischen Ermittlungen und Überlegungen, die im Handlungsverlauf von Erzählungen anklingen. Die Problematik eine wie auch immer ausgeprägte Realität sprachlich ausdrücken zu können, führt zuweilen dazu, theoretische Ansätze aus den Geisteswissenschaften in literarische Texte einzubauen oder naturwissenschaftliche Erkenntnisse unbefragt zu übernehmen. Die in den vorliegenden Ausführungen besprochenen Autor(inn)en stimmen darin überein, dass jede Wahrnehmung auf der bewussten und auch unbewussten Aufnahme von sinnlichen und geistigen Eindrücken basiert. Die Eindrücke werden sinnvoll zu einer Wahrnehmungseinheit gestaltet und im Gedächtnis bewahrt.14 Die Wahrnehmung wurzelt in Erleben, Handeln, Betrachten und Reflektieren. Jedes Erleben erfasst eine sinnliche und geistige Reaktion auf das, was uns in Natur und Gesellschaft umgibt und auch auf Ereignisse im Leben. Das Handeln kann in instinktiven Reaktionen gründen, die besonders in der Kriegsthematik geschildert werden. Der Begriff kennzeichnet jedoch ferner jedes bewusst überlegte Verhalten zur Umwelt und bildet die Voraussetzung zu möglicher Selbst- und Welterkenntnis.15
Das Gedächtnis ist sowohl individuell als auch kollektiv eingefärbt. Es erfasst den Augenblick des Geschehens, die Zeitspanne eines Eindrucks, die konkrete Reaktion auf eine Begebenheit und die festgehaltene Sensation, welche unterschiedliche Sinneseindrücke zu einer Einheit verschmilzt. Die gespeicherten und geordneten Eindrücke initiieren außerdem bewusste Lernprozesse. Der Vorgang beeinflusst die Bewusstseinslage von Individuen und Figuren in Texten und schafft die Voraussetzung für die unterschiedlichsten literarischen Gestaltungen. Beispielsweise erfährt der Erzähler, ein Physiker, in Christoph Aigners Anti Amor (1994), wie komplex abgründig jede Wahrnehmung ist. Sein Gegenspieler, Theseider, reduziert die ideelle, ideale klassische Liebesvorstellung und sittliche Neigung auf rein biologische Vorgänge. Beide bezweifeln schließlich jede Möglichkeit einer objektiven Erkenntnis. Scharfsinn und Spekulation, Phantasie und Wahn stehen zuletzt gleichberechtigt nebeneinander in der im Text postulierten immer „werdenden und vergehenden Welt.“16
Ein in der Erinnerung kritisch beleuchteter Eindruck kann tradierte oder kollektive Vorstellungen übernehmen und das Ereignis zu einer neuen, authentisch wirkenden Einheit verbinden. Dieser Vorgang führt zu Verunsicherungen in Tatsachenberichten und Aussagen von Augenzeugen. Er ist Ausgangspunkt für Erkundungen zahlreicher Autor(inn)en in Bestandsaufnahmen der Vergangenheit. Darüber hinaus beleuchten die Realismus-Diskussionen (sozialistischer, klinischer, magischer Realismus) und die Literaturkrisis-Debatten das Wechselverhältnis von Stileigenheiten und Wahrnehmung, Erinnerung und politischen oder ästhetischen Überzeugungen.17 Augstein und Walser versuchten 1998 in einem kritischen Gespräch die Beschaffenheit der Erinnerung zu bestimmen. Ihr Meinungsaustausch „Erinnerung kann man nicht befehlen. Martin Walser und Rudolf Augstein über ihre deutsche Vergangenheit“18 verdeutlicht in Feststellung, Frage und Gegenfrage, wie beide im Rückblick ihr Handeln und ihre Unterlassungen häufig so deuten, dass sie ihrem gegenwärtigen Erfahrungshorizont entsprechen. Beide suchen die Wahrheit, unterbrechen aber ihre Beobachtungen durch kritische Einwände, in denen deutlich wird, dass nicht alles so verlaufen sein kann, wie sie es in ihrer jetzigen Erinnerung im Gedächtnis haben. Beispiele: „Walser: Bist du sicher? … Das halte ich für die nachträgliche Inszenierung eines Films. Augstein: Ich weiß es noch. Sonst hätte es sich mir ja nicht eingeprägt. … Walser: Und das hast du dir gemerkt? Da warst du erst zehn.“ Walser fasst nach: „Das hast du nicht gesagt, jetzt verklärst du irgend etwas. … Du wußtest doch nicht, wer Lovis Corinth ist und daß man die Bilder verkaufen muß. Gib zu, das hat dein Vater gesagt, Rudolf!“ Augstein betont die Ablehnung Hitlers in seiner Familie, die politisch wach erscheint; darauf Walser: „Du bist gleich auf der SPIEGEL-Seite der Welt geboren worden. … Rudolf, du bist wirklich der beste, schönste, liebenswürdigste, ungefährdetste Roman …, den ich je gelesen habe. … Mit der Wirklichkeit kann es nichts zu tun haben.“ Darauf Augstein: „Es ist erlebte Wirklichkeit, nicht geschönt.“ Walser ist überzeugt davon, dass jeder bewusste Rückblick die Vergangenheit verändert. Das Gespräch weist hin auf die Problematik „falscher“ Erinnerungen, die subjektiv als wahr, untrüglich, wirklich empfunden werden, aber objektiven Tatsachen widersprechen.19
Walser unterscheidet zwischen Gedächtnis und Erinnerung. Gedächtnis ist faktisch; es erfasst Einzelheiten, die etwas genau bestimmen (ein Lehrer stolpert im Klassenzimmer; der Pfiff eines Freundes; ein Bild an der Wand im Wohnzimmer), aber keine größeren Zusammenhänge herstellen. Walsers Skizze „Ein Jahr und das Gedächtnis“ setzt mit der Beobachtung ein: „Das Gedächtnis, unsere große Unfähigkeit: ein Haus, das unser eigen ist, aber wir haben nichts zu sagen darin.“20 Darauf folgen vorbeifliegende politische und gesellschaftliche Pressenachrichten und persönliche Eindrücke eines Jahres. An sie schließt die Frage an, ob das Ganze lediglich ein Angebot ist, aus dem sich das Gedächtnis nur aussucht, was ihm gefällt. Möglicherweise kann das Gedächtnis „Steine blühen lassen“ oder sich vertraut machen mit der endgültigen „Redaktion aller Communiqués.“ (267) Gedächtnis ist sicherlich in fiktiven Dokumentationen von Kriegserfahrungen stark mit Appellen an die Einfühlung der Leser verknüpft. Erinnerung dagegen ist gestaltetes Gedächtnis; sie stellt Assoziationen her, schafft Überblicke, vermittelt Einsichten, die auch anderen nachvollziehbar werden. Sie erweckt in Texten Sympathie; sie ist eine kritisch besonnene Rückschau. Erinnerung ist letztlich geistig literarisch. Sie ist das, was Hesse im Kapitel „Die Berufung“ (Das Glasperlenspiel, 1943) schildert, wenn er darauf hinweist, Knecht habe in seinem Denken zwischen „legitimen“ und „privaten“ Assoziationen in der Gestaltung eines Spieles unterschieden. Zur Erläuterung führt der Erzähler das Beispiel eines abgeschnittenen Holunderblattes an. Der Geruch des Blattes zusammen mit der Erinnerung an ein Schubertlied „Die linden Lüfte sind erwacht“ ergibt eine Assoziationskette, die „Frühling“ ins Allgemeine, Typische erhöht.
Im dritten Kapitel der Novelle Ein fliehendes Pferd (1978) findet sich ein aufschlussreicher Hinweis auf die Walser ständig beschäftigende Ermittlung des Zusammenspiels von Gedächtnis und Erinnerung. Der Stuttgarter Studienrat Helmut Halm denkt über den plötzlich in seinem Leben aufgetauchten Klaus Buch und dessen Rekonstruktion seiner Vergangenheit nach. Der Erzähler stellt fest: „Helmut begriff allmählich, daß dieser Klaus Buch für einige ihm teure Jahre seines Lebens keine Zeugen mehr gehabt hatte. Und gerade aus diesen Jahren wollte er offenbar überhaupt nichts verlorengehen lassen. Zur Wiedererweckung des Gewesenen brauchte er einen Partner, der zumindest durch Nicken und Blicke bestätigte, daß es so und so gewesen sei. Ohne diesen Partner könnte er gar nicht sprechen von damals. Helmut sah, daß er es mit dem Kriegskameradenphänomen zu tun hatte. Er kannte diesen Wiedererweckungsfanatismus nicht. Jeder Gedanke an Gewesenes machte ihn schwer. Er empfand eine Art Ekel, wenn er daran dachte, mit wieviel Vergangenheit er schon angefüllt war.“21 Nach kurzem Nachdenken folgt der Satz: „Meistens wußte dieser Klaus Buch allerdings so genau Bescheid über das, was gewesen war, daß Helmut erschrak.“ (284) Helmut ist bestürzt und spürt Neid, weil sein Gedächtnis zwar mit Namen und Eindrücken angefüllt ist, aber keine erkennbare Form hat. Er kann das „Erzählbare“ nicht fassen. „Die Namen und Gestalten, die er aufrief, erschienen. Aber für den Zustand, in dem sie ihm erschienen, war tot ein viel zu gelindes Wort.“ (284) Für Klaus Buch dagegen lebt das Vergangene in einer „Pseudoanschaulichkeit“ auf, die alles Vergangene verleugnet und in plastischer Fülle vergegenwärtigt. „Bei Klaus Buch rollte es nur so von Tönen, Gerüchen, Geräuschen; das Vergangene wogte und dampfte, als sei es lebendiger als die Gegenwart.“ (285) Walser lässt der Sprache freien Lauf, um in einer Fülle von Eindrücken die formlose Vergangenheit im gegenwärtigen Gedächtnis festzuhalten und zugleich kritisch zu ironisieren. Demgegenüber versichert Jurek Becker 1997 in einem Interview, dass in seinem „Unbewußten“ Eindrücke des Vergangenen existieren. Aber auf die Frage, ob ihn seine Kindheit im Ghetto beeinflusst habe, antwortet er: „Das kann ich nicht sagen. Das müßte ein Psychiater rauskriegen. Ich habe keine Erinnerung daran. Ich kann Ihnen nichts über das Ghetto erzählen. Ich habe es vergessen – so als wäre es nie gewesen.“22 Er fährt fort mit der Feststellung, dass er sich zuerst intensiv mit der Vergangenheit beschäftigte, als er Material für seine Erzählungen sammelte. Dass die Konzentration auf Details, besonders wenn ein Autor alles „genaugenommen“ festhalten will, zu wuchern beginnt und die Gesamtdarstellung trüben kann, wird in der Erinnerungsdiskussion in Klaus Schlesingers Die Sache mit Randow (1976) deutlich. Die als Kriminalroman angelegte Erzählung beschreibt den Prozess gegen die Randow-Bande und den Mörder Randow. Sie verdeutlicht jedoch außerdem in detaillierten Einzelheiten das Leben in der DDR, fängt das Berliner Lokalkolorit und die damaligen Unterhaltungen der Einwohner ein und bietet viele lesenswerte Kurzporträts. Konkrete Hinweise auf die allgemeine Situation machen die Zeitumstände auch jungen Lesern verständlich, die der geschilderten Zeit bereits fernstehen.
Die Auseinandersetzung mit der Vergangenheit und Gegenwart ist eingehender in den Schilderungen von Maron, Ortheil und Hilbig. Im Erzählverfahren Marons wird deutlich, was auch die Erzählungen von Ortheil und Hilbig prägt und was bereits Soziologen wie etwa Maurice Halbwachs und Karl Mannheim in ihren Schriften feststellten: Die Erinnerung an Vergangenes wird von der gesellschaftlichen Umwelt mitbestimmt. Individuelle und kollektive Erinnerungen hängen von den zeitbedingten, zurückliegenden und gegenwärtigen Umständen ab. Dieser Sachverhalt tritt besonders deutlich in Marons Pawels Briefe hervor. Der konkrete Anlass der Suche nach der vergangenen und vergessenen Zeit ist die Umfrage eines holländischen Fernsehteams, das 1994 nach Berlin kommt, um die Haltung der Deutschen zur Vergangenheit zu dokumentieren. Die Autorin beginnt die Erzählung mit Fragen: Warum jetzt diese Geschichte schreiben? Die Lebensläufe gehören der Vergangenheit an. Wie entstand das Gefühl, sich „rechtfertigen zu müssen“? Warum etwas festhalten, das „wenig sicher ist“?23 Was ist Erinnerung? Wie ist sie beschaffen? „Erinnern ist für das, was ich mit meinen Großeltern vorhatte, eigentlich das falsche Wort, denn in meinem Innern gab es kein versunkenes Wissen über sie“. (8) Darüber hinaus erwägt Maron die Möglichkeit, dass das ganze Vorhaben ein Versuch sei, dem eigenen Leben Sinn zu geben oder es geheimnisvoll zu gestalten.
Die entstehende Familiengeschichte vermittelt Einblicke in das Leben von drei Generationen. Sie schildert die Herkunft, den Existenzkampf und den Tod des Großvaters Pawel Iglarz, eines zum Baptismus konvertierten Juden aus Polen, der sich mit seiner Frau Josefa in Berlin niederlässt, um dort als Schneider eine sorgenfreie Existenz aufzubauen; die Großeltern werden 1939 nach Polen ausgewiesen und kommen nach kurz befristetem Dasein im Ghetto im Konzentrationslager um. Die Geschichte beschreibt ferner die Kindheit der Mutter Hella und ihre Entwicklung zu einer überzeugten Kommunistin; sie erfasst das Aufwachsen und die kritische Meinungsbildung von Monika im Hause der Mutter und des Stiefvaters Karl Maron, des DDR-Innenministers von 1955 bis 1963. Das besondere Kolorit dieser alltäglichen Geschichten entspringt den Beobachtungen der Beteiligten, ihren Versuchen, das Geschehen zu verstehen, es selbst zu verklären, und der ständigen Befragung der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Maron schildert die Auswirkungen des politischen Geschehens auf die Großeltern als ein von unkontrollierbaren Mächten gesteuertes Schicksal. Gleichzeitig bezweifelt sie die Vorstellung von undeutbaren Mächten und lehnt jeden Mythos des Vergangenen ab.
Marons Verunsicherung ist persönlich und bestimmt zugleich die Zweifel der Erzählerin, die sich fragt, ob es überhaupt möglich ist, eine objektiv-kritische Schilderung des Vergangenen zu geben. Die Darstellung der Auswirkungen des politischen Geschehens der NS-Zeit, der DDR-Jahre und der Wende auf die Betroffenen erfasst widersprüchliche Auffassungen: man musste sich anpassen; man wollte überleben; das Schicksal ist undeutbar; man wurde aufgerufen, verantwortlich zu handeln. Der Rückblick hält eine Szene fest, in der die Mutter nach alten Fotos sucht und auf einen Karton mit Briefen des Großvaters aus dem Ghetto und Antwortbriefen der Kinder stößt. Die Mutter ist verwirrt, kann sich nicht erinnern, diese Briefe gelesen oder geschrieben zu haben. Maron stellt fest: „es war unmöglich, daß sie die Briefe nicht gelesen hatte, so wie es unmöglich war, daß sie die in ihrer eigenen Handschrift nicht geschrieben hatte.“ (10) Die Erkenntnis, dass sich die Mutter an den Briefwechsel, „in dem es um ihr Leben ging, nicht erinnern konnte“ (11), verbunden mit der Tatsache, dass jedes Vergessen in der öffentlichen Meinung gerade zu einem Synonym für Verdrängung und Lüge geschrumpft“ (11) war, leitet Reflexionen über Gedächtnis, Erinnern, persönliche und historische Wahrheit, Dokumentation und Authentizität ein, welche die gesamte Darstellung prägen. Diese Überlegungen sind nicht nur maßgebend für die Schilderung des Lebens der Großeltern und der Mutter, sondern bestimmen auch Marons Bestandsaufnahme ihres eigenen Lebens.
Besonders aufschlussreich sind Marons Zweifel angesichts ihrer eigenen Vergangenheit. Beim Nachdenken über ihre 1995 im „Spiegel“ enthüllte Beziehung zum MfS gerät sie schließlich in ähnliche Verwirrung wie ihre Mutter. Sie ist überzeugt davon, dass ihr Kontakt, der der Stieftochter des DDR-Innenministers Karl Maron, mit der Stasi nichts als eine „kuriose und komische Episode“ war. Sie ist „nicht sonderlich stolz“ auf die Rolle, die sie gespielt hat, sieht aber auch keinen Grund, sich zu schämen, denn sie hatte die Konsequenz aus ihren Irrtümern bereits vor vielen Jahren gezogen. Besonders beachtenswert wirkt Marons Geständnis ihrer zunehmenden Verunsicherung, als ein Fernsehredakteur sie beschuldigt, einen Bericht über ihre beste Freundin für die Stasi verfasst zu haben. „Es war unmöglich, trotzdem begann ich, mir Situationen auszudenken, in denen ein Mensch etwas tun könnte, ohne später davon zu wissen … Es gab eine Stunde, in der ich bereit war, alles für möglich zu halten … wenn es das gibt, daß einer außerhalb seiner selbst ist und dann nichts mehr davon weiß.“ (200) Maron spricht hier die völlige Verunsicherung der Menschen in einem Staat an, in dem jeder nicht nur ständig überwacht wird, sondern auch selbst schließlich daran teil hat, eine Situation, die Hilbig in Ich (1993) und Eine Übertragung (1989) verfolgt.
Aus dieser Sicht, in der jedes Erinnern in kritisches Nachdenken, Befragen und Neubesinnen übergeht, entsteht eine Denkform der fortgesetzten Reflexion, in der das Vergangene im Gegenwärtigen aufgehoben ist und zugleich das Zukünftige mitdenkt.24 Deshalb endet das Buch konsequent mit einem Blick auf unsere Tage. Die Erzählerin erträgt, dass ihre Mutter Mitglied der PDS ist, so wie diese sich damit abgefunden hat, dass ihre Tochter „Antikommunistin“ wurde. „Morgen werde ich sie anrufen, oder übermorgen … heute jedenfalls noch nicht.“ (205)25 Von ausschlaggebender Bedeutung ist die von nahezu allen Autor(inn)en erwähnte Eigenheit persönlicher Erinnerungen: beim Rückblick entstehen Angstzustände. Erfahrungen aller Art – irgend etwas schwer Bedrückendes, wirklich Erfahrenes, manches gehört oder gelesen und verinnerlicht – trüben die Erinnerung. Sie erregen Unruhe und Schrecken.
Im Rückblick auf ihre Kindheit, der Fragestellung Marons vergleichbar, kommt Christa Wolf in Kindheitsmuster (1976) immer wieder auf das Problem zurück, wie eine Situation entstehen konnte, in der Menschen nicht nur gleichgültig wurden, sondern auch niemals die richtigen Fragen stellen konnten und nichts mehr wissen wollten. Sie betont den Verlust fester Normen und die Hilflosigkeit der Menschen in den Kriegsjahren, die jede sinnvolle, freie Entwicklung individueller Eigenschaften verhinderte. Wolf charakterisiert mit ihrer Feststellung die Haltung von Mitläufern, Nischenstehern, „Nicht-Betroffenen“ und allen, die wie Grass findet am Rande stehen. „Auch daß Schriftsteller – was ihres Berufes ist – die Vergangenheit nicht ruhen lassen können, zu schnell vernarbte Wunden aufreißen, in versiegelten Kellern Leichen ausgraben, verbotene Zimmer betreten, heilige Kühe verspeisen oder wie Jonathan Swift es getan hat, irische Kinder als Rostbraten der herrschaftlich englischen Küche empfehlen, ihnen also generell nichts, selbst nicht der Kapitalismus heilig ist, all das macht sie anrüchig, strafwürdig. Ihr schlimmstes Vergehen jedoch bleibt, daß sie sich in ihren Büchern nicht mit den jeweiligen Siegern im historischen Verlauf gemein machen wollen, sich vielmehr dort mit Vergnügen herumtreiben, wo die Verlierer geschichtlicher Prozesse am Rande stehen, zwar viel zu erzählen hätten, doch nicht zu Wort kommen.“26 Die vorliegende Darstellung erschließt, dass eigentlich alle, die in den Jahren zwischen 1933 und 1945 lebten, betroffen sind.
Auseinandersetzungen dieser Art entsprechen den Erwartungen der Leser in autobiographisch eingefärbten Kindheitserinnerungen, in historisch oder gesellschaftskritisch entworfenen Romanen, wie etwa Grass’ Ein weites Feld (1995) oder Erzählungen, die die persönliche Entwicklung Einzelner nach 1945 schildern. Sie wirken dagegen überraschend und geben den Texten ein besonderes Kolorit, wenn sie entweder unvermittelt auftreten oder gegenwärtige Familienverhältnisse und Gesellschaftsstrukturen beleuchten, deren besondere Eigenart darin besteht, dass sie von der deutschen Vergangenheit geprägt wurden (wie etwa in Jurek Beckers Amanda herzlos, 1992; Herta Müllers Der Fuchs war damals schon Jäger, 1992 oder Herztier, 1994; Gerlind Reinshagens Zwölf Nächte, 1989 oder Jäger am Rand der Nacht, 1993; und selbst Birgit Vanderbekes Das Muschelessen, 1990).
2.2.Abrechnen – Verstehen
Erzählungen und Bühnenstücke, die Einblicke in das historische Geschehen aus der Perspektive der Betroffenen vermitteln, betonen nahezu ausnahmslos die Schwierigkeit, im Überblick ein Verständnis der Vergangenheit zu gewinnen. Sie thematisieren Ahnungslosigkeit, Dabeistehen, Schweigen, Wissen, Verfehlung, Tat und Sünden der Unterlassung. Die Aufarbeitung führt aus der Zeit der Weimarer Republik und der Kriegsjahre über die Zeit des getrennten Deutschlands bis in die Gegenwart. Aus der lebendig-bunten, wechselnden Folge der Schilderungen entsteht die Voraussetzung für einen Überblick der Vergangenheit, der die Grundlage für ein Verständnis der Geschichte bildet. Die Erzählungen (Romane, Novellen, Kurzgeschichten, Genrebilder), Interviews und Debatten der Autor(inn)en der Kriegs- und Nachkriegsgenerationen von 1945 bis 1985 haben sowohl die Erinnerung an Nationalsozialismus, Holocaust und Krieg als auch die Deutungsmuster der Vergangenheit maßgebend geprägt. Trotz einer scheinbar faktisch abgesicherten Grundlage sind die darauf aufbauenden, kulturell erworbenen Bewusstseinsbilder literarische Erkundungen. Sie sind einerseits individualisiert, da Erzählungen die Ereignisse aus der Perspektive und Erlebnissphäre Einzelner gestalten. Andererseits erhalten sie eine Abstraktion des Allgemeinen oder Typischen durch die unterschiedlichen Erzählverfahren, durch eingeflochtene Kommentare und Fragen an die vorausgegangene Generation, die manchmal zu Familienzerwürfnissen führen. Fragen, Dialoge und Selbstgespräche erweitern die historische Sicht, in der sich dann ein mögliches Geschichtsverständnis anbahnt. Die politischen Debatten über Kollektivschuld, Verbrechen, Nazi-Opfer, Holocaust, Schlussstrich, geteiltes Deutschland, Wiedervereinigung und Leiden einer verführten Generation kommen in den Darstellungen zu Wort. Die Vergangenheit spricht immer mit, wenn Autor(inn)en literarische Figuren entwerfen, die über sich nachdenken und ein persönliches Selbstverständnis entwickeln, das sich nicht von dem nationalen Selbstverständnis trennen lässt.
Die ersten literarischen Auseinandersetzungen mit der Vergangenheit setzen Zeichen, sind richtungsweisend und schaffen in Gestaltungen des thematisierten Krieges und den damit verknüpften typischen Motiven der Todesfahrt, der verkehrten Welt, des Chaotischen, der Umwertung von Farben wie etwa schwarzer oder roter Schnee, der rauchenden Gaskammern und Stimmen im Wind die Voraussetzung für eine Tradition, die bis heute fortbesteht. Sie stellen keine Versuche einer umfassenden historischen Aufarbeitung dar. Sie vertreten mit Ausnahme der aus der Emigration in die sowjetische Besatzungszone und spätere DDR heimgekehrten, engagierten Schriftsteller keine eindeutige politische Einstellung. Was vorherrscht ist ein Misstrauen gegenüber jeder Politik, eine allgemein demokratische Haltung und die Hoffnung auf einen neuen Anfang. Wichtig ist das zentrale Anliegen, die jüngste Vergangenheit mit einer neuen Sinnstiftung zu konfrontieren. Das Gestern erscheint im Spiegel des Andersseins, das im Gegensatz zu den Rückgriffen auf die Antike nicht vorbildlich wirkt, sondern kritische Distanzierung fordert. Das Individuum wird aufgerufen, im Willen zum Mitleben eine neue lebenswürdige Grundlage des Daseins zu schaffen. Aichinger, Apitz, Böll, Bredel, Borchert und Celan rechnen ab und klagen an. Die Bestandsaufnahmen verzichten auf Ambivalenz. Sie gehen von der Überzeugung aus, dass alle am Krieg Beteiligten schuldig waren. Der charakteristische Standort der erzählenden Stimmen ist der eines Richters, der zugleich die Indizien der Anklage vorlegt. So entsteht die eigenartige Situation, dass selbst dann, wenn zentrale Figuren im Handlungsverlauf gezwungen werden ihr Versagen anzuerkennen, der Grundzug der Erzählperspektive im Ordnungsgefüge eines möglichen sittlichen Handelns verankert bleibt.27
Die Stimmen unterscheiden klar zwischen gut und böse, Täter und Opfer, Recht und Unrecht, Schuld des Handelns und Sünden des Unterlassens. Diese Haltung bedingt eine Dialektik von Identitätsverständnis und eines möglichen Andersseins, das im Ruf an das Gewissen zu Wort kommt. Der menschlichen Identität zugeordnet ist die Freiheit und gleichermaßen die Unfreiheit des Willens: Die Freiheit, denkend an einer Sinnstiftung des Daseins mitzuwirken, die Unfreiheit, sich im Handeln und Unterlassen den in historischem Verlauf wechselnden, zeitbedingten und konkret zweckbezogenen Vorstellungen anzupassen. Dem Anderssein zugeordnet ist ein Prinzip der sittlichen Ordnung und möglichen Vollkommenheit. Es ist ein Entwurf der reinen Vernunft, nicht historisch ableitbar, aber dennoch sittlich sinnstiftend im Dasein verankert. Daher zögert Aichinger nicht den Morgenstern, Apitz nicht die kommunistische Utopie und Borchert nicht Gott und den Anderen in die Texte zu übernehmen. Jedes Erkennen des Andersseins verlangt verantwortliche Entscheidungen und Selbsterkenntnis. Viele Texte schildern, wie einzelne Figuren in der Grenzsituation des NS-Staates und der Ausnahmesituation des Krieges in Ereignisse verwickelt werden, in denen sie verantwortlich, das bedeutet im Zusammenhang der Texte grundsätzlich sittlich handeln sollten, aber in tragischer Verstrickung oft schuldig werden. Der Begriff der Verantwortlichkeit ist in der juristischen und der ethischen Sinndeutung dem Begriff der Schuld, einer möglichen Verschuldung beigeordnet. Das bedingt, selbst wenn die frühen Texte den Sachverhalt nur kurz belichten, außerordentliche Lebenskrisen. Sie kommen zu Wort, als Beckmann die schweren Folgen seiner Ausführung eines Befehls erkennt,28 wenn die Krankenschwester in Borcherts „An diesem Dienstag“ aus dem Lazarett an ihre Eltern schreibt: „Ohne Gott hält man das gar nicht durch“ (194), wenn ein Heimkehrer in Bölls „Als der Krieg zu Ende war“ monatelang darüber nachdenkt, wo „die Grenze zwischen Haß und Verachtung verläuft“, und als er sie nicht finden kann sagt: „ich wäre lieber ein toter Jude als ein lebender Deutscher“29, oder wenn Feinhals und Heinrich Fähmel erfahren, dass Unterlassung und selbst der Widerstand zu menschlicher Verschuldung führen.30 Die Krise wird zum Wendepunkt im Leben des Lokomotivführers Franz Ossadnik in Bieneks Zeit ohne Glocken. Er ist ein Mitläufer, erfüllt seine Pflicht, fährt täglich mit seinem Zug in das Vernichtungslager Birkenau und erkennt eines Tages plötzlich auf dem Bahnsteig in den auf den Abtransport wartenden Menschen seine Nachbarn und Mitbürger aus Gleiwitz. Die anonyme Menge nimmt plötzlich Gestalt an. In der Nacht sagt er seiner Frau, er habe sich freiwillig zum Frontdienst gemeldet, denn die Arbeit als Lokomotivführer könne er nun nie mehr tun.31 In anderen Erzählungen erscheint die Krisensituation als Forderung, unter keinen Umständen nachzugeben, sondern zu handeln. Deshalb ringt sich Ellen in Aichingers Die größere Hoffnung zur Einsicht durch: Du musst handeln. Du musst Dein eigenes Ausreisevisum unterschreiben.32
Nicht zu übersehen sind Dokumentationen, die in der Gegenwart die Verfehlungen der Vergangenheit wieder entdecken. Milo Dor konstatiert in der mit der Beschreibung des Lebens von Mladen Raikow verflochtenen Bestandsaufnahme der Kriegs- und Nachkriegsjahre sachlich und scheinbar unbeteiligt einen Kreislauf des Bösen. Dors Technik der narrativen Umzingelung der zentralen Figur vermittelt Einblicke in Mladens Existenz durch Überlegungen zahlreicher Figuren – Verwandte, Bekannte, Freunde, Beobachter und Autor. Sie findet eine exakte Parallele in der historischen Situation, in der sich nichts ändert. Mladen ist eingekreist. Die Machthaber wechseln, aber Deutsche, Jugoslawen, Russen, Österreicher foltern, schinden, unterdrücken und vergewaltigen ihre Opfer. Mladen, ursprünglich standhaft, ist am Ende zermürbt und völlig desillusioniert. Die Bewusstseinslage in der österreichischen Zweiten Republik ist eine des Vergessens und der Anpassung an die neue Wirklichkeit. Mladen weiß, dass man in Mitteleuropa heute nicht ohne weiteres Menschen umbringt, kann sich aber vorstellen, dass man „einfach Passanten zu einer bestimmten Stunde anhält, verhaftet und über den Haufen schießt.“33Die Raikow-Saga ist wie Ransmayrs Morbus Kitahara ein Dokument der Resignation und trägt in der Gestaltung eines möglichen Fortbestehens der Unbelehrbarkeit der Menschen zum historischen Verständnis bei.