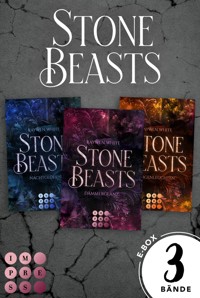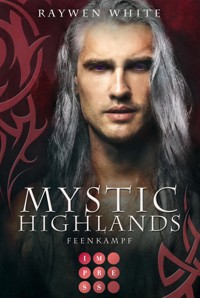4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Forever
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Die-Unsterblichen-Reihe
- Sprache: Deutsch
Sie kann sich nicht erinnern, doch er kämpft um ihre Liebe – Der zweite Teil der packenden Romantasy-Saga Nachdem Bael aus den Fängen des Dämonenfürsten befreit ist, macht er sich auf die Suche nach Ashra, der Liebe seines Lebens. Er findet heraus, dass sie vor vielen Jahren in ihre Heimat, das Elfenreich, zurückgekehrt ist, wo sie als Prinzessin in Kürze heiraten soll. Verzweifelt versucht Bael, sie umzustimmen, doch Ashra kann sich nicht an ihn und ihre Liebe erinnern. Als die Elfen beginnen, Jagd auf den Eindringling zu machen, sieht Bael keinen anderen Ausweg als die Flucht. Er nimmt Ashra mit sich, deren Erinnerungen immer wieder auflodern, nur um dann erneut zu erlöschen. Es beginnt eine Reise voller Gefahren, die gleichzeitig eine Zerreißprobe für Baels Gefühle wird. Doch wer steckt hinter dem Fluch, der Ashras Erinnerungen bannt? Und wird es Bael gelingen, seine große Liebe zurückzugewinnen? Von Raywen White sind bei Forever by Ullstein erschienen: Entfachte Glut (Der Fluch der Unsterblichen 1) Vergessene Leidenschaft (Der Fluch der Unsterblichen 2) Flammender Sturm (Der Fluch der Unsterblichen 3) Gestohlene Gefühle (Der Fluch der Unsterblichen 4)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 868
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Die AutorinRaywen White lebt gemeinsam mit ihrem Mann im Raum Frankfurt am Main. Schon als Kind wurde ihr nachgesagt, sie habe eine lebhafte Fantasie. Diese hat sie sich glücklicherweise bis heute bewahrt. Denn erst in den letzten Jahren entdeckte die Diplominformatikerin ihre Leidenschaft fürs Schreiben. Ganz besonders haben es ihr dabei die Genres Fantasy und Romance angetan, die sie gekonnt miteinander verbindet.
Das Buch
Sie kann sich nicht erinnern, doch er kämpft um ihre Liebe – Der zweite Teil der packenden Romantasy-SagaNachdem Bael aus den Fängen des Dämonenfürsten befreit ist, macht er sich auf die Suche nach Ashra, der Liebe seines Lebens. Er findet heraus, dass sie vor vielen Jahren in ihre Heimat, das Elfenreich, zurückgekehrt ist, wo sie als Prinzessin in Kürze heiraten soll. Verzweifelt versucht Bael, sie umzustimmen, doch Ashra kann sich nicht an ihn und ihre Liebe erinnern. Als die Elfen beginnen, Jagd auf den Eindringling zu machen, sieht Bael keinen anderen Ausweg als die Flucht. Er nimmt Ashra mit sich, deren Erinnerungen immer wieder auflodern, nur um dann erneut zu erlöschen. Es beginnt eine Reise voller Gefahren, die gleichzeitig eine Zerreißprobe für Baels Gefühle wird. Doch wer steckt hinter dem Fluch, der Ashras Erinnerungen bannt? Und wird es Bael gelingen, seine große Liebe zurückzugewinnen?
Von Raywen White sind bei Forever by Ullstein erschienen:Entfachte Glut (Der Fluch der Unsterblichen 1)Vergessene Leidenschaft (Der Fluch der Unsterblichen 2)Flammender Sturm (Der Fluch der Unsterblichen 3)
Raywen White
Vergessene Leidenschaft
Der Fluch der Unsterblichen
Forever by Ullsteinforever.ullstein.de
Originalausgabe bei Forever Forever ist ein Digitalverlag der Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin Oktober 2016 (1) © Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin 2016 Umschlaggestaltung: ZERO Werbeagentur, München Titelabbildung: © FinePic® Autorenfoto: © privat ISBN 978-3-95818-115-1 Hinweis zu Urheberrechten Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken, deshalb ist die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben. In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
Verlust
Erst wenn man jemanden verliert, kann man wirklich ermessen, wie sehr man denjenigen wirklich gebraucht hat. Wie sehr jemand ein Teil von einem selbst war.
Ich spüre den Verlust, als würde mir die Seele entrissen.
Es schmerzt.
Brennt in meinen Lungen.
Nimmt mir jede Kraft, mich zu bewegen. Mein Lebenswille ist gebrochen, mein Wesen in tausend Stücke zersplittert.
Und doch schlägt mein Herz wie wild gegen meinen Brustkorb. Atme ich stoßweise immer wieder die abgestandene Luft. In mir ist noch ein winziger Funke Leben, ein winziger Hauch von Widerstand. Ich weiß nicht, woher ich die Kraft nehme, um zu kämpfen. Winzige Splitter meines zerstörten Selbst hängen noch am Leben, wollen leben.
Haben Hoffnung.
Es tut so verdammt weh. Eine nie enden wollende Qual raubt mir die Luft zum Atmen. Stumm öffne ich den Mund zu einem erbitterten Schrei der Pein, doch er sitzt tief in meinem Hals, sitzt fest verankert in meinem Herzen und lässt mich nicht los.
Mein ganzer Körper krampft, bäumt sich auf, im sinnlosen Kampf, den er führt. Die Natur selbst ist stärker als mein gebrochener Wille, der nur noch ein Ende meines Leidens herbeisehnt.
Ich habe nicht mehr die Kraft, nicht mehr den Willen zu atmen und doch füllt der nächste Lufthauch meine Lungen, schlägt mein Herz weiter gegen meine Rippen. Ich verstehe nicht, warum winzige Stücke in mir noch um den nächsten Atemzug kämpfen. Denn in diesem Leben gibt es nichts mehr. Nichts. Ich bin gefangen in meinem Körper, gefangen im Schmerz, der mich in die trostlose Unendlichkeit begleitet.
Wie viel Leid, wie viel Schmerz kann ich noch ertragen, bevor mein Körper endlich aufhört sich gegen den gnadenvollen Tod zu wehren?
Nichts ist mehr da, wofür es sich lohnt zu leben.
Nichts außer Verzweiflung.
1.
Wütend und gereizt schritt Bael Dragos durch den großen Raum und fuhr sich aufgebracht durch seine kurzen braunen Haare. Es war ungewohnt und merkwürdig, durch die sauberen Strähnen zu streichen, die sich nun in Wellen über seine Ohren legten. Lange Zeit hatte ihm kein Friseur zur Verfügung gestanden. Ihm hatte eigentlich gar nichts zur Verfügung gestanden. Nur Einsamkeit. Nur Dunkelheit.
Fünfundzwanzig Jahre lang war er kein Teil dieser Welt gewesen. War von einem Dämon in ein finsteres Loch geworfen worden. Doch das war nun vorbei. Sein gequälter Geist schien dies jedoch immer noch nicht wirklich glauben zu können. Das Gefühl, die schweren schmiedeeisernen Ketten würden um sein Fußgelenk liegen, ließ ihn einfach nicht los.
Das Zimmer, in dem er sich befand, machte ihn nervös. Es schien so leer zu sein wie sein Leben. Nur ein großes Futonbett und eine Kommode standen in dem fast kahlen Raum.
Nach fünfundzwanzig Jahren in dem kleinen Kerker hatte er nun das Gefühl, er würde sich in dieser Weite verlieren oder ins Nichts gezogen werden. Die Wände waren weiß gestrichen, alles war hell und freundlich, blendete seine Augen, die so lange nur Dunkelheit gekannt hatten.
Die großen Panoramafenster boten einen wundervollen Ausblick auf die leuchtende Skyline von New York, die sich vor dem dunklen, wolkenverhangenen Himmel abhob. Doch er vermied es, einen Blick hinauszuwerfen, wandte sich verunsichert ab. Die Aussicht auf Freiheit beunruhigte ihn, nachdem er jahrelang nur auf nackten und kahlen Fels gestarrt hatte.
Wie oft hatte er sich in all den Jahren der Gefangenschaft nach diesem Ausblick gesehnt? Wie oft hatte er den Anblick der Skyline vor seinem inneren Auge heraufbeschworen? Doch jetzt, wo er ihn wahrhaftig direkt vor sich sah, konnte er ihn nicht ertragen. Er war ein Mahnmal, das ihn immerzu daran erinnerte, wie lange er fort gewesen war.
Fünfundzwanzig Jahre. Es hatte sich alles verändert. Er hatte sich verändert.
Der Zorn brodelte in ihm. Zugleich fühlte er sich verwirrt und verloren. Die Trauer um all die unwiederbringlichen Jahre lag schwer wie ein Mühlstein um seinen Hals. Wie ein verwundetes Tier wollte er sich zurückziehen, wollte einfach nur vergessen, was er in den letzten Jahren durchgemacht hatte. Doch die Wut brannte in ihm lichterloh, ließ ihn aggressiv von einer Seite des Raumes zur nächsten wandern, obwohl sein Körper, der so lange in einer kauernden Position verbracht hatte, dagegen aufbegehrte. Schweiß brach ihm aus allen Poren, seine lange nicht mehr gebrauchten Muskeln zitterten vor Anstrengung. Er sollte sich hinlegen, sollte sich Ruhe gönnen.
Doch er konnte es nicht. Eine kleine zierliche Blondine, die in dem riesigen Bett lag, hinderte ihn daran den Raum zu verlassen und sich wieder in ein enges und dunkles Loch zu verkriechen, wie er es am liebsten getan hätte.
Immer wieder wanderte sein aufgewühlter Blick zu ihr hin. Ihre Augen waren geschlossen und ihr Atem ging ruhig und gleichmäßig. Seit Tagen lag sie nun schon so da. Ihre Haut war talgig und wässrig, sodass sie fast durchscheinend wirkte. Die junge Frau fühlte sich kalt und klamm an. Der Arzt, der sie untersucht hatte, meinte, sie liege im Koma, weil sie ihre gesamte magische Energie verbrannt hatte.
Wütend und verzweifelt hatte Bael dem Mann zugehört, der behauptete, er könne nicht sagen, ob sie überhaupt jemals wieder zu Bewusstsein kommen würde, geschweige denn wann. Bis vor fünf Tagen war er ihr nie zuvor begegnet gewesen. Bis vor fünf Tagen war er noch ein Gefangener gewesen.
Wütend raufte er sich die Haare. Ihr verdankte er seine Rettung aus der Hölle, die Chance darauf, wieder ein Leben führen zu können. Sie bedeutete Hoffnung.
Verloren stand er da und sah hilflos auf das Wunder, das er immer noch nicht begreifen konnte. Auf die glückliche Vergangenheit, für die sie stand. Die Vergangenheit, die er verloren hatte.
Zornig drehte er sich um und schritt in die andere Richtung des Raumes.
Fünfundzwanzig Jahre, die er unwiederbringlich verloren hatte.
Das gleichmäßige Pochen ihres Herzens war deutlich über die Stille hinweg zu hören. Bael war dabei gewesen, als sie sich dermaßen verausgabt hatte, dass ihr Körper in diesen komatösen Zustand gefallen war. Doch er hatte ihr nicht helfen können, er war zu schwach gewesen. Kaum bei Bewusstsein. Es machte ihn wütend und verbittert, er hätte es verhindern können. Er hätte verhindern müssen, dass sie ihr eigenes Leben beinahe geopfert hätte.
Zähneknirschend wanderte sein finsterer Blick von dem wichtigen Wesen im Bett auf den schwarzhaarigen Mann, der indirekt für den besorgniserregenden Zustand der jungen Frau verantwortlich war.
Der Kerl war immerhin ein Drache, er wäre nicht an einer lächerlichen Schusswunde gestorben. Aber das hatte sie nicht wissen können. Sie war so unschuldig, hatte keine Ahnung von seiner Welt, die nun auch ihre war. Sie war als Mensch aufgewachsen.
Weil ich nicht da war. Weil ich nichts von ihr wusste.
Selbstekel überrollte ihn, machte ihn noch wütender. Knurrend trat er einen Schritt auf den Mann zu. Doch Kane Kincade hatte keinen Blick für das, was um ihn herum geschah. Er schien die vielen Leute, die immer wieder in sein Schlafzimmer platzten und mit ihm sprachen, nicht einmal zu bemerken. Er hockte einfach nur neben der zerbrechlich aussehenden Person im Bett und griff wiederholt nach ihrer Hand, ihrem Haar. Streichelte und berührte sie, als wolle er sich davon überzeugen, dass das Mädchen wirklich noch lebte. Dass sie real war.
Auch wenn er Kane in diesem Moment gerne den Hals umgedreht hätte, er konnte ihn verstehen. Konnte dieses drängende Bedürfnis nur zu gut nachvollziehen, da er selbst sich auch ständig vergewissern musste, dass die junge Frau real war. Dass sie nicht nur ein Traum war und er in Wirklichkeit noch immer in seinem Kerker saß, endgültig dem Wahnsinn verfallen.
Er rieb sich über das glatte Gesicht und wunderte sich, dass nicht, wie noch vor wenigen Tagen, lange Barthaare sein Kinn bedeckten. Es hatte sich so viel verändert.
Eingehend betrachtete er das Mädchen. Sie ähnelte ihrer Mutter, hatte die gleiche kleine Stupsnase, aber auch die hohen Wangenknochen der stolzen Elfe. Vor allem aber hatte sie ihre Augen. Diese tiefen grünen Seen, die wie ein Meer aus frischem Gras wirkten. Schmerzhaft zog sich sein Herz zusammen, als er sich erinnerte. Er wollte, dass die junge Frau die Augen wieder öffnete, damit er sicher sein konnte, dass er nicht geträumt hatte.
Er verharrte und starrte einfach auf dieses Wunder. Sein Zorn verpuffte und wurde durch Ungläubigkeit ersetzt. Es war ihm immer noch unbegreiflich, dass dies sein Kind sein sollte. Seine Tochter. Verbittert raufte er sich die Haare. Es war unmöglich. Sie konnte nicht seine Tochter sein. Und doch war sie es. Er wusste es. Müde rieb er sich erneut das Gesicht und durchstreifte weiter das Zimmer.
Sobald er dem Bett auch nur ein wenig nahekam, vernahm er das leise Knurren seines zukünftigen Schwiegersohns. Er konnte es ihm nicht einmal verübeln, nicht nachdem er, ihr eigener Vater, versucht hatte, sie zu töten. Es spielte dabei keine Rolle, dass er zu diesem Zeitpunkt nicht einmal gewusst hatte, dass sie sein eigen Fleisch und Blut war. Seine Tochter. Er hatte eine Tochter.
Es war unglaublich. Es war unmöglich. Es war ein Wunder. Sie war ein Wunder. Nicht nur für ihn, für seine ganze Spezies war ihre Existenz etwas Besonderes. Sie bedeutete Hoffnung auf eine bessere Zukunft. Und doch zugleich auch die schmerzhafte Erinnerung an das, was sein Volk unwiederbringlich zerstören konnte, was es bereits verloren hatte. Er hatte verhindern müssen, dass sie den ärgsten Feinden seines Volkes, den Dämonen, in die Hände fiel. Dass sich das grausame Schicksal seiner Art wiederholte. Ihm drehte sich auch jetzt noch der Magen um und seine animalische Seite kam dichter an die Oberfläche, ließ ihn tief in der Brust ein drohendes Knurren ausstoßen.
Wenn er daran dachte, dass sie tatsächlich in die Hände seines Feindes gelangt war. Welche Pläne der Dämon mit ihr gehabt hatte, der ihn selbst all die Jahre gefangen gehalten hatte. Es trieb ihm die Tränen in die Augen. Zornig fauchte er und versuchte sich nicht auf den jungen Mann zu stürzen, der die Schuld an ihrer Gefangennahme trug. Der sie dieser Bestie ausgeliefert hatte. Er durfte jetzt nicht darüber nachdenken, durfte nicht die Kontrolle verlieren. Sonst würde er sich in das gefährliche Wesen verwandeln, das er in Wahrheit war.
Abermals durchstreifte er den Raum und grübelte darüber nach, dass sich innerhalb von so wenigen Tagen sein Leben unwiderruflich geändert hatte. Er sollte glücklich darüber sein, doch die Zeit im Kerker hatte Spuren hinterlassen, er war nicht mehr der ausgeglichene und optimistische Mann, der er vor seiner Gefangenschaft gewesen war. Er hatte immer viel gelacht, doch es war, als hätte er es in all den Jahren verlernt.
Der Schmerz und der Wahnsinn, die seine einzigen Gefährten in der kleinen Kerkerzelle gewesen waren, hatten ihre Klauen tief in ihn geschlagen, ihn immer noch nicht verlassen. Eine falsche Bewegung von Kane und er würde ihm die Kehle zerfetzen.
Er wollte ihm die Kehle zerfetzen.
Seine Tochter war durch die Hölle gegangen wegen diesem Mistkerl. Seine Reißzähne wurden länger, genauso wie sich seine Klauen zu spitzen Dolchen formten. Da war er wieder, der blanke Zorn des Wahnsinns, der in ihm wütete und seine Schritte durch den großen Raum beschleunigte, wie auch den Takt seines Herzschlags. Er ließ ihn einfach nicht los.
Fest ballte er die Fäuste, biss die Zähne zusammen, bis auch dieser kurze Wutanfall vorüber war. Er durfte den Mann nicht töten. Nicht wenn ihm das zukünftige Glück seiner Tochter irgendetwas bedeutete. Aber wie gern würde er es tun. Wie gern würde er all den Schmerz und den Zorn, der unter einer hauchdünnen Schicht in ihm brodelte, loswerden. Er durfte ihm nicht nachgeben, durfte sich nicht der blindwütigen Aggression des Drachen in ihm ergeben. Er würde alles um sich zerstören, auch sie.
Tief atmete er ein. Er war nicht nur auf Kane Kincade wütend, nein, er war vor allem über die Tatsache wütend, dass man ihm die Jahre ihrer Kindheit gestohlen hatte, dass er nicht die Möglichkeit gehabt hatte, sie zu beschützen. Wäre er da gewesen, wäre sie Kane niemals über den Weg gelaufen. Es war ihm scheißegal, dass sie dessen Gefährtin war.
Die Tür in den Flur öffnete sich geräuschlos. Im Augenwinkel erkannte er eine großgewachsene Frau mit rotblonden Haaren, die den Raum betrat. Sie hatte zwei Hörner, wie es bei Dämonen üblich war, die sich in einem eleganten Schwung nach oben streckten, aber sie war keine Dämonin. Sie gehörte zu seinem eigenen Volk, sie gehörte zu den Drachen.
Seine seit Tagen aufgestaute Wut kochte über, doch bevor er sich dem wilden Wesen in sich endgültig ergab, stürmte er an der Rothaarigen vorbei, die ihn bekümmert ansah. Tief in ihm war das Wissen vergraben, dass sie nichts für all die Geschehnisse konnte. Er wollte sie nicht hassen. Doch sobald er sie – seine eigene Mutter – sah, das wissende und geheimnisvolle Lächeln, welches sie meistens zur Schau trug, schien ihm der Zorn sämtlichen Verstand zu entreißen und zurück blieb nur der Instinkt eines wilden Tieres. Sie musste es gewusst haben. Sie hätte dieses Desaster verhindern können. All das Leid, das seine Gefährtin erduldet haben musste.
Schwankend blieb er stehen, als das Gefühl der Einsamkeit, des unendlichen Verlustes, ihn schmerzhaft traf. Er vermisste sie so sehr, dass er es nicht einmal ertrug, ihren Namen auszusprechen. Seine Gefährtin, die Mutter seiner Tochter. Wenn er bei seiner Tochter war, sah er sie vor sich und scharfe Klingen zerschnitten sein Herz. Doch dieses Gefühl war für ihn normal, nachdem er fünfundzwanzig Jahre nichts anderes gespürt hatte. Fünfundzwanzig Jahre getrennt von ihr.
Er wollte zu ihr, er musste sie sehen. Wahrscheinlich wollte sie jedoch nach all der langen Zeit gar nichts mehr mit ihm zu tun haben. Sie hatte ihn damals nicht akzeptiert, hatte sein wahres Wesen verabscheut. Wie sehr würde sie ihn nun hassen, wo der Drache in ihm dicht unter der Oberfläche saß. Jeden Moment bereit zuzuschlagen. Tief in sich spürte er das Monster, das sie in ihm gesehen hatte. Er würde es nicht noch einmal ertragen, den Hass und die Abscheu in ihren strahlenden Augen zu sehen. Zitternd atmete er ein.
Bael hörte es knacken und spürte, wie ihn jemand kräftig am Arm zog. Als er aufsah, erkannte er den jungen Matthew Baker, der ziemlich schockiert auf etwas starrte und murmelte: »Kein Wunder, dass uns Kane aus dem Haus haben will, wenn du ihm die Einrichtung demolierst.«
Verständnislos schaute Bael in dieselbe Richtung, in die der Blick von Matt ging, und fluchte, als er die zerstörte Arbeitsplatte bemerkte. Er hatte gar nicht mitbekommen, dass er in die Küche gegangen war, geschweige denn, dass er die schwarze Granitplatte so fest umklammert und schließlich zerbrochen hatte.
Böse grinste er und zwinkerte Matt zu. »Ich bin der Vater seiner Gefährtin, der Junge wird mich niemals aus dem Haus bekommen.«
Der andere Mann öffnete mit einem leichten Druck eine der langweiligen weißen Schranktüren, die nicht einmal einen Griff hatten, und holte sich eine saubere Tasse aus dem Schrank. »Das klingt irgendwie merkwürdig aus deinem Mund.« Er drückte in schneller Abfolge einige silberne Knöpfe an einem riesigen schwarzen Automaten, der direkt im Anschluss den angenehmen Duft von frischem Kaffee verströmte.
»Was klingt merkwürdig?«
Matthew lächelte ihm verschwörerisch zu. »Vater seiner Gefährtin.«
Bael knurrte und nahm sich ebenfalls eine Tasse aus dem Schrank. Ein Kaffee würde ihm guttun. Er fühlte sich müde und erschöpft. Zitternd stellte er die langweilige weiße Tasse – wieso musste seine Tochter ausgerechnet auf diesen Langweiler stehen – unter den Kaffeevollautomaten. Weiter kam er allerdings nicht, bei dem Druck auf den Knopf mit der Aufschrift Start passierte gar nichts. Er versuchte noch einige andere Knöpfe, aber das Gerät schien ihn nur mit blinkenden Lichtern auszulachen.
»Das kann man ja nicht mit ansehen.« Matt drängte ihn etwas von der modernen Maschine fort und drückte wieder schnell hintereinander einige Knöpfe und schon summte der Automat glücklich vor sich hin, bevor dieser seine Tasse mit heißem Kaffee füllte.
Böse funkelte Bael den Automaten an, der nur ein weiteres Zeugnis war für die rasante Entwicklung der menschlichen Technik, die er verpasst hatte. Das Ding konnte froh sein, dass es nicht allein mit ihm war, sonst hätte er es zu Kleinholz verarbeitetet. Er war jedoch in diesem riesigen Apartment nie allein. Ständig spazierten andere Drachen ein und aus, wollten das Wunder sehen, welches seine Tochter war.
Die Nähe zu den vertrauten Personen, deren Leben weitergelaufen waren, während sein eigenes nur aus einem schwarzen Loch bestanden hatte, brannte wie Salz in einer offenen Wunde. Er ertrug es nicht, wenn ihm jemand zu nahekam. Ertrug die Nähe seiner damaligen Freunde nicht. Die mitleidigen Blicke. Das Lachen.
Seufzend lehnte er sich an die zerstörte Arbeitsfläche und beobachtete, wie die kleinen Luftblasen im cremigen Schaum auf dem Kaffee platzten. »Ich finde ehrlich gesagt alles merkwürdig. Es hat sich so viel verändert. Ich kann kaum glauben, dass ich Vater bin. Ich mache mir Sorgen, weil sie immer noch nicht erwacht ist. Dass mein Kind ein weiblicher Drache ist, ist mir ehrlich gesagt egal!«
Aber irgendwann würde er sich damit auseinandersetzen müssen, denn seine Tochter war der erste weibliche Drache, der seit mehr als sieben Jahrtausenden geboren worden war. Sie war die Hoffnung für sein ganzes Volk.
In Noor, dem Reich der Elfen, 38 Jahre zuvor
Auf einer kleinen Hügelkuppe stand eine junge Frau und sah auf die in der Ferne strahlenden weißen Mauern des Königspalastes zurück, der die vielen kleinen und bunten Gebäude der friedlichen Stadt Evaron überragte. Das leuchtende Weiß glitzerte in der Sonne, als wäre der Palast ein strahlendes Juwel, eingebettet im saftigen Grün des Landes. Die Schatten der großen Bäume hinter ihr streckten sich den Hang hinunter, als würden sie nach dem einladenden Licht des Gebäudes greifen wollen.
Tief atmete Ashra die frische und reine Luft des Morgens ein. Noch zögerte sie, ihr waghalsiges Vorhaben umzusetzen. Schon eine ganze Weile stand sie im Schutz des Waldes und betrachtete wehmütig die Schönheit ihres geliebten Zuhauses. Es fiel ihr schwer fortzugehen, ihre Heimat, ihr Volk und ihre Familie zu verlassen. Sie kannte nicht die Gefahren, die auf sie warteten. Hatte keine Ahnung vom Nexus, der Welt, in die sie gehen wollte.
Einen Schritt nur in den grünen Wald hinein und sie wäre das erste Mal so weit von ihrem Heim entfernt, wie noch nie zuvor in den zweiundsechzig Zyklen ihres kurzen Lebens. Fort von allem Vertrauten, der Sicherheit ihrer Familie, fort von ihren Freunden. Einfach allem, was ihr jemals etwas bedeutet hatte.
Sie sog die frische Waldluft tief in ihre Lungen. Es gab kein Zurück mehr, sobald sie diesen Schritt tun würde, hinein in den dunklen Wald. Noch zögerte sie. Lieber würde sie bei ihrem Volk bleiben, das sie brauchte.
Beschämt schloss sie die Augen und senkte ihren Blick auf den grasbewachsenen Boden. Nein, die Bewohner von Evaron brauchten sie nicht, nicht wirklich. Ihr Vorhaben würde ihnen mehr helfen, als wenn sie weiterhin ihre kleinen Verletzungen heilte oder sich lächelnd der Menge zeigte. Es gab genug fähige Heiler in der Stadt. Es wäre anmaßend von ihr, deren Fähigkeiten nicht zu würdigen, auch wenn sie die Beste ihrer Zunft war.
Und doch versagte sie. Konnte das schlimmste Leiden ihres Volkes einfach nicht heilen. Konnte nicht das drohende Schicksal der Elfen abwenden. Ihr Volk starb und das bereits seit mehreren Lebenszyklen. Es war ein langsamer Tod, schleichend kam er zu ihnen auf leisen Sohlen und nahm ihnen Stück für Stück die Hoffnung auf eine wundervolle Zukunft. Eine Zukunft voller Leben.
Tränen traten ihr in die Augen. Sie konnte dies nicht einfach hinnehmen und tatenlos danebenstehen, wie ihr Vater es seit Langem tat. Nicht einen einzigen weiteren Tag lang.
Kräftig stieß sie die angehaltene Luft aus ihren Lungen. Unter ihrem Volk gab es viele fähige und talentierte Heiler, doch keiner von ihnen unternahm etwas. Sie ignorierten es, genauso wie der König, dem sie einfach blind folgten. Sie trat einen kleinen Schritt zurück. Das Blut rauschte ihr in den Ohren vor Aufregung und Angst.
Wenn weiterhin mehr Elfen starben, als geboren wurden, dann würde ihr stolzes Volk aussterben und die Dämonen konnten die wenigen Überlebenden auch noch vernichten, wie sie es schon so oft versucht hatten. Sie würden kommen, würden Evaron niederbrennen und zerstören, wie sie es bereits vor einiger Zeit mit der Hauptstadt der Sylphen getan hatten. Es würde keine Überlebenden geben.
Schon jetzt standen immer mehr Häuser leer in der wunderschönen Stadt, welche sich sanft an den Palast schmiegte. Das süße Lachen eines Kindes war ein kostbares Geschenk, das in letzter Zeit leider zu selten erklang. Viele Paare warteten bereits seit mehreren Dekaden vergeblich auf den Segen von Mutter Sonne. Auf ein Kind, so selten und kostbar.
Eine tiefe Sehnsucht erfasste sie, als sie an das Gefühl dachte, wie sie erst vor sieben Tagen ein Neugeborenes auf dem Arm gehalten hatte. Das Erste seit über zwei Sonnenzyklen.
Ihre Spezies war noch nie sehr fruchtbar gewesen. Den Aufzeichnungen zufolge, die sie in ihrer Ausbildung studiert hatte, nahm die Geburtenrate seit Langem langsam, aber stetig ab. Sie konnte es schwarz auf weiß belegen, doch keinen schien es zu interessieren. Keiner schien ihr überhaupt zuzuhören.
Die Ältesten ihrer Zunft schmetterten ihre Argumentationen einfach ab. Es liege an den anderen Völkern und an deren schlechtem Einfluss. Nur, welche anderen Völker denn? Die Elfen hatten ihr Reich fast vollständig abgeschottet und ließen nur noch wenige ausgewählte Händler das Portal durchschreiten, welches ihre Welt mit dem Nexus verband. Und selbst dies wollte das Parlament nun verbieten. Sie wollten kein einziges fremdes Wesen mehr ihr Herrschaftsgebiet betreten lassen.
Die Männer mit den langen weißen Bärten, die sich Gelehrte nannten, sprachen davon, dass ihr Volk durch die Dämonen immer weiter dezimiert worden wäre und diese die Schuld an dem Sterben ihrer Art trugen. Sie verschlossen einfach ihre Augen vor den Tatsachen, wollten nicht glauben, dass irgendetwas mit ihnen selbst nicht in Ordnung war. Stur behaupteten sie dann immer, dass Kinder schon von jeher selten gewesen seien. Heute wären einfach nicht mehr so viele Eltern würdig, dass ihnen Mutter Sonne ein Kind schenke.
Doch Ashra konnte das nicht glauben. Sie wollte es nicht glauben, wollte einfach nicht weiter nur zusehen. Es hatte nichts mit der Mutter Sonne zu tun. Gar nichts. Die alten Männer waren einfach nur abergläubische Dummköpfe. Sie würde selbst das Schicksal ihres Volkes in die Hand nehmen müssen.
Noch einmal holte sie tief Luft. Ihre Entscheidung stand unumstößlich fest. Sie hatte schon festgestanden, noch bevor sie die Anhöhe erklommen hatte, auf der sie nun Abschied von ihrem Zuhause nahm.
Wenn ihr Vater ihr wenigstens zugehört hätte und auf ihre Vorschläge eingegangen wäre, dann wäre sie vielleicht geblieben. Doch so, so musste sie selbst in den Nexus reisen und das Pantheon, den Rat der magischen Wesen, um Hilfe ersuchen.
Die Männer und Frauen des Rates kamen aus den unterschiedlichsten Reichen, mit dem Ziel, alle magischen Völker zu schützen, sich auszutauschen und zu vermitteln. Ihr weit zurückreichendes Wissen und ihre magische Macht waren legendär. Das Pantheon würde ihrem Volk sicher helfen, doch der König weigerte sich überhaupt mit ihm in Kontakt zu treten. Sein Stolz würde noch den Untergang der Elfen bedeuten.
Sie schluckte, ihr Vater würde ihr diesen Verrat nie verzeihen. Doch das Schicksal rief sie und sie würde ihm folgen. Sie tat es nicht für sich selbst, sondern für ihr Volk, ihrer aller Zukunft. Trotzig straffte sie die Schultern und tauchte endgültig in den dunklen Wald ein. Ihre kräftigen Schritte waren auf dem weichen Moos nicht zu hören. Nur wenige Fuß weit von hier würde der Pfad beginnen, der sie an ihr Ziel brachte. Den Nexus – der Welt der Menschen. Das Zentrum, das alle anderen Welten miteinander verband.
Die verschiedenen Händler, die den weiten Weg auf sich nahmen, um am großen Markttag, der einmal pro Mondzyklus stattfand, ihre Waren feilzubieten, erzählten ihr schon Geschichten aus dem Nexus, seit sie ein kleines Kind war.
Eine Welt, aus der alle anderen entstanden waren, und welche weit größer war, als jedes magische Reich. Die Händler hatten den Nexus immer als einen Ort voller Wunder beschrieben. Dort konnte jeder Macht und Reichtum gewinnen, auch ohne Magie. So wie die Menschen, die Erfindungen besaßen, für die man etwas Ähnliches wie Magie benötigte, etwas, das sie Strom nannten.
Jeder konnte Strom haben, man musste nicht mit dieser magischen Kraft geboren worden sein, man konnte sie kaufen, wie Waren auf dem Markt. Sie wusste über die Menschen nicht viel, nur, dass sie gefährlich waren. Dass sie in früheren Zeiten viele magische Wesen bis zu deren Ausrottung gejagt hatten. Dass sie Krieg gegen die magischen Völker geführt hatten.
Diese ungewöhnliche Mischung aus Angst und freudiger Erwartung ließ ihr Herz laut und kräftig schlagen.
Die Waldluft roch nach Zedern und Kiefern. Schon jetzt hatte sie ein wenig Heimweh, doch sie war immer noch wütend auf ihren Vater, mit dem sie erst gestern Abend wieder lautstark gestritten hatte. Vielleicht war das der Grund, warum sie den Mut fassen konnte, endlich diesen gefährlichen Weg einzuschlagen.
2.
New York, Gegenwart
Zähneknirschend schaute Bael auf den verletzten jungen Drachen, der stöhnend auf dem Boden vor ihm lag. Kane war ein kampferprobter Soldat, durch und durch ein Krieger, der bereits viele Schlachten erlebt hatte. Er selbst hingegen hatte schon immer lieber seine Nase in Bücher gesteckt und sich der Wissenschaft zugewandt. Seine Finger schmerzten, als er sie zu einer Faust ballte.
Auch wenn er bereits über tausend Jahre alt war und die Kraft eines Drachens von Jahr zu Jahr wuchs, niemals hätte er den größeren und erfahrenen Mann dermaßen fertigmachen können. Kane hätte stattdessen mit ihm den Boden aufwischen müssen.
Dass der Junge nicht bei der Sache war, konnte er ihm nicht verübeln. Dessen Gefährtin – seine Tochter – hatte immer noch nicht das Bewusstsein zurückerlangt. Und jeder Tag, der verging, ohne dass sie erwachte, machte nicht nur ihm selbst, sondern auch Kane zu schaffen. Der Junge gab sich die Schuld. Er machte sich schreckliche Sorgen und stand einfach komplett neben sich.
Bedrückt musste Bael sich eingestehen, dass es ihm genauso erging. Er hatte die Kontrolle verloren. Der Zorn in ihm war so gewaltig geworden, dass er nicht mehr klar denken konnte. Nicht nachdem, was er gerade erfahren hatte. Was dieser Mistkerl Tanja zugemutet hatte. Wie er sie behandelt hatte.
Immer noch aufgebracht raufte er sich die Haare, schnaubte wie ein wilder Stier und hielt sich die schmerzende linke Seite. Einige gute Treffer hatte der Junge ihm jedoch auch beibringen können. Bereits jetzt spürte er, wie sein linkes Auge etwas anschwoll. Doch am Ende hatte Kane sich einfach nur von ihm zu Brei schlagen lassen.
Die mangelnde Gegenwehr hatte seinem blindwütigen Zorn die Spitze genommen. Es war unbefriedigend, wenn sich der Gegner nicht wehrte. Seine Instinkte waren die eines Jägers und nicht die eines Schlächters, auch wenn er im Zorn sehr wohl unbedacht töten konnte. Aber er war nicht das Monster, das alle anderen Völker in seiner Spezies sahen.
Tief atmete er ein und versuchte, sich zu beruhigen. Sein sprunghaftes Verhalten war nicht normal, passte eigentlich gar nicht zu ihm. So war er früher nicht gewesen.
Seufzend schaute er wieder auf Kane, der sich langsam aufrappelte. Jetzt, wo die Wut seinen Blick nicht mehr trübte, bemerkte er, in welch schlechter Verfassung der Junge war. Die Qual stand ihm deutlich ins Gesicht geschrieben. Einerseits empfand Bael Mitleid, anderseits wollte er ihn noch mehr leiden sehen. Dieser Bastard hatte seine Tochter entführt. Mitten in die Wüste von Ignate, dem Hauptreich der Dämonen. Noch immer tobte der animalische Wunsch in ihm, den Jungen bluten zu lassen. Wütend knurrte Bael, als der junge Drache sich erheben wollte. »Bleib liegen, ich denke, meiner Tochter gefällt dein Gesicht so wie es ist.«
Er hielt sich nur mühsam zurück und fuhr sich fluchend mit der Hand über den Mund. Die anderen Drachen des Hortes liefen fast nur noch auf Zehenspitzen um ihn herum. Er hörte sie flüstern, sie konnten sich nicht entscheiden, welcher Drache erbärmlicher aussah. Kane oder er selbst.
Sein Blick wanderte wieder zu dem Mann auf dem Boden. Dessen T-Shirt war zerrissen, bereits jetzt schimmerte seine Haut an einigen Stellen im Gesicht bläulich grün, doch der tiefsitzende Schmerz in dessen blauen Augen kam nicht von den Verletzungen. Nein, diesen Schmerz kannte Bael nur zu gut. Es war die Sorge um seine eigene Gefährtin. Die Sehnsucht nach ihr, die einen Drachen fast an den Abgrund des Wahnsinns trieb, solange sie ihn nicht ebenfalls als ihren Gefährten akzeptierte. Solange der Paarungsrausch all sein Denken beeinflusste, bis auch sie die Tatsache akzeptierte, dass sie zusammengehörten. Für Immer, denn ein Drache paarte sich für den Rest seines Lebens. Da, wo sein Herz saß, war nur noch purer Schmerz. Wenn er dadurch den Schmerz beenden könnte, er würde es sich herausreißen.
Seine Gefährtin hatte ihn niemals akzeptiert und doch hatte sie ihm ein Kind geboren.
Er hatte warten wollen, bis das Mädchen aufwachen würde und er ihr alles erklären konnte. Der Schmerz in ihren Augen, als er versuchte sie zu töten, hatte sich tief in seine Seele eingegraben. Es war derselbe Ausdruck von Entsetzen, von Verrat gewesen, wie auch in den wundervollen Augen ihrer Mutter, als er ihr gesagt hatte, dass er ein Drache war. Als sie ihn anschrie, er sei ein Monster.
Ein Blick auf den stöhnenden Mann vor ihm und er kam sich tatsächlich wie dieses Monster vor. Ohne seine Gefährtin würde er zu diesem Monster werden.
Kane würde sich um Tanja kümmern. Es war nicht mehr seine Aufgabe, es war nie seine Aufgabe gewesen.
Resigniert schloss er die Augen. Es war an der Zeit, dass er endlich das tat, was er schon die ganze Zeit hätte tun sollen. Seine Gefährtin finden. Von ihr wollte er Vergebung. Sie sollte die Wunden heilen, die die Gefangenschaft in ihm hinterlassen hatten. Nur sie konnte diese quälende Einsamkeit vertreiben, die ihn seit Jahren in den Wahnsinn trieb.
Wenn er ehrlich war, hatte er einfach Angst. Angst davor, sie für immer verloren zu haben.
Seufzend ging er in das große, helle Schlafzimmer und lehnte sich mit verschränkten Armen an den Türrahmen. Sein Blick wanderte nachdenklich über die leblose Gestalt seiner Tochter und dann zu seiner Mutter, die in einem Stuhl saß und ihn lächelnd beobachtete. Dunkle Schatten zogen über ihr Gesicht und sie presste missmutig ihre Lippen aufeinander.
Bael trat zwei Schritte in den Raum. Wütend presste er die Zähne aufeinander und versuchte sich einzureden, dass seine Mutter seine Gefangennahme verhindert hätte, wäre sie dazu in der Lage gewesen. Doch der Zweifel nagte an ihm und er verspürte den Zorn eines in die Ecke gedrängten Tieres, das sich verteidigen wollte. »Du weißt sicherlich, warum ich hier bin.«
Sie nickte und wandte sich wieder ihrer Enkelin zu, um ihr eine Strähne aus dem Gesicht zu streichen.
Ihre Bewegungen wirkten verkrampft und sorgenvoll. Vielleicht hatte sie in ihren oft verstörenden Visionen etwas gesehen, weswegen sie sein Vorhaben nicht guthieß. Vielleicht machte sie ihm allerdings auch etwas vor, wie schon so oft. Sie würde ihm nicht sagen, was sie gesehen hatte.
Eigentlich spielte dies keine Rolle. Sein Entschluss stand schon seit Tagen fest, er hatte nur den Mut finden müssen sich seiner Angst zu stellen. Angst davor, seiner Gefährtin, seiner Sárnye, gegenüberzutreten, nach all den Jahren, die er sie im Stich gelassen hatte. Das Wissen darüber, dass er nichts dafürkonnte, änderte nichts an den Schuldgefühlen, die er empfand. Er hatte sie in Gefahr gebracht. Noch immer hörte Bael die Drohungen, die der Dämon in sein Ohr geflüstert hatte, während dieser ihn folterte.
Seine Mutter stand auf und schnaufte nicht damenhaft. »Du bist gerade erst zurückgekehrt, ich verbiete dir, jetzt wieder zu gehen.«
Mit verkniffenen Augen sah er sie an. »Ich bin erwachsen, Mutter.«
Plötzlich wirkte die sonst so starke Frau vor ihm schwach und zerbrechlich, als würde sie irgendetwas belasten. Er trat auf sie zu und wollte sie schon in die Arme ziehen, wie er es früher immer getan hatte, wenn die Visionen sie quälten. Doch er konnte nicht, er ertrug ihre Nähe nicht.
»Deine Tochter liegt im Koma, du solltest hier sein, wenn sie erwacht.« Ihre laute Stimme war voller Wut und stachelte seinen eigenen Unmut nur weiter an.
»Ihre Mutter sollte genauso hier sein!« In diesem Moment fragte er sich, ob seine Gefährtin überhaupt hier sein wollte. Ob sie ihr Kind, einen verhassten Drachen, nicht einfach verstoßen hatte.
Er war sich sicher, dass seine Mutter mehr wusste und es machte ihn rasend, dass sie ihm nicht erzählte, was mit seiner Gefährtin geschehen war, nachdem er von dem Dämon Xerxes gefangen genommen worden war. »Ich habe die letzten fünfundzwanzig Jahre in einer kleinen Zelle verbracht.« Wütend zeigte er auf die blasse Gestalt in dem Bett. »Ich habe ihre Kindheit verpasst! Meine Gefährtin verloren! Ich weiß nicht, ob sie auf mich wartet oder mich vielleicht sogar sucht. Vielleicht gibt es aber auch einen anderen Mann in ihrem Leben. Vielleicht ist sie glücklich.« Krampfhaft schluckte er, versuchte seine Fassung zu wahren. Seine Hand zitterte und er fuhr sich durch sein Haar, damit sie es nicht bemerkte.
Immer wieder schossen ihm Bilder von ihr und einem Fremden durch den Kopf. Vermischten sich mit den Erinnerungen aus einer Zeit, als sie noch glücklich zusammen gewesen waren und hinterließen einen bitteren Geschmack. Er wollte nicht, dass seine Gefährtin glücklich war und hasste sich zugleich für diesen Gedanken. Doch es war besser, als den Gedanken zuzulassen, sie könnte tot sein.
Sie ist nicht tot! Sie darf es nicht sein.
Vielleicht wusste seine Mutter genau, was ihn auf dieser Reise erwarten würde. War es nur die Gewissheit, dass er seine Gefährtin endgültig verloren hatte?
Nein, er durfte sich nicht aus Furcht davor weiterhin verstecken. Er würde sich nie aus den Klauen des Wahnsinns befreien, wenn er nicht die Wahrheit erfuhr. Er musste sie sehen. Wenigstens einmal.
»Findest du nicht, dass ich nach dem ganzen Mist wenigstens die Wahrheit erfahren sollte?«
Statt ihm zu antworten, stand Walvarie auf, ging zu dem großen Panoramafenster und blickte hinaus. Minutenlang schwieg sie, während er gespannt darauf wartete, dass sie endlich das aussprach, was sie die ganze Zeit vor ihm verbarg.
Die schmerzhafte Wahrheit.
Sie ist glücklich.
Sie hasst dich.
Sie ist tot.
Er musste daran glauben, dass sie lebte. Es war das Einzige, was ihn nicht endgültig dem Wahnsinn verfallen ließ. Seine Mutter sagte jedoch nichts, kehrte ihm einfach den Rücken zu. Ihm platzte der Kragen, wie so oft in den letzten Tagen. »Verdammt, Mutter! Diese Fragen haben mich die letzten Jahre schon genug gequält. Du hättest es verhindern können!«
Bei seinen Worten zuckte sie erneut zusammen und er presste wütend die Lippen aufeinander. Er hatte es ihr nicht vorwerfen wollen. Kannte ihre Bürde. Wusste, wie ausgeliefert sie eigentlich war.
Die meisten Hellsichtigen wurden irgendwann wahnsinnig. Sie unterlagen dem Irrglauben, sie könnten die Zukunft nach Belieben beeinflussen. Doch es war nur eine Täuschung, denn die Zukunft war schon von Natur aus veränderbar, bestand aus unendlichen Möglichkeiten. Egal was sie auch versuchten, am Ende waren sie nur ein Werkzeug in der Hand des Schicksals. Vollkommen machtlos.
Sie legte ihre schlanke Hand an das kalte Glas und ließ sich nach vorne sinken, bis ihre Stirn ebenfalls die dünne Scheibe berührte. »Du hast keine Ahnung, was es mich gekostet hat, dich dort zu wissen.« Sie drehte sich zu ihm um und erschrocken sog er die Luft ein, ihre Iris war flammend rot, während ihr rosa Tränen die Wangen hinabliefen. »Doch du irrst dich, ich habe es nicht verhindern können.«
Bei dem hilflosen Anblick der sonst so starken Frau, die ihre ganze Art seit Jahrtausenden führte, zerbarst seine gesamte Wut in tausend Stücke und zurück blieb nur das Bedürfnis, sie zu beschützen und zu trösten. Sich ihr in die Arme zu werfen, wie er es als Kind immer getan hatte. »Ich weiß. Und es tut mir leid.« Er trat auf sie zu und umarmte sie, spürte, wie ihr Leib vom Schluchzen erschüttert wurde. Es war ein merkwürdiges Gefühl, jemanden so nah zu sein. Als würden die Nerven unter seiner Haut schmerzhaft unter Strom stehen. »Ich muss sie finden.«
Walvarie schniefte verstohlen und löste sich wieder von ihm. Ihr Blick wanderte zu dem Mädchen und ein zärtliches Lächeln umspielte ihre Lippen, aber in ihren Augen lag Schmerz. »Ich war es. Ich habe deiner Gefährtin ihr Kind genommen.«
»Du hast …« Bael wich entsetzt einen Schritt zurück. »Was hast du getan?«
Kurz schloss Walvarie ihre Augen, doch dann richtete sie sich kerzengerade auf. »Ich habe eine Hexe zu ihr geschickt, um den Säugling zu holen, bevor dieser unseren Feinden in die Hände fällt.«
Kälte kroch in Baels Glieder bei der Erinnerung daran, was Xerxes mit seiner Tochter geplant hatte. Nachdenklich betrachtete er die junge Frau. Das, was er bisher über ihr Leben erfahren hatte, war nicht gerade beruhigend gewesen. »Warum hast du zugelassen, dass sie unter Menschen aufwuchs?« Seine Mutter hätte sie zu sich nehmen können. Der Drachenhort hätte das Mädchen beschützt.
»Ich weiß, was du denkst. Aber es war der einzige Weg, um sie zu schützen.«
»Ich bin mir sicher, dass meine Gefährtin dir danken wird, sobald sie erfährt, dass es nur zu Tanjas Schutz war.«
Walvarie lachte kläglich. »Ja, sicher. So dankbar, wie du es die ganze Zeit über gewesen bist?«
Betreten über sein aggressives Verhalten der letzten Tage verschränkte er mürrisch seine Arme vor der Brust und betrachtete sie aufmerksam. In ihm brannte die Frage, was damals passiert war. Was mit seiner Gefährtin geschehen war. Doch seine Kehle war wie zugeschnürt.
Seufzend spielte Walvarie mit einer Strähne ihres rotblonden Haares. Er kannte sie gut genug, um die verräterischen Anzeichen zu erkennen. Die gerunzelte Stirn, die angespannten Schultern. »Was verschweigst du mir?«
Sie drehte ihm wieder den Rücken zu und sah aus dem Fenster. »Deine Gefährtin ist an ihrem Verlust zerbrochen.«
»Was soll das bedeuten?«
Sie drehte sich zu ihm um, ihre Augen hatten wieder ihre gewöhnliche schwarze Färbung. Es war, als würde man in ein schwarzes Loch sehen und hineingezogen werden. »Die Frau, die du einst kanntest, existiert nicht mehr.«
Knurrend packte er sie an den Schultern. Er konnte es nicht glauben. »Sie ist nicht tot, sie kann nicht tot sein. Ich wüsste es!«
Mit einem schmerzerfüllten Seufzen brach sie zusammen. »Ich weiß es nicht.«
Schockiert erstarrte er. Seine Mutter hatte noch nie diese Worte verwendet. Niemals!
Amerika, 38 Jahre zuvor
Ein unangenehmes Kribbeln begleitete Ashra durch das Portal auf die andere Seite. Der steinige Boden, auf den sie ihren Fuß setzte, unterschied sich sehr von dem saftigen Gras, welches sie eben noch gespürt hatte. Tief atmete Ashra die Luft ein, die sie nun umgab. Sie war trocken und hinterließ einen fremden Geschmack auf ihrer Zunge. Hustend sah sie sich um. Die hoch am Horizont stehende Sonne warf ein tröstendes Licht auf das kleine Tal, in dem sie sich befand. Vor ihr erstreckten sich sanfte Hügel, die in verschiedenen Grüntönen schimmerten. Nur an dem kleinen Bachlauf, an dessen steinigem Ufer sie stand, wuchsen Bäume.
Zitternd setzte sie sich auf einen umgefallenen, verwitterten Baumstamm und atmete tief durch, versuchte die aufkommende Panik zu unterdrücken, die schwer auf ihr lastete. Der Himmel in diesem fremden Reich schien sie zu erdrücken. Sie beugte sich vor und ließ ihre Hand in das kühle Wasser eintauchen, ließ sie von dem seichten Strom umspielen.
Dann zog sie sie hinaus und rieb sich damit über das angespannte Gesicht, während sie immer noch versuchte, mit dem Schock umzugehen, der von der fremden Umgebung ausgelöst worden war. Von dem Gefühl, als würde sie sich auf einmal unter Wasser befinden. Tief atmete sie ein, versuchte ihre Lungen mit Luft zu füllen, um sich zu beruhigen. Doch die Luft war anders als in ihrer Heimat. Schwer und mit einer rauchigen Note.
Fahrig befeuchtete sie sich noch einmal den Hals und den Nacken. Ihr Herz schlug immer noch viel zu schnell von dem letzten Stück, das sie zum Portal gerannt war. Niemand hatte sie aufgehalten oder sich ihr in den Weg gestellt. Aber sie wusste jetzt schon, dass sie bald verfolgt werden würde. Sie hatte das aufgeregte Flüstern gehört, die Blicke der Männer auf sich gespürt, die das Tor bewacht hatten. Die Soldaten des Königs hatten sie erkannt und doch hatten sie sie das Portal durchschreiten lassen.
Sie konnte es immer noch nicht glauben. Immer noch nicht begreifen, dass sie es tatsächlich getan hatte.
Mit ihren bloßen Füßen strich sie über den feuchten Boden. Sie konnte die Magie fühlen, die in ihr wohnte, aber sie war so schwach, dass sie im ersten Moment dachte, es gebe sie in dieser Welt gar nicht. Als Elfe war Ashra ein Wesen der Natur, ihre magische Kraft schöpfte sie aus der Erde. Aus dem Leben, das diese hervorbrachte. Doch sie fühlte fast nichts. Fühlte sich nur einsam und verloren.
Weinend grub sie ihren Kopf in ihre Hände. Ihr war nicht klar gewesen, wie schwierig es werden würde in der Welt der Menschen. Sie hatte das Gefühl, als würde ihr plötzlich ein Teil ihrer selbst fehlen.
Ein vertrautes Geräusch, wie das Muhen einer Kuh, ließ sie irgendwann überrascht aufhorchen. Sie zögerte nur kurz, doch dann erinnerte sie sich an ihre Aufgabe. Wenn sie weiterhin hier saß und weinte, wie ein kleines Kind, würde irgendjemand sie auf Befehl ihres Vaters doch noch zurückholen. Sie stand auf und schaute, woher das Geräusch gekommen war. Die Tiere, die sie in einiger Entfernung hinter einem Hügel in einem eingezäunten Bereich fand, ließen ihr Herz aufgeregt schlagen. Im Nexus gab es auch Kühe, der Himmel war ebenfalls blau, die Bäume und das Gras grün. Es war eigentlich nicht anders als zu Hause. Jedenfalls nicht viel.
Sie lief zu dem Pferch und überlegte, wem diese Nutztiere gehören könnten. Ein merkwürdiges Geräusch war zu hören. Immer wieder im Takt. Ein lautes Summen. Sie fasste kurz an das Seil, das die Fläche umschloss, und schrie überrascht auf. Ihre Hand schmerzte und sie sah erstaunt den Zaun an, der scheinbar dafür verantwortlich war. Fragend und neugierig blickte sie sich um, doch niemand war zu sehen. Langsam streckte sie ihren Zeigefinger aus und berührte erneut das gelbe Seil. Nochmals spürte sie den schmerzhaften Schlag, der ihr durch den ganzen Arm schoss.
Was für eine Art von Zauberei war das? Sie schüttelte sich, zu gern hätte sie dieses merkwürdige Phänomen untersucht, aber sie musste weiter. Irgendwann hoffte sie auf einen Menschen zu treffen. Sie würde sicherlich bald auf eine ihrer Siedlungen stoßen, hatten ihr doch die Händler immer erzählt, dass sie riesige Städte besäßen, die hundertmal größer waren als Evaron. Und auch sonst war bekannt, dass die Menschen überall in der Natur ihre Spuren hinterlassen, sie langsam töteten, weswegen die meisten Elfen sie verabscheuten.
In diesem Moment fragte sich Ashra jedoch, ob die Händler übertrieben hatten. Bis auf den Zaun sah sie nichts, was sich von ihrer Welt unterschied. Die Menschen bestellten genauso ihre Felder und hielten Tiere in eingegrenzten Bereichen wie ihr eigenes Volk.
Es war bereits fast Mittag, als sie auf einen breiten, seltsam anmutenden Pfad stieß. Es sah aus, als wäre die Steinfläche geschmolzen und dann glatt ausgerollt worden wie Brotteig. Die schwarze Straße mit dem gelben Strich in der Mitte war das Erste, was ihr wirklich fremd war, und daher ihre Neugier weckte. Über das Zirpen der Grillen hinweg hörte sie ein dunkles, dumpfes Geräusch. Es erinnerte an einen aufziehenden Sturm, doch am weiten Himmel war keine einzige Wolke zu sehen. Das unheimliche Geräusch wurde lauter. Sie versteckte sich in dem dichten Maisfeld, das nahe dem schwarzen Steinweg lag, und beobachtete, wie etwas Rotes an ihr vorbeisauste. Es war sehr viel schneller gewesen als ein Pferd im wilden Galopp.
Schnell sprang Ashra aus ihrem Versteck und rannte auf den Weg. Noch eine ganze Weile sah sie erstaunt dem roten Fleck hinterher, der mit großer Geschwindigkeit am Horizont verschwand. Magie! Das war eindeutig die Magie der Menschen. Sie hatte nie glauben können, dass sich die Menschen auf Kutschen so schnell fortbewegen konnten wie der Wind. Doch sie hatte es gerade mit eigenen Augen gesehen.
Unsicher stand sie in der Nachmittagssonne und wusste nicht, welche Richtung sie einschlagen sollte. Sollte sie der Kutsche folgen? Oder doch lieber zu deren Ursprung gehen?
Kurzerhand knobelte sie es aus, ließ das Schicksal entscheiden, das sie schon hierhergeführt hatte. Sie blickte in die Richtung, in die die Kutsche entschwunden war, und folgte ihr.
Ihr Magen brummte laut und sie brach sich ein großes StückFlam – ein wohlschmeckendes Elfenbrot – ab, das sie erst heute Morgen beim Bäcker stibitzt hatte. Sie war aufgeregt. Es schien, als würde sie nun doch bald zu den Menschen gelangen. Wie sie allerdings danach das Pantheon finden sollte, um ihr Anliegen vorzubringen, wusste sie nicht. Sie trank einen Schluck aus ihrem Wasserschlauch, den sie erst am Bach aufgefüllt hatte. Das Wasser schmeckte irgendwie scharf und würzig, nicht so klar und rein wie zu Hause.
Sie würde sich daran gewöhnen müssen, denn nach Hause würde sie lange Zeit nicht mehr können. Wehmütig begab sie sich auf den Weg, den ihr Mutter Sonne gewiesen hatte.
Wieder hörte sie das Rauschen der roten Kutsche und schaute neugierig zurück, in die Richtung des lauten Geräusches. Ein grauer Punkt schoss schnell auf sie zu und wurde immer größer. Fasziniert beobachtete sie, wie er an ihr vorbeiraste und dann langsamer wurde und ein Stück von der Steinfläche hinab in den trockenen Staub rutschte.
Erschrocken blieb sie stehen und starrte das merkwürdige Gefährt an, das nur wenige Schritte vor ihr stand. Es sah gar nicht aus wie die Kutschen, die sie kannte. Bis auf die vier Räder und die kastenartige Form hatte dieses Vehikel nur wenig mit den Wagen der Händler oder der königlichen Familie gemein. Aber es war wunderschön, glänzte in der Sonne wie feinstes Silber.
Es gab immer noch ein seltsames dröhnendes Geräusch von sich und sie wusste nicht, wie sie reagieren sollte. Plötzlich erstarb das Geräusch und die Kutsche der Menschen öffnete sich. War sie etwa kaputt?
Eine Frau stieg aus dem Wagen, sie schien alt zu sein, den Falten nach zu urteilen über tausende von Zyklen. Aber halt, das konnte nicht sein, die Menschen wurden nicht älter als hundert. Neugierig musterte sie den ersten Menschen, der ihr begegnete. Eigentlich sah die Frau, bis auf die merkwürdige Kleidung und die runden Ohren, nicht anders aus als die alte Bretaia, der sie immer Kraftbrühe vorbeibrachte.
»Möchtest du mitfahren?«
Ashra legte, darüber verwundert, dass sie die schnellen Worte der menschlichen Frau verstand, den Kopf etwas schräg. Es hieß, die Menschen würden mit vielen verschieden Zungen sprechen.
»Kindchen, die nächste Stadt ist noch einige Meilen entfernt. Du wirst es vor Einbruch der Dunkelheit nicht mehr rechtzeitig schaffen, wenn du die ganze Strecke läufst.«
Ashra hatte keine Ahnung, was Meilen waren, aber die Frau schien ernsthaft um ihr Wohlergehen besorgt. So nickte sie zögerlich. »Danke.«
Das Lächeln, welches daraufhin die Mundwinkel der Menschenfrau nach oben zogen, war ehrlich, und Ashra lächelte zurück. Diese Frau schien ihr nichts Böses zu wollen.
Unsicher folgte sie ihr zu der grauen Kutsche und versuchte sich ihre Furcht vor dem merkwürdigen Gefährt nicht anmerken zu lassen. Sie machte alles genauso wie die Frau, öffnete die Tür und setzte sich in den weichen Sitz aus Leder – dieses Vehikel war eindeutig sehr viel bequemer als eine Kutsche. Allerdings hatte sie Probleme mit dem Band, das sie sich um den Körper wickeln sollte. Es wollte sich immer wieder an seine ursprüngliche Position zurückziehen und der metallene Schmuck an seinem Ende, den die Frau in einen kleinen Schlitz gesteckt hatte, wollte bei Ashra auch nicht stecken bleiben.
Surrend sprang das Band zurück, als das Gefährt ein tiefes Knurren von sich gab und Ashra erschrocken losließ. Sie versuchte sich zu beruhigen und warf verstohlen einen Blick auf die Frau neben sich, die ihre Hände auf ein Rad direkt vor ihr gelegt hatte. Lächelnd und warm war deren Blick auf sie gerichtet. »Kindchen, du brauchst keine Angst zu haben. Ich bringe dich wirklich nur in die nächste Stadt. Du bist von zu Hause fortgelaufen, stimmt’s? Ich werde nicht zur Polizei gehen und dich melden. Du kannst gerne in Joeys Zimmer übernachten, er geht momentan aufs College und es steht daher leer.«
Den ersten Teil hatte Ashra ja noch verstanden, aber der Rest war ihr ein Rätsel. Woher wusste die Frau, dass sie fortgelaufen war? War sie eine Hellsichtige? Unsicher überprüfte Ashra, ob ihre langen Haare noch an Ort und Stelle saßen und die Spitzen ihrer Ohren verbargen. Das einzige Gesetz des Pantheons lautete, dass die Menschen des Nexus nichts von der Existenz magischer Wesen erfahren durften. Es war ihr von klein auf beigebracht worden, denn die Elfen wollten genauso wenig, wie alle anderen Völker, dass die Menschen ihre Art wieder verfolgten. Verhalten entschied sie sich dazu, einfach alles auf sich zukommen zu lassen und sich nicht an den merkwürdigen Worten der Frau zu stören. Sie lächelte und nickte ihr abermals zu. »Danke.«
Das Gefährt ruckte plötzlich vorwärts und fuhr wieder auf die geschmolzene Steinstraße. Ihr Magen schien allerdings irgendwie zurückzubleiben, als es beschleunigte und die Felder zu einem farbigen Strich verschwommen, der an ihr vorbeizog.
»Wie alt bist du, Kindchen?« Sie blickte von dem Farbenrausch, den sie durch die perfekte Glasscheibe sehen konnte und die von der hohen Handwerkskunst der Menschen zeugte, zu der Frau hinüber. »Zweiundsechzig Zyklen werden es beim nächsten Vollmond.«
Die Frau schien darüber nicht glücklich zu sein, ihr Gesicht wurde grimmiger. Nach einer Weile, in der sich Ashra an die schnelle Geschwindigkeit des merkwürdigen Gefährts gewöhnt hatte, fragte die Frau etwas verhalten. »Bist du aus dieser Sekte, die weiter oben in der Nähe von Concordia lebt?« Ashra hatte ihre Finger gegen das vollkommen durchsichtige Glas gelegt und beobachtete erstaunt, wie sich die Landschaft wandelte. Immer mehr Wohnhäuser zogen an ihr vorbei, die Architektur wirkte fremd, aber trotz allem einladend und gemütlich. »Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was eine Sekte sein soll.« Sie hörte ein Schnauben und drehte sich wieder zu der Frau um. »Ist das ein Problem?«
Die Frau warf ihr einen kurzen, musternden Seitenblick zu und seufzte dann. »Nein, nein.« Sie lächelte ihr zu. »Ich befürchte mein Mann wird nur nicht begeistert sein, dass ich mal wieder einen Streuner mit nach Hause bringe.«
3.
New York, Gegenwart
Fünfundzwanzig Jahre lang hatte Bael nun schon warten müssen, dass irgendetwas passieren würde, doch die letzten fünf Minuten kamen ihm vor wie eine Ewigkeit. »Kannst du nicht schneller fahren?«
Matt warf ihm einen bösen Seitenblick zu. »Du siehst genauso wie ich, dass vor uns die Autos stehen und sich keinen Millimeter bewegen.«
Verärgert kniff Bael die Augen zu und rieb sich über das Gesicht. »Ja! Aber … Verdammt!«
Matt lachte. Der junge Drache hatte ein ziemlich fröhliches Gemüt und ging ihm allein deswegen schon auf die Nerven. Obwohl sie sich früher sehr gut verstanden hatten. Aber alle anderen, die gerade seine Tochter belagert hatten, als er das Bedürfnis verspürte, sofort nach seiner Gefährtin zu suchen, hatten ihn nur entsetzt angesehen. Wenn er darüber nachdachte, welchen verstörten Eindruck er gemacht haben musste, konnte er dies sogar verstehen. Selbst jetzt saß der Schock über die Aussage seiner Mutter noch tief.
Die Frau, die du einst kanntest, existiert nicht mehr.
Er musste etwas tun. Irgendetwas.
»Wir werden sie schon finden«, meinte der junge Drache, als könnte er Baels Gedanken lesen.
Wie gern wäre er genauso zuversichtlich wie Matt, aber er hatte das Gefühl, er würde unter Tonnen von Schutt und Asche begraben werden, die einst einmal sein Leben gewesen waren. »Du hast gehört, was meine Mutter gesagt hat.«
»Sie ist deine Gefährtin, wenn sie tot wäre, wüsstest du es.«
»Die Paarung ist nie vollzogen worden«, murmelte Bael leise. Es schmerzte ihn dies zuzugeben. Sie waren nicht wirklich miteinander verbunden, nicht so wie es sich für einen Drachen und seine Gefährtin gehörte.
Matt zog scharf die Luft ein. »Aber wie ist das möglich? Sie hat dein Kind bekommen?« Sein Einwurf war berechtigt. Verzweifelt rieb Bael sich das Gesicht. Es war ein Fehler gewesen. Sein Fehler. Verdrießlich blickte er aus dem Seitenfenster und biss die Zähne fest aufeinander.
»Du konntest dich also damals nicht beherrschen?« Matt lachte und Bael knurrte gefährlich, was den anderen Drachen jedoch nicht im Geringsten verunsicherte. »War das nicht sogar der Grund, warum du mit Kane den Boden aufgewischt hast?«
Wütend warf Bael Matt einen Blick zu. »Frag dich lieber, wieso sie mir eine Tochter geschenkt hat«, fauchte er. Selbst jetzt noch war es für ihn unverständlich, dass er eine Tochter hatte. Je mehr sie sich von dem Penthouse entfernten, in dem Tanja bewusstlos in einem Bett lag, desto mehr hatte er das Gefühl, er hätte sie sich nur eingebildet. Drachen bekamen keine Töchter. Ihre Nachkommen waren allesamt männlich und das aus gutem Grund.
Wenn er sich vorstellte, wie es für seine Gefährtin gewesen sein musste, als sie von der Schwangerschaft erfahren hatte, wuchsen seine Schuldgefühle. Ihr Entsetzen musste riesig gewesen sein, als sie begriff, dass sie sein Kind erwarten würde, das Kind eines Drachen. Sie war vollkommen auf sich allein gestellt gewesen, hatte niemanden in dieser Stadt gehabt, an den sie sich hätte wenden können. Seit er sie damals nach New York geholt hatte, hatten sie jede freie Minute gemeinsam verbracht. Selbst eine Stunde getrennt von ihr, war für ihn damals eine Qual gewesen.
Wütend boxte er auf das Armaturenbrett, das ein protestierendes Knarzen von sich gab.
»Schlag mich, aber lass mein Auto in Ruhe, es kann sich nicht wehren.« Matts entrüsteten Ausruf begleitete ein freches Grinsen, weswegen ihn Bael gar nicht erst ernst nahm und wortlos geradeaus schaute. »Solltest du dich nicht eigentlich genügend abreagiert haben, nachdem du Kane schon gezeigt hast wo der Hammer hängt?« Matt gab Gas, als das Auto vor ihm anfuhr, und bremste, als es ebenfalls bremste.
Bael hätte besser mit der U-Bahn fahren sollen. Knurrend antwortete er ihm: »Für dich reicht es noch.« Mürrisch sah er aus dem Fenster durch die lange Straßenschlucht, die vor ihnen lag. Er hätte jetzt aussteigen und zur nächsten U-Bahnstation laufen können. Doch bei dem Gedanken an die engen Tunnel, an die Dunkelheit, die dort unten herrschte, fing sein Herz an zu rasen. Schon der enge Innenraum dieses Wagens machte ihm zu schaffen, obwohl das Licht alles sanft ausleuchtete und die Schrecken der letzten Jahre zurückdrängte. Unruhig rutschte er in seinem Sitz hin und her. Erinnerungen an seine letzten freien Momente in dieser Welt schossen durch seinen Kopf. Er war auf dem Weg zu ihr gewesen, doch dann …
»Ist alles okay mit dir?« Der ernste und besorgte Blick, den ihm der junge Mann zuwarf, machte ihm bewusst, dass er schwer atmete und seine scharfen Klauen sich in seinen Oberschenkel bohrten, als er diesen fest umklammerte. Er wischte sich mit der Hand über die feuchte Stirn, über die Nase und dann über den Mund. »Nein, aber das ist nicht wichtig. Warum hat der Hort sich nicht um sie gekümmert?«
»Um wen?« Matt setzte den Blinker und bog rechts ab, in eine weniger befahrene Straße.
»Um meine Gefährtin!« Grollend blickte er den jungen Drachen an, der sich auf die Fahrbahn vor ihm konzentrierte und wieder aufs Gas trat.
»Ach die. Da musst du deine Mutter fragen.«
»Ich frage aber dich!«
»Ehrlich gesagt, wusste es keiner.« Matt warf ihm einen nachdenklichen Seitenblick zu und sah dann wieder auf die Straße. »Du hättest erleben müssen, wie sie uns vor zwei Wochen zu sich rief und sagte, sie würde ihre Enkelin besuchen und deswegen eine Weile in New York leben. Es war so still, dass du eine Stecknadel hättest fallen hören. Die Ältesten haben schon überlegt, ob ihre Visionen sie nun doch um den Verstand gebracht haben.«
»Ich finde das nicht lustig.«
Matt seufzte ergeben. »Ich sagte ja, du hättest das erleben müssen. Ärgerlich, dass ich in dem Moment kein Foto von ihren dummen Gesichtern gemacht habe.«
Bael schnaufte ungehalten und Matt wurde ernst. »Also, wie sieht der Plan aus?«
Stumm sah Bael aus dem Fenster, die Autos schlängelten sich langsam und hupend durch die Straßen von New York. »Ich weiß es nicht.« In seinem Inneren schien sich alles schmerzvoll zusammenzuziehen. Er wusste nicht, wo er überhaupt anfangen sollte zu suchen. Sie könnte nach all den Jahren überall sein.
»Hatte sie Bekannte hier in New York?«
Müde ließ er den Kopf hängen. »Um ehrlich zu sein, hatte sie dafür keine Zeit.«
Matt lachte und zwinkerte ihm grinsend zu. »War wohl mit einem paarungswütigen Drachen beschäftigt?«
Bael brummte nur als Antwort. Die Paarungszeit war für Drachen nicht gerade einfach, sie konnten an nichts anderes denken, als daran, sich mit ihrer Gefährtin zu vereinen. Und wenn sie daran gehindert wurden, wurden sie meist aggressiv.
Fünfundzwanzig Jahre. Ein Wunder, dass er bisher nicht den Verstand verloren hatte. Er fühlte sich vollkommen ausgebrannt und hilflos.
»An irgendwen musste sie sich doch wenden können, als sie …«, begann Matt erneut.
»Ich weiß es nicht. Verdammt noch mal!« Unwirsch unterbrach Bael ihn und raufte sich die Haare. Er hatte sie im Stich gelassen. Er hätte Vorkehrungen treffen müssen, hätte sich selbst mehr in Acht nehmen müssen.
Stumm saßen sie eine Weile nebeneinander und starrten aus der Frontscheibe.
»Aber du musst doch irgendetwas wissen; hatte sie Familie? Freunde?«
Wütend ballte Bael die Fäuste. »Wir haben nie darüber gesprochen.« Er schluckte, als er den mitleidigen Blick bemerkte, mit dem ihn Matt betrachtete, und sah erneut aus dem Seitenfenster.
»Was ist mit Montgomery?«, versuchte es Matt nach einer ganzen Weile wieder, während Bael auffiel, dass sie scheinbar im Kreis fuhren, denn an diesem Springbrunnen waren sie vor Kurzem schon einmal vorbeigekommen. »Wenn ich hier allein gestrandet wäre und Hilfe bräuchte, würde ich mich an ihn wenden.«
Matt hatte recht. James Montgomery war das mächtigste Wesen in dieser Hemisphäre und die meisten magischen Wesen gingen zu ihm, wenn sie etwas brauchten. Der Mann hatte überall seine Finger im Spiel. Selbst der Hort unterhielt geschäftliche Beziehungen zu ihm, obwohl seine Art eigentlich lieber für sich blieb. Er kannte den Mann schon seit er denken konnte und sah in ihm so etwas wie einen Freund. Zumindest, soweit James überhaupt irgendjemandes Freund sein konnte. Es wäre möglich, dass seine schwangere Gefährtin zu ihm gegangen war. Ärgerlich fluchte er. Warum hatte er daran nicht schon früher gedacht.
Kansas, 1978