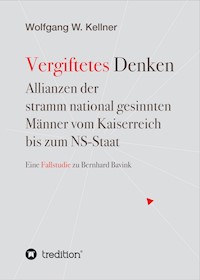
Vergiftetes Denken - Vom Kaiserreich bis zum NS-Staat - Geschichte von Antisemitismus Rassenideologie Eugenik E-Book
Wolfgang W. Kellner
9,00 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Es geht um die Denkweisen aus der Wilhelminischen Zeit, die sich in der Weimarer Republik radikalisierten und von der nationalsozialistischen Vernichtungsideologie adaptiert wurden. Dieses wird am Beispiel des Bildungsbürgers Bernhard Bavink aus Bielefeld (1879-1947) gezeigt. Die Etablierung einer antiwestlichen, antidemokratischen und antiparlamentarischen Politik im ideologischen Diskurs des halben Jahrhunderts vom Kaiserreich bis zum NS-Staat wird auch inter Verwendung zeitgenössischer Quellen geschildert. Das Buch soll dazu beitragen, Erkenntnisse für aktuelle politische Entwicklungen zu gewinnen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 401
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
„…hat Deutschland eine schwindelhafte Extratour in den Abgrund getanzt…“
(Die Schuldfrage, 1946)
So liegt Erkenntnis […] im denkenden Nachvollziehen des von Menschen Hervorgebrachten und Getanen (Geschichte)
(Basler Universitätsreden, 30. Juni 1960)
Karl Jaspers
Wolfgang W. Kellner
Vergiftetes Denken
Allianzen der
stramm national gesinnten
Männer vom Kaiserreich
bis zum NS-Staat
Eine Fallstudie zu Bernhard Bavink
Wolfgang W. Kellner, Diplom-Verwaltungswirt, war dreizehn Jahre lang hauptamtlicher Bürgermeister seiner Heimatstadt Leer/Ostfriesland. Er veröffentlichte 2015 im „Emder Jahrbuch für historische Landeskunde Ostfrieslands“ die Abhandlung „Die Vergessenen – Die ‚Juni-Aktion‘ 1938 gegen ‚Arbeitsscheue‘ im Raum Leer“. Es folgte 2017 eine Studie zur Rolle der Kommunen und ihrer Führungskräfte im NS-Staat mit dem Titel „Verfolgung und Verstrickung – Hitlers Helfer in Leer“.
Wolfgang W. Kellner ist Vorsitzender der „Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit Ostfriesland“.
© 2021
Autor: Wolfgang W. Kellner, Leer
Lektorat: Hergen Hillen, Hamburg
Umschlaggestaltung: Axel Camici, Pogum
Verlag & Druck: tredition GmbH, Halenreie 40–44, 22359 Hamburg
ISBN:
Softcover 978-3-347-49461-9
Hardcover 978-3-347-49462-6
E-Book 978-3-347-49463-3
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung,
Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie, detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Inhalt
Vorbemerkung
Einleitung
Erster Teil: Leben in einem unruhigen Jahrhundert
Im Kaiserreich bis zur Zäsur 1918
In der abgelehnten Weimarer Republik
In der „Nationalen Bewegung“ und im NS-Staat bis zum Krieg
Kriegsjahre
Die Offensive 1941–1944 für eine Professur in Münster
Zweiter Teil: Die geistige Welt der „stramm national gesinnten Männer“
Ein völkisch-nationales Weltbild und der Kepler-Bund
Im Netzwerk der „Völkischen Erneuerer“
Der „Organische Staat“: Politische Waffe gegen die Demokratie
Dritter Teil: „Die biologische Katastrophe“
Arier und Germanen und die Weltherrschaft
Der Wert eines Menschen unter Barbaren
Rassenideologische Radikalisierung
„Biologisierung“ und „Medikalisierung“ der Politik
Aufgaben der „Ausjätemaschine“: Sterilisation und Euthanasie
Die „Lebenserfüllung des Weibes“
Vierter Teil: Die „Judenfrage“
Gewöhnlicher und „planmäßiger“ Antisemitismus
Der Rabbiner und der Antisemit
Bavinks Vorschlag für eine „Judengesetzgebung“
Fünfter Teil: Der Geist zwischen Philosophie und Ideologie
Relative und ewige Wahrheiten und die Religion
Philosophie und Ideologie
Vergiftete Vokabeln
Konklusion
Quellen
Danksagung
Literatur
Vorbemerkung
Nach der Veröffentlichung meiner regionalen Studie zur Rolle von Führungskräften der Kommunen im NS-Staat1 regten Leser an, die Rolle des in Leer geborenen Dr. Bernhard Bavink (1879-1947) im rassenideologischen Diskurs der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts zu untersuchen. In dieser Studie, die sich mit Einzelschicksalen im NS-Staat und der Struktur der Verfolgung verschiedener Bevölkerungsgruppen befasste, behandelte ich kursorisch den theoretischen Überbau für eine biologische Bevölkerungspolitik.
Bei meinen Recherchen zur Person Bavink stieß ich auf ein Gutachten von Michael Schwartz aus dem Jahre 1993, das für die Stadt Bielefeld verfasst wurde. Anlass war eine Diskussion um die Benennung einer Schule nach Bernhard Bavink.2 Das Gutachten beleuchtete u. a. die Einstellung Bavinks zu dem Thema der „Vernichtung lebensunwerten Lebens“ im NS-Staat und löste eine lebhafte Debatte aus, die zu mehreren apologetischen und relativierenden Schriften führte.3
Mein Interesse daran, das Leben Bavinks als Sonde für diesen Zeitraum deutscher Geschichte zu verwenden, war geweckt.
Das Ziel der vorliegenden Arbeit ist, die schriftlich niedergelegten Erinnerungen und die Veröffentlichungen Bavinks und seiner Zeitgenossen ab der Wilhelminischen Zeit mit den allgemeinen politischen und weltanschaulichen Strömungen ins Verhältnis zu setzen. Bavink war Zeuge und Akteur eines für Deutschland dramatischen politischen Wandels, der „einer schwindelhaften Extratour in den Abgrund glich“.4
Die Fragen, die sich aus der Auseinandersetzung mit den vorgefundenen Materialien ergaben, lauteten: Wie konnte sich in diesem halben Jahrhundert die antiwestlich, antidemokratische und antiparlamentarische Politik im „Bildungsbürgertum“ etablieren? Was bewirkte die „Ideologisierung der Realität“ (Hannah Arendt)? Wie kam es dazu, dass ein Gymnasialprofessor wie Bavink von den Nationalsozialisten schon vor dem Machtwechsel zu den führenden Rassentheoretikern im Deutschen Reich gezählt wurde, dass er Vorschläge für eine „Judengesetzgebung“ veröffentlichte, entgegen dem Votum seiner Kirche die „Zwangssterilisierung“ an Kindern befürwortete und auch die „Vernichtung lebensunwerten Lebens“ in seinen Denkhorizont aufnahm und dabei Menschen das Menschsein absprach? Was war die Ursache für eine damit einhergehende Verwilderung und Verrohung der Sprache, die nicht nur Bavink, sondern auch einen Teil der „geistigen Elite“ auszeichnete?
Diese Arbeit will Antworten auf diese Fragen ergründen. Sie hat Aktualität, weil Denkweisen aus der Wilhelminischen Zeit, die sich in der Weimarer Zeit radikalisierten und von der nationalsozialistischen Vernichtungsideologie adaptiert wurden, nach dem Zusammenbruch des „Dritten Reichs“ nicht verschwanden. Sie sind noch heute im politischen Diskurs von stramm national gesinnten Personen zu finden. Ich möchte dazu beitragen, Erkenntnisse für aktuelle politische Entwicklungen zu gewinnen.
Es geht um Bavinks Wirkung als „öffentlicher politischer“ Mensch, vor allem als Teil der von ihm so bezeichneten „eugenischen Bewegung“ und der Zugehörigkeit zu der von ihm so klassifizierten Gruppe von „stramm national gesinnten Männern“. Dabei sollen die allgemeinen politischen Verhältnisse infolge der umwälzenden historischen Entwicklungen, vor allem seit Ende des Ersten Weltkrieges, analysiert werden. Strukturen, Prozesse, Inhalte und Personen können nicht voneinander getrennt werden.
Zur Methodik: Mehrdimensionalität des individuellen Denkens und Handelns eines Menschen über Jahrzehnte ist komplex. Im ersten Teil wird daher das Handeln und Denken Bavinks im biografischen Kontext dargestellt. Der zweite bis fünfte Teil handelt von wesentlichen Denkansätzen und Auffassungen aus verschiedenen Perspektiven. Bestimmend für mich war der Ansatz, die „geistige Atmosphäre“ und das politische Umfeld auf dem Weg in den NS-Staat zu analysieren.
Ich werde daher durch ausführliche Wiedergabe von Zitaten von Zeitgenossen unterschiedliche Politikansätze behandeln. Dadurch soll der originale Sprachduktus für die Leser*innen zugänglich werden. Eine Umformung in die indirekte Rede des heutigen Sprachgebrauchs hätte einen Informationsverlust zur Folge; die Gedanken sollen „unentstellt“ (Karl Jaspers5) dargeboten werden. Wichtig ist für mich, die Sprache selbst als Indiz für die „Ideologisierung der Realität“ (Hannah Arendt) und Instrumentalisierung als politische Waffe zu dokumentieren.
1 Kellner, Wolfgang, Verfolgung und Verstrickung – Hitlers Helfer in Leer.
2 Schwartz, Michael, Bernhard Bavink: Völkische Weltanschauung – Rassenhygiene – Vernichtung lebensunwerten Lebens, Hg.: Stadtarchiv und Landesgeschichtliche Bibliothek Bielefeld.
3 Vgl. u. a. Hentschel, Klaus; Bernhard Bavink; Gromann, Margret, Bernhard Bavink.
4 Jaspers, Karl, Die Schuldfrage, S. 68.
4 Jaspers, Karl, Die Schuldfrage, S. 68.
5 Jaspers, Karl, Die maßgebenden Menschen, S. 74 f.
Einleitung
Im Jahr 1918, mit Beginn seines dokumentierten öffentlichen politischen Wirkens, war Bavink (1879-1947) ein neununddreißig Jahre alter promovierter Studienrat und Autor. Der zeitliche Anteil seiner „politischen“ Lebenszeit (gerechnet ab dem 18. Lebensjahr) betrug in der Wilhelminischen Zeit 20 Jahre, in der Weimarer Republik 15 Jahre und im NS-Staat 12 Jahre. Zehn Jahre lebte er in Kriegszeiten, ohne selbst Soldat zu sein. Er starb im Sommer 1947 im besetzten Deutschen Reich vor Gründung der Bundesrepublik Deutschland.
Die Menschen, die Bernhard Bavink persönlich kannten, schilderten ihn als liebevollen Familienvater, beliebten Lehrer, Universalgelehrten und gläubigen Christen. Sein langjähriger Kollege und sein Zeuge in Entnazifizierungsverfahren, Oberstudiendirektor Dr. Zenke, schrieb:
„Wenn ich den Sinn seines Lebens richtig deute, so wurde es gelebt aus einem dreifachen Glauben: zum einem aus dem Glauben an das Reich der Werte, das unzerstörbar über allem Irdischen lebt, zum zweiten aus dem Glauben an die Kraft des Geistes, der das Erforschliche erforscht und vor dem Unerforschlichen sich in Demut beugt, und zum dritten und höchsten aus dem Glauben an Gott als den Grund des wahren Lebens. […] Professor Bavink war im Grunde kein politischer Mensch, wenn er auch am Schicksal Deutschlands innigen Anteil genommen hat.“6
Bavink legte insbesondere nach 1945 Wert darauf, als unpolitischer, rational denkender Wissenschaftler gesehen und verstanden zu werden.7 Widersprüchlich war dazu seine Aussage im März 1928 in einem Aufsatz zur Rassenhygiene, als er zu den „Politikern“ bemerkt: „das sind wir heute alle.“8
In Würdigungen nach seinem Tod9 wurde von der „Tragik seines Lebens“ gesprochen. Diese Aussage bezog sich ausdrücklich nicht auf sein familiäres Schicksal,10 sondern darauf, dass es Bavink weder in der Weimarer Republik noch in der NS-Zeit gelang, eine Professur zu erhalten. Eine ihm 1947 noch vor Gründung der Bundesrepublik angetragene Honorarprofessur in Münster konnte er durch seinen frühen Tod nicht mehr antreten. Er stellte seinem Namen in Veröffentlichungen stets die Bezeichnung „Professor“ voran, was durchaus zu Irritationen führte. Diesen Titel erhielt er am 10. Juli 1917 als Oberlehrer nach dem preußischen Erlass vom 10. Juli 1917 als „Prädikatsbezeichnung“.11 Bis zu einem Drittel der Oberlehrer konnten seinerzeit einen solchen Titel als „Charaktertitel“ erhalten.12 Mehrere Versuche scheiterten, einen Lehrstuhl zu besetzen. Er, der sich zu Recht zum „Bildungsbürgertum“ zählte, dachte und handelte zeitlebens wie ein Mitglied der aktiven akademischen Elite.
Auf seinem spezifischen wissenschaftlichen Gebiet, den Naturwissenschaften, war er Schullehrer und Autor, nicht Forscher, sondern Kompilierer. Die Auguste-Viktoria-Schule für Mädchen, an der Bavink als Studienrat tätig war, wurde erst 1923 von der Stadt Bielefeld mit der Stimmenmehrheit der von ihm damals vehement geschmähten Parteien SPD und „Demokraten“ in ein Lyzeum mit realgymnasialen Studienzweig umgewandelt. An dieser Schule konnten die Schülerinnen dann auch die allgemeine Hochschulreife erlangen.13
Wer war Bavink? Einige divergierende Stimmen dazu:
Ein deutschnationaler Sympathisant der NS-Bewegung und unbequemer Non-Konformist, konservativer Intellektueller während der NS-Zeit (Hentschel), gescheiterter und vergessener Pionier eines Dialogs zwischen Theologie und modernen Naturwissenschaften (Benk), Beispiel für die inhumanen Konsequenzen einer völkisch-biologischen Weltanschauung (Schwartz), Lehrer, Wissenschaftler und Philosoph (Gromann), Vorkämpfer der Euthanasie (Klee), „zwiespältigste“ Persönlichkeit der ausgehenden Weimarer Jahre und der ersten Monate nach der Machtergreifung (Vogelsang), bedeutender Mann (Wenzl), Mensch(en) unserer Heimat, der uns den Weg zu den unversiegbaren Quellen höchster Werte zeigte, einer der bedeutendsten Söhne unserer Stadt und unserer ostfriesischen Heimat (Bürgermeister Uebel und Stadtdirektor Bakker der Stadt Leer 1952), wissenschaftlicher Schriftsteller, Poet (Hermann), gefährlich (Rabbiner Kronheim), Darsteller und Lehrer, kein eigentlicher Denker (Karl Jaspers).
Diese Charakterisierungen Bavinks sind Gegenstand meiner Arbeit. Nach Karl Jaspers ist „der politische Zustand und die gesamte Lebensart der Menschen nicht zu trennen. Es gibt keine absolute Scheidung von Politik und Mensch sein…“ Und weiter: „Man könnte denken: Es dürfe doch Menschen geben, die völlig apolitisch seien […] wie Mönche, Einsiedler, Gelehrte und Forscher, Künstler […] Aber die politische Haftung trifft sie mit, weil auch sie ihr Leben durch die Ordnung des Staates haben. Es gibt kein Außerhalb in modernen Staaten.“14 Dem Psychiater Karl Jaspers folgend kann eine nachträgliche Aussage über das eigene unpolitische Verhalten, wie sie Bavink 1945 für sich traf, für eine im eigenen Bewusstsein vorhandene diffuse Schuldannahme sprechen und damit auf eine Entlastungsstrategie zielen.
In der vorliegenden Arbeit werde ich Gedanken des in Oldenburg geborenen konservativen und elitären Denkers und Mediziners Karl Jaspers (1883–1969) verwenden, da er ein Zeitgenosse Bavinks war. Trotz ihrer unterschiedlichen Lebenswege gab es einen Schnittpunkt im Leben der beiden: Jaspers fertigte 1929 ein Gutachten über Bavink während eines Besetzungsverfahrens für einen Lehrstuhls an der Universität Erlangen an.
Bavink schrieb im Juni 1939 nach sechs Jahren im NS-Staat, in einer rückblickenden Bewertung: „Unter den geistigen Wegbereitern des neuen Deutschland gebührt Eugen Fischer ein Ehrenplatz: er hat mit Ploetz und Lenz15 […] und vielen anderen in der Zeit vor 1933 die eugenische Bewegung […] mächtig vorwärts treiben helfen […] und so die geistige Atmosphäre mit schaffen helfen, in der das Dritte Reich zur Existenz gelangen konnte.“16 (Hervorh. d. Verf.) Er zählte sich selbst in diesem Zusammenhang zu den alten Mitkämpfern dieser Männer. Bavinks hier anklingender Stolz über das Dritte Reich spiegelt wider, dass Hitler und der NS-Staat kurz vor Kriegsbeginn nach dem Anschluss Österreichs, der Annexion des Sudetenlandes und der „Rest-Tschechei“ auf dem Höhepunkt ihres Ansehens in der Bevölkerung standen. Hitler hatte im März 1939 geäußert: „…ich werde als der größte Deutsche in die Geschichte eingehen.“17
Dieses Diktum Bavinks zum Entstehen des Dritten Reiches ist ein Schlüssel für das Verständnis der Epoche, dieses halben Jahrhunderts, mit der sich diese Studie befasst. Die Auffassung Bavinks, das Schaffen einer bestimmten geistigen Atmosphäre unter seiner Beteiligung sei notwendige Bedingung für das Entstehen des NS-Staates gewesen, führt zu der Leitvorstellung für das vorliegende Buch. Bavink war nicht nur Beobachter, sondern auch politischer Akteur. Die Beschäftigung mit ihm kann als Sonde genutzt werden, um die Bedingungen für den „Tanz in den Abgrund“ (Karl Jaspers) zu untersuchen.
6 Dr. Zenke, Bernhard Bavink – ein Lebensbild, in: Festschrift der Stadt Leer, 1952. Zenke, der seit 1912 in Bielefeld lebte und acht Jahre jünger als Bavink war, hatte wie dieser die Reifeprüfung am Realgymnasium in Leer abgelegt. Landesarchiv Nordrhein-Westfalen Abt. Westfalen, R 001 Personalakten Nr. 863.
7 Im Entnazifizierungsbogen des Jahres 1945 gab er an, er habe in seinem Wirken unpolitische Themen behandelt.
8 Bavink, Bernhard, Rassenhygiene und protestantische Ethik, in: Süddeutsche Monatshefte, 25. Jg., Heft 6, S. 435.
9 Zenke i. d. „Festschrift der Stadt Leer“ und Hermann in „Bernhard Bavink und die Philosophie“.
10 Bavinks erste Ehefrau starb nach zehnjähriger Ehe. Drei seiner Kinder aus erster und zweiter Ehe starben 1944/1945 innerhalb eines Jahres, davon zwei Söhne als Wehrmachtssoldaten.
11 Staatsarchiv Münster, Provinzial Schulkollegium, Personalakten Nr. B 8.
12 Nipperdey, Thomas, Deutsche Geschichte 1866–1918, Band I, S. 560.
13 Vogelsang, Reinhard, Geschichte der Stadt Bielefeld, Band III, S. 99 f.
14 Jaspers, Karl, Die Schuldfrage, S. 52 ff.
15 Lenz 1936: „Die jüdische Rasse ist […] als eine Rasse von Parasiten geschildert worden. Zweifellos können die Juden zu einem schweren Schaden für ein Wirtsvolk werden […] Ein Lebewesen gedeiht besser ohne Parasiten.“ Zitat in: Klee, Deutsche Medizin im Dritten Reich, S. 256.
16 Unsere Welt, Heft 6, Juni 1939 in dem Aufsatz: Eugen Fischer 65 Jahre alt, S. 154 f.
17 Vgl. Fest, Joachim, Hitler, S. 770.
Erster Teil: Leben in einem unruhigen Jahrhundert
Im Kaiserreich bis zur Zäsur 1918
Bavink wurde im Jahr 1879 geboren und damit in politische Zustände hineingeworfen, die höchste Anforderungen an ein moralisches politisches Bewusstsein und Verhalten der Menschen verlangten.
Wer im letzten Quartal des 19. Jahrhunderts geboren wurde, erlebte bei normaler Lebenserwartung zwei Weltkriege, vier Staatsformen und einen elementaren Wandel der Wirtschaft und Gesellschaft vom Agrarstaat zum hochtechnisierten Industriestaat, von einer Klassengesellschaft zur Massengesellschaft. In zeitlichem Zusammenhang mit seinem Geburtsjahr wurde der Viertakt- (Otto-)Motor, das Telefon, die Glühlampe, die elektrische Eisenbahn und das Maschinengewehr erfunden.
Deutschland war erst wenige Jahre vor Bavinks Geburt nach dem deutsch-französischen Krieg 1870/71 zu einem von Preußen beherrschten Nationalstaat geworden, mit einem „Kaiser“ an der Spitze. In den vorangegangenen Jahrzehnten waren die Grundlagen für umfassende Veränderungen des Wirtschaftslebens gelegt worden. Werner Sombart, ein zeitgenössischer Nationalökonom und Soziologe (1863–1941), schrieb:
„Was der Zeit nach 1851 den Stempel aufdrückt und ihr einen schon völlig modernen Charakter […] verleiht, ist der Umstand, daß sich die Spekulationswut – die Gewinnsucht – ein neues Feld der Betätigung sucht: die Gründung gewinnversprechender Unternehmungen […] In diese politisch ruhigen Jahre fällt die Geburtsstunde des neuen Deutschlands.“18Zu den Jahren nach der Reichsgründung 1871 schrieb Sombart: „Dann kommen die Jubeljahre nach den siegreichen Kriegen19 mit ihrem Gründerrausche als einer Folge der enormen Zuflüsse von Bargeld aus Frankreich, des „‘Milliardensegens‘„. Das unterlegene Frankreich musste 4,2 Milliarden Goldmark für die Kriegskontribution zahlen.20 „Es wiederholen sich genau dieselben Erscheinungen, nur großartiger, mächtiger wie [sic] in den 1850er Jahren: Friedensstimmung, Preishausse, rasche Vermögensbildung, Entfachung der Gewinnsucht, Hereinbrechen eines Spekulations- und Gründungsrausches“.
Von 1810–1910 verdoppelte sich die Einwohnerzahl Deutschlands. Das bedeutete innerhalb von Einhundert Jahren eine Zunahme von vierzig Millionen Menschen und infolgedessen eine hohe Binnenwanderung. In Preußen lebten 1849 rd. 28 % der Menschen in Städten, 1910 im Deutschen Reich 60 %.21 Die Bevölkerungsdichte stieg von 76 auf 120 Menschen pro qkm (von 1871–1914).22
Zwischen dem Geburtsjahr Bavinks und den letzten Vorkriegsjahren (1912) stieg die Einwohnerzahl seiner Geburtsstadt Leer um fast ein Drittel, von rd. 9.900 auf 12.000 Menschen.23 Der Stadtplaner Henrici prognostizierte eine „Stadt von mindestens 50.000 Einwohnern“ innerhalb der damaligen Stadtgrenze.24
In den achtziger und neunziger Jahren des 19. Jahrhunderts stagnierte die Wirtschaftsentwicklung, die in eine Rezession mündete. Etwa fünf Millionen Auswanderer verließen in dieser Zeit das Land. Ab 1895 bis zum Krieg erlebte das Land wieder eine Phase der Hochkonjunktur.
Die Umwälzung der Wirtschaft und Gesellschaft hatte, wie der preußische Historiker Heinrich von Treitschke meinte, eine „Vergröberung“ der Politik zur Folge. In einer Rede am 19. Juli 1895, zwei Jahre vor dem Abitur Bavinks, bei der Kriegs-Erinnerungsfeier in der Königlichen Friedrich-Wilhelms-Universität zu Berlin, beklagte von Treitschke die immer roher und gröber werdenden Parteikämpfe nach 1871. Es ging nur selten um politische Gedanken, sondern häufig um wirtschaftliche Interessen. Klassenhass und eine Bedrohung des Friedens in der Gesellschaft seien die Folge. Eine demokratisierte Gesellschaft führe zur Herrschaft des Geldes und Pöbels. Diese Feststellung wurde später zum Bestandteil der völkischen Ideologie. Treitschke meinte: „Das Alles sind ernste Zeichen der Zeit“. Diese Entwicklung sah er nicht nur in der Innenpolitik. Eine neue kriegerische Auseinandersetzung wurde von ihm an die Wand gemalt: „…das Schwert muss behaupten, was das Schwert gewann […] durch Gewalt wird Gewalt überwältigt.“25
Das politische Interesse nahm während der Schulzeit Bavinks auch in Leer zu. Bei den Reichstagswahlen 1884 betrug die Wahlbeteiligung 45 %, 1907 waren es bereits 91 %. Die liberalen Parteien gewannen bei den Wahlen von 1867–1912 die absolute Mehrheit im Wahlkreis. Bei dieser Betrachtung muss berücksichtigt werden, dass nur eine Minderheit der Einwohner teilhabeberechtigt war. Wahlberechtigt waren etwa 20 % der Bevölkerung. Für die Magistratswahl in Leer waren 1896 bei einer Gesamteinwohnerzahl von 11.470 lediglich 542 Männer wahlberechtigt; diese Zahl entsprach weniger als 5 % der Bevölkerung. Wahlberechtigt waren nur besitzende Männer.
Neben den bürgerlichen Parteien bildete sich in den neunziger Jahren der sozialdemokratische Arbeiterverein als erste moderne Mitgliederpartei. Bürgertum und Arbeiterschaft bewegten sich in eigenen gesellschaftlichen Welten. In den neunziger Jahren lebten in Leer bei einer Einwohnerzahl von etwa 12.000 ungefähr 700 bis 800 Arbeiterfamilien.26
Werner Sombart stellte die Frage, ob es in Deutschland überhaupt eine gemeinsame Kulturbasis geben könne zwischen einem ostelbischen Gutsbesitzer und einem städtischen Proletarier, zwischen einem Gutstagelöhner und dem Bankier im Berliner Tiergartenviertel.27
Die sozialen Gegensätze zeigten sich bei den Wohnverhältnissen, im Vereinswesen, im Wahlverhalten und beim Schulbesuch auch in der Stadt Leer. Arbeiterkinder bewarfen die an den Schülermützen erkennbaren Gymnasiasten aus den bürgerlichen Familien mit Steinen.28
Die Schriftstellerin Wilhelmine Siefkes schilderte ihre Erkenntnisse nach Hausbesuchen als Lehrerin in Leer:
„Da waren die vornehmen Bürgerhäuser […] die Wohnungen des Mittelstandes – Kaufleute, Beamten, der selbständigen Handwerker – einfach, aber von keiner Not zeugend. […] die Arbeiterwohnungen, meistens nicht viel mehr als eine Küche, höchstens kam noch ein schmaler Schlafraum dazu. Dort lernte ich nun die materielle Not kennen“.29
Die Verschiebung der überkommenen Sozialstrukturen, ohne dass die Führungsschicht ihre gesellschaftliche und wirtschaftliche Macht mit anderen Gruppen teilte, war nach Auffassung des Historikers Eberhard Jäckel das schwerwiegendste Problem für die innere Struktur der deutschen Gesellschaft. Auf der einen Seite standen die Gruppen oder Klassen, die ihren Rückhalt im Großgrundbesitz, in der Unternehmerschaft, im wohlhabenderen Bürgertum, in der Armee und Beamtenschaft hatten. Auf der anderen Seite standen die anwachsende Arbeiterklasse und die kleinbürgerlichen Schichten.30 Der liberale Politiker Ludwig Haas schrieb 1912:
„Man empfindet es immer mehr als unerträglich und krankhaft, daß in einem Staate wie Deutschland, dessen Macht auf der Arbeitsleistung seiner werktätigen Schichten beruht, nun gerade jene dünne Schicht des Großgrundbesitzes, die wirtschaftlich für unsere Großmachtstellung bedeutungslos ist, politisch herrschend und maßgebend sein soll.“31
Bavink war das einzige Kind eines Schokoladenfabrikanten. Der Begriff „Fabrik“ für das Unternehmen seines Vaters war nicht die Kennzeichnung eines Industriebetriebs, sondern eines Handwerksbetriebes mit wenigen Arbeitskräften.32 Der Lokalhistoriker Heiko Leerhoff spricht von Klein- oder Kleinstbetrieben in Leer, die die Bezeichnung „Fabrik“ führten.33 Nach Bavinks Lebenserinnerungen kauften alle „besseren Leute“ die Süßwaren bei Bavink.34 Es war für die damalige Zeit ungewöhnlich, dass aus der Ehe seiner Eltern keine weiteren Kinder hervorgingen. Die durchschnittliche Kinderzahl betrug in der Zeit etwa vier. Vater, Onkel und Tanten stammten aus „gebildeten Kreisen“.35
Sombart unterschied für diese Zeit nach Art ihres Wirtschaftssystems in einer groben Einteilung vier soziale Klassen: 1. die Repräsentanten der feudal-bodenständigen Gutswirtschaft, die Junker, 2. die Bourgeoisie, die die kapitalistische Verkehrswirtschaft betreiben, 3. das Kleinbürgertum als Vertreter noch handwerklicher Fertigung und 4. das Proletariat. Die Bauern bildeten nach Sombart eine Gruppe sui generis.36 Nipperdey spricht von acht Hauptklassen, wobei die gebildeten und besitzenden Bürger, zu denen Bavink gehörte, mit 1,7 Millionen gegenüber fast 20 Millionen Arbeitern und Dienstboten zahlenmäßig in der Minderheit waren.37
Aus den privaten Aufzeichnungen Bavinks38 ist nicht zu entnehmen, ob er sich aufgrund seiner Herkunft als Mitglied des Kleinbürgertums oder der Bourgeoisie einordnete. Nach dem Ersten Weltkrieg sah er in der Arbeiterschaft „zuallererst den Haß gegen den Bourgeois“. Er sprach auch von den „sogenannten Gebildeten“ und davon, dass der „Klassenkampfgeist“ von innen her überwunden werden müsse, wobei „die höhere Schicht“ vorangehen und ihren „Standesdünkel“ abstellen solle. Die Herstellung einer klassenüberwindenden „Volksgemeinschaft“ war vor 1933 ein politischer Zielbegriff in allen politischen Lagern. Eine ähnliche Wortwahl wie Bavink verwandte zum Beispiel Hitler unter der Überschrift „Die Revolution der Gesinnung“ während einer Versammlung der NSDAP am 24. September 1920. In einem amtlichen Bericht darüber wurde er wie folgt zitiert: „Der Bürger müsse von seinem Standesgefühl sehr viel nachgeben wie auch der Proletarier von seinem Klassenstolz. Es kann keine Klassen geben wie heute“.39
Bavink stellte für sich fest: „daß ich das grosse und unverdiente Glück gehabt habe, von beiden Seiten [gemeint sind die Ahnen der Eltern. Anm. d. Verf.] eine ganze Anzahl wertvoller Erbanlagen auf den Weg mitbekommen zu haben“.40 Nach seiner Klassifizierung war er ein „kulturfähiger Mensch.“41 Er sprach von den zu fördernden „Vollmenschen“ und „Familien mit guten Erbanlagen“ im Gegensatz zu den „Untermenschen“.42
Trotz seiner guten Erbanlagen war er im Kindergarten dem Spott der „frechen“ anderen Kinder ausgeliefert. Er sprach von der Angst vor einer „Blamage“. Der Kindergarten war für ihn keine schöne Erinnerung, weil er wegen seines Anzugs ausgelacht wurde. Diese Ausgrenzungserfahrung war für ihn das Allerschlimmste und er bekam dadurch Wutanfälle.43
Auch in der Schule war er ein Außenseiter, der regelmäßig Prügel einstecken musste. Noch als Erwachsener beschäftigten ihn „die Abgründe von Gemeinheit und Rohheit“, die sich in dem Verhalten seiner Mitschüler auftaten. „Die größte Ehre in Leer [in der Schule. Anm. d. Verf.] war, ein möglichst schlechter Schüler zu sein, […] je älter und stumpfsinniger jemand in seiner Klasse saß, um so höher stand er in der Achtung seiner Klassengenossen“. Bavink, der fast immer Primus war (Abitur 1897), stellte fest, dass von 25 Schülern des Gymnasiums und Realgymnasiums gerade mal 4 oder 5 „reif“ fürs Abitur gewesen seien. Dafür waren sie für andere Dinge „überreif“. Einer seiner Mitprimaner erzählte ihm, wie viele (uneheliche) Kinder er angeblich schon habe. Die Mehrzahl der Schüler war in seinen Augen schon zu Säufern geworden, bevor sie die Schule verließen. Er sprach von einem trostlosen Schulniveau, das ihn den Ekel im Hals hochtreiben ließ. „Ich habe das Abitur als den Wegfall eines ganz ungeheuerlichen Druckes, ja eines unausgesetzten Martyriums empfunden“.44 In einem offiziellen Rückblick einer örtlichen Zeitung auf hundert Jahre dieses Gymnasiums hieß es: „So hat sich die Staatliche Doppelanstalt in Leer zu einer geistigen Zentrale unserer engeren Heimat entwickelt, aus der ein nicht geringerer Teil der Jugend Ostfrieslands seine geistige Nahrung bezog.“45
In der Schulpolitik gab es ab 1880 eine intensive Diskussion über die „Schulüberbürdung“ auf den humanistischen Gymnasien, die beispielsweise 1907 in einem Zeitschriftenartikel in der Behauptung gipfelte, die Schule sei ein „Schrecksystem“, das den Grund für Lebensmüdigkeit und Krankheiten liefere. Der mitunter zeitgenössisch hervorbrechende Hass auf die Schule war so ausgeprägt, dass man staunen kann, in welchem Umfang Teile des deutschen Bildungsbürgertums an der Qualität der eigenen Statusgrundlage zweifelten, so der Bielefelder Historiker Joachim Radkau.46
Die negativen Eindrücke der Schulzeit hatten sich bei Bavink geistig so tief verankert, dass er sie fünfzig Jahre später in der Schrift „Kampf und Liebe als Weltprinzip“ verarbeitete.47 Er sprach von besonders gut beanlagten [sic!] und interessierten Jungen als unglückliche Parias, die gequält und verprügelt werden. Als Erwachsener erfuhr Bavink eine ähnliche Demütigung, die er in seinen „Erinnerungen“ im Sommer 1933 schilderte. Ihm, dem „geistigen Führer“ der Bielefelder „Nationalen Bewegung“, wie er sich selbst bezeichnete, wurde von einem „alten Parteimitglied“ seiner NSDAP-Ortsgruppe aus nichtigem Anlass der Hut vom Kopf geschlagen bzw. gerissen.48 Ein Hut war zu dieser Zeit ein Teil der identitätsstiftenden Kleidung des Bürgertums.49 Auch hier erlebte er wieder die traumatische Erfahrung des angeblichen Hasses gegen die „höheren Stände“ und eines Status als Paria. Durch diese Erfahrungen während der Schulzeit und in weiteren Lebenszeiten könnte das Narrativ der Degeneration der Menschheit durch Überhandnehmen der „Unterwertigen“ angelegt und bestätigt worden sein, das Bavink in den zwanziger Jahren zu einem Anhänger der Eugenik und „Rassenhygiene“ machte.
Eine frühe Prägung entstand mutmaßlich durch die Wahl seiner Religion. Das Einzelkind Bavink entschied sich als Fünfzehnjähriger bewusst gegen den mennonitischen Glauben des Vaters und folgte seiner streng vom lutherischen Glauben geprägten Mutter.50 Die Mennoniten waren in seiner Heimatstadt eine kleine Gemeinschaft, während die Lutheraner die dominierende Religionsgesellschaft waren.
Dr. Armin Hermann begründete 1978 diese Entscheidung frei nach Freud psychologisch als Überwindung des Vaters und mit der Liebe zur Mutter.51 Der Vater wurde als „freireligiös, politisch liberal, stark rationalistisch“ beschrieben. Die Mennoniten sahen es als religiöse Pflicht an, Staatsämter abzulehnen, hatten eine Gegnerschaft gegen jede Form des aristokratischen Lebensstils aufgrund ihrer unpolitischen oder antipolitischen Grundsätze, so der Soziologe Max Weber 1904/05.52
Für Thomas Nipperdey verweist eines der Zentralmotive des Luthertums, dessen anthropologischer Pessimismus, auf konservative Wertvorstellungen, auf das Misstrauen gegen Massen, Mehrheiten und Mitbestimmung.53 In einem Beitrag zur Analyse der rechten Medienpolitik des Münchner Verlegers Lehmann nach dem Ersten Weltkrieg, zu dem Bavink Kontakt hatte, wird als Ursache für eine rechtsextreme Gesinnung eine funktionale Umdeutung des lutherischen Protestantismus für völkische Ziele vermutet.54 Festredner Hermann stellte fest: „Die weltanschauliche Position von Bavink war seit jungen Jahren festgelegt“.55
Im Vergleich zu Bavink soll das Handeln der elf Jahre jüngeren Lehrerin Wilhelmine Siefkes (1890–1984) dargestellt werden, die in der Nachbarschaft von Bavinks Elternhaus aufwuchs. Sie erkannte den Widerstreit zwischen religiöser Orientierung und rechter Ideologie. Am 1. Mai 1933, den die Nationalsozialisten zum staatlichen Feiertag machten und für sich inszenierten, ergab sich in Leer für die 43-jährige Lehrerin folgendes Bild:
„In geschlossener Formation marschierten sie, die Angestellten von Behörden und Firmen […] die Kollegien der einzelnen Schulen, ja eine Gruppe von Primanern mit ihren Mützen – ich hörte sie schon von weitem singen: „Haut den Juden mit dem Schädel an die Wand […] Wenn das Judenblut vom Messer spritzt […] Und direkt dahinter – mir stockte der Herzschlag – da gingen unsere lutherischen Pastoren! […] daß diese vorgeblichen Hüter des Christentums […] nicht den Mut aufbrachten, wegzutreten und sich zu distanzieren, das versetzte mir einen Schlag […] Am nächsten Tag ging ich zum Amtsgericht und erklärte meinen Austritt. Etwas später bin ich dann bei den Mennoniten eingetreten.“56
Zu einer solchen Lebenslage sei ein Diktum von Karl Jaspers angeführt: „Nirgends hört die persönliche Verantwortung auf […] Sie beginnt dort, wo ich die Möglichkeit und schon beginnende Faktizität des Verbrechens sehe und doch mitmache. Wo gerufen wird: ‚Deutschland erwache‘, ‚Juda verrecke‘, ‚es werden Köpfe rollen‘. […] muß das Gewissen sprechen“.57
Siefkes wurde zu einer Gegnerin des NS-Staates und schloss sich der Sozialdemokratie an. Bavink war aktives Mitglied der „Nationalen Bewegung“ und trat 1933 der NSDAP bei.
Während der Schulzeit und des Studiums von Bavink wandelte sich das Deutsche Reich bis zum Weltkrieg von dem halbliberalen Staat des 19. Jahrhunderts zu einem Interventions- und Sozialstaat mit imperialistischen Ambitionen und einer ausgeprägten militärischen Aufrüstung. Der Anteil der Staatsausgaben am Nettosozialprodukt stieg von Bavinks Geburtsjahr bis zum Jahr 1913 um rd. 50 %. Der Wandel der Staatsaufgaben führte zu mehr Mitwirkungsmöglichkeiten des Parlaments. Die Macht des Reichstages verstärkte sich.58
Kaiser Wilhelm II., König von Preußen, erzwang 1890 den Rücktritt des Reichskanzlers Bismarck. Ab 1900 amtierte der Diplomat Bernhard von Bülow als Reichskanzler. Das Reich hatte ein „halbparlamentarisches System“, denn letztlich konnte der Monarch durchregieren. Es herrschte ein wachsender Wohlstand durch eine lange Phase der Hochkonjunktur und leicht zunehmender Verteilungsgerechtigkeit. Im Reichstag waren Sozialdemokraten, die Zentrumspartei, Konservative, Nationalliberale und Linksliberale vertreten. Antisemiten und Agrarier erhielten bei der Reichstagswahl im Jahre 1903 nur sehr wenige Mandate.
Bei näherer Betrachtung ergaben sich schwere Verwerfungen. Der 33-jährige Schriftsteller Heinrich Mann schrieb im April 1904 einem Freund:
„Es ist leider die Nation selbst, die auf eine Stufe von Materialismus gesunken ist, wo die Worte Freiheit, Gerechtigkeit nur noch leerer Schall sind. Geld verdienen, die Arbeiterbewegung durch soziale Gesetze oder aber durch Repressalien zur Ruhe bringen, damit man ungestört weiter Geld verdienen kann: sage selbst, ob das nicht das einzige ist, das die Deutschen aller Stände heute ernsthaft beschäftigt. Das einzige Ideal ist ein voller Magen […] die idealistische Kraft, die ein Volk oder doch die Besseren aufbringt gegen die dumme Brutalität der Machthaber, die fehlt in diesem Lande“.59
Ludwig Haas, Mitglied der liberalen „Fortschrittlichen Volkspartei“ und Verfechter eines Bündnisses mit den Linken, plädierte 1913 für die Ablösung der Vorherrschaft des Junkertums durch die Demokratisierung und die Liberalisierung des deutschen Staatswesens.60 Die klar gegen Arbeiterinteressen gerichtete Politik zeigte sich in einem aus heutiger Sicht absurden Beispiel. Im preußischen Abgeordnetenhaus wurde von den Konservativen die Besteuerung von Fahrrädern, aber nicht von Reitpferden beschlossen. In einer zeitgenössischen Schilderung der politischen Lage hieß es 1911: „Im Kampf für ihre Vorrechte kennen die Junker keine Scham, keine Rücksichten.“61
Max Weber, ein Freund Karl Jaspers, konstatierte 1918 für das Kaiserreich:
„Er [Bismarck. Verf.] hinterließ eine Nation ohne alle und jede politische Bildung […] und als Folge der mißbräuchlichen Benutzung des monarchischen Gefühls als Deckschild eigener Machtinteressen im politischen Parteikampf. Eine Nation, daran gewöhnt, unter der Firma der ‚monarchischen Regierung‘ fatalistisch über sich ergehen lassen, was man über sie beschloß“.62
Er sprach von den Spießbürgern, die Bismarck verklären, die aber nicht zu eigenem politischen Denken fähig sind.63 Kommende Friktionen in der politischen Landschaft und Vorprägungen politischer Weltanschauungen im bürgerlichen Lager bis in die Weimarer Zeit deuteten sich hier bereits an.
In diesem politischen Gärungsprozess trat Bavink während seines Studiums 1904 der nicht schlagenden Verbindung „Wingolf“ bei, die evangelisch-lutherisch geprägt war und in der philosophisch-theologische Debatten den Austausch dominierten. Nach einem Studium der Mathematik, Physik und Chemie entschied er sich beruflich für den Schuldienst.64 Während eines Kuraufenthaltes in Davos lernte der 22-jährige Student durch Gespräche mit anderen Kurgästen verschiedene politische Richtungen kennen. Zu der Zeit hatte er offenbar noch keine parteipolitische Präferenz entwickelt.65 Seine Vortrags- und Veröffentlichungstätigkeit vor 1914 für den Keplerbund deutet auf eine konservative Ausrichtung hin. In seinen Erinnerungen sah er den „Kepler-Bund“ als Feld für die „rein geistige Arbeit an den höheren Schichten“.66 Seine Haltung war die eines wissenden und sachlichen Mahners.
Bavink war von 1905 bis zu seiner Pensionierung im Jahr 1944 als verbeamteter Lehrer tätig, zuerst in Gütersloh und ab 1912 in Bielefeld. Am 12. März 1905 legte er das erste Mal für einen Dienstherren den Treueeid ab:
„Ich, Bernhard Bavink, schwöre zu Gott dem Allmächtigen und Allwissenden, daß seiner königlichen Majestät von Preussen, meinem Allerhöchsten Herrn, ich untertänig treu und gehorsam sein und alle mir vermögens meines Amtes obliegenden Pflichten nach besten Wissen und Gewissen genau erfüllen, auch die Verfassung gewissenhaft beobachten will, so wahr mir Gott helfe.“
Es folgten in seinem Berufsleben Treueeide für die Weimarer Republik, Nachkriegspreußen und Hitler.
1912 konnte Bavink problemlos die Schule wechseln. Er wurde Oberlehrer an einer höheren Schule für Mädchen in Bielefeld. Die Zahl der weiterführenden Schulen nahm zu, entsprechend wurden auch mehr Lehrer eingestellt. Das Sozialprestige dieses Berufsstandes war bei den herrschenden Eliten des Adels und des Militärs jedoch nicht hoch. Der Kaiser meinte mehrfach spöttisch, Kanzler Bülow wolle seine eines „Friedrichs des Großen“ würdigen Reden auf Formen und Stil eines „Oberlehrers an höheren Töchterschulen herunter redigieren“.67
Die 1. Auflage von Bavinks Hauptwerk „Ergebnisse und Probleme der Naturwissenschaften“, ein naturwissenschaftliches Lehrbuch, erschien 1914 noch vor dem Krieg. Bavink hatte 1912 das Manuskript fertiggestellt.68
Politische Äußerungen Bavinks beziehen sich in seinen Lebenserinnerungen auf die Zeit des Krieges ab 1914. Er war als 35-Jähriger aus gesundheitlichen Gründen nicht Soldat geworden, aber „während des Ersten Weltkrieges standen wir stets unbedingt auf der nationalen Seite“.69 Nach seiner Erinnerung konzentrierte sich das gesamte Interesse auf die Kriegsereignisse und die politischen Vorgänge.
„In Deutschland verstand man an unseren Feinden damals wohl gerade dies am wenigsten: daß sie sogar in Kunst und Wissenschaft ihre Feindschaft austobten. […] Für uns sachlich denkende Deutsche war das der Gipfel des Wahnsinns, niemand unter uns dachte damals entfernt daran, unsererseits mit solchen Albernheiten zu beginnen. Nur wenn die anderen so anfingen, sahen sich unsere Geistesarbeiter natürlich gezwungen, auch unsererseits mit gleicher Münze heimzuzahlen.“70
In den letzten Kriegsmonaten erlitt die Reichswehr Verluste von 760.000 Mann, davon 350.000 Gefangene und Vermisste. Die Kriegshandlungen sowohl an der Westfront als auch an der Ostfront fanden bis zum Ende Krieges zu keiner Zeit auf deutschem Staatsgebiet statt. Die Soldaten waren tödlich erschöpft, kriegsmüde und kriegsunwillig.71
In der bürgerlichen zivilen Parallelwelt des Studienrates Bavink waren im letzten Kriegsjahr Pfingstferien, Geburtstagsfeiern, die zweite Heirat am 5. Oktober 1918 (seine erste Frau starb1915) mit anschließender Hochzeitsreise ins Lipper Land bestimmend.72
18 Sombart, Werner, Die deutsche Volkswirtschaft im neunzehnten Jahrhundert, S. 81.
19 Gemeint sind der Deutsche Krieg von 1866 und der Deutsch-Französische Krieg von 1870/71.
20 Nipperdey, Thomas, Deutsche Geschichte 1866–1918, Band 1, S. 283.
21 Sombart, Werner, Die deutsche Volkswirtschaft im neunzehnten Jahrhundert, S. 394 f.
22 Nipperdey, Thomas, Deutsche Geschichte 1866–1918, Band I, S. 9 f.
23 Eimers, Enno, Kleine Geschichte der Stadt Leer, S. 72.
24 Stadt Leer (Hg.), Leer – Gestern – Heute – Morgen, S. 92.
25 Treitschke, Heinrich von, Zum Gedächtnis des großen Krieges, S. 25 f.
26 Eimers, Enno, Kleine Geschichte der Stadt Leer, S. 61 f.
27 Sombart, Werner, Die deutsche Volkswirtschaft im neunzehnten Jahrhundert, S. 420.
28 Eimers, Enno, Kleine Geschichte der Stadt Leer, S. 62.
29 Siefkes, Wilhelmine, Erinnerungen, S. 59.
30 Jäckel, Eberhard, Hitlers Weltanschauung, S. 152 f.
31 Haas, Ludwig, in: Naumann, Friedrich (Hg.) „Patria!“, 1913, S. 11.
32 Eimers, Enno, Kleine Geschichte der Stadt Leer, S. 63.
33 Stadt Leer (Hg.), Leer – Gestern – Heute – Morgen, S. 78.
34 Bavink, Erinnerungen, S. 30. Siehe auch Anmerkung Quellen.
35 Bavink, Erinnerungen, S. 23.
36 Sombart, Werner, Die deutsche Volkswirtschaft im neunzehnten Jahrhundert, S. 441.
37 Nipperdey, Thomas, Deutsche Geschichte 1866–1918, Band I, S. 425.
38 Stadtarchiv Bielefeld, NL Bavink.
39 v. Albertini, Besson, Deist, Deuerlein, Hitlers Eintritt in die Politik und die Reichswehr, in: Vierteljahreshefte für Zeitgeschichte 7. Jg. (1959), Heft 2, S. 185 ff., Dokument 27
40 Bavink, Erinnerungen, S. 23.
41 Bavink, Unsere Welt, Heft 2, Februar 1928, S. 38.
42 Stadtarchiv Bielefeld A II 17/11; Bavink, Aufsatz „Die Rasse in den Geisteswissenschaften“, Sonderabdruck aus den Neuen Jahrbüchern, Jg. 1933, S. 275.
43 Bavink, Erinnerungen, S. 42.
44 Bavink, Erinnerungen, S. 45 ff.
45 Zeitung Rheiderland, Nr. 275, 24. November, Drittes Blatt.
46 Radkau, Joachim, Das Zeitalter der Nervosität, S. 315 f.
47 Bavink, Bernhard, Kampf und Liebe als Weltprinzip, S. 77 f.
48 Bavink, Erinnerungen, S. 327.
49 Kocka, Jürgen (Hg.), Bürgertum im 19. Jahrhundert, Band 1, S. 18.
50 Gromann, Margret, Bernhard Bavink, S. 44 f.
51 Hermann, Armin, Bernhard Bavink und die Philosophie, Abdruck einer Festrede „150jähriges Bestehen der seinerzeitigen Bavink-Schule in Bielefeld“ 1978, S. 3.
52 Weber, Max, Die protestantische Ethik und der kapitalistische Geist, S. 131.
53 Nipperdey, Thomas, Deutsche Geschichte 1866–1918, Band 1, S. 494.
54 Lohff, Brigitte in: Stöckel, Sigrid (Hg.), Die „rechte Nation“ und ihr Verleger, S. 241.
55 Hermann, Armin, Bernhard Bavink und die Philosophie, Abdruck einer Festrede „150jähriges Bestehen der seinerzeitigen Bavink-Schule in Bielefeld“ 1978, S. 3.
56 Siefkes, Wilhelmine, Erinnerungen, S. 97 f.
57 Jaspers, Karl, Die Schuldfrage, S. 95 f.
58 Vgl. Nipperdey, Thomas, Deutsche Geschichte 1866–1918, Band II, S. 471 ff.
59 Zitiert in: Möller, Jürgen (Hg.), „Historische Augenblicke – Das 20. Jahrhundert in Briefen“, 1999, S. 22.
60 Haas, Ludwig in: Naumann, Friedrich (Hg.) Patria!, S. 11.
61 Frank, Ludwig, Die bürgerlichen Parteien des Deutschen Reichstages, S. 24.
62 Weber, Max, Rationalisierung…, S. 268.
63 Zitiert bei Grüttner, Michael in: Sandkühler, H. J. (Hg.), Philosophie im Nationalsozialismus, S. 32.
64 Gromann, Margret, Bernhard Bavink, S. 65 ff.
65 Gromann, Margret, Bernhard Bavink, S. 82 f.
66 Unsere Welt, Heft 11 (November 1932), S. 329 f.
67 Nipperdey, Thomas, Deutsche Geschichte 1866–1918, Band II, S. 725.
68 Gromann, Margret, Bernhard Bavink, S. 108.
69 Gromann, Margret, Bernhard Bavink, S. 122.
70 Bavink, Erinnerungen, S. 283. Der letzte Satz fehlt in der „offiziellen“ Biografie seiner Tochter Margret Gromann.
71 Nipperdey, Thomas, Deutsche Geschichte 1866–1918, Band 2, S. 866.
In der abgelehnten Weimarer Republik
Ein Waffenstillstand beendete am 11. November 1918 die Kampfhandlungen des Ersten Weltkrieges. Dieses Ereignis war ein Schock für Bavink und viele Deutsche, denn die Militärführung hatte weder Regierung und Parlament noch Öffentlichkeit über die wahre militärische Lage informiert, sodass ein „illusionärer Optimismus“ in der Bevölkerung (Nipperdey) herrschte. Die oberste Heeresleitung unter General Ludendorff schob die Verantwortung für die militärische Niederlage geschickt der Politik zu.
Der Bielefelder Politiker Carl Severing beschrieb seine Erinnerungen am Ende des Krieges:
„An die deutschen Sozialisten richtete man die Aufforderung [1918 in die Regierung einzutreten. Verf.] in einem Augenblick, in dem die Niederlage feststand und die Regierung mit ihrer Beteiligung den Frieden schließen mußte“. Bereits am 3. Oktober 1918 „hatte die Oberste Heeresleitung […] erklärt, daß es geboten sei, den Kampf abzubrechen. […] Trotzdem wurde jetzt eine laute Agitation militärischer und alldeutscher Kreise betrieben, den Krieg fortzusetzen“.
Severing bezeichnet diese Gruppe als „Hasardeure“ und „verantwortungslose Kamarilla“, die mit ihren Forderungen eine Zerstückelung Deutschlands und Tausende weiterer Tote bewirkt hätten.73
Die vom Versailler Friedensvertrag ausgelöste „Kriegsschuldfrage“ wurde zu dem Vehikel eines fanatischen Hasses gegenüber den „Linken“ und gegen die Republik instrumentalisiert. Den von den Rechten behaupteten „Dolchstoß“ hatte es nicht gegeben. Der Krieg war durch die Übermacht der Gegner an allen Fronten verloren worden. Eine Verlängerung des Krieges wäre sinnlos gewesen.74
Als in einem Aufsatz in den „Monistischen Monatsheften“ die Schuld des Kaisers und seiner Ratgeber am Krieg thematisiert wurde, behauptete Bavink 1920, dass diese Thesen „wahnsinnige Lügen“ seien.75
Der Schlosser, Gewerkschafter und Sozialdemokrat Carl Severing (1875–1952), in den dreißiger Jahren zeitweilig Innenminister in Preußen und im Reich, war bis 1919 Redakteur der sozialdemokratischen Zeitung „Volkswacht“ in Bielefeld. Er und andere arbeiteten aktiv an einer friedlichen Transformation der Zustände des Kaiserreichs in eine neue Republik. Der Revolutionstag, der 8. November, endete in Bielefeld ohne Blutvergießen. Es wurde ein Volks- und Soldatenrat gebildet. Die erste Vollversammlung des Bielefelder Volksrates am 27. Oktober 1918 war nach Severings Eindruck eine Volksgemeinschaft im besten Sinne des Wortes. Es waren alle Berufsgruppen und politischen, wirtschaftlichen und beruflichen Vereinigungen vertreten. Er erhielt von der Versammlung volle Zustimmung für die Feststellung: „Der heutige Tag führt zum ersten Mal alle Parteien und Stände freiwillig zu gemeinsamer Arbeit zusammen. So sollte es immer sein, dann ist der Wiederaufbau Deutschlands gesichert!“76
Die frühere Nachbarin Bavinks in seiner Heimatstadt Leer, die Lehrerin und Schriftstellerin Wilhelmine Siefkes, sah in dem Ende des Kaiserreichs einen Neubeginn: „Wenn ich an die Zeit nach dem Ersten Weltkrieg zurückdenke, so erscheinen mir die Zwanziger Jahre als die glücklichsten meines jungen Lebens. Mein Beruf machte mir Freude, daneben trat von allen Seiten Neues an mich heran.“77
Bavink nahm die Situation anders wahr: „Gleich in den ersten Monaten unseres neuen Ehelebens brach die Revolution aus und es kam alles das Schreckliche, was sie im Gefolge hatte: Völlige Zertrümmerung Deutschlands und das Elend der ersten Nachkriegsjahre.“78
Rechte Nationalisten wollten das Rad der Geschichte gewaltsam zurückdrehen. Das Deutsche Reich befand sich in den ersten Nachkriegsjahren in einer bürgerkriegsähnlichen Situation. Im Jahre 1919 wurden Rosa Luxemburg, Karl Liebknecht, der bayerische Ministerpräsident Kurt Eisner, 1921 der Zentrumspolitiker Matthias Erzberger und 1922 Reichsaußenminister Walter Rathenau ermordet. Einen Tag vor diesem Mord hatte der deutschnationale Reichstagsabgeordnete Karl Helfferich in einer seiner vielen Hetzreden Rathenau maßlos angegriffen.79
Am 16. Januar 1919 meldete die „Westfälische Zeitung“: „Ein Drahtbericht von heute morgen bringt die erfreuliche Kunde von der Verhaftung der beiden Führer der spartakistischen Bewegung, Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg.“ In dem Bericht hieß es weiter: „Hoffentlich trifft die Regierung für alle Zeit Vorsorge, die beiden Unruhestifter […] für allezeit unschädlich zu machen. […] Ist erst einmal ein Exempel statuiert, dann werden es die anderen Heißsporne […] wohl überlegen, ob sie weiterhin Kopf und Kragen riskieren“.80 Am Tag darauf meldete die Zeitung: „Liebknecht auf der Flucht erschossen – Rosa Luxemburg von der Menge getötet.“ Tatsächlich wurden beide von Freikorps-Soldaten der Garde-Kavallerie-Schützen-Division ermordet.
In Bielefeld wurde am 15. März 1919 dazu aufgerufen, bewaffnete Freiwilligenverbände zu bilden.81 Dies war eine Reaktion auf die zweite Phase der Revolution. In der ersten ging es um politische Demokratisierung, in der zweiten Phase wurden die Forderungen der wirtschaftlichen Rätebewegung radikaler. Die Regierung Scheidemann antwortete auf die Unruhen und wilden Streiks mit dem Einsatz von weit rechtsstehenden Verbänden der Freikorps.82
Am 14. März 1919 hatte der 39-jährige Studienrat Bavink, „wohnhaft Kastanienstr. 14“,83 von der Polizeiverwaltung Bielefeld die Erlaubnis bekommen, einen Revolver mit sich zu führen.84 Der Waffenbesitz von Zivilpersonen war durch eine Verordnung des Rates der Volksbeauftragten vom 14. Dezember 1918 und durch eine weitere Verordnung vom 13. Januar 1919 illegal geworden.85 Die genaue Bezeichnung der Handfeuerwaffe als „Revolver“ deutete auf eine tatsächlich bei Bavink vorhandene Waffe hin. Welchem Zweck sollte sie dienen? Wollte der militärisch Ungeübte sich einem Freikorps anschließen oder sollte sie der Selbstverteidigung dienen? Der Münstersche „Wingolf“, Bavinks Studentenverbindung, gehörte 1919/20 der „Akademischen Wehr Münster“ unter Martin Niemöller an. Sie war von dem späteren Rektor der Universität Münster Hubert Naendrup gegründet worden. Zu dieser Zeit war er wie Niemöller Mitglied der DNVP und Unterstützer des Kapp-Putsches.86
Carl Severing schilderte die Verhältnisse in der Zeit nach der „November-Revolution“: „Gewehre und Karabiner mit Munition, Revolver und Maschinengewehre mit Munition und andere Waffen waren in ungeheuren Mengen in den Besitz der Zivilbevölkerung geraten. So waren alle Voraussetzungen für die blutigsten Auseinandersetzungen gegeben, wenn es nicht gelang, das Feld für Ordnung und Recht zu behaupten.“87 Über eine Unterredung als Reichs- und Staatskommissar im Ruhrrevier im Frühjahr 1919 schrieb er: „Einige Mitglieder dieser Abordnung beschäftigten sich während der Unterhaltung mit ihren schweren Pistolen so ungeniert, als wären diese Dinge ein Bestandteil ihrer Schreibutensilien gewesen“.88
Nach Bavinks Schilderungen erlebte seine Familie 1919 die zweite Phase der Revolution in Bielefeld, als nach dem verunglückten „Kapp-Putsch“ die Spartakisten einen Aufstand gegen die damalige sozialdemokratische Regierung Severing angestiftet hatten.
Bavink irrte in seinen Erinnerungen: Der „Kapp-Lüttwitz-Putsch“ fand im März des Jahres 1920 statt und brach bereits am 18. März zusammen. Severing wurde nach Niederschlagung des Putsches am 29. März 1920 zum preußischen Innenminister ernannt.89In dem von Bavink genannten Jahr 1919 war er Reichskommissar für das Ruhrgebiet. Bavink erinnerte sich:
„An meinem Geburtstag [30. Juni 1919. Verf.] saßen wir abends in unserer Essstube in der Kastanienstraße zusammen, als plötzlich in den Gärten der Nachbarschaft Handgranaten detonierten und scharfe Schüsse über uns hinweg von der Promenade in die Stadt hineinpfiffen […] Es war freilich mehr ein Unfug dummer Jungens aus den Reihen des Kommunismus gewesen […] Zwei Tage später wurde Bielefeld von regulärem Militär besetzt und die Spartakistenbanden zerschlagen“.90
Am 28. Juni 1919 waren, mutmaßlich auch durch angereiste Matrosen aus Hamburg, Unruhen wegen der unzureichenden Lebensmittelversorgung und der angeblichen Wucherpreise – eine Kriegsfolge – ausgebrochen. Auf dem Bielefelder Wochenmarkt wurden die Bauern und Händler bedrängt. Die Waren wurden durch die Aufrührer zu herabgesetzten Preisen verkauft oder beschädigt und beseitigt.91 Am Montag, dem 30. Juni 1919, wurde in Bielefeld an der Ecke Turnerstraße eine Handgranate geworfen, die einen Mann tötete und mehrere Menschen verletzte. Außerdem wurden Salven in die Luft geschossen. Am 1. Juli 1919 rückten Soldaten des Freikorps Gabke aus Sennelager in die Stadt ein. Durch Schüsse aus dem Rathaus und von einem Angehörigen des Freikorps gab es einen weiteren Toten und Verletzte. Anschließend beruhigte sich die Lage wieder.92
Am 1. Juli 1919 berichtete die in Bielefeld erscheinende sozialdemokratische „Volkswacht“ in einem kurzem Artikel über die Ausschreitungen am vorhergehenden Sonnabend und zitierte einen Heringsverkäufer mit den Worten, er habe Heringe für 90 Pfennige eingekauft und für 95 Pfennige wiederverkauft. In fast gleicher Länge wurde über den Spielplan des Zirkus Althoff berichtet und der Besuch empfohlen.
Bavinks vor dem Krieg noch diffuse konservative Weltanschauung entwickelte sich ab 1918 zu einer radikal rechten Gesinnung: „…nun lag die nächste Zukunft schwarz für Deutschland da. Gut, dass wir nicht ahnten, wie schwarz sie sein sollte“, so Bavink in seinen Erinnerungen. Und weiter heißt es: „dass die von den Linken eingeschlagene Politik sowohl innen- wie aussenpolitisch zu nichts als Demütigungen und zuletzt zum völligen Niederbruch führen musste. Und das Unglaubliche war, dass die zunächst in Deutschland herrschende Mehrheit das überhaupt nicht sehen wollte […] Es war also klar, dass ich mich von vornherein auf die Seite der nationalen Opposition stellte, denn man konnte damals […] nicht rechts genug sein.“ (Hervorh. Verf.) Bavink bekannte in seinen Lebenserinnerungen: „Wir alle im Keplerbund waren stramm national gesinnte Männer.“93 Teile der Familie seiner Frau tendierten hingegen zur politisch liberalen Richtung, zur „Deutschen Volkspartei“ und zur „Deutschen Demokratischen Partei“.94
Die Gegner der Republik äußerten sich wie Hitler 1925 in „Mein Kampf“: „Was wir heute um uns und in uns erleben müssen, ist nur der grauenvolle, sinn- und vernunftzerstörende Einfluß des Meineidsstaats des 9. November 1918. Mehr als je gilt hier das Dichterwort vom Bösen, das fortzeugend Böses muß gebären […] tragen die Schuld daran diejenigen, die […] seit 1918 unser Volk zu Tode regieren“.95
Der Bielefelder Historiker Reinhard Vogelsang stellte fest: „Das Bielefelder Klima wurde in diesen Tagen von zwei Tendenzen bestimmt. Erstens war die Position der SPD so fest in der Arbeiterschaft verankert, dass eine konkurrierende Partei wie die USPD kaum und die Spartakusgruppe gar nicht Fuß fassen konnte, und zweitens hatte sich das Bürgertum so weit mit den neuen Verhältnissen abgefunden, dass es in die Zukunft blickte“.
Die von Bavink erwartete schwarze Zukunft und der völlige Niedergang bildeten einen Kontrast wie schon im Krieg zu seiner privaten bürgerlichen Welt: Dazu gehörte die Übernahme der Leitung des Keplerbundes 1920 und die Fertigstellung der zweiten Auflage seines Hauptwerks. Beide Tätigkeiten wurden großzügig von der Schulbehörde durch eine Beurlaubung vom Schuldienst unterstützt. Hinzu kamen die Beförderung zum Oberstudienrat, private Reisen und im Jahr 1927 der Bau eines repräsentativen Hauses. Ein weiteres Statussymbol des Bürgertums, die Beschäftigung eines „Dienstmädchens“, wurde für die Familie Bavink möglich. Der Jahresverdienst eines Gymnasiallehrers betrug um die Jahrhundertwende das Dreißigfache eines Dienstmädchens.96 Der berufliche Status ermöglichte eine Abgrenzung nach unten, zu den „Untermenschen“, wie Bavink 1931 die Schicht bezeichnete, die von der SPD vertreten wurde.97 Die „Dienstbotenfrage“ war im Bürgertum Prestigeangelegenheit.98So erörterte Bavink in seinen Lebenserinnerungen mehrfach die Schwierigkeit, geeignete Frauen zu finden. Bei den „Landmädchen“ wurde der „Dienst“ zunehmend unbeliebter. Ein Experte stellte bereits 1911 fest, dass viele Frauen die Fabrik dem „Dienstmädchendasein“ vorzogen, weil die Werkmeister nicht so grob waren wie die „gnädigen Frauen“.99
Bavink stand mit seiner Kritik an der neuen politischen Ordnung in der Phalanx vieler Intellektueller. Die meisten Hochschullehrer trauerten dem untergegangenen Bismarck-Reich nach und erblickten in der Weimarer Republik hauptsächlich das „beschämende Ergebnis eines verlorenen Krieges“.100 Zwischen bürgerlichen „Vernunftrepublikanern“ und der extremen bürgerlichen Rechten klaffte ein Abgrund.101
Die größte Volksschullehrerorganisation, der deutsche Lehrerverein, tendierte in den 1920er Jahren politisch zur linksliberalen DDP oder zur SPD, während Lehrer an höheren Schulen überwiegend nationalkonservative oder nationalliberale Positionen vertraten. Etwa 20–30 % der Hochschullehrer waren Mitglieder einer politischen Partei, überwiegend der konservativen Deutschnationalen Volkspartei (DNVP).102
Nach dem Ende des Kaiserreichs mussten die Beamten den neuen Staat als Dienstherrn akzeptieren. Bavink leistete statt des vormaligen Eides auf den preußischen König jetzt zwei Treueide auf die Staatsform, die er ablehnte: jeweils in Bielefeld am 17. Februar 1920 auf die Weimarer Reichsverfassung und am 13. Juni 1921 auf die Preußische Verfassung.103 Auch die Verfassung des Freistaates Preußen vom 30. November 1920 (Preußische Gesetzessammlung 1920, Nr. 54, S. 543) erklärte das Land in Artikel 1 zur Republik.





























