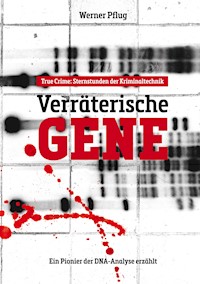
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Die DNA-Revolution im Kontext echter Fälle Als Werner Pflug in seiner Tätigkeit beim Landeskriminalamt in Stuttgart 1989 erstmals den "genenetischen Fingerabdruck" und kurz darauf die hochsensitive DNA-Analyse nach dem PCR-Verfahren anwendet, befindet er sich in einer absoluten Ausnahmesituation: In seinen Gutachten soll er als Erster in Deutschland die neue DNA-Welt und damit Neuland im Bereich der Kriminaltechnischen Institute betreten. Mit der DNA-Analyse verfügte die Polizei Ende der achtziger Jahre über eine völlig neue Methode mit einer großen Aussagekraft und einem hohen Beweiswert. Dies nun in ein Gutachten einführen zu können, das damit so gut wie keinen Interpretationsspielraum mehr offenließ, war geradezu revolutionär. Im Laufe der Jahre gelangen, zusammen mit seinem engagierten Team, viele weitere Meilensteine, an deren Entwicklung Werner Pflug entscheidend mitgewirkt hat. Der Blick hinter die Kulissen der Polizeiarbeit und ins Labor erweist sich dabei als ebenso spannend wie die Aufklärungsarbeit der Fahnder selbst. Geschildert werden Fälle in ihrer gesamten Breite - vom Tathergang bis zur Gerichtsverhandlung. Dadurch ist das Buch für den historisch geneigten Leser ebenso interessant wie für den Krimifan.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 325
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Begleitwort
Begleitwort
Dank
Vorwort
Erster Fall: 1989 – Der Wahrheit auf der Spur
Zweiter Fall: Polymerase-Kettenreaktion (PCR)
Dritter Fall: Torso
Vierter Fall: Klebeband
Fünfter Fall: Beretta
Sechster Fall: Reiterhof
Anhang
Glossar
Begleitwort
Erst kürzlich ist ein 71-Jähriger wegen Mordes zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt worden – für einen Frauenmord, der 25 Jahre ungeklärt geblieben war. Und der es wohl auch geblieben wäre, wenn nicht winzigste Spuren an den Fingernägeln des Opfers doch noch zu einem Mann geführt hätten, den die Polizei bei ihren Ermittlungen glatt übersehen hatte. Ich habe das mehrmonatige Gerichtsverfahren im Gerichtssaal verfolgt – und die DNA-Trefferquote von eins zu 24 Billionen erstaunt zur Kenntnis genommen.
Vom genetischen Fingerabdruck überführt – heute eine Selbstverständlichkeit in der Kriminalistik. Vor über 30 Jahren war das freilich noch eine exotische Wissenschaft, über die ich als junger Stuttgarter Polizeireporter erstmals berichten durfte. »Verräterische Gene im Blutfleck«, lautete der Bericht über die DNA-Analyse 1988 in den »Stuttgarter Nachrichten«. Es war die erste Begegnung mit dem Mikrobiologen Dr. Werner Pflug, der kurz davor war, die revolutionäre Methode beim baden-württembergischen Landeskriminalamt in Gang zu setzen. Auch ich war fasziniert von den Morsezeichen aus dem Innersten eines Menschen, damals noch als Strichcodes auf Folien sichtbar gemacht.
Der Bericht fand große Beachtung – auch weil das Thema juristisch und politisch höchst umstritten war. Würde hier etwa in das Erbgut eines Menschen eingegriffen? Kann ein Richter solche Untersuchungen überhaupt als Beweismittel gelten lassen? Die Debatte in unserer Redaktion drehte sich damals aber auch um die Frage, ob wir das Ganze nicht besser DNS-Verfahren taufen müssten. Es heiße schließlich Desoxyribonuklein-Säure, argumentierten die sprachbewussten Redaktionskollegen, und eben nicht Acid. Immer diese Anglizismen! Also bitte DNS statt DNA schreiben! Bekanntlich kam es anders.
Werner Pflug hat seither die Sensorik der Methoden immer feiner herausgearbeitet, und wir haben die Entwicklungen unseren Lesern über die Jahre stets verständlich übersetzen können. Heute kann man sagen: Die DNA-Analyse des Mikrobiologen hat nicht nur den kriminalistischen Ermittlungen zu einem entscheidenden Durchbruch verholfen – sondern auch der Reputation eines jungen Polizeireporters bei seinen Vorgesetzten. Er verfolgt nun gespannt, was Werner Pflug selbst über diese Zeit zu erzählen hat.
Wolf-Dieter Obst
Stuttgarter Polizeireporter seit 1988
Begleitwort
Am Anfang jeder Erfolgsgeschichte steht in der Regel eine Innovation. Der Siegeszug der forensischen DNA-Analyse beginnt im Jahr 1984. Alec Jeffreys findet heraus, dass Variationen des genetischen Codes der DNA geeignet sind, Personen zu unterscheiden und diesen die von ihnen verursachten biologischen Spuren zuzuordnen. Anders gesagt: Der genetische Fingerabdruck ist geboren. Doch diese Erkenntnis allein bringt noch keinen Täter vor Gericht, der Transfer in die forensische Praxis ist die Herausforderung. Innovation allein reicht nicht. Es braucht jetzt einen Menschen, der die ausgetretenen Wege verlässt, die Ergebnisse aus der Forschung adaptiert und für die Praxis nutzbar macht. Kurzum: Einen echten Pionier. Wir schreiben das Jahr 1987. Dr. Werner Pflug vom Kriminaltechnischen Institut des Landeskriminalamtes Baden-Württemberg beginnt zusammen mit einer Kollegin des Landeskriminalamtes Berlin und einem Kollegen des Bundeskriminalamtes die neue Methode des RFLP (Restriktionsfragmentlängenpolymorphismus) für die forensische Arbeit aufzuarbeiten. Die drei Wissenschaftler bauen auf den Erkenntnissen von Jeffreys auf und schreiben Kriminalgeschichte. Bereits im Jahre 1989 kommt die Methode in einem Mordfall erfolgreich zum Einsatz. Das Gericht akzeptiert die Spur als Sachbeweis. Es ist ein Quantensprung für den objektiven Tatbefund. Dieser Paradigmenwechsel ist die Geburtsstunde der DNA-Analytik in Deutschland. Gleichzeitig ist dies für Dr. Werner Pflug der Beginn seiner Passion. Er lässt nicht locker und arbeitet sich immer tiefer in die Materie ein. Der amerikanische Biochemiker Kary Mullis entwickelt zu dieser Zeit die Polymerase-Kettenreaktion – kurz PCR für Polymerase Chain-Reaction – und erhält im Jahre 1993 hierfür den Nobelpreis für Chemie. Die PCR-Technik beflügelt die Arbeit von Dr. Werner Pflug.
Während für die RFLP- Methodik größere Spurenmengen erforderlich sind, genügen dank der PCR-Methode auch kleinste Spurenmengen. Dr. Werner Pflug und sein Team nutzen die PCR-Technik für die praktische Fallarbeit am Landeskriminalamt Baden-Württemberg und etablieren sie erfolgreich in der forensischen Praxis.
Die Geschichte der forensischen DNA-Analyse ist seither untrennbar mit dem Namen Dr. Werner Pflug verbunden. Er hat mit der von ihm aufgebauten Organisationseinheit seine DNA in der Kriminaltechnik hinterlassen. Auch dank seiner wissenschaftlichen Weitsicht und seines unermüdlichen Engagements ist das LKA Baden-Württemberg bundesweit führend in der DNA-Analytik. So haben wir beispielsweise mit der Einführung der Geräte für das Next Generation Sequencing im Mai 2019 die Möglichkeit, Augen-, Haar- und Hautfarbe festzustellen. Im Jahr 2020 nehmen wir als erstes LKA in Deutschland ein mobiles DNA-Analysegerät in den Betrieb und orientieren uns am Pioniergeist von Dr. Werner Pflug. Wir bleiben am Puls der Zeit, um mit modernster Analysetechnik die Kriminalitätsbekämpfung weiterhin umfassend zu unterstützen.
Andreas Stenger
Präsident des Landeskriminalamts Baden-Württemberg
Stuttgart im September 2021
Dank
Besonderen Dank an Ingeborg Merz für die Durchsicht und Korrektur des Rohkonzepts und an Wolfram Freitag, Grafiker, für die Gestaltung des Umschlagdesigns.
Dank auch an Andreas Stenger, Präsident des Landeskriminalamts Baden-Württemberg sowie an Wolf-Dieter Obst, Stuttgarter Polizeireporter für deren Begleitworte zu meinem Buch.
Herzlichen Dank an meine Familie für die guten Wünsche zum Gelingen und Erfolg des Buches und besonders auch für die Unterstützung beim Eintippen und den vielen fruchtbaren Diskussionen mit meiner Frau Elisabeth.
Vorwort
Wenn ich heute auf meinen Lebensweg zurückblicke, bin ich verblüfft, wie viel Leben da hineinpasst. Und dass ich heil angekommen bin an diesem Aussichtspunkt, von dem aus ich gerade zurückblicke. Es kommt mir fast wie eine Ewigkeit vor und ich habe immer noch nicht genug davon. Bin das wirklich ich, der so viel erlebt hat? Damals am 2. Juni 1949 war der Start auf einem Bauernhof eher ein gefährliches Umfeld, wenn man halbjährig aus fast zwei Meter Höhe auf einen Steinboden fällt und einjährig an Keuchhusten erkrankt. Gott sei Dank habe ich beides gut überstanden. Natürlich gab es auf dem Hof auch immer viel zu tun, wobei ich und meine zwei Brüder so gut wie wir konnten mithalfen.
Barry Long hat einmal gesagt: »Das Geheimnis liegt im Tun, nicht im Reden oder Nachdenken darüber.« Nach diesem Prinzip wurde auch das Miteinander gestaltet.
*
Den Kindergarten fand ich langweilig, die Schule schon viel besser, aber meine Wissbegier und Begeisterung wurde erst richtig mit dem Studium der Biologie an der Uni Stuttgart-Hohenheim befriedigt. Ich konnte in den Praktika selbstständig meine Arbeit einteilen, es war wie eine Befreiung nach dem doch sehr engen Schulrahmen! Nach der Diplomvorprüfung heuerte ich im Institut für Mikrobiologie und Molekularbiologie von Professor Dr. Franz Lingens an. Dort lernte ich auch das Handwerkzeug, um selbstständig Grundlagenforschung betreiben zu können. Der Institutsleiter bot mir dann eine Stelle zur Aufklärung der Vitamin-B6-Biosynthese in einer Diplom- und anschließenden Doktorarbeit an, die ich gerne annahm. Im achten Semester hatte ich 1974 meine Urkunde als Diplom-Biologe (mit Auszeichnung) in der Hand. Nach weiteren drei Jahren erhielt ich meine Promotionsurkunde (summa cum laude). Meine Ergebnisse, in einem Biosynthese-Schema zusammengefasst, wurden von mir und meinem Doktorvater in einer Fachzeitschrift gemeinsam publiziert.
Während des letzten Drittels meiner Doktorarbeit hatte ich mich – nach Absprache mit meinem Doktorvater – noch parallel für das Medizinstudium eingeschrieben. Im Frühjahr 1979 lag dann das Physikum, die wissenschaftliche Medizinerprüfung, hinter mir und die klinischen Semester begannen. Als ich kurz danach bei meinem Doktorvater vorbeischaute, sah ich zufällig am schwarzen Brett eine Stellenausschreibung vom Landeskriminalamt (LKA) im Bereich Medizin/Biologie. Ich war neugierig und schickte meine Bewerbung an die angegebene Adresse. Zwei Tage später hatte ich eine Einladung zu einem Vorstellungsgespräch. Bei meiner Vorstellung war ich überrascht von dem guten, entspannten Arbeitsklima und der Aussicht, das Methodenspektrum für die Fallaufklärung weiterzuentwickeln. Offensichtlich war der positive Eindruck nicht nur auf meiner Seite, da der dortige Abteilungsleiter am nächsten Tag anrief und mir die Stelle anbot, die ich freudig annahm. Jetzt wurde es richtig spannend. Ich musste meine bisherigen Verpflichtungen bei der Medizinerausbildung abmelden und meinen Studienkollegen/-innen Adieu sagen. Da war schon auch viel Wehmut dabei.
*
Mitte Mai 1979 trat ich meine Stelle beim Kriminaltechnischen Institut (KTI) des LKA in Stuttgart an. Neben der Einarbeitung in das vorhandene Methodenprogramm begann ich parallel neue Merkmalsysteme (Enzym- und andere Proteinsysteme) in das bestehende Methodenspektrum zu integrieren. Damit verbesserte ich den Beweiswert unserer Befunde in vielen Fällen um den Faktor 50 bis 100.
Schon bald wurden Anfragen für Ausbildungsbesuche von anderen LKÄ/BKA sowie Rechtsmedizinischen Instituten aus dem gesamten deutschsprachigen Raum an mich herangetragen. Auch das FBI lud mich 1984 für einen Vortrag nach Washington ein.
*
Ende 1985 publizierte der englische Genetiker Alec Jeffreys erstmals ein komplexes DNA-Strichcode-Muster, das als »genetischer Fingerabdruck« Geschichte schreiben sollte. Daraufhin wurde von den bundesdeutschen KTI-Leitern 1987 beschlossen, die DNA-Analyse für den Routineeinsatz in der Fallaufklärung aufzubauen. Das Stuttgarter LKA, das Berliner LKA sowie das BKA sollten dies in die Hand nehmen. Für die Sichtbarmachung des Strichmusters mit einer radioaktiven DNA-Sonde hatte das Berliner Robert-Koch-Institut im Herbst 1987 sein Isotopenlabor zur Verfügung gestellt. Auf unseren Stuttgarter Röntgenfilmen sahen die schwarzen Strichmuster wie aus dem Bilderbuch aus (s. a. Titelseite). In der zweiten Jahreshälfte 1989 waren wir in Stuttgart die Ersten, die bei einem schweren Sexualdelikt und versuchten Mord mittels DNA-Analyse den Fall aufklären konnten. Dies war der Auftakt zu einer beispiellosen Erfolgsgeschichte, welche die Aufklärung von Straftaten aller Art bis zum Mehrfachmord revolutionierte.
Wenn ich heute vor der Wahl stünde, an einer der Wegkreuzungen einen anderen Weg einzuschlagen, würde ich alles wieder genauso machen. Ich war zur rechten Zeit am rechten Ort und bin sehr dankbar dafür.
Erster Fall: 1989 – Der Wahrheit auf der Spur
Im Sommer 1989 waren wir in unserer Dreierarbeitsgruppe vom LKA Baden-Württemberg, dem LKA Berlin und dem BKA bereits mehr als zwei Jahre mit dem Aufbau und der Weiterentwicklung der DNA-Analyse beschäftigt und inzwischen längst in der Lage, die Methode im Routinebetrieb einzusetzen. Mitte Juli hatten wir dies einem übergeordneten Gremium, den Leitern der Kriminaltechnischen Institute in Deutschland, in unserem Abschlussbericht entsprechend dargelegt. Der Bericht wurde von ihnen einstimmig gebilligt und in eine wissenschaftliche Publikation eingebunden. Dies sollte zu einem späteren Zeitpunkt dann noch einmal eine Rolle spielen. Und jetzt würden wir in Stuttgart also die Ersten der Kriminaltechnischen Institute sein, die in Deutschland die DNA-Analyse in einem Kriminalfall zur Anwendung brächten. Beim BKA und den anderen bundesdeutschen Landeskriminalämtern hatten sie noch nicht angefangen, die DNA-Analyse bei echten Fallgeschehen anzuwenden.
Bei unserem ersten DNA-Kriminalfall handelte es sich um eine schwere Vergewaltigung, bei dem das Opfer beinahe zu Tode gekommen wäre.
*
Es war wieder ein warmer Sommertag im Juli gewesen. In einem kleinen Waldgebiet außerhalb der Stadt fühlte er sich vertraut und sicher. Der Mann war schon öfter hier gewesen. Er hatte sich an einer aussichtsreichen Stelle versteckt und den mit Moos bewachsenen Waldweg beobachtet. Einmal war er von einem Hund einer Joggerin überrascht und angebellt worden. Sie war aber schnell und ohne Anhalten weitergelaufen und hatte mit einem scharfen Pfiff ihren Hund zu sich gerufen. Auf Olaf S. hatte diese Begegnung nach dem ersten Schrecken wie eine kalte Dusche gewirkt. Die Erregung war wie weggeblasen und ein Gefühl der Ernüchterung hatte sich breitgemacht. Diesmal sollte ihm das nicht passieren.
Auf dem Weg zu seinem Versteck stellte er sein Auto auf einen Wanderparkplatz, nicht weit von der Endstation der Buslinie 8, ab und ging zu Fuß weiter. Es war kurz nach 18.00 Uhr und die Temperatur war unter den Bäumen immer noch sehr angenehm warm. Da kein Regen zu erwarten war, hatte er nur sein verwaschenes und bereits schon wieder verschwitztes T-Shirt, seine teils zerrissenen Jeans und die ausgetretenen Leinenschuhe an. Zum Schutz gegen die tiefer stehende Sonne hatte er seine Nickelbrille mit den dunklen Sonnenschutzgläsern aufgesetzt. Als er seinen Platz erreicht hatte, war alle Restunsicherheit wie weggeblasen. Sein Kopf und sein Körper hatten in einen anderen Modus geschaltet. Er war jetzt bereit. Er hatte den Entschluss gefasst, seine Kleidung bis auf die Schuhe auszuziehen. Von seinem Platz aus konnte er in beide Richtungen auf eine Entfernung von schätzungsweise siebzig bis hundert Meter den Waldweg einsehen.
Er hatte den Platz gut ausgewählt. Die Zeit schien stehen zu bleiben. Kein Luftzug war spürbar. Ab und zu ein kurzes Zwitschern eines Vogels, das Gurren einer Taube. Einmal ein Knacken hinter ihm im Wald. Sein ganzer Körper fühlte sich an wie ein aufgezogenes Uhrwerk – bis zum Anschlag angespannt und bereit, beim Drücken des Startknopfes sein Programm abzuspulen. Als er endlich ganz hinten auf dem Weg eine Gestalt mit mäßigem Tempo näherkommen sah, ging alles ganz schnell und wie von selbst.
Als die Joggerin kurz vor seinem Versteck war, trat er hervor, musste sich kurz räuspern und sagte zu der jungen Frau in scharfem Ton: »Wenn du mitmachst, passiert dir nichts Schlimmes.« Die Frau blieb wie angewurzelt stehen. Er sah die Angst, das Entsetzen in ihren Augen. Er packte sie am Arm, zog sie in das Gebüsch und weiter in den Wald hinein. Die Frau wehrte sich, bettelte und schrie um Hilfe. Nun gab es kein Zurück mehr. Die Frau sollte endlich ruhig sein! Er schlug sie. Und als sie immer noch schrie, drückte er ihr den Hals zu, bis sie endlich kollabierte und aus ihrem Mund kein Ton mehr kam. Dann streifte er ihr die Jogginghose und den Slip ab, sodass ihr Geschlecht frei zugänglich war. Er drang in sie ein und erleichterte sich in ihr. Alles ging viel zu schnell, wie ein mechanisches Abreagieren. Danach zog er sich rasch wieder an und verließ den Ort, ohne sich noch einmal nach der leblosen Frau umzuschauen. Erst kurze Zeit danach, als er schon auf dem Weg zu seinem Auto war, wurde ihm bewusst, dass er der Frau etwas Schlimmes angetan hatte.
Er erreichte sein Auto und fuhr weg. Er wollte weit weg von diesem Waldstück und dem zurückliegenden Geschehen. Er wollte Abstand, so als würde er sich mit jedem Meter, jedem Kilometer weiter von der Tat entfernen, bis letztlich nichts mehr übrig blieb, was ihn berühren oder in Bedrängnis bringen könnte.
*
Als die Frau wieder zu Bewusstsein kam, hatte sie Schmerzen am ganzen Körper, am stärksten aber war der Halsbereich betroffen. Sie konnte kaum ihren Kopf bewegen und wusste gar nicht, was überhaupt geschehen war. Ihr Unterkörper war entblößt und nur langsam schoben sich Erinnerungsfetzen in ihr Bewusstsein von einem nackten Mann, der ihr plötzlich auf dem Waldweg bedrohlich gegenüberstand. Sie rappelte sich so gut es ging auf, zog ihren verschmutzten Slip und ihre kurze Jogginghose wieder an. Dann lief sie mit verstörtem Ausdruck, als müsste sie die schon früher oftmals zurückgelegte Wegstrecke zu Ende bringen, auf dem Waldweg weiter, bis sie einer Frau begegnete. Die fremde Frau nahm sich ihrer an und begleitete sie in ihrem Auto nach Hause. Sie blieb bei ihr, bis zwei Polizeibeamte eintrafen und alle notwendigen Maßnahmen in die Wege leiteten. Kurz vor Mitternacht gab der Arzt ihr eine Beruhigungsspritze, um ihr ein paar Stunden erlösenden Schlaf zu ermöglichen. Eine gute Freundin war gekommen und hatte sich darauf eingerichtet, bei ihr über Nacht zu bleiben und ihr beizustehen.
Noch in derselben Nacht liefen die polizeilichen Ermittlungen an. Wie immer bei derartigen Fällen der Schwerstkriminalität – die Staatsanwaltschaft sprach von Vergewaltigung und versuchtem Mord – wurde eine Ermittlungsgruppe gebildet. Diese sollte aus den zahlreichen eingegangenen Hinweisen aus der Bevölkerung sowie den Aussagen der Geschädigten den richtigen Aufklärungsweg herausfiltern.
Auf die Spur eines Tatverdächtigen, Olaf S., kam man durch die Zeugenaussage eines Busfahrers, der einen beigegoldfarbenen Pkw in Tatortnähe gesehen hatte. Nachdem mehrere hundert Fahrzeughalter überprüft worden waren, fand man im Fahrzeug des Olaf S. auch eine Nickelsonnenbrille, so wie sie das Opfer der Vergewaltigung beschrieben hatte. Außerdem war Olaf S. bereits früher einmal wegen sexueller Nötigung verurteilt worden. Die Polizei legte dann der jungen Frau mehrere Bilder von verschiedenen Männern zur Identifizierung des möglichen Täters vor. Bilder von Olaf S. waren ebenfalls dabei. Bei einem Bild von ihm meinte sie: »Der könnte es gewesen sein. Von der Statur und Kopfform her entspricht der am ehesten dem Täter.« Sie wurde aber unsicher, als sie die Tätowierungen auf der Brust und den Unterarmen sah, die sie bei dem nackten Mann, der ihr auf dem Waldweg gegenübergetreten war, nicht bemerkt hatte. Diese waren aber so auffällig, dass sie eigentlich kaum zu übersehen waren. Somit war die Frage nach der Identität des Täters doch wieder mit einem großen Fragezeichen versehen.
*
Jetzt kamen wir vom Kriminaltechnischen Institut des LKA Stuttgart ins Spiel. Die kriminaltechnisch geschulten Sicherungsbeamten hatten gleich nach der Tat verschiedene Beweismittel (in der Fachsprache »Asservate« genannt) erhoben, dokumentiert, fotografiert, in Papiertüten verpackt und beschriftet. Bei Sexualdelikten waren es damals vor allem mögliche Faserspuren, Haarspuren und sogenannte Sekretspuren. Letztere in der Regel Mischspuren aus Sperma und Vaginalsekret, an Bekleidungsstücken angetragen oder nach der Tat bei der Geschädigten auf sterilen Mulltupfern als Vaginalabstrichpräparate gesichert. In meinen Zuständigkeitsbereich fielen die Sekretspuren. Seltener spielten auch reine Speichelspuren oder Mischspuren aus Speichel und Sperma eine Rolle.
Die für den Fall zuständige Polizeidirektion im Südwesten von Baden-Württemberg hatte in ihrem Untersuchungsantrag durch den Leiter der Ermittlungsgruppe erstmals eine DNA-Analyse beantragt. Er hatte mich telefonisch umfassend über das Geschehen informiert und den Stand der laufenden Ermittlungen mitgeteilt, um uns eine gezielte Auswertung des Spurenmaterials zu ermöglichen. Ein Kurier überbrachte die Asservate. Als aussichtsreiche Beweismittel konnten wir die Bekleidungsstücke (Slip, Jogginghose und T-Shirt), welche die Geschädigte zur Tatzeit getragen hatte, sowie ärztlich gesicherte Vaginalabstrichpräparate heranziehen. Außerdem erhielten wir zu Vergleichszwecken Blutproben von tatverdächtigen Personen und von der Geschädigten.
Birthe, eine unserer kriminaltechnischen Assistentinnen, die zusammen mit mir maßgeblich am Aufbau der DNA-Analyse beteiligt war, machte sich gleich an die Präparation der Sperma/Vaginalsekret-Mischspuren.
Natürlich waren wir bei der Aufbereitung des Spurenmaterials für unsere erste fallbezogene DNA-Analyse übervorsichtig. Jeder Schritt wurde mehrfach von verschiedenen Personen im Labor überprüft. Doch als Erstes mussten wir nachweisen, ob Spermasekret vorhanden war, und wenn ja, in welcher Menge. Also fertigte Birthe von allen sekretverdächtigen Antragungen mikroskopische Präparate an und färbte diese mit einer roten Fuchsin-Zellfärbelösung. Unter dem Mikroskop waren dann alle rot eingefärbten Spermatozoen an ihrer charakteristischen ovalen Form und der am hinteren Ende sitzenden Geißel erkennbar. Wenn die Spermatozoen bei der mikroskopischen Anfärbung noch eine intakte Geißel besitzen, spricht dies für frisches, qualitativ hochwertiges Spurenmaterial. Damit steigt die Wahrscheinlichkeit für gute DNA-Ergebnisse. Glücklicherweise fanden wir an den Vaginalabstrichpräparaten und auch im Zwickelbereich des Slips tatsächlich genug qualitativ brauchbares Spermasekret. Das sah schon einmal gut aus. Wir konnten also zweigleisig vorgehen: Einerseits wollte ich die üblichen serologisch und biochemisch nachweisbaren Merkmale bestimmen (z. B. Blutgruppen und Eiweißstoffe), und nun, als Novum, erstmals eine Art »molekularen Steckbrief« per DNA-Analyse erstellen.
*
Zunächst bestimmten wir die Blutgruppe der männlichen Spermazellen. Bekanntlich gibt es vier verschiedene Blutgruppen: A, B, AB und O. Der Anteil der Blutgruppen A und O liegt jeweils bei knapp über vierzig Prozent in unserer mitteleuropäischen Bevölkerung, der für die Blutgruppe B bei ca. 12 Prozent. Den geringsten Anteil hat die Blutgruppe AB mit nur etwa 5 Prozent.
In ähnlicher Weise gibt es die Möglichkeit, anhand weiterer, in unserem DNA-Bauplan festgelegter erblicher Merkmale den Beweiswert der Untersuchungen zu steigern. So untersuchte ich einen Eiweißstoff, die Phosphoglucomutase (PGM), ein Enzym, das einen bestimmten Schritt im Zuckerstoffwechsel steuert und bei der mitteleuropäischen Bevölkerung in zehn unterschiedlichen Varianten vorkommt. Da die beiden genannten Merkmale (Blutgruppe und PGM) voneinander unabhängig vererbt werden, kann man die entsprechenden Häufigkeitswerte miteinander multiplizieren und damit den Beweiswert entscheidend verbessern. Im Idealfall aber wollten wir diesmal den Beweiswert so stark verbessern, dass statistisch betrachtet nur eine Person weltweit als Spurenverursacher in Betracht kommt (Ausnahme eineiige Zwillinge, die damals gentechnisch nicht unterscheidbar waren). Dieser Idealfall sollte mit der DNA-Analyse erreicht werden.
*
Bislang hatten wir an der umfangreichsten Mischspur aus dem Schrittbereich des Schlüpfers der Geschädigten die Merkmale, Blutgruppe und das PGM-Enzym, bestimmen können, die nicht zu der Geschädigten passten und somit vom Sperma-Anteil des Täters stammen mussten. In der Gesamtschau hatten wir nun einen kombinierten Häufigkeitswert von einem Prozent, bezogen auf die mitteleuropäische Bevölkerung. Das heißt, von hundert nicht verwandten Personen sollte – statistisch betrachtet – im Idealfall nur eine Person diese Kombination aufweisen. Und diese Kombination traf bei dem bisher Verdächtigen Olaf S. tatsächlich auch zu. Doch natürlich waren wir damit immer noch Welten entfernt von einer konkreten Individualisierung, da immerhin bei etwa sieben Milliarden Menschen auf unserem Planeten – rein rechnerisch – von 35 Millionen männlichen Personen mit solchen Merkmalsausprägungen auszugehen war.
Ich teilte den Ermittlungsbeamten die bisherigen Befunde schon vorab telefonisch mit. Doch jetzt durfte ich noch auf die Befunde der DNA-Analyse hoffen. Nachdem nun die konventionellen Analysemethoden ausgeschöpft waren, konnten wir mit der Vorbereitung für die DNA-Analyse beginnen. Mit dieser als »genetischer Fingerabdruck« bekannten Methode (s. a. Anhang) hofften wir, in statistische Häufigkeitswerte von eins zu mehreren Milliarden vorzustoßen. Bis dahin mussten wir allerdings noch etwas Geduld aufbringen. Erst nach der Analyse von vier für die Untersuchung verwendeten DNA-Sonden würde ich das Endergebnis berechnen können.
Damals, im Jahr 1989, stand uns beim Landeskriminalamt in Stuttgart noch kein funktionsfähiges Isotopenlabor zur Verfügung. Deshalb mussten wir weiterhin für die radioaktiven Arbeiten bei unseren BKA-Kollegen/-innen in deren Isotopenlabor Unterschlupf finden. Das Labor war in einem Lagergebäude auf dem riesigen BKA-Areal untergebracht. Als ich bei unseren radioaktiven Vorversuchen das erste Mal den Vorraum betreten hatte, war mir dieser wie eine Rumpelkammer vorgekommen, da er mit einem Berg defekter Labor- und Bürostühle fast vollständig angefüllt war. Auch das Labor selbst, ein kleiner, etwas schummriger, fensterloser Raum mit dunklen Ecken, machte nicht den Eindruck eines Hightech-Labors. Hier und da tauchten unter den Tischen schwarze, an den kräftigen Beinen behaarte Spinnen auf, die uns größer als normal vorkamen, gerade deshalb aber doch irgendwie zu dem Isotopenlabor passten. Mutanten halt, sagten wir scherzhaft. Birthe hatte stets großen Respekt vor ihnen.
Nun also sollte sich unsere mit so vielen Mühen und Hoffnungen verbundene Methode der DNA-Analyse in der kriminaltechnischen Praxis bewähren. Birthe und ich waren voller Zuversicht, natürlich aber auch aufgeregt, als wir uns nach Wiesbaden aufmachten. Wie schon bei unseren radioaktiven Vorversuchen holte sie mich ab, denn für sie war es kein Umweg, wenn sie beim LKA in Stuttgart vorbeifuhr, die vorbereiteten Utensilien in einen Dienstwagen packte und mich anschließend in meinem Heimatort, der auf dem Weg nach Wiesbaden lag, mitnahm. Diesmal hatte sie einen älteren, neutral aussehenden Golf von unserem Fahrdienst bekommen. Der Verkehr wurde immer dichter und unsere Anspannung wuchs. »Hoffentlich kommen wir ohne Stau in Wiesbaden an«, ging mir durch den Kopf. Die mitgeführten temperaturempfindlichen Reagenzien waren nicht der Grund dafür; diese waren in einer Kühlbox gut gelagert und hätten problemlos bis zum nächsten Tag durchgehalten. Es war eher das aufregende Gefühl, am Anfang von etwas ganz Neuem, noch nie Dagewesenem zu stehen – vergleichbar einer großen Theaterpremiere, vor der das Lampenfieber alle Sinne, ja sogar jede Zelle im Körper zu erfassen scheint. Wir kamen aber gut durch, checkten in Wiesbaden in unsere gebuchten Hotelzimmer ein und fuhren dann gleich weiter zum Bundeskriminalamt.
*
In dem kleinen Isotopenlabor konnte wegen der räumlichen und technischen Gegebenheiten immer nur ein Team arbeiten. Die erforderlichen Teilschritte bei der Sichtbarmachung des Strichcodes beanspruchten jeweils einen halben Tag Laborarbeit mit anschließender Reaktionsphase über Nacht bis zum nächsten Teilschritt. Wir hatten uns deshalb so abgesprochen, dass das BKA-Team vormittags, normalerweise einem Wochenanfang, mit ihren Tests beginnen und wir Stuttgarter dann nachmittags starten sollten. Am Dienstag und Mittwoch konnte anschließend im selben Zeitrhythmus weitergearbeitet werden. Liefe alles nach Plan, könnten wir schon am Mittwoch die ersten schwarzen Strichmuster auf unserem Röntgenfilm begutachten – das erste Resultat mit Material von einem schweren Verbrechen. Jetzt lagen aber noch einige Stunden konzentrierter Arbeit vor uns. Und vorher mussten wir in der Kantine unsere Energiespeicher auffüllen. Wie fast immer saßen wir zu viert mit unseren BKA-Kollegen/-innen beim Mittagessen und unterhielten uns angeregt über fachliche Probleme. Bei einer früheren Tour, noch während der DNA-Aufbauphase, hatten Birthe und ich die Öffnungszeit der Kantine nicht beachtet und dann den ganzen Nachmittag mit leerem Magen im Labor verbringen müssen. Für das konzentrierte Arbeiten mit radioaktivem Material war dies nicht zuträglich gewesen. Das wollten wir kein zweites Mal riskieren und führten deshalb von da an begonnene Fachdiskussionen immer in der Kantine weiter, auch wenn das Essen dabei oft zur Nebensache wurde.
*
Nach der nahrhaften Pause machten wir uns erwartungsfroh an die Arbeit. Als wir die Tür zum Labor aufschlossen, den Lichtschalter drückten und unsere Augen sich an das Kunstlicht gewöhnt hatten, begannen wir gleich mit den in der Aufbauphase schon vielmals eingeübten Vorbereitungen und Abläufen. Die weiße DIN-A5-große Nylonmembran, auf der die zu vergleichenden DNA-Fragmente aus tatrelevanten Spuren sowie den Vergleichsproben des Opfers und tatverdächtiger Personen in parallelen Bahnen fixiert waren, tränkten wir zunächst in einer speziellen Reaktionslösung. Danach überführten wir sie zusammen mit der Reaktionslösung in eine Plexiglas-Kassette, in der die Membran in einem sechzig Grad heißen Wasserbad sanft geschüttelt wurde. Die Wände der Kassette waren circa einen Zentimeter dick, sodass die radioaktiven Strahlen im Reaktionsgemisch vom Plexiglas weitgehend absorbiert wurden. Parallel dazu markierten wir die erste DNA-Sonde radioaktiv. Sobald beide Arbeitsgänge abgeschlossen waren, pipettierte ich die radioaktive Sonde zu der Nylonmembran in die Kassette, verschloss die Pipettieröffnung wieder und versenkte die Kassette abermals in dem sechzig Grad Celsius heißen Wasserbad, wo sie über Nacht weiter leicht geschüttelt wurde. Mit den radioaktiven Lösungen gingen wir immer äußerst sorgfältig um. Unvorsichtiges oder schlampiges Arbeiten würde einen immensen Aufwand für die Dekontamination nach sich ziehen. Das wollten wir uns nicht antun. Das Pipettieren mit den konzentrierten radioaktiven Lösungen führte ich immer selbst durch, um Birthe, meine junge Assistentin, im Hinblick auf eine spätere Mutterschaft zu schützen. Ich war zum damaligen Zeitpunkt bereits dreifacher Vater.
»Wie ist dein Gefühl?«, fragte ich Birthe beim Spülen und Aufräumen der benutzten Gefäße. »Ich bin etwas aufgeregt«, sagte sie, »aber es wird gut werden. Wir bekommen bestimmt ein schönes Strichmuster auf dem Röntgenfilm zu sehen. Ich wette, dass die Spermaspur zu einem der Tatverdächtigen passt.« »Dann muss ich also wetten, dass wir den richtigen Spermaverursacher nicht dabeihaben«, entgegnete ich. Um die Spannung hoch zu halten, schlossen wir manchmal Wetten ab. Die mit der Bearbeitung betraute Assistentin durfte sich immer zuerst das wahrscheinlichste oder erhoffte Ergebnis aussuchen, und mir blieb dann nur noch die Gegenposition. Gewettet wurde normalerweise um einen Cappuccino oder eine Tafel Schokolade, im Sommer manchmal auch um einen Eisbecher. Meist gewann so die Assistentin, und beide waren wir froh über die gelungene Tätersuche.
Am späten Nachmittag verließen wir das Gebäude durch die verschiedenen Kontrollbereiche beim BKA und fuhren zu unserem Hotel Fürstenhof unten in der Stadt. Nach einer kurzen Rast im Hotelzimmer gingen wir in ein chinesisches Restaurant in der Nähe unseres Hotels. Das gute chinesische Essen war inzwischen zu unserem Belohnungsritual geworden und immer ein entspannter Abschluss nach dem stundenlangen konzentrierten Arbeiten.
*
Am nächsten Morgen beim Frühstück im Hotel unterhielten wir uns wie meistens schon wieder über fachliche Dinge. An diesem Morgen lag der Fokus natürlich beim nächsten Arbeitsschritt, der auf uns wartete. Wir gingen alle Abläufe noch einmal gemeinsam gedanklich durch, um ja nichts zu vergessen. Die leichte Anspannung machte sich Luft in Bemerkungen wie »hoffentlich ist die Plexiglaskassette dicht geblieben«, »hoffentlich gab es keinen Stromausfall« und »hoffentlich hat das Schüttelwasserbad die Temperatur gehalten«. Ernsthaft besorgt waren wir aber nicht.
Gegen elf Uhr fuhren wir hoch zum BKA. Wir wollten möglichst früh zum Mittagessen, um spätestens gegen 13.00 Uhr weiterarbeiten zu können. Voraussetzung dafür war natürlich, dass bei der BKA-Arbeitsgruppe vor uns alles nach Plan abgelaufen war. Und so war es auch diesmal, denn kaum hatten wir in der Kantine die Essenstabletts auf dem Tisch abgestellt, als sich auch schon mein BKA-Kollege Herbert und seine Assistentin zu uns gesellten. Der Weg ins Labor würde also frei für uns sein. Auch sie hatten sich panierte Schnitzel mit Pommes geholt. Dienstags war dies immer unsere scherzhaft als »Hybridisierungsessen« bezeichnete Mahlzeit, mit der wir Kraft tankten für die umständlichen, hohe Konzentration erfordernden Waschprozeduren, die am Nachmittag anstanden, wobei kein Tropfen der radioaktiven Lösungen verlorengehen sollte.
Nach dem Essen und der Schlüsselübergabe machten wir uns schnell auf den Weg zum Isotopenlabor. Unsere Plexiglaskassette auf dem Boden des Wasserbades hatte dichtgehalten. Nichts Ungewöhnliches war erkennbar. Eine kurze Überprüfung des Badewassers auf ausgelaufene Radioaktivität war negativ. Gott sei Dank! Unter einer Schutzvorrichtung entfernte ich die Einfüllschraube an einer Ecke der Kassette mit einem Vierkantschrauber und zog mit einer Einwegspritze die radioaktive Lösung heraus, bis ich alle Flüssigkeit aus der Kassette entfernt hatte. Dann gab ich frische, entsprechend temperierte, nichtradioaktive Waschlösung in die Kassette, verschraubte die Einfüllöffnung wieder und legte die Kassette in das Schüttelwasserbad. Dieses Auswaschen der überschüssigen, nicht an die Nylonmembran gebundenen Radioaktivität wurde mehrfach wiederholt, bis in der Waschlösung keine über das natürliche Maß hinausgehende Radioaktivität mehr messbar war. Die radioaktiven Inkubations- und Waschlösungen füllte ich in einen Sicherheitsbehälter, wo sie bis zum Abklingen der Radioaktivität aufbewahrt wurden. Das eingesetzte radioaktive Element zur Aktivierung der DNA-Sonden war Phosphor (P32). Dieser hat eine Halbwertszeit von ca. 13 Tagen. Wenn die Radioaktivität nach einigen Monaten so weit abgeklungen ist, sodass man nur noch die natürliche Radioaktivität in den Lösungen nachweisen kann, konnten die Reaktionslösungen über den Ausguss entsorgt werden.
*
Die feuchte Membran packte ich dann in Frischhaltefolie ein und legte sie in eine metallene Röntgenkassette. Ein kurzer Scan mit dem Dosimeter zeigte an, dass noch einiges an Radioaktivität auf der Membran vorhanden war. Wir waren immer erleichtert, wenn die Messskala bei diesem Arbeitsschritt die richtige Menge an Radioaktivität anzeigte. Ein zu starkes Knistern oder gar ein Pfeifton des Gerätes würde auf eine Panne bei den Waschschritten hinweisen. Dann wäre der Röntgenfilm nach dem fotografischen Entwickeln möglicherweise total geschwärzt. Andererseits wäre bei zu geringer Radioaktivität auf dem Film vermutlich kein schwarzes Strichmuster erkennbar, was an einer fehlerhaften Aktivierung der DNA-Sonde oder einer zu geringen Menge an Spuren-DNA auf der Nylonmembran liegen könnte. Der Film würde dann blank, wie unberührt aussehen. Anschließend legte ich bei Rotlicht einen Röntgenfilm auf die verpackte Membran und verschloss die Kassette. Damit war der Film vor Kunst- oder Tageslicht gesichert. Bis zum nächsten Tag lagerten wir sie in einer Tiefgefriertruhe bei minus achtzig Grad Celsius, damit die Strichmuster auf dem Röntgenfilm konzentriert und nicht durch Diffusionseffekte verwaschen aussahen, was die Auswertung hätte beeinträchtigen können. Nun blieb uns nur noch, im Labor aufzuräumen und auf ein gutes Ergebnis am morgigen Tag zu hoffen. Ich verbrachte eine recht unruhige Nacht und im Halbschlaf grübelte ich, ob wir vielleicht doch etwas vergessen oder falsch gemacht hatten. Als ich am Morgen aufwachte, waren diese trüben Gedanken wie weggewischt und ich konnte es gar nicht erwarten, was die erste DNA-Sonde uns präsentieren würde. Mit etwas Glück könnten wir vielleicht sogar schon beim ersten vergleichenden Blick erkennen, ob das Strichmuster unserer Spermaspur zu einem der Tatverdächtigen passt. Ich fieberte dem vielleicht spannendsten Moment seit Beginn meiner DNA-Forschungsarbeiten entgegen, nämlich dem Augenblick, der darüber entscheiden würde, ob erstmals eine Straftat in Deutschland von einem Kriminaltechnischen Institut mittels DNA-Analyse aufgeklärt werden könnte.
*
Natürlich freut man sich immer, wenn ein Tatverdächtiger im ersten Anlauf, also beim ersten vergleichenden Blick auf die Strichmuster, zu den Tatspuren passt. Solch ein Augenblick setzt ordentlich Adrenalin und Glückshormone frei und spart oft zermürbendes wochen- oder monatelanges Weiterarbeiten an einem Fallgeschehen. In der Mehrzahl der Fälle aber geht die Suche nach dem wahren Täter zunächst weiter. Zumindest kann ich dann aber viele der in Tatverdacht geratenen Personen meistens schon nach der ersten DNA-Sonde eindeutig entlasten. Dieser Aspekt ist genauso wichtig und von seiner Bedeutung für die Rechtssicherheit ebenso herausragend wie die eindeutige Überführung einer Person als Spurenverursacher. Hat man jedoch eine solche Person identifiziert, obliegt es dann immer noch dem Ermessen des Gerichts, ob diese dann tatsächlich als Täter verurteilt wird. Doch nach meiner langjährigen Erfahrung geht es bei übereinstimmenden DNA-Befunden normalerweise nur noch um die Höhe des Strafmaßes.
Am Mittwochvormittag nahmen wir unser Gepäck schon mit zum BKA, denn das Entwickeln der Röntgenfilme würde nicht mehr allzu viel Zeit in Anspruch nehmen. Beim Anziehen unserer Schutzkleidung im Labor meinte Birthe nachdenklich: »Eigentlich ist es ja schon etwas ungewöhnlich, wenn man sich so auf seine Arbeit freut. Die meisten Leute erleben halt immer nur denselben Alltagstrott. Aber bei uns gibt es so viele spannende Momente.« Ich schaute sie erstaunt an und lachte dann: »Sag das aber bloß nicht zu laut. Sonst müssen wir noch Vergnügungssteuer bezahlen.«
Als wir das Isotopenlabor betraten, hingen die BKA-Filme noch zum Auswaschen überschüssiger Fixierlösung im Wasserbad. Schnell setzten wir die Lösungen fürs Entwickeln und Fixieren an und holten unsere auf minus achtzig Grad Celsius tiefgekühlte Kassette aus der Gefriertruhe. Beim Wechsel von Neon- zu Rotlicht brauchten unsere Augen wie immer einen kurzen Moment, um sich an die schummrige Atmosphäre zu gewöhnen. Nachdem der seit gestern Nachmittag exponierte Röntgenfilm in der Wanne mit der Entwicklerlösung schwamm, legte ich gleich einen frischen Film auf die Nylonmembran. Diesen wollte ich nun ebenfalls – jedoch diesmal fünf Tage lang – exponieren, um bei schwach ausgeprägten Signalen dem Film mehr Zeit für eine stärkere Schwärzung zu geben.
*
Der spannendste Moment kommt dann, wenn in der Entwicklerlösung langsam, immer stärker werdend, die schwarzen Strichmuster auf dem Film erscheinen. Dabei kann man regelrecht zusehen, ob sich die eingesetzte Spuren-DNA im konkreten Fall als ausreichend erweist und ob sie der parallel analysierten DNA eines Tatverdächtigen wirklich gleicht.
Unser Ergebnis war positiv. Ich schaute Birthe an, die natürlich auch sehr gespannt war, und sagte nur: »Passt zu unserem Tätowierten!« Dann fügte ich hinzu: »Sieht zumindest so aus. Die Spurensignale könnten noch etwas intensiver sein. Aber dafür haben wir ja nächste Woche noch den Fünf-Tages-Film. Eine genaue Auswertung der Muster werde ich aber schon übers Wochenende zu Hause durchführen und den Beweiswert, das heißt, die entsprechende Häufigkeit des erhaltenen Strichmusters innerhalb unserer Bevölkerung, berechnen.«
Beim »genetischen Fingerabdruck« werden insgesamt vier unterschiedliche DNA-Sonden nacheinander eingesetzt, um einen hohen Beweiswert, vielleicht sogar eine individuelle Zuordnung zu einer Person zu erhalten. So mussten wir also in den folgenden Wochen dieselben Prozeduren mit der entsprechenden Nylonmembran noch dreimal mit jeweils verschiedenen DNA-Sonden durchführen. Erwiese sich die tatrelevante Spermaspur dann immer noch als passend zum Tatverdächtigen Olaf S., würde es für ihn sehr eng werden. Wahrscheinlich würde das Gericht die Täterschaft dann nicht mehr in Frage stellen, sondern nur noch das Strafmaß festsetzen. Einzig ein eineiiger Zwillingsbruder könnte dann die Sache noch komplizieren (zum damaligen Zeitpunkt waren eineiige Zwillinge über die DNA-Analyse nicht zu unterscheiden).
*
Zufrieden packten wir unsere Sachen zusammen, gaben den Laborschlüssel zurück und stärkten uns noch in der Kantine, bevor es wieder Richtung Heimat ging. Unterwegs hatten wir eine Reifenpanne und mussten das Reserverad aufziehen. Vielleicht war dies ein Warnschuss, dass wir in unserer Euphorie nicht in der Konzentration auf den immer dichter werdenden Verkehr nachlassen durften.
Zu Hause angekommen nahm ich meine Tasche aus dem Kofferraum und bot Birthe an, noch kurz auf eine Tasse Kaffee mit reinzukommen. Sie wollte aber schnell weiter nach Stuttgart, um das Auto beim LKA abzugeben und den ersten Röntgenfilm in unser Untersuchungslabor zu bringen. Sie konnte es nicht erwarten, den Kollegen/-innen, die jetzt noch im Labor waren, unsere tollen Ergebnisse kundzugeben.
Als ich die Haustüre aufschloss, wurde ich schlagartig wieder in meine private Welt hineinkatapultiert. Meine drei Kinder standen schon erwartungsvoll auf dem Treppenabsatz und riefen: »Papa, Papa, hast du uns auch was mitgebracht? Bitte, bitte.« Meist hatte ich, wenn mir etwas Zeit blieb, in einem Spielzeugladen in der Innenstadt von Wiesbaden noch etwas Kleines besorgt. Manchmal ein Kinderbuch zum Vorlesen, oft auch eine Hörspielkassette mit »Benjamin Blümchen« oder Kassetten von Michael Ende und Astrid Lindgren.
Bis zum Wochenende hatten wir noch Proben aus weiteren aktuellen Kriminalfällen DNA-technisch bearbeitet, sodass wir die neuen Nylonmembranen ebenfalls am kommenden Montag auf unserer nächsten Fahrt zum BKA nach Wiesbaden mitnehmen konnten.
*
Am Montagmorgen saß ich gerade mit meiner Familie am Frühstückstisch, als das Telefon klingelte. Es war Birthe, die fröhlich ins Telefon rief: »In etwa einer Stunde bin ich bei Ihnen, falls mich kein Montagsstau auf der A 81 ausbremst.« Tatsächlich traf sie schon eine knappe Stunde später ein – sichtlich voller Tatendrang. Ich nahm meine gepackte Tasche, verabschiedete mich von meiner Frau und meinen Kindern und stieg zu Birthe in das Dienstauto. Absprachegemäß übernahm nun ich das Steuer. Diesmal hatte sie ein Auto mit Automatikgetriebe mitgebracht. Das war für mich neu und anfangs doch etwas gewöhnungsbedürftig. Wir kamen gut voran und waren natürlich sehr gespannt auf das Aussehen des fünf Tage alten Röntgenfilms von der ersten Hybridisierung in der vergangenen Woche. Außerdem hatten wir ja schon die neuen Nylonmembranen von weiteren Sexualdelikten im Gepäck. In der Anfangsphase unserer DNA-Analysen waren oftmals nur Sexualdelikte für diese Art der Untersuchung geeignet, denn normalerweise ist im Spermasekret bei gleichem Volumen wesentlich mehr DNA als im Blut vorhanden. Dies liegt daran, dass bei Säugetieren die roten Blutzellen nach ihrer Ausreifung keinen Zellkern und somit keine DNA mehr enthalten. Zellkern-DNA liefern hier nur die weißen Blutzellen (Leukozyten).
In Wiesbaden waren wieder dieselben Hotelzimmer für uns reserviert, sodass wir uns dort allmählich schon ein wenig heimisch fühlten. Nach dem Abladen des Gepäcks fuhren wir gleich weiter den Österberg hoch zum BKA, wo uns das übliche Prozedere der Parkplatzsuche und der peniblen Kontrolle unserer Dienstausweise erwartete. Unser BKA-Kollege Herbert nahm uns an der Pforte in Empfang und brachte uns gleich in die Kantine, wo Herberts Assistentin, Frau Freitag, bereits einen Tisch für vier Personen belegt hatte. Die beiden waren heute früher fertig geworden, und ihre Fünf-Tages-Röntgenfilme von letzter Woche hingen noch zum Auswaschen der Fixierlösung im fließenden Wasser.
*
Wir hielten uns nach dem Essen nicht lange mit Diskussionen auf, da wir kaum erwarten konnten, wie unser Röntgenfilm aussehen würde, der nun seit fünf Tagen auf der radioaktiv markierten Nylonmembran gelegen hatte. Bei der kurzen Übernacht-Inkubation in der Vorwoche waren die Schwärzungen der Spuren-DNA auf dem Film zwar nur äußerst schwach erkennbar gewesen, hatten sich jedoch an genau parallelen Stellen wie die Signale des Tatverdächtigen Olaf S. befunden. Oder hatte ich mir das unter dem hohen Erwartungsdruck vielleicht doch nur eingebildet? Wir würden aber bald Gewissheit haben, ob meine erste Einschätzung vor fünf Tagen richtig gewesen war.
Nach dem Öffnen der Kassette legte ich den Röntgenfilm in die Wanne mit Entwicklerlösung. Unsere volle Aufmerksamkeit war nun auf den Film gerichtet, den Birthe durch gleichmäßige leichte Bewegungen der Wanne in der Entwicklerlösung hin- und herschwenkte.
Diese Phase hat stets etwas ganz Faszinierendes: das Wissen, dass in wenigen Minuten endlich die mögliche Beteiligung verdächtigter Personen an einer Straftat sichtbar werden kann. Entsprechend angespannt warteten wir darauf, dass jeden Moment auf dem zunächst klaren, unbefleckten Film schwarze Striche auftauchten (die Strichform ergibt sich aus der Form der Probentaschen im Agarose-Trenngel s. a. Anhang Abb. 3). »Juhuu!«, jubelte Birthe. »Wir haben es geschafft! Unsere erste Einschätzung war richtig!« Tatsächlich. Die DNA aus der Spermaspur passte zum Tatverdächtigen Olaf S. Ich hatte ja nichts anderes erwartet. Doch noch mussten wir uns in Geduld üben. Erst nach Analyse aller vier in der Untersuchung verwendeten DNA-Sonden würde ich das Endergebnis berechnen können.
*
Getragen von dem deutlich positiven Befund bereitete ich die zweite Sonde zügig und doch äußerst konzentriert für ihren radioaktiven Einsatz vor. Parallel dazu mussten wir von der Nylonmembran die erste DNA-Sonde wieder mit einer speziellen Reaktionslösung abwaschen und die Membran für das »Rendezvous« mit der neu radioaktiv markierten zweiten Sonde fit machen. Danach übertrugen





























