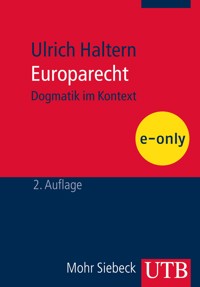28,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: C. H. Beck
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Man kann die starken Ambivalenzen der europäischen Integration nur managen, aber nicht beseitigen. Denn was die Europäisierung voranbringt, das führt zu Konflikten mit dem nationalen Selbstbehauptungswillen vieler Einzelstaaten, während umgekehrt dieser Willen einer machtpolitischen Bündelung der Union im Wege steht. In dieser Situation zwingt das weltpolitische Stühlerücken in der Gegenwart Europa verstärkt dazu, sich auf die veränderte Lage einzustellen. Ob und wie es der Europäischen Union gelingen kann, dem Einbruch atavistischer politischer Gewalt zu begegnen und den Aufstieg populistischer Kräfte in den Mitgliedsländern einzudämmen, auch davon handelt diese scharfsinnige Bestandsaufnahme der europäischen Integration. Dieses Buch führt systematisch durch die Funktionsbereiche der EU und untersucht anhand von Beispielen auf den drei Ebenen Recht, Politik und Kultur die Verlaufsmuster ihrer Entscheidungsprozesse. Es zeigt, dass die innere Spannung der europäischen Integration sich in eine Mechanik übersetzt, die problemübergreifende Regelmäßigkeiten aufweist: Einer begrenzten Überführung von Macht auf die Unionsebene folgt deren Entgrenzung. Dies wiederum zieht starke Ambivalenzen der Staaten und ihrer Bürger gegenüber der Integration nach sich.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Titel
ULRICH HALTERN
VERSCHLUNGENE STAATEN
Die paradoxe Mechanik der europäischen Integration
C.H.BECK
Übersicht
Cover
INHALT
Textbeginn
INHALT
Titel
INHALT
Motto
EINLEITUNG
KAPITEL 1: GRUNDLAGEN
I. Integrationsrecht
II. Integrationsverfassung
III. Konstitutionalisierung, Regulierung, Effektuierung
KAPITEL 2: KONSTITUTIONALISIERUNG
I. Recht – Organisation und Bürger
1. Organisation (1): Institutionen
2. Organisation (2): Wertekonstitutionalismus
3. Bürger (1): Grundrechtsschutz
4. Bürger (2): Unionsbürgerschaft
II. Politik – Verfahren
III. Kultur – Politische Identität
KAPITEL 3: REGULIERUNG
I. Recht – Überkonstitutionalisierung und Kompetenzen
1. Überkonstitutionalisierung
2. Kompetenzen
II. Politik – Institutionelle und prozedurale Anlage von Regulierung
1. Politikgestaltung durch unabhängige Institutionen
2. Spezialisierung und Pluralisierung
III. Kultur – Grenzen des Marktes
KAPITEL 4: EFFEKTUIERUNG
I. Recht – Juristische Konstitutionalisierung
1. Hybride Emanzipation
2. Massive Stärkung
3. Spannungsgeladene Ambivalenz
II. Politik – Fiskalische Effektuierung
III. Kultur – Symbolische und judikative Ambivalenz
1. Ambivalente Symbolik
2. Ambivalenter Verfassungsgerichtsverbund
FAZIT
Begrenzungen
Möglichkeiten
ANMERKUNGEN
Einleitung
Kapitel 1 Grundlagen
Kapitel 2 Konstitutionalisierung
Kapitel 3 Regulierung
Kapitel 4 Effektuierung
Fazit
ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS/GLOSSAR
NACHWORT
Zum Buch
Vita
Impressum
Motto
… niemand zeigt die Richtung; viele halten Schwerter, aber nur, um mit ihnen zu fuchteln; und der Blick, der ihnen folgen will, verwirrt sich. Vielleicht ist es deshalb wirklich das Beste, sich, wie es Bucephalus getan hat, in die Gesetzbücher zu versenken.
FRANZ KAFKA, Der neue Advokat
EINLEITUNG
Spätestens mit der Rückkehr Donald Trumps ins Weiße Haus ist unmissverständlich deutlich geworden, dass gegenwärtig ein weltpolitisches Stühlerücken stattfindet, das die Verteilung von Herrschaftsmacht und den dieser Macht zugrundeliegenden Ideen neu ordnet. Im Tumult von Klimakrise, Flüchtlingsströmen, Pandemiefolgen und Technologiewandel zerbröseln sowohl die Pax Americana als auch die europäische Friedensordnung, die Landkarte wird als Koordinatensystem von Vektoren großer Interessensphären neu gezeichnet, und multipolare Geopolitik kehrt in Gestalt von konventionell eingesetzter Gewalt und strategisch eingesetzten Investitionen als Kriegs- und Wirtschaftsmacht zurück.
Dadurch verändert sich auch die Landkarte politischer Ideen. Die für eine Weile scheinbar zwingende Ausbreitung des demokratischen Gedankens ist nicht nur zum Erliegen gekommen, sondern kehrt sich um: Viele Länder und Gesellschaften wenden sich populistischen oder autoritären Ideen zu und entfremden sich zunehmend dem liberalen Wertesystem. Auch im Westen – in den USA ebenso wie in Europa – entkonsolidiert sich die liberaldemokratische Idee. Nicht nur in, sondern auch zwischen den Staaten wird zudem die Idee der vernunftgeleiteten Zähmung des Politischen, die in den internationalen Beziehungen als Verrechtlichung daherkam und sich ebenso wie die Demokratie unaufhaltsam auszubreiten schien, aufgegeben oder doch immer weiter relativiert. Demokratisches Recht ist heute nicht mehr das Mittel der Wahl, jedenfalls nicht außerhalb Europas.
Diese Entwicklungen treffen die Europäische Union weitgehend unvorbereitet. Sie sieht schlecht gerüstet aus für die Wiederkehr von Geopolitik und den Wettbewerb mit Mächten wie China, die erstens in größeren zeitlichen Zyklen denken als wir und die zweitens Politik, Handel und Investitionen sowie Verteidigung zu einer einheitlichen Strategie verschmelzen. Dies führt zu kontinuierlichen Enttäuschungen über die übernationalen Entscheidungen der Union und die nationalen ‹Egoismen› ihrer Mitgliedstaaten. Dass die EU in den internationalen Beziehungen nicht erst seit heute ein einigermaßen schlechtes Bild abgibt, ist wenig überraschend. Geopolitische Erwägungen sind dem Nachdenken der Union über sich selbst im Ganzen fremd geblieben. Wenn es zutrifft, dass Geopolitik auf den drei Säulen Macht, Territorium und Narrativ aufruht[1], sind die Defizite der europäischen Integration unübersehbar. Nicht Macht, sondern deren Relativierung durch das Recht (in institutioneller, prozeduraler und materieller Hinsicht) steht im Zentrum der Integration. Territoriale Integrationsgrenzen sind von Beginn an schemenhaft gewesen und haben sich im weiteren Verlauf immer wieder verschoben, ohne dass die Gründe hierfür immer plausibel, geschweige denn zwingend waren. Narrative von sich selbst hat die Union nie einsichtig und glaubhaft machen können: Zu schwach war und ist die europäische politische Identität ihrer Bürger, als dass sie skeptischeren Narrativen von Technokratie und Bürokratie und den konkurrierenden nationalen Identitäten hätte widerstehen können; zu stark waren die Gegensätze zwischen den mitgliedstaatlichen Finalitätsvorstellungen, als dass sich eine gemeinsame europäische Erzählung hätte formen können, die den von außen zugewiesenen Narrativen etwas entgegenzusetzen hätte.
Natürlich sind die Kategorien von Macht, Territorium und Narrativ auch in Europa nicht verschwunden. Sie sind in den Mitgliedstaaten – insbesondere in den großen Mitgliedstaaten wie Frankreich (Deutschland dürfte eine Weile eine Sonderrolle gespielt haben[2]) – so lebendig wie eh und je. Machtdiskurse spielen dort, wie man etwa am Beispiel der politischen Diskussionen um den Brexit studieren konnte, eine wichtige, oft auch ökonomische Erwägungen abdrängende Rolle. Auch die bewehrte Territorialgrenze ist alles andere als unwichtig geworden. Sie manifestiert sich insbesondere in Krisen: als Außengrenze in der Flüchtlings-, als Binnengrenze in der Coronakrise. Politische Narrative dazu, wer ‹wir› sind, wer ‹wir› waren und sein wollen, sind ebenfalls in den Mitgliedstaaten aufgehoben, die nach wie vor die politische Heimat der Bürger sind und den wichtigsten sozialen Vorstellungsraum für individuelle und kollektive Identität zur Verfügung stellen. Keine supranationale post-histoire-Haltung der Union, die sich über Vernunft legitimiert, über den Markt operiert und über den Output rechtfertigt, kann den sozialen Vorstellungsraum von Staatlichkeit, die sich auf souveräne, unmittelbar vom Volk abgeleitete Herrschaftsmacht und damit einhergehende politische Identität verlassen kann, ganz schließen.[3]
Hier liegt trotz aller Rede über gemeineuropäische Werte ein handfestes Spannungsverhältnis. Union und Mitgliedstaaten bringen unterschiedliche Existenzräume für Autorität zum Entstehen. Auf der einen Seite steht ein Fortschrittsdiskurs der integrationspolitischen Notwendigkeit, der in einer sich schnellstmöglich vertiefenden Union die Vollendung einer historischen Vision sieht. Seine Vektoren entstammen der politischen (Friedensideal, weltpolitisches Gewicht), wirtschaftlichen (Binnenmarktprosperität), historischen (Lehren aus der Geschichte), moralischen (Solidargemeinschaft der Bürger) und rechtlichen (Rechtsauftrag «immer engerer Zusammenschluss der Völker») Arena und lassen kaum Raum für Alternativen (Bewältigung zunehmend transnationaler Probleme nur durch zunehmend transnationale Integration) zu. Auf der anderen Seite steht ein skeptischer Diskurs, der das Lokale ins Zentrum rückt und gegenüber dem Fortschrittsgedanken überall Dichotomien in Gestalt von Vor- und Nachteilen einführt: Den Prosperitätsgewinnen des Binnenmarktes steht die Aussicht auf schmerzhafte Anpassungsprozesse und Globalisierungsverlierer gegenüber; der Solidargemeinschaft steht die Behauptung einer überspannten transeuropäischen Tugendzumutung gegenüber; der Rechtsgemeinschaft steht die Betonung des Nichtrechtlichen gegenüber, das sich wiederum stark aus Divergenzen speist (unterschiedliche Interessen, Sprachen, Kulturen, Traditionen usw.). Dadurch steigen Themen an die Oberfläche, die noch vor wenigen Jahren in der individuellen Anschauung des Privaten versunken waren und nun wieder dem Rampenlicht des Öffentlichen ausgesetzt sind, wie etwa die Religion oder die Heimat, die dem europäischen Nomadentum entgegengehalten wird. Einer wie immer hergeleiteten europäischen Identität werden nationale Erinnerungen gegenübergestellt, die sich als kollektiver Gedächtnishaushalt einer enger umgrenzten politischen Gemeinschaft anders auf die Vergangenheit beziehen als die – zunehmend als Globalgeschichte stattfindende und möglicherweise die Einsichten der Kulturtheorien über das Eigene und Symbolische verspielende[4] – Geschichtsschreibung.
Auch die Metaphern unterscheiden sich. Vorwärtsstürmen oder innehalten? Reformieren oder konsolidieren? Vertiefen oder zurückbauen? Handeln oder nachdenken? Entscheiden oder diskutieren? Der europäische Diskurs betont im Politischen das effizient Vernünftige und das zweckhaft Funktionale, im Rechtlichen das dogmatisch Vorrangige und das harmonisierend Einheitliche, und im Kulturellen das projekthaft Geschaffene und das beweglich Liquide. Der staatliche Diskurs betont im Politischen das demokratisch Legitimierte und das föderal Vielfältige, im Rechtlichen das radiziert Entschiedene und das spezifisch Eigene, und im Kulturellen das gewachsen Organische und das unbeweglich Erdige.
Natürlich sind diese Gegensätze klischeebeladen. Ernstzunehmende politische Diskurse bedienen sich in wechselnden Kombinationen aus beiden Bedeutungsreservoirs. Praktisch sind beide nicht in deutlich identifizierbare Lager unterteilt, sondern eng miteinander verschlungen. Die Union ist ja kein dem Staat gleich- und gegenübergestelltes Gemeinwesen mit unabhängiger Herrschaftsgewalt und eigenem Territorium, sondern existiert in dem normativ und institutionell dicht besiedelten Raum zwischen den Mitgliedstaaten, einem «crowded space».[5] Die staatliche Stimme steht nicht derjenigen der Union gegenüber, sondern verschafft sich auch innerhalb der Union Raum. Während manche Unionsinstitutionen weitgehend vom Einfluss der Mitgliedstaaten isoliert sind, sind andere mit Vertretern der Mitgliedstaaten besetzt und bringen mitgliedstaatliche Interessen zur Entfaltung. Umgekehrt verlässt sich die Union auf mitgliedstaatliche Organe, um ihre eigenen Entscheidungen in den Staaten auf die Straße zu bringen. Auf politischer, rechtlicher und kultureller Ebene kommt es so zu einer Doppelhelix von Institutionen, Verfahren, Rechtsbefehlen und Überzeugungen, die sich komplex aufeinander beziehen und sich manchmal ergänzend, manchmal konkurrierend zueinander verhalten. Die Räume, die hierdurch entstehen, sind, ebenfalls abhängig vom Kontext, stabil oder volatil und transportieren auf allen Ebenen – politisch, rechtlich, kulturell – Kommunikationen, die sich wiederum miteinander verschlingen.
Dass hierdurch das Politische verwirbelt wird, ist selbstverständlich. Autorität und Legitimation treten auseinander; Gestaltungsspielräume stehen plötzlich in keinem angemessenen Verhältnis mehr zu dem politischen Gespräch hierüber (in der Union policy without politics, in den Mitgliedstaaten politics without policy)[6]. Kompetenzen driften, unabhängige Institutionen treffen politische Entscheidungen, Legitimation wird mit Effizienz verrechnet. Die demokratischen Probleme etwa, die mit der europäischen Integration durch die Machtverlagerung von den Parlamenten auf die Exekutive, die Aushebelung nationaler Opposition, die geringen Feedback-Möglichkeiten der Bürger, die Intransparenz und die Repräsentationsprobleme – von den tatsächlichen Verlusten an individueller Entscheidungsautonomie zugunsten von Gewinnen an kollektiver Entscheidungsmacht gar nicht zu reden – einhergehen, sind oft genug beschrieben worden. Auch die eher dünne Basis der Union etwa im Hinblick auf demokratische Verantwortlichkeit und soziale Legitimation macht sich in alles andere als subtiler Weise bemerkbar, insbesondere vor dem Hintergrund, dass die Union in politisch immer sensibleren Bereichen immer größere Entscheidungsbefugnisse besitzt. Dies führt zu starken Verunsicherungen aufseiten des Staates, in den sich das Volatile der Union hineinfrisst: Die Entscheidung über Inklusion/Exklusion als Pfeiler von Staatlichkeit ist mitgliedstaatlicher Autonomie teilweise entzogen; Grenzen als Verortung und Radizierung staatlich organisierter politischer Gemeinschaft verlieren zunehmend ihre Unterscheidungsfunktion; staatlicher Raum büßt verstärkt an Präzision und konstituierender Kraft ein; und demokratische Prozesse laufen manchmal ins Leere.
Aufgefangen zu werden scheint diese Verwirbelung des Politischen zunächst ausgerechnet dadurch, dass die Union eben eine andere Art von Gemeinwesen als der Staat ist. Sie galt lange Zeit gerade nicht in erster Linie als politische Gemeinschaft, sondern als «Rechtsgemeinschaft»[7]; als «Rechtsunion» wird sie auch heute noch bezeichnet. Das Juristische, das die Institutionen sortiert, die Verfahren anordnet, die inhaltlichen Vorgaben macht und deren Umsetzung dann kontrolliert, unterscheidet die Union nicht nur von allen anderen internationalen Organisationen, deren Durchsetzungsmacht im «crowded space» zwischen souveränen Staaten deutlich begrenzt ist, sondern stellt auch Orientierung und Ordnung zur Verfügung. Das Regelhafte verdichtet sich häufig in Hierarchien: Das materielle Prinzip des Vorrangs des Unionsrechts vor dem nationalen Recht und sein prozedurales Schwesterprinzip des EuGH-Monopols, Unionsrecht verwerfen zu können, sind die sichtbarsten Ausprägungen dieser Hierarchieemergenz. Sie führen dazu, dass man seit mehr als drei Jahrzehnten von einer europäischen «Verfassung» spricht, die neben und über die nationalen Verfassungen tritt.
Doch dieser Schein trügt. Das Juristische ist kein sicherer Hafen im schäumenden Ozean des Politischen, ebenso wenig wie unabhängige Institutionen – weder Gerichte noch Zentralbanken oder Agenturen – auf Dauer vom Politischen unberührt bleiben. Tatsächlich bricht sich auch im Recht der Unterschied der politischen Handlungsräume und der sozialen Vorstellungsschemata Bahn. Recht markiert unabhängig von seiner abstrakten Formulierung und seinem unbedingten Geltungsanspruch einen Vektor, der auf die Erfahrungen und Hoffnungen einer politischen Gemeinschaft verweist. Die Bedeutungen, die sich darin wiederfinden, sind abhängig von der ganz partikularen Geschichte dieser Gemeinschaft. Diese Partikularität verleiht dem Recht, insbesondere dem Verfassungsrecht, seine Authentizität und macht es zu ‹unsrigem›. Hier verschränkt sich die Herrschaft des Volkes mit der Herrschaft des Rechts. Gerichte lesen das Recht so, dass dahinter die politische Gemeinschaft sichtbar wird; sie lesen Gemeinschaften. Dadurch reiben sich die unterschiedlichen politischen und kulturellen Verständnisse von Gemeinschaft auch im Recht; juristische Auslegungen von Rechtssätzen werden zu Orten, an denen politische Identität verhandelt wird. Es beginnt ein Tauziehen um die Bedeutung von Legitimität und Effizienz, Demokratie und Vernunft, Einheit und Vielfalt und darum, wer ‹wir› sind. Was aus europarechtlicher Sicht einen Rechtsbruch darstellt, stellt sich aus nationaler Sicht als die Bergung authentischer Bedeutung dar. Freilich sind nicht nur die zugrundeliegenden Vorstellungsschemata und Interessen, sondern auch die Instrumente für ihre Durchsetzung ungleich verteilt. Sie führen häufig dazu, dass die dicht gewebten Vergemeinschaftungsimaginationen des Staates sich den deutlich dünner gewebten Vergemeinschaftungsimaginationen der Union beugen müssen. Soziale Legitimation wird dadurch nicht gerade gestärkt und Erwartungen an beide Räume, Union und Staat, werden enttäuscht. Doch bleiben Widerspruch und Bestreitbarkeit möglich und vergrundsätzlichen die juristische Aushandlung von Geltungsansprüchen. Kein dichter Konstitutionalismus lässt sich so ohne weiteres durch einen dünnen Konstitutionalismus streamlinen. Die Sorge, dass aus der verschlungenen Integrationskonstellation Staaten hervorgehen, deren Eigenheiten von der Union verschlungen werden, ist zu groß.
Damit entsteht auf politischer, rechtlicher und kultureller Ebene der Integration ein kompliziertes Gemisch aus nationalen und supranationalen Herrschaftsansprüchen, in dem sich staatliche Interessen nicht einfach auflösen. Die Rechtsgemeinschaft der europäischen Integration ist keine zentralisiert regierte, sondern eine multipolare und noch dazu extrem bewegliche Doppelhelix, deren Gestalt und Bewegungsrichtung von den Kontexten und Umständen des konkret zu Entscheidenden abhängt. Es spricht für den Integrationswillen der Mitgliedstaaten, dass dieses empfindliche Konstrukt so belastbar und resilient ist, wie es heute trotz aller Krisen dasteht.
Dieses Buch sieht sich die Doppelhelix genauer an. Nur das Verständnis ihrer Beschaffenheit kann Erklärungen für die Herkunft, die Gegenwart und die Zukunft der Integration bereitstellen und darüber aufklären, inwiefern und warum Europa anders ist als China oder die USA und wieso das nicht nur notwendig, sondern auch gut so ist. Dabei ist es nicht die Sicht der Union, die entscheidend ist, ebenso wenig wie die Sicht des Staates; es ist die Relation. Juristisch gewendet ist es nicht die unionsrechtliche oder die staatsrechtliche Norm, die Antworten zur Verfügung stellt, sondern die aus beiden Rechtsordnungen zusammengesetzte, beständig austarierte Integrationsrechtsordnung als Doppelhelix. Die Verschraubung ihrer beiden Stränge steht im Zentrum dieses Buches, nicht der einzelne Strang.
Diese relationale Betrachtung führt auf den Ebenen Recht, Politik und Kultur zu einer Integrationserzählung, die in allen Funktionsbereichen der Europäischen Union eine regelmäßige Plotstruktur aufweist. Sie besteht aus drei Akten. Im ersten überführen die Mitgliedstaaten Entscheidungsbefugnisse auf die überstaatliche Ebene und profitieren von einer emanzipierten und dadurch erhöhten Problemlösungskapazität. Im zweiten Akt verdichtet sich diese Emanzipation zu einer massiven Stärkung der europäischen Ebene, manchmal mit, manchmal ohne direktes Zutun der Mitgliedstaaten. Dies führt im dritten Akt zu einer Ambivalenz der Mitgliedstaaten, die mit so nicht erwarteten Konsequenzen ihrer ursprünglichen Emanzipationsentscheidung konfrontiert sind: Die Rechtslage ist nicht vollständig von ihrem Normsetzungswillen (und damit vom gefundenen politischen Kompromiss) gedeckt. Diese Ambivalenz mündet in Spannungen, die sich bereichsübergreifend durchziehen und mitunter sogar dramatisch entladen. Sie sind besonders deutlich erkennbar in stark souveränitätsaffinen Bereichen wie power of the purse (Steuern, Haushalt, Sozialpolitik) und power of the sword (Sicherheitspolitik, Verteidigung, Strafrecht), stecken aber ebenso im eigentlich ständig brummenden Maschinenraum des Binnenmarktes.
Auflösen lassen sich Ambivalenz und Spannungen nicht. Sie folgen aus der Tatsache, dass EU und Nationalstaaten unterschiedliche Formen politischer Vergemeinschaftung sind und sein sollen, dass sie daher innerhalb ganz unterschiedlicher Formen von sozialen Vorstellungsschemata existieren und dass sie deshalb unterschiedlich dichte individuelle und kollektive Loyalität einfordern können. Man kann diese Ambivalenz und Spannungen nur managen, nicht beseitigen. Die Form des Managements hängt davon ab, welche Interessen und Werte auf den Waagschalen liegen, und das wiederum ist kontextabhängig. Systematische oder prinzipienorientierte Ideallösungen sind daher unmöglich, ihre akademische Einforderung irrelevant und ihre Bezeichnung – Bundesstaat, Staatenverbund usw. – gleichgültig. Die Union übersteht keine ihrer Krisen, weil es diesen oder jenen großen Plan zur inneren Ordnung gibt (obwohl die Robustheit ihres institutionellen Gefüges und die Chuzpe ihres Gerichtshofes natürlich helfen), sondern weil sich aus der konkreten Abwägung der Problemlage politische oder ökonomische Anreize in Richtung Europäisierung ergeben.
Das weltpolitische Stühlerücken verändert den Kontext dieser Abwägung, worauf sich die Verhandlungsspiele einstellen und die Ergebnisse anders ausfallen werden als bislang. Wie so häufig werden unliebsame Reformen im Innern durch Druck von außen erleichtert. Ob der Druck ausreicht, um zu einem Umdenken politischer Identität zu führen und daran dann neugestaltete und deutlich einheitlicher ausgerichtete Politikprozesse anzuschließen, ist offen, aber aufs Ganze gesehen zweifelhaft. Die Kräfte, die Donald Trump erneut ins Weiße Haus getragen haben, existieren auch in Europa. Zudem sieht es wie eine Ironie der Geschichte aus, dass die hochmoderne europäische Integration, die die verstaubten völkerrechtlichen Mechanismen und Ideen hinter sich gelassen hat, nun durch den Einbruch atavistischer politischer Gewalt vor sich hergetrieben wird. Aber natürlich wird die Union damit zugleich auch auf ihre ursprüngliche Ratio zurückgeführt: Sie war und ist ein Friedensprojekt.
Ich werde zunächst die Doppelhelix näher erläutern, die Unterschiede im Verfassungsverständnis aufzeigen und den analytischen Rahmen strukturieren (Kapitel 1). Danach führe ich durch die Funktionsbereiche der Union (Kapitel 2: Konstitutionalisierung; Kapitel 3: Regulierung; Kapitel 4: Effektuierung) und untersuche anhand von Beispielen auf den drei Ebenen Recht, Politik und Kultur die Plotstruktur von Emanzipation, Stärkung und Ambivalenz. Dass viel davon mit Recht zu tun hat, liegt in der Natur der Sache, denn die Union besitzt als Rechtsunion nun einmal ein rechtliches Rückgrat.
KAPITEL 1
GRUNDLAGEN
I. Integrationsrecht
Es ist seit drei Jahrzehnten eine Selbstverständlichkeit, über die Organisation der europäischen Integration in verfassungsrechtlichen Begriffen und Bedeutungen nachzudenken. Dadurch tritt neben die seit langem diskutierte verfassungsrechtliche Frage, wie Staat und Europäische Union miteinander zu verschrauben sind, die Verfassung der Union als gedanklicher Raum der verfassungsrechtlichen Ergänzung und des verfassungsrechtlichen Wettbewerbs. Staatliches und europäisches Verfassungsrecht verschleifen sich heute in einer Komplexität, die sowohl juristischen Konsens als auch juristischen Widerspruch erlaubt. Die Konzeptionen reichen von einer gemeinsamen Verbundverfassung, in der staatsrechtliche und unionsrechtliche Regeln einen weitgehend homogenen Verfassungskörper formen,[1] bis hin zu einer Gegenüberstellung von staatlichem und europäischem Verfassungsrecht, in der Konflikt (insbesondere im Kompetenzbereich) selbstverständlich ist und der staatliche Letztkontrollanspruch prämiert wird.[2] Die genaue Natur der Verschleifung wirkt zurück auf den staatsrechtlichen Verfassungsraum, dessen Gestaltungsmöglichkeiten der europäischen Integration je nach Konzeption variieren. Dadurch oszilliert das Verständnis dessen, was als Verfassungsrecht der europäischen Integration gelten kann, beständig zwischen den drei Polen Staatsrecht – europäisches Verfassungsrecht – Verschraubungsdogmatik, und jeder neue verfassungsrechtlich vorgetragene Anspruch europäischer Institutionen fordert das staatliche Verfassungsrecht und die Verschraubung mit dem Recht der Europäischen Union neu heraus.
Dieses Flimmern lässt sich nicht in einfache dogmatische Konstruktionen fassen, die vorgeben, lediglich konsentierte, notwendige oder effiziente Anwendungen von Transmissions- und Kollisionsregeln zu sein. Vielmehr ist der genaue Zuschnitt abhängig von institutionellen Beziehungen, politischen Belangen, wirtschaftlichen Bedingungen und soziokulturellen Bedeutungen. All diese Faktoren sind beständig in je eigener Bewegung und verändern sich auf der Zeitschiene. Nicht nur, aber auch in dieser Dynamik liegt der zutreffende Kern der Annahme, dass die europäische Integration in all ihren Aspekten – institutionell und materiell – als Prozess zu begreifen ist, der anders als die nationalen Verfassungskonstrukte ‹noch nicht› in einen zufriedenstellend festgelegten Aggregatzustand übergegangen ist, sondern immer noch als ‹Projekt› verstanden wird.[3] Dieses Volatile, das noch immer kennzeichnend für die Integration ist, frisst sich in das nationale Integrationsverfassungsrecht weiter und führt zu einer Bestreitbarkeit von höchstrichterlichen Integrationsaussagen, die in anderen Bereichen des Staatsrechts in dieser Form nicht bekannt sind.[4]
Dogmatisch schlägt sich dies in einer Simultaneität divergierender Rechtserzählungen nieder, die andere Rechtsbereiche gleichfalls so nicht kennen. Sowohl die legitimierenden Grundlagen im Allgemeinen als auch die interpretatorischen Konsequenzen im Einzelfall sind manchmal so wenig konsentiert wie die Antwort auf die Frage der institutionellen Entscheidungszuständigkeit. Dies betrifft nicht nur die ohnehin recht polyphone Wissenschaft des Integrationsrechts, sondern auch die Praxis der nationalen Gerichte in den 27 Mitgliedstaaten und des Europäischen Gerichtshofs (EuGH). Die nationalen Gerichtsbarkeiten formen mit der Gerichtsbarkeit des EuGH eine Doppelhelix an Rechtsaussagen, die in ihrer Gesamtheit Auskunft über den eigentlichen normativen Zustand der europäischen Integration gibt.
Damit sind mehrere Dinge gesagt, institutionell und materiell. Erstens sind – institutionell – nationale Gerichtsentscheidungen nicht einfach kleine Zahnräder im Getriebe eines hierarchisch geordneten Maschinenraums unionsrechtlicher Dogmatik mit dem EuGH an der Spitze. Das innere Verhältnis von nationalen Gerichten und EuGH sieht oberflächlich aus wie eine steife Rangordnung: Es gelten materiell das Vorrangprinzip (EU-Recht ‹schlägt› nationales Recht, wenn es zu einem Konflikt kommt) und institutionell das Vorabentscheidungsverfahren (nationale Gerichte haben gemäß Artikel 267 AEUV das Recht und manchmal die Pflicht, dem EuGH Fragen zur Auslegung des Unionsrechts vorzulegen; dieses Verfahren hat der EuGH zunehmend hierarchisch ausgestaltet). Doch unter der Oberfläche handelt es sich eher um eine komplexe Verschlingung, denn «der EuGH kann sagen, was er will; die eigentliche Frage ist, warum ihm irgendjemand gehorchen würde».[5] Denkt man das Verhältnis der Gerichte vom internationalen statt vom staatlichen Recht aus, wird die Rolle nationaler Gerichte als «Lebenssaft im Betriebssystem der Union»[6] sogleich einsichtig, denn im internationalen Recht nutzen nationale Gerichte ihre Rolle häufig, um nationale Souveränität zu schützen und dadurch die Effektivität des Völkerrechts dramatisch zu mindern. Dass es im Unionsrecht, anders als im Völkerrecht, nicht zu einem Effizienzverlust – der bis zur normativen Quasi-Unverbindlichkeit des nicht-staatlichen Rechts reichen kann – kommt, zeigt den Abstand des Unionsrechts vom Völkerrecht. Er bemisst sich einerseits an den Rechtsbehauptungen des EuGH, ohne die es am Rückgrat der Unionsrechtsordnung fehlen würde. Er hat andererseits in gleichem Maße mit der Akzeptanz eines Großteils dieser Behauptungen durch die mitgliedstaatlichen Gerichte zu tun, die nicht in jeder Hinsicht rechtssicher durchgesetzt werden kann. Erleichtert (aber eben nicht erzwungen) wird diese Akzeptanz durch das Vorlageverfahren gemäß Art. 267 AEUV, das der wichtigste Kommunikationskanal zwischen nationalen Gerichten und EuGH ist. Hier stehen sich die mitgliedstaatliche und die Unionsgerichtsbarkeit zwar in unterschiedlichen Rollen gegenüber, die aber nicht identisch sind mit denjenigen von Befehlsempfänger und Befehlendem. Die Sprache von Gehorsam und Unterwerfung ist daher nur dann überzeugend, wenn man sich – begrifflich und dogmatisch eng – auf den Oberflächendiskurs der EuGH-Rechtsbehauptungen beschränkt. Unterhalb dieser Oberfläche ist auch dem EuGH deutlich bewusst, dass er in vielerlei Hinsicht auf die freiwillige Kooperation nationaler Gerichte angewiesen ist; die Sprache von unbedingter Rechtsbindung steht im Dienste der Überzeugungsarbeit, die der EuGH gegenüber den nationalen Gerichten leisten muss.
Zweitens wirkt sich diese anspruchsvolle institutionelle Verschränkung – materiell – auf den Gehalt dessen aus, was als Integrationsrecht gelten kann. Die Rolle der nationalen Gerichte kann nicht ohne Konsequenzen dafür bleiben, wie der Inhalt eines unionsrechtlichen Rechtsbefehls zu verstehen ist und wie weit er reicht. Das Recht in der Union ist nicht dasselbe wie das Recht in einem Staat, denn es handelt sich um einen hybriden Rechtsraum, in dem unterschiedliche Verfassungsschichten aneinanderstoßen und sich, mit von Fall zu Fall unterschiedlicher Kraft, Platz zu schaffen versuchen, in dem gegensätzliche politische und rechtliche Vorstellungen aufeinanderprallen und in dem starke und selbstbewusste Akteure unterschiedliche Bedeutungen in identische Worte hineinlesen. Das Recht der europäischen Integration ist nicht identisch mit den Aussagen des EuGH oder gar der Kommission zur Frage, was das Recht der europäischen Integration ist. Es ergibt sich vielmehr aus dem Gespräch der nationalen Gerichte mit dem EuGH. Die Doppelhelix dieses kontinuierlichen Rechtsgesprächs – in der sich rechtliche Positionen je nach politischem, wirtschaftlichem oder sozialem Kontext fortentwickeln, zurückziehen, anlagern, mischen oder gegeneinanderstellen – umreißt das Rechtssystem der Integration, jedenfalls soweit es um die Verschraubung des Unionsrechts mit dem nationalen Recht geht, viel genauer als ein isolierter Strang der Helix.
Diese materiellrechtliche Folgerung aus der institutionellen Konstellation zu ziehen ist nicht gleichbedeutend mit einem Freibrief für nationale Gerichte, Unionsrecht nach eigenem Gutdünken auszulegen oder zu missachten und dabei den EuGH zu ignorieren. Das Rechtsgespräch ist keine politische Verhandlung, in der je nach Lage mal dies, mal das geäußert, gefordert und festgestellt werden kann. Es ist vielmehr ein anhand von bindenden Rechtssätzen und in dogmatischen Strukturen geführtes Gespräch, das an feste Regeln gebunden ist und das selbst im kontroversesten Fall nur auf längerfristig vorbereitete und angekündigte Positionen zugreifen kann. Die Rechtsgeschichte der Integration hat gezeigt, dass Positionen, die diese Voraussetzungen nicht erfüllen, kein Beharrungsvermögen entwickeln können.[7] Teil der Regeln, an die sich nationale Gerichte halten, ist der Großteil der vom EuGH formulierten europarechtlichen Dogmatik. Hierzu gehören die institutionelle Zentralstellung des EuGH und die in Luxemburg mit eherner Verve und Kompromisslosigkeit vorgetragene Kollisionsregel des Vorrangs. Dazu gehört aber auch die Anerkennung von dogmatischen und rechtspolitischen Zielen wie der einheitlichen Anwendung des Unionsrechts in allen Mitgliedstaaten, die verhindert, dass sich einzelne Mitgliedstaaten diejenigen Regeln, denen sie zu folgen bereit sind, herauspicken und andere Regeln einfach missachten. Gerade ein so hochreguliertes Rechtsgebilde wie der Binnenmarkt – für die Union wie für die Mitgliedstaaten von zentraler Bedeutung – bedarf der einheitlichen Regelanwendung quer durch die Union, um funktionieren zu können. Dies fördert die Bereitschaft von politischen Entscheidungsträgern, Marktteilnehmern und Gerichten, den europarechtlichen Regeln zu folgen. In der Konsequenz werden offene Konflikte nur selten und eher an den Rändern der europaverfassungsrechtlichen Dogmatik ausgetragen. Die Doppelhelix ist zwar durch stete Dynamik, aber auch im Wesentlichen durch ein gutes Miteinander in fast selbstverständlicher Kooperation geprägt.
Für diejenigen, die das Recht der europäischen Integration sinnvoll beobachten möchten, bedeutet dies, dass eine jedenfalls methodisch anspruchsvolle Aufgabe auf sie wartet. Vielleicht ist sie am ehesten vergleichbar mit dem Methodenprofil der Konstellationsforschung, die auf Dieter Henrich zurückgeht und (philosophische) Konstellationen identifiziert als «dichten Zusammenhang wechselseitig aufeinander einwirkender Personen, Ideen, Theorien, Probleme oder Dokumente, in der Weise, daß nur die Analyse dieses Zusammenhangs, nicht aber seiner isolierten Bestandteile, ein Verstehen der philosophischen Leistung und Entwicklung der Personen, Ideen und Theorien möglich macht».[8] Rechtswissenschaftliche Forschung im Europarecht kann sich nicht einfach auf das unionsrechtliche (oder staatsrechtliche) dogmatische Geflecht beschränken, sondern muss diesen Zusammenhang selbst ins Zentrum stellen, auch wenn dies aufwändiger ist. Es ist erstens bereits nicht ganz einfach, den Überblick über die Entwicklungen der Unionsrechtsordnung mit ihren komplexen Prozessen auf den politischen, gesetzgeberischen und rechtsprechenden Ebenen zu behalten. Zweitens sind die politischen und rechtlichen Reaktionen der Akteure des eigenen Mitgliedstaates häufig subtil statt offenkundig. Drittens bedarf es auch eines immerhin annähernden Überblicks über die anderen Mitgliedstaaten, um sich ein Bild vom Zustand der rechtlichen Rezeptionsschleife machen zu können,[9] was zu einer Renaissance der Rechts- und Verfassungsvergleichung geführt hat.[10] Damit sind unionsrechtliche, verfassungs- und verwaltungsrechtliche und vertiefte rechtsvergleichende Kenntnisse angesprochen. Da sich die Dynamik der Prozesse zu einem guten Teil aus den politischen und wirtschaftlichen Kontexten ergibt und diese sogar Einfluss auf das juristische Ergebnis haben, ist viertens auch eine an den Politik- und Wirtschaftswissenschaften geschulte Kontextsensibilität von Vorteil. Die neuere historische (und politikwissenschaftliche) Forschung gibt fünftens Auskunft über die handelnden Personen, ihre Ideen, Sozietäten und epistemischen Kulturen[11] und stellt dadurch den juristischen Erzählungen, die allzu oft von scheinbaren Alternativlosigkeiten umspielt werden, andere gedankliche Räume zur Seite. Diese Räume thematisieren intellektuelle und soziale Konfigurationen, leiten von der Notwendigkeit zur (manchmal kontingenten) Möglichkeit über und spannen damit ein Forschungsfeld auf, das nicht nur den wissenschaftlichen Spuren unterschiedlicher Personen und Richtungen genauer folgen, sondern zudem die Anlässe, Motive, Gründe und Kraftfelder genauer in den Blick nehmen kann. Dadurch kann ein solches Forschungsprogramm dem durch zu enge Dogmatik induzierten Determinismus des Regelmäßigen, der Linearität oder der Geschichtsteleologie entkommen und eine echte – und interessante – Plotstruktur der Alternativität und Varianz entwerfen.
Dies erzeugt eine juristische Doppelbödigkeit bei der Lektüre von Integrationsrecht, insbesondere im Verständnis von Entscheidungen des EuGH. Einerseits arbeiten diese, ebenso wie nationale Gerichtsentscheidungen, die Abstraktionshöhe des Primär- und Sekundärrechts auf der Ebene des Einzelfalles klein und verdichten das dogmatische Geflecht des Unionsrechts. Die juristische Ausbildung bereitet auf die Analyse dieser Bedeutungsebene ausgezeichnet vor. Andererseits stellen Urteile des EuGH Botschaften an nationale Akteure, insbesondere an die mitgliedstaatlichen Gerichte, dar, die sich nicht nur auf den Einzelfall oder die dogmatische Frage beziehen.[12] Kommuniziert werden institutionelle Machtsignale, Beschwichtigungen im Kompetenzstreit, Warnungen im Hinblick auf Rechtsprechungslinien oder Beharrungen in rechtspolitischen Angelegenheiten. Nichts davon muss mit dem konkreten Rechtsstreit oder dessen Beteiligten zu tun haben. Von einer Vorabentscheidung über eine portugiesische Vorlage können Signale an die polnische Regierung gegen den Rückbau der Rechtsstaatlichkeit ausgehen;[13] mit einem Urteil, das die Vorlage des italienischen Staatsrates beantwortet, können Botschaften an das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) und die Bundesregierung gesandt werden.[14] Die Lektüre eines EuGH-Urteils vollzieht sich daher anders als diejenige eines Amtsgerichtsurteils; sie berücksichtigt beide Sinndimensionen. Erstere liegt auf der Hand und kann mithilfe des normalen juristischen Handwerkszeugs ohne weiteres analysiert werden. Letztere wird vom EuGH, der als Gericht streitgegenstandsbezogen und methodentreu vorgehen und üblicherweise Abstand halten muss von der offenen Thematisierung institutioneller Machtbeziehungen, weniger deutlich kommuniziert und bedarf daher auch bei den Rezipienten der Entscheidung größerer Aufmerksamkeit, Sensibilität und Kreativität.
Es wäre nicht angemessen, nur die erste Dimension als genuin juristische Bedeutungsebene zu begreifen und die zweite Dimension etwa als politisch abzuqualifizieren, als nachrangig zu erachten oder gar aus dem engeren rechtswissenschaftlichen Analysehorizont auszugliedern. Dem EuGH obliegt gemäß Art. 19 Abs. 1 S. 2 EUV die Aufgabe, die «Wahrung des Rechts» bei der Auslegung und Anwendung der Verträge zu sichern. Dies ist ohne die freiwillige Kooperation der nationalen Gerichte unmöglich, da es diese sind, die proaktiv die Mitwirkung des EuGH an der dogmatischen Durchformung des Rechts überhaupt erst durch ihre Vorlagetätigkeit ermöglichen und sie dann reaktiv rezipieren und umsetzen wollen müssen. Die Kommunikation zwischen dem EuGH und nationalen Gerichten, die sich als Subtext insbesondere in den Entscheidungen des EuGH (und auf mitgliedstaatlicher Ebene in den Entscheidungen der Höchst-, vor allem der Verfassungsgerichte) findet, ist genuin juristischer Teil der Arbeit des EuGH. Entsprechend muss sich auch die Europarechtswissenschaft einstellen. Ein interdisziplinäres wissenschaftliches Programm ist das freilich nicht, sondern lediglich eine kontextsensible Erweiterung des juristischen Methodenkanons, der nicht bei der Anwendung der nationalen Methoden stehenbleiben kann.[15]
II. Integrationsverfassung
Die rechtliche Doppelhelix des Integrationsrechts legt nahe, dass die Verfassung der europäischen Integration ebenfalls als Doppelhelix zu begreifen ist, in der sich nationale und europäische Verfassungsnormen und -prozesse einander anlagern, ergänzen, modifizieren und – manchmal stabil, manchmal volatil – zu einer verbundverfassungsrechtlichen Einheit eigener Art entwickeln. Insbesondere der Begriff einer Verfassung als «Verbund», der aus der politikwissenschaftlichen Multilevel Governance-Forschung ins Juristische importiert wurde und dabei an analytischer Schärfe eingebüßt hat,[16] suggeriert eine Verschlingung mehrerer Verfassungsebenen, die zumindest gleichwertig erscheinen oder bei denen sogar – im Einklang mit der Kollisionsrechtsprechung des EuGH – der europäischen Verfassungsebene die Leitfunktion zuerkannt wird. Ob dies tatsächlich der Fall ist, ist eine offene Frage.
Dass die Unionsrechtsebene überhaupt – inzwischen allgemein akzeptiert[17] – als Verfassungsebene konzipiert wird, ist keine Selbstverständlichkeit. Die Tatsache allein, dass ein von allen verwendetes Vokabular zur Umschreibung der Integration vorliegt und die Gründung und nachfolgende Entwicklung der Union als Geschichte einer allmählichen Konstitutionalisierung gelesen wird, ist nicht gleichbedeutend mit einem Konsens darüber, was darunter genau zu verstehen ist und was daraus folgt. Verfassungselemente des Unionsrechts – insbesondere die unmittelbare Anwendbarkeit und der Vorrang des Unionsrechts, das geschlossene und effiziente europäische Rechtsschutzsystem und die jedenfalls zum Teil robuste europäische Grundrechtsschicht – geben einerseits Anlass, ganz selbstverständlich mit dem Verfassungsbegriff zu operieren, hinterlassen aber andererseits zugleich den Eindruck einer «Verfassungsordnung light» oder eines «‹Als-Ob›-Konstitutionalismus».[18] Dieser nicht immer randscharf zu artikulierende Anschein eines Mangels dürfte auch dazu beigetragen haben, dass der Vertrag über eine Verfassung für Europa, der sich eines ostentativ konstitutionalisierenden Vokabulars bediente, bei der Bevölkerung der wichtigen Gründungsstaaten Frankreich und den Niederlanden 2005 durchfiel und nur als Reformvertrag unter Aufgabe der Verfassungsrhetorik gerettet werden konnte.
Diese Ambivalenz des europäischen Verfassungsbegriffs, der ubiquitär ist und zugleich irgendwie verkürzt erscheint, stellt die Frage nach der Validität der Schablone, die das aus dem geschichtlichen Erfahrungszusammenhang des Staates entliehene Verfassungskonzept für die europäische Integration besitzt.[19] Dass diese Schablone schon frühzeitig benutzt wurde, ist weder Überraschung noch intellektuelle Schwäche, denn unbekannte Objekte werden zunächst durch Schemata beschrieben, die den Referierenden schon bekannt sind.[20] Doch ist die Sprache eines jahrhundertealten, geschichtsbeladenen Begriffs aus dem staatlichen Raum wirklich eine glückliche Wahl im Hinblick auf ihre Verwendung für ein volatiles, keineswegs festgefügtes überstaatliches Integrationsprojekt?
Die staatliche Verfassungstradition prägt die Art und Weise, wie über Konstitutionalismus nachgedacht wird, sowohl was die Form (etwa Gewaltengliederung) als auch was den Inhalt (etwa Rechtsstaatlichkeit und Grundrechtsschutz) angeht. Sie gibt Orientierung bei der Anerkennung von Verfassungsrecht (wie im Fall der Union) oder bei der Nichtanerkennung (wie im Fall des Völkerrechts). Für die europäische Integration zieht dies gemischte Konsequenzen nach sich.
Einerseits erlaubt die staatliche Verfassungsschablone, die Union als eigenständiges Gemeinwesen mit dem staatlichen Bereich entliehenen und für die eigenen Umstände und Bedürfnisse adaptierten Verfassungsinhalten und -dogmatiken zu begreifen. Ein guter Teil dieser Inhalte und Dogmatiken ist gemeinwesenneutral und gleicht daher den staatlichen Strukturen. Dementsprechend finden sich im Unionsrecht die unmittelbare Anwendbarkeit und, wie es sich für Verfassungsrecht gehört, der Vorrang als zentrale Bausteine. Auch das umfassende und effektive System des Rechtsschutzes und der Rechtsdurchsetzung sowie ein recht weit entwickelter Grundrechtsschutz gehören zu diesen staatsähnlichen Strukturen. In ihrer Gesamtheit rechtfertigen sie eine Erzählung, nach der sich die Unionsrechtsordnung von einem Vertragsregime, das souveräne Staaten untereinander band, zu einem Verfassungsregime weiterentwickelt hat, das innerhalb seines Anwendungsbereiches juristische Personen und Individuen mit gerichtlich durchsetzbaren Rechten und Pflichten ausstattet und sich daher im Bereich des Konstitutionalismus bewegt.
Andererseits stellt die staatliche Verfassungsschablone eine Herausforderung für die europäische Integration dar. Konstitutionalismus ist nur zu einem Teil gemeinwesenneutral; in vielerlei Hinsicht ist er spezifisch auf das Gemeinwesen, das er organisiert, zugeschnitten und abgestimmt. Individualrechte etwa werden zwar häufig menschenrechtlich konzipiert und universell formuliert; gleichwohl sind sie trotz ihrer universellen Formulierung abhängig von der Geschichte und der kollektiven Erfahrung einer ganz bestimmten politischen Gemeinschaft. Universelle Ambition und spezifische Pfadabhängigkeit stehen in Verfassungen Seite an Seite; selbst wenn man in Prinzipien und Funktionen denkt und Platon oder Hobbes diskutiert, kommt es auf die Anwendung auf dieses spezifische Gemeinwesen an.[21] Diese Spezifität, oder Geschichtlichkeit, von Verfassungsnormen schafft und speichert tiefe Traditionen und Selbstverständnisse politischer Gemeinschaften und versieht die Verfassungsnorm mit einer eigenen Authentizität, die einen symbolischen und letztlich normativen Überschuss erzeugt.[22] An diesem Punkt unterscheidet sich daher – trotz seiner Familienähnlichkeit und mancher übereinstimmender Eigenschaften – der Unions-Konstitutionalismus von demjenigen der europäischen Staaten. Die staatliche Verfassungsschablone verarbeitet diese Unterschiede zunächst als Mangelerzählung, die sich vornehmlich aus dem Umstand speist, dass die Union nun einmal kein Staat ist und daher einige Elemente staatlichen Verfassungsdenkens vermissen lässt.
Die erste Leerstelle ist rechtlicher Natur und kann als Mangel an souveräner Entscheidungsmacht zusammengefasst werden. Staaten verstehen sich als oberste Ordnungsgewalt eines Gemeinwesens, die sich weder inneren noch äußeren Gewalten zu beugen hat. Die Europäische Union besitzt diese Form exklusiver Letztentscheidungsmacht nicht, sondern ist an einen begrenzten Bereich von staatlich übertragenen Zuständigkeiten und an von außen aufgegebene Regeln zu deren Ausübung gebunden. Die Mitgliedstaaten halten – trotz einiger Auflösungserscheinungen – eifersüchtig an ihrem Status als «Herren der Verträge» fest.[23] Die Tatsache, dass sich der Radius der Unionskompetenzen beständig erweitert, sowohl durch neue Übertragungen seitens der Mitgliedstaaten als auch durch schleichende Kompetenzverlagerungen aufgrund von muskulösen Interpretationen und Ausübungen der bereits existierenden Kompetenzen seitens der Unionsinstitutionen, ändert nicht die jedenfalls grundsätzlich gebundene und durch souveräne Übertragungsakte definierte Entscheidungszuständigkeit der Union.
Die zweite Leerstelle ist politischer Natur und besteht darin, dass die Union nicht über einen auf das Volk verweisenden pouvoir constituant verfügt. Man könnte diesen Zusammenhang als den Mangel originärer Ableitung von Entscheidungsgewalt zusammenfassen. Dies ist kein Repräsentationsmangel in dem Sinne, wie ihn etwa das BVerfG dem Europäischen Parlament vorwirft. Es ist auch keine Umformulierung der These, dass die Union bereits deshalb demokratisch defizitär sein müsse, weil ihr ein demos fehle. Weder geht es um die Mechanik von Repräsentation noch um soziologische Integrationstheorie, es geht nicht einmal um historische Faktizität. Vielmehr geht es um politische Imagination, die in der staatlichen Blaupause dessen, was zur Verfassung gehört, derart zentral ist, dass ihr Fehlen in der EU grundlegende Legitimationsschwierigkeiten aufwirft.[24] Im Staat steuert die soziale Imagination, der Volkssouverän habe mit der Verfassung den Staat in seine Existenz gesprochen, ein wirkungsmächtiges Legitimationsnarrativ, das Bürger und Staat in eine Wechselbeziehung setzt und die politische Seite der rechtlichen Souveränität darstellt.[25] Die Europäische Union kennt keine solche Imagination, auch wenn zunehmend von der Souveränität Europas die Rede ist.[26] Die Integration basiert auf einem von souveränen Staaten abgeschlossenen völkerrechtlichen Vertrag und die fortschreitende Konstitutionalisierung der Verträge hat – trotz ihrer Suche nach dem genuin Politischen von gesellschaftlicher Integration – diese Lücke nicht füllen können.[27]
Die dritte Leerstelle schließlich ist soziokultureller Natur und bezieht sich auf prekäre politische Identität. Zugehörigkeit zum Staat wird rechtlich durch Staatsbürgerschaft vermittelt, doch geht sie nicht im Rechtlichen – in den Rechten und Pflichten von Bürgern – auf. Sie stellt darüber hinaus eine Austauschbeziehung her, indem der Staat durch die Loyalität seiner Bürger überhaupt erst historische Präsenz erlangt, der Bürger umgekehrt nicht nur Schutz und Fürsorge, sondern vor allem eine ‹imaginative Heimat› erhält. Mit politischer Identität liest man die Geschichte des Staates als Geschichte des Volkssouveräns, zu dem man selbst gehört, und damit als eigene. Vergangenheit, Zukunft und Raum des Staates werden zu kollektiven und dann individuellen Vorstellungshorizonten. Hierin liegt nicht nur eine starke Legitimationserzählung, sondern auch ein großes metaphysisches Versprechen. Die Union kann ein solches Versprechen nicht machen. Anders als Staaten gelingt es ihr nicht, individuellen Identitäten den Stempel kollektiver Identität aufzudrücken. Europäische politische Identität ist trotz der Behauptung des EuGH, die Unionsbürgerschaft sei der «grundlegende Status» der europäischen Bürger,[28] höchstens in Ansätzen und zumeist anlassbezogen vorhanden.[29] Die rechtliche Zentralstellung der Bürger (die in der Konstitutionalisierungserzählung eine so herausragende Rolle spielt, weil die Bürger Unionsrecht unmittelbar vor ihren nationalen Gerichten einklagen und dadurch ihre Mitgliedstaaten zum europarechtlichen Rechtsgehorsam zwingen können) hat kein gleich starkes politisches Gegenüber: Politisch genießen die Bürger lediglich eine Randstellung. Möglicherweise hängt dies auch mit dem wechselseitig instrumentellen Verhältnis von Union und Bürger zusammen.[30] Die politische Heimat der Bürger jedenfalls ist nach wie vor der Staat, nicht die Union. Zusammengefasst sehen die drei Leerstellen der Union also wie folgt aus:
Recht
Mangel an souveräner Letztentscheidung
Politik
Mangel an originärer Ableitung von Entscheidungsgewalt (pouvoir constituant) (pouvoir constituant)
Kultur
Mangel an politischer Identität
Die Union besitzt keine dieser klassischen Eigenschaften, die alle mit der geisteswissenschaftlichen Kategorie der Souveränität zusammenhängen[31] und die über deren gesellschaftliche Erfahrung dem Staat zugeschlagen sind.[32] Sie muss neben und in Beziehung zu den Staaten existieren, die diese Eigenschaften – rechtlich letzte Entscheidungsmacht, politisch originäre Herrschaftsableitung und soziokulturell dominierende Kollektividentität – für sich selbst reklamieren. Der durch staatliche Erfahrung geprägte Verfassungsbegriff lässt die Union daher als minderes Verfassungswesen erscheinen, das sich durch Defizite und funktionale Äquivalente für das ‹eigentlich› Verfassungsförmige auszeichnet.
Freilich ist das nur ein Teil der Geschichte. Die staatliche Verfassungsschablone ist jedenfalls im Hinblick auf die europäische Integration zwar nicht entwertet oder relativiert, aber eröffnet doch insofern einen neuen gedanklichen Raum, als sich der Blick nicht nur auf die staatliche Schablone, sondern auch auf eine Form jenseits dieser Schablone richten kann. Hierin liegt der wahre Kern einer (ansonsten eher Denkfaulheit kommunizierenden) sui generis-Behauptung. Der Integrationsverfassungsbegriff muss nicht notwendigerweise ein Raum der Abwesenheit und Defizienz sein, sondern kann auch alternative Visionen und neue politische Bedeutungen bereitstellen und insofern ein echter Möglichkeitsraum sein.
Es ist wichtig, diesen Raum nicht nur politisch zu füllen, sondern auch juristisch ernst zu nehmen. Dadurch sind jedenfalls zwei rechtswissenschaftliche Haltungen ausgeschlossen. Zum einen reicht es nicht aus, die staatliche Folie als Plotstruktur des Mangels zu benutzen und beständig die Defizite zum Maßstab der Beurteilung zu machen, etwa im Bereich der demokratischen Legitimation.[33] Zum anderen reicht es umgekehrt nicht aus, die staatliche Folie einfach auf die Integration zu projizieren, dadurch die Unterschiede jedenfalls weitgehend zu invisibilisieren und eine einfache, aus der staatsrechtlichen Schablone bekannte Hierarchie für das Unionsrecht nutzbar zu machen, die in dogmatischer Engführung der Kollisionsrechtsprechung des EuGH einfach Rechtsbefehle zu erkennen meint, Gehorsam einfordert und hartnäckige Widersprüche aus dem Kreis der Mitgliedstaaten als europarechtliche Verfallsgeschichte im Angesicht nationalstaatlicher Restauration formuliert.[34] Stattdessen müsste ernst genommen werden, dass sich die Union zu anderen Gemeinwesen anders verhält als Staaten. Sie ist kein voll souveränes Gegenüber mit eigenem Territorium, sondern besetzt den Raum, an dem sich die Mitgliedstaaten berühren. Neil Walker hat hierfür den treffenden Begriff des beengt-gedrängten Raumes (crowded space) mit sich überlappenden Grenzen gefunden.[35] Dieser Raum wird von Union und Mitgliedstaaten gleichermaßen bevölkert, und hier zeigen sich sowohl die Fehlstellen als auch die Möglichkeitsräume des europa- oder integrationsrechtlichen Konstitutionalismus.
Erstens ist der politische Horizont der Union enger und flacher als derjenige des Staates. Souveräne Letztentscheidungsmacht, originäre Herrschaftsableitung und dominante Kollektividentität sind Bausteine eines staatlichen Selbstverständnisses, das Zuständigkeitsgrenzen nur als selbstgesetzt akzeptiert und innerhalb dieser Grenzen sowohl umfassende Regulierungsgewalt als auch primäre Identitätsreferenz für sich in Anspruch nimmt. Die Union hat deutlich engere und gerade nicht selbstgesetzte Zuständigkeitsgrenzen, übt innerhalb dieser Grenzen keine umfassende Regulierungsmacht aus und muss sich auf allenfalls ergänzende Kollektividentität beschränken. Sie besitzt dadurch den Status eines rechtlich partiellen, politisch zusätzlichen und kulturell sekundären Gemeinwesens. Will man Konstitutionalismus nicht auf eine einzige Schablone begrenzen, sondern ihn als Skala lesen, kann man formulieren, dass die Union am deutlich dünneren Ende angesiedelt ist, während die Mitgliedstaaten sich noch immer am dichten Ende der Konstitutionalismus-Skala befinden.
Zweitens ist der von Union und Mitgliedstaaten dicht besiedelte Raum seiner Form nach durch zwei Mechanismen geprägt, die sich aus der Natur dieses crowded space ergeben. Einerseits führen die Überlappungen und Bruchlinien zu der Notwendigkeit der Brückenbildung, der Kooperation, der Kollaboration und der gegenseitigen Ergänzung von Politiken und Prozessen, die sich im Verfassungscharakter der Union als Koordinierungs- und Ergänzungsmechanismus zeigt. Andererseits bedrängen sich im crowded space unterschiedliche Verfassungsschichten gegenseitig. Staaten bringen hierfür rechtlich ihren souveränen Anspruch auf umfassende exklusive Letztentscheidung und politisch ihre durch originäre Ableitung von Herrschaftsgewalt deutlich überlegene Legitimation ins Spiel. Die Union trägt indessen rechtlich das Argument der übertragenen Letztentscheidung und politisch die funktionale Notwendigkeit der Koordinierung durch Brückenbildung vor, die häufig nur durch effektiv durchgesetzte Einheitlichkeit erreichbar erscheint. Überlappungen führen hier zu einem Wettbewerb der Zuständigkeiten und Durchsetzungsmacht, welcher in einem Spannungsverhältnis zum kollaborativen Grundverhältnis steht.
Drittens hat die Logik des crowded space, die zu einer gegenseitigen Durchdringung der jeweiligen Gemeinwesen führt, auch Auswirkungen – vielleicht die stärksten – auf die innere Komposition des Unions-Konstitutionalismus. Am deutlichsten zeigt sich dies an den institutionellen Bausteinen der Union. Während bei Staaten nicht nur die normativen, sondern auch die institutionellen Elemente und deren Beziehungen zueinander zu einem einzigen Gemeinwesen beitragen oder dahingehend aufgelöst werden (selbst wenn die inneren Referenzpunkte in politischer, ethnischer, religiöser oder funktionaler Hinsicht Differenz markieren), ist das institutionelle Wesen der Union das eines ‹hybriden› Gemeinwesens, in dem die einzelnen Institutionen den ‹gemischten›, ‹verbundenen›, ‹kombinierten›, ‹zusammengesetzten› Charakter des Gesamten widerspiegeln, ihre Wurzeln in den Quellen unterschiedlicher Gemeinwesen tragen und auch funktional deren Logik und Interessen zumindest mitverfolgen. Es bleibt freilich nicht beim Institutionellen, sondern das Zusammengesetzte und dadurch häufig Hybridisierte der Union greift sogleich auf das Prozedurale und das Materielle aus. Dadurch kann und will die Union nicht ihre politische, rechtliche und kulturell-soziale Repräsentation in der Einheit des Gemeinwesens finden, sondern muss das – staatlicher Repräsentationserfahrung innewohnende – Denken in Einheiten wie ein Prisma aufspalten.[36] Die institutionelle, prozedurale und materielle Struktur der Union spiegelt insoweit die mehrbödige und undeutliche Natur des Gegenstands Europa wider, in Bezug auf den territoriale und zeitliche Grenzmarkierungen zwischen den vielen unterschiedlichen Erzählungen und sozialen Konstruktionen schemenhaft werden. Man kann dies positiv wenden und von einem Wald von Ideen, Symbolen und Mythen sprechen, der die Vielfalt von Bedeutungen reflektiert, statt die Herzen der Menschen um ein einziges Thema herum zu versammeln;[37] dann fokussiert man auf das der Integration einzigartige Potential der Überwindung staatlicher Imaginationen und Hypertrophien. Man kann auch die Verunsicherung thematisieren, die mit Bedeutungsverschiebungen einhergeht und eine Liquidität von Inhalt, Form und Methode der Integration hervorbringt, welche wiederum nicht selten als Verlust von sicherem Wissen oder, schlimmer, Authentizität der neuen Ordnung verstanden wird.[38]
Viertens zeichnet sich Unions-Konstitutionalismus durch eine – nun bereits seit Jahrzehnten andauernde – zeitliche Besonderheit aus. Anders als staatliche Verfassungsräume, die regelmäßig den Eindruck einer fertigen, konsolidierten, sedimentierten und sich nun nur noch adaptierenden Ordnung machen, zeigt sich der Unions-Verfassungsraum als einer, der immer noch im Bau statt in einer vollständig fertiggestellten Form realisiert ist. Dieses Volatile des ‹Noch-Nicht› führt zu einem flimmernden Schwebezustand der Verfassungsförmigkeit der europäischen Integration, der mehrere Konsequenzen nach sich zieht. Zum einen entzieht sich der Unions-Verfassungsraum dadurch der staatlichen Schablone. Wenn irgendwo besonders deutlich ist, dass der nationale Verfassungsbegriff nur beschränkt auf die Integration passt, dann an dieser Stelle. Anders als die Reife des staatlichen Konstitutionalismus transportiert die Unabgeschlossenheit des europäischen Konstitutionalismus nicht nur einen offenen Ausgang, sondern auch eine Unbestimmtheit, die die normative Struktur nicht unbeeinflusst lässt. Zum anderen verleiht diese normative Unbestimmtheit – die in einem kuriosen Gegensatz zur Redseligkeit der politischen Verlautbarungen und der vertraglichen Bestimmungen über Wesen, Werte und Ziele der Union steht (Art. 1 ff. EUV) – der Union den Charakter einer Projektionsfläche, auf der mühelos unterschiedliche, gar widersprüchliche Wesens- und Finalitätsvorstellungen abgebildet werden können.[39]
Diese Verfassungseigenschaften der Union, die große juristische Spielräume zur Verfügung stellen, provozieren aus der Sicht des längst gesettelten staatlichen Verfassungskonstrukts einen schwer zu stillenden Kontrollhunger. Der manchmal fast zwanghaft erscheinende Drang mitgliedstaatlicher Gerichte, Vertrauen zu verweigern oder jedenfalls Kontrolle besser als Vertrauen zu finden, ergibt sich quasi organisch aus dem ‹dichteren› Konstitutionalismus der Mitgliedstaaten, der den ‹dünneren› Konstitutionalismus der Union einhegen will und dafür auch keine schlechten Argumente hat. Er ergibt sich auch aus dem dicht besiedelten normativen Raum zwischen den Mitgliedstaaten, der sich in der alltäglichen Praxis von Union und Mitgliedstaaten zwar als ganz überwiegend kollaborativ zeigt, aber auch regelmäßig das Kompetitive an die Oberfläche steigen lässt. Ein guter Teil dieses Wettbewerbs schlägt sich als Kompetenzkonflikt bei Anwendung und Reichweite von Normen nieder. Inhaltlich entzündet sich das Misstrauen nationaler Kontrollinstanzen nicht selten an der flimmernden Unbestimmtheit einzelner Bausteine des europäischen Konstitutionalismus, der zwischen den 27 mitunter stark voneinander abweichenden Performanz- und Finalitätserwartungen der Mitgliedstaaten einerseits und der mit Bestimmungs- und Durchsetzungsanspruch einhergehenden Determinierung durch die Union andererseits oszilliert. Auch und gerade dieser methodisch und prozedural nicht immer leicht in nationale canones einpassbare Vorgang löst Misstrauen und Widerspruch aus. Ein wichtiges Einfallstor für die Kontrolle ist die Verbundnatur der Integration: Indem die Union auf Prozesse und Institutionen der Mitgliedstaaten zugreift, insbesondere um ihr Recht zu vollziehen, eröffnet sie den Mitgliedstaaten nicht selten den Kontrollzugriff auf ihre eigenen Akteure; da diese Unionsrecht vollziehen, können Staaten dieses dadurch indirekt zu kontrollieren versuchen.
Die Kontrolle kleidet sich regelmäßig in den rechtlichen Anspruch, eine Verstaatlichung der Union ebenso verhindern zu wollen wie eine Entstaatlichung des eigenen Mitgliedstaates. Beide Seiten werden abgesucht im Hinblick auf ihr demokratisches und legitimatorisches Niveau. Die staatliche Seite muss sich befragen lassen, ob sie noch ausreichenden Raum zur politischen Gestaltung der wirtschaftlichen, kulturellen und sozialen Lebensverhältnisse besitzt und ob der staatliche Parlamentarismus seiner Verantwortung bei der Ausgestaltung der Integration noch hinreichend gerecht werden kann. Die unionsrechtliche Seite muss sich befragen lassen, ob die Union dort, wo sie autonom handeln darf, ihrerseits demokratischen Grundsätzen folgt und ein ihrer Herrschaftsmacht angemessenes demokratisches Legitimationsniveau besitzt. Im Grundsatz ist das einleuchtend, führt aber zu einem juristischen double bind, in dem die staatliche Kontrollinstanz fast alle Steuerungsfähigkeit verliert. Einerseits darf das demokratische Legitimationsniveau der Union ein bestimmtes Niveau nicht unterschreiten (weil sonst ihre Herrschaftsausübung illegitim wäre), andererseits aber auch nicht überschreiten (weil sonst ein staatsähnlicher Charakter erreicht wäre, der den Mitgliedstaat entstaatlichen könnte). Die Folge dieses double bind ist die Schrumpfung eines demokratischen Möglichkeitsraumes auf einen Schnappschuss der Gegenwart. Besonders eindrücklich zu studieren war dies im Lissabon-Urteil,[40] in dem das BVerfG eine scheinbar differenzierte Staatsaufgabenlehre als Stoppschild-Blaupause für die Zukunft verfassen wollte, diese aber am damals aktuellen Stand der Integration orientieren musste und damit in die Kontingenzfalle tappte, welche den Schnappschuss schnell dem Vergessen anheimgab.[41]
Beide Stränge der integrationsverfassungsrechtlichen Doppelhelix bleiben damit unbefriedigend. Unionsrechtlich ist allen Akteuren klar, dass eine Vergemeinschaftung oberhalb einer internationalen Organisation, aber unterhalb eines Staates zu Einbußen in Repräsentation, Demokratie und möglicherweise auch individuellem Rechtsschutz führt. Die staatliche Schablone passt daher weder inhaltlich noch institutionell, doch bleibt sie wirkungsmächtig, weil sie die Beobachter in die Lage versetzt zu sagen, was substantiell und formell akzeptabel ist und was nicht. Das der Integration Eigene, das ‹sui generis›, darf – auch da sind sich Europa- und Staatsrechtler einig – nicht dazu führen, dass bestimmte Standards der demokratischen und rechtlichen Selbstbestimmung unterschritten werden. Funktionale Notwendigkeiten wie etwa die größtmögliche einheitliche Anwendbarkeit von Unionsrecht oder das Prinzip des gegenseitigen Vertrauens aber führen ebenso wie unkontrollierte Kompetenzerweiterungen immer wieder zu Schräglagen und Querständen, die einen schalen Geschmack hinterlassen: Die staatliche Kontrolle hilft nicht gegen die staatsrechtliche Unbehaustheit, denn ihre Korrekturmöglichkeiten sind beschränkt.
Das liegt zum einen daran, dass deutsche Kontrollinstanzen nur 1/27 des mitgliedstaatlichen Helixstrangs ausmachen und dadurch auch staatlich anerkannte wichtige Funktionen des Unionsrechts – wie die einheitliche Anwendbarkeit des europäischen Rechts, die gerade für Deutschland als größten Marktteilnehmer von erheblicher Bedeutung ist – aushebeln würden. Zum anderen verrutscht die eigene mitgliedstaatliche Verfassungsmatrix unter dem Einfluss der europäischen Integration. Es stehen sich ja nicht Union und Mitgliedstaat als zwei voneinander unabhängige Einheiten gegenüber, sondern das Besondere des EU-Konstitutionalismus ergibt sich schließlich gerade aus seiner Eigenschaft als partiell, akzessorisch, ergänzend, zusammengesetzt, hybrid, unbestimmt und umstritten. Wie in der Konstellationsforschung ist es der Zusammenhang, der den Schlüssel zum Verstehen darstellt, nicht der einzelne Teil. Dieser Zusammenhang wird durch institutionelle und prozedurale Konfigurationen technisch operationalisiert und führt dazu, dass sich auch im nationalen Verfassungsrecht die Schablonen verändern, die Gewichte verschieben und die Bewertungen wandeln. Beispielsweise stärken supranationale Entscheidungsstrukturen innerstaatlich die Exekutive und schwächen die Legislative; eine supranationale Judikative verändert das spezifische Gewicht der nationalen Rechtsprechung und das Verhältnis zwischen unterinstanzlichen und Letztgerichten; die Umsetzung supranationaler Entscheidungen lässt die nationale Verwaltung, die sich als Dienerin zweier Herren wiederfindet, nicht unberührt. Der Staat selbst und mit ihm das Staatsrecht wandeln sich und handeln sich dadurch, dass sie prozedural und institutionell von der Union in Dienst genommen werden, einen Teil von deren Unabgeschlossenheit ein. Positiv kann man das als dynamisches Aufbrechen von verkrusteten Strukturen durch ein grenzübergreifendes demokratisches Experimentierfeld beschreiben, aber negativ sickert dadurch auch die Unbestimmtheit und das Bestreitungspotenzial von EU-Konstitutionalismus in den staatsrechtlich definierten Konstitutionalismus ein.
Noch gar nicht mit eingerechnet in diese nationalverfassungsrechtliche Verunsicherung ist der reale Verlust an nationaler Regulierungs- und Entscheidungsautonomie, der mitunter die Politik und das Politische auseinandertreten lässt und zu einem staatsrechtlichen Leerlauf führt, in der zwar die ‹eigentlich› demokratischen Prozesse vor einem dichten, mit politischer Identität unterlegten Konstitutionalismus ablaufen, die ‹eigentlichen› Entscheidungen aber an ganz anderer Stelle getroffen werden, obwohl dort der Konstitutionalismus deutlich dünner und die demokratische Legitimation prekärer ist.