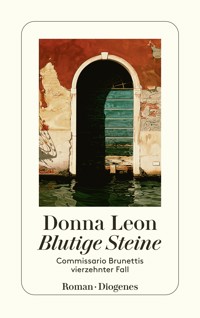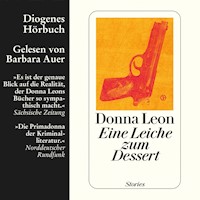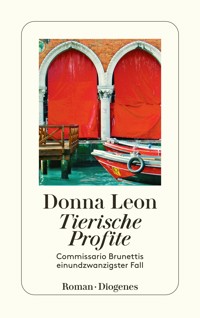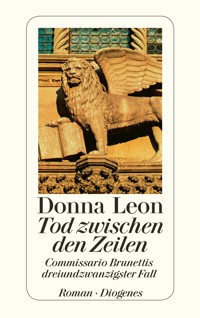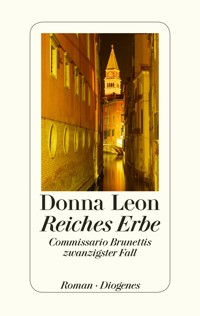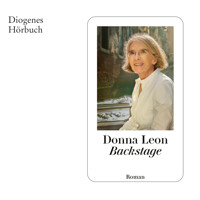10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Commissario Brunetti
- Sprache: Deutsch
Ein Fall, der Brunetti näher geht als jeder andere: der vermeintliche Selbstmord eines Jugendlichen, so alt wie sein eigener Sohn. Ein Fall auch, der in eine unheimliche Welt führt: hinter die verschlossenen Tore der Kadettenschule von San Martino.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 330
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Donna Leon
Verschwiegene Kanäle
Commissario Brunettis zwölfter Fall
Roman Aus dem Amerikanischen von
Titel des Originals:
›Uniform Justice‹
Die deutsche Erstausgabe
erschien 2004 im Diogenes Verlag
Das Motto aus: Mozart, Così fan tutte,
in der Übersetzung von Hermann Levi,
Breitkopf und Härtel, Leipzig 1898
Umschlagfoto von Fulvio Roiter
(Ausschnitt)
Copyright © Fulvio Roiter
Für Hedi und Agustí Janés
All rights reserved
Alle Rechte vorbehalten
Copyright © 2015
Diogenes Verlag AG Zürich
www.diogenes.ch
ISBN Buchausgabe 978 3 257 23523 4 (2. Auflage)
ISBN E-Book 978 3 257 60074 2
Die grauen Zahlen im Text entsprechen den Seitenzahlen der im Impressum genannten Buchausgabe.
In uomini, in soldati Sperare fedeltà?
Bei Männervolk, bei Soldaten
[7] 1
Durst weckte ihn. Nicht der gesunde Durst, der sich nach drei Runden Tennis oder einem Tag auf der Skipiste allmählich einstellt, sondern jener unbarmherzige, quälende Brand infolge übermäßigen Alkoholkonsums, wenn der Körper dringend nach Flüssigkeitsausgleich verlangt. Er lag wach im Bett, verschwitzt, in klebrig feuchter Unterwäsche, und hatte Durst.
Erst dachte er, er könne ihn überlisten und sich einfach zurückfallen lassen in den dumpfen Trunkenheitsschlaf. Also drehte er sich auf die Seite, atmete mit offenem Mund ins Kissen und zog sich die Decke über die Schultern. Aber sosehr sein Körper auch nach Ruhe verlangte, er kam nicht dagegen an – weder gegen den Durst noch gegen das nervöse Ziehen in der Magengegend.
Schlapp und willenlos lag er da und versuchte wieder einzuschlafen. Tatsächlich gelang das auch für ein paar Minuten, aber dann schreckte eine Kirchenglocke irgendwo stadteinwärts ihn unsanft ins Bewußtsein zurück. In seinem Kopf entstanden Flüssigkeitsbilder: prickelndes Mineralwasser in einem beschlagenen Glas, von dem die Tropfen abperlten; der Trinkbrunnen auf dem Flur seiner Grundschule; ein Becher schäumendes Cola. Mehr als alles, was ihm am Leben je begehrenswert oder verlockend erschienen war, brauchte er etwas zu trinken.
Noch einmal versuchte er den Schlaf herbeizuzwingen und wußte doch schon, daß er verloren und nun keine [8] andere Wahl mehr hatte, als aufzustehen. Er wußte nicht gleich, auf welcher Seite er aus dem Bett steigen mußte, ihm graute vor dem kalten Fußboden im Gang, aber dann warf er alle Bedenken so ungestüm beiseite wie seine Decken und richtete sich auf. Sein Kopf dröhnte, der Magen protestierte unwirsch gegen den abrupten Stellungswechsel, doch der Durst war stärker.
Er öffnete seine Zimmertür und tappte auf den Flur hinaus, den von draußen ein fahler Lichtschein erhellte. Wie er befürchtet hatte, war es scheußlich, mit bloßen Füßen über kaltes Linoleum zu laufen, aber der Gedanke an das erlösende Wasser, das am Ende des Flurs winkte, half ihm, sich zu überwinden.
Schlaftrunken taumelte er in den Waschraum und stürzte gierig zum ersten der weißen Becken hin, die in langer Reihe eine ganze Wand säumten. Er drehte den Kaltwasserhahn auf und ließ ihn gut eine Minute laufen: Selbst in seinem benommenen Zustand ekelte er sich vor dem rostig warmen Geschmack des ersten Strahls, der aus diesen Rohren kam. Als das Wasser, das ihm über den Ellbogen rann, kalt genug war, fing er es mit den hohlen Händen auf, beugte sich nieder und schlürfte geräuschvoll wie ein schlabbernder Hund. Herrlich kühl und erfrischend spürte er es die Kehle hinabfließen: gerettet! Er wußte aus Erfahrung, daß man nach den ersten Schlucken innehalten sollte, innehalten und warten, wie der aufgewühlte Magen auf die unverhoffte Zufuhr alkoholfreier Flüssigkeit reagieren würde: im ersten Moment sehr empfindlich, aber da er jung war und gesund, gab sich das bald, und dann schluckte auch der Magen brav, ja konnte gar nicht genug bekommen.
[9] Erleichtert hielt er den Kopf unter den Hahn und schlürfte noch acht oder neun Mundvoll, einer ums andere eine Wohltat für den ausgetrockneten Körper. Dann allerdings kippte etwas in seinem vollgepumpten Magen, der löste ein Signal im Gehirn aus, und ihm wurde im Nu so schwindelig, daß er sich vorbeugen und mit den Händen am Beckenrand abstützen mußte, so lange, bis die Welt sich nicht mehr um ihn drehte.
Wieder tauchte er die Hand unter den fließenden Strahl und trank. An einem gewissen Punkt, als Verstand und Erfahrung ihn warnten, daß jeder weitere Schluck riskant wäre, richtete er sich mit geschlossenen Augen auf und fuhr sich mit den nassen Handflächen erst übers Gesicht und dann übers T-Shirt. Rasch noch einmal mit dem Hemdzipfel die Lippen betupft, bevor er sich erfrischt und mit dem Gefühl, langsam wieder unter die Lebenden zu gehören, anschickte, in sein Zimmer zurückzukehren.
Und die riesige Fledermaus sah, einen Vampir, oder das, was seine benebelten Sinne auf die Entfernung dafür hielten. Auch wenn es keiner sein konnte, denn das, was da schwarz und drohend von der Decke hing, war bestimmt zwei Meter lang und so breit wie ein ausgewachsener Mensch. Trotzdem sah es aus wie ein Vampir: Ganz deutlich erkannte er den Kopf über den schlaff herabhängenden Flügeln und darunter die Krallenfüße.
Er kniff die Augen zusammen und rubbelte sich mit den Händen übers Gesicht, wie um die Erscheinung fortzuwischen, aber als er die Augen wieder aufschlug, war der finstere Spuk noch immer da. Er wollte fliehen und schlich, weil er sich nicht traute, dem Gespenst den Rücken zu [10] kehren, im Krebsgang zur Tür zurück, neben der er den Schalter für die Deckenbeleuchtung wußte. Wie er jetzt, halb betäubt vor ungläubigem Entsetzen und die Hand zitternd nach hinten gestreckt, fahrig über die Kacheln tastete, hätte man glauben können, mit der Berührung dieser Wand vergewissere er sich der letzten ihm noch verbliebenen Verbindung zur Realität.
Wie ein Blinder folgte er seiner sehenden Hand an der Wand entlang, bis er den Lichtschalter gefunden hatte. Die Neonröhren, die in langer Doppelreihe angeordnet waren, flammten eine nach der anderen auf und tauchten den Raum in ein kaltes, grelles Licht.
Während die gleißende Helligkeit sich flackernd ausbreitete, kniff er die Lider ganz fest zusammen. Nur nicht mit ansehen müssen, wie sich der Vampir, aus dem wohligen Schattendunkel seines Versteckes aufgescheucht, in Bewegung setzte! Erst als alle Lichter ruhig brannten, öffnete der Junge die Augen und zwang sich hinzusehen.
[11] 2
Es dauerte ziemlich lange, bis die Behörden auf den Tod des Kadetten Moro reagierten, wobei diese Verzögerung am wenigsten seinem Klassenkameraden Pietro Pellegrini anzurechnen war. Der kehrte, sobald die Wellen der Übelkeit verebbten, auf sein Zimmer zurück, griff zum telefonino, das ihm schon fast wie ein natürlicher Fortsatz seiner Gliedmaßen erschien, so oft benutzte er es, und rief seinen Vater an, der geschäftlich in Mailand weilte. Pietro erklärte ihm, was passiert war oder vielmehr was er gerade gesehen hatte. Der Vater versprach zunächst, er würde die Polizei verständigen, besann sich dann aber in seiner Eigenschaft als Rechtsanwalt eines Besseren und entschied, der Sohn solle selber anrufen, und zwar unverzüglich.
Nicht, daß Pellegrinis Vater befürchtet hätte, sein Sohn könne etwas mit dem Tod des anderen Jungen zu tun haben. Aber als Strafverteidiger war er mit den Gedankengängen der Behörden wohlvertraut und wußte zum einen, daß ein Zeuge, der eine Straftat erst mit Verzögerung anzeigte, unweigerlich selbst in Verdacht geriet, und zum anderen, daß man es sich bei der Polizei gern einfach machte. Also riet er seinem Sohn – ja man könnte sagen, er befahl es ihm –, umgehend die Behörden zu verständigen. Der Junge, den sein Vater und zwei Jahre San Martino zu striktem Gehorsam erzogen hatten, bezog das auf die Schulbehörde, und so ging er nach unten, um seinem Direktor zu melden, daß in dem Waschraum im dritten Stock ein Toter hing.
[12] Der Polizist in der Questura, der schließlich verständigt wurde, notierte den Namen des Anrufers und ließ sich den Sachverhalt schildern. Kaum war das Gespräch beendet, erkundigte er sich bei dem Kollegen, der mit ihm in der Telefonzentrale Dienst tat, ob sie die Meldung nicht an die Carabinieri weiterleiten sollten, da San Martino als Militäreinrichtung doch wohl eher in deren Zuständigkeit als in die der Questura falle. Nach einigem Hin und Her rief der zweite Polizist im Bereitschaftsraum an, um die Verfahrensfrage dorthin weiterzuleiten. Der Kollege, der drüben abhob, sagte, nein, die Akademie sei eine Privatschule ohne offizielle Anbindung an die Armee – er wußte das, weil der Sohn seines Zahnarztes auf die San Martino ging –, und folglich seien doch sie zuständig. Die zwei in der Telefonzentrale diskutierten noch eine Weile, bevor sie sich endlich der Meinung ihres Kollegen anschlossen. Da es inzwischen schon nach acht war, eine Zeit, zu der ihr Vorgesetzter für gewöhnlich bereits an seinem Schreibtisch saß, wählte einer der beiden die Nummer von Commissario Guido Brunetti.
Der bestätigte ohne Zögern ihre Zuständigkeit, fragte aber gleich darauf argwöhnisch: »Wann ist der Anruf eingegangen?«
»Sieben Uhr sechsundzwanzig, Signore«, antwortete Alvise wie aus der Pistole geschossen.
Ein Blick zur Uhr bestätigte Brunetti, daß seitdem über eine halbe Stunde verstrichen war, aber da Alvises Stern nicht zu den hellsten am Firmament der Questura zählte, sparte er sich jede Kritik und sagte nur: »Fordern Sie ein Boot an. Ich komme runter.«
Sowie er aufgelegt hatte, überflog Brunetti den [13] Dienstplan. Da Ispettore Lorenzo Vianello weder für diesen noch für den nächsten Tag eingeteilt war, rief er bei ihm zu Hause an und erklärte in groben Zügen, was vorgefallen sei. Bevor der Commissario ihn darum bitten konnte, sagte Vianello: »Wir treffen uns dort.«
Wenn es Alvise gelungen war, dem Bootsführer Brunettis Auftrag fehlerfrei zu übermitteln, dann wohl nicht zuletzt deshalb, weil der nur einen Schreibtisch weiter saß. Immerhin fand Brunetti, als er ein paar Minuten später aus der Questura trat, Alvise und den Bootsführer schon an Bord der im Leerlauf vor sich hin tuckernden Barkasse. Mit einer unmißverständlichen Handbewegung winkte er Alvise wieder zurück. »Gehen Sie nach oben, Sergente, und schicken Sie mir Pucetti herunter.«
»Aber soll ich Sie denn nicht begleiten, Signore?« fragte Alvise so enttäuscht wie eine Braut, die der Bräutigam vor der Kirche stehengelassen hat.
»Das geht nicht, leider. Wissen Sie, falls die Schule noch mal anruft, dann möchte ich, daß sie denselben Ansprechpartner haben. Das schafft Vertrauen, und auf die Weise werden wir um so mehr erfahren.«
Auch wenn diese Notlüge alles andere als plausibel war, gab Alvise sich offenbar damit zufrieden, und Brunetti überlegte nicht zum ersten Mal, ob es vielleicht gerade die unsinnigen Befehle waren, die einem Mann wie ihm am ehesten einleuchteten. Jedenfalls kehrte der Sergente folgsam in die Questura zurück. Ein paar Minuten später war Pucetti an Bord, und der Bootsführer manövrierte die Barkasse von der Riva fort und auf den Bacino di San Marco zu. Der Regen der letzten Nacht hatte die Luft reingewaschen und der [14] Stadt einen herrlich klaren Morgen beschert, auch wenn schon ein scharfer Hauch von Spätherbst in der Luft lag.
Brunetti hatte seit über zehn Jahren keine Veranlassung mehr gehabt, nach San Martino hinauszufahren, nicht seit der Abschlußprüfung eines Vetters zweiten Grades, der anschließend, wie die meisten Absolventen der Kadettenschule, gleich im Leutnantsrang von der Marine übernommen worden und fortan zügig aufgestiegen war – gleichermaßen zum Stolz seines Vaters wie zur Verwirrung der übrigen Verwandtschaft. Weder bei den Brunettis noch in der Familie seiner Mutter hatte es je eine Militärtradition gegeben. Wenn es zum Krieg kam, wurden die Männer natürlich trotzdem eingezogen, und falls, wie im Zweiten Weltkrieg, die Front quer durchs eigene Land verlief, blieb auch die Familie daheim nicht verschont.
Vor diesem Hintergrund war es nur verständlich, daß Brunetti von Kindheit an über die Militärs und ihre pompösen Auftritte mit jener geringschätzigen Verachtung hatte reden hören, die seine Eltern und deren Freunde sich ansonsten für Regierung und Kirche aufsparten. Und im Laufe seiner Ehe mit Paola Falier, einer Frau von linkslastiger, wenn auch sprunghafter politischer Gesinnung, hatten sich Brunettis Vorbehalte begreiflicherweise noch verstärkt. Für Paola bestand das größte Verdienst der italienischen Armee in ihrer langen Tradition vermeintlich feiger Rückzugsgefechte. Die größte Schmach hingegen lastete sie jenen politischen und militärischen Führern der jüngeren Geschichte an, die sich dieser Tradition widersetzt und den sinnlosen Tod Hunderttausender junger Männer verschuldet hatten, weil sie sich in trügerischer [15] Verblendung nur mehr von der eigenen Ruhmsucht und dem politischen Ehrgeiz ihrer Verbündeten leiten ließen.
Brunettis eigene Erfahrungen mit den Militärs, im Wehrdienst und danach, hatten ihm wenig Anlaß gegeben, Paolas Urteil in Frage zu stellen. Selbst die zynische These, das Militär (das italienische wie das jeder anderen Nation) unterscheide sich nicht groß von der Mafia, war nicht ganz von der Hand zu weisen: Hier wie dort herrschte eine von Männern dominierte, frauenfeindliche Organisation; unfähig zu moralischem Handeln oder auch nur schlichter Fairneß außerhalb der eigenen Reihen; machtgierig, arrogant gegenüber der Zivilbevölkerung; gewaltbereit und feige zugleich. Nein, der Unterschied war tatsächlich nicht groß, außer daß die einen ihre Uniformen mit Orden und Lametta dekorierten, während die anderen den unauffälligen Zwirn von Armani und Brioni bevorzugten.
Mit der Geschichte der Akademie war Brunetti leidlich vertraut. 1852 von Alessandro Loredan – einem frühen Gefolgsmann und späteren General Garibaldis – auf der Giudecca gegründet, residierte die Schule in einem weitläufigen Gebäudekomplex auf der Insel. Loredan, der kinderlos und ohne männliche Erben starb, hatte zusätzlich zu diesem Anwesen auch seinen Privatpalazzo und das gesamte Familienvermögen in einen Treuhandfonds überführt, unter der Bedingung, daß die Erträge ausschließlich zum Aufbau und Erhalt der Militärakademie verwendet würden, die er nach dem Schutzpatron seines Vaters benannt hatte.
Nun waren die Oligarchen von Venedig zwar nicht unbedingt Anhänger des Risorgimento, aber wenn es galt, der [16] Stadt ein so riesiges Vermögen wie das von Alessandro Loredan zu erhalten, durfte die Gesinnung ruhig einmal hintanstehen. Nur Stunden nach dem Tod des Generals war der genaue Wert seines Vermächtnisses beziffert, und binnen Tagen hatten die im Testament benannten Treuhänder einen pensionierten Offizier, der zufällig mit einem von ihnen verschwägert war, mit der Leitung der Akademie betraut. Die wurde bis zum heutigen Tag nach streng militärischen Regeln geführt, eine Eliteschule, auf der die Söhne hoher Offiziere und vermögender Patrizierfamilien jenen sprichwörtlich letzten Schliff erhielten, der in der Regel auch ihnen den Weg in den Offiziersstand eröffnete.
Bis hierher war Brunetti mit seinem Rückblick gekommen, als das Boot hinter der Kirche Sant’ Eufemia in einen Seitenkanal einschwenkte und den nächsten Anlegeplatz ansteuerte. Pucetti sprang mit dem Tau an Land und schlang es um den eisernen Haltering auf dem Pflaster. Dann streckte er Brunetti die Hand entgegen und half ihm von Bord.
»Zur Schule geht’s da lang, nicht wahr?« Brunetti wies auf die Leeseite der Insel und zur Lagune hin, die in der Ferne gerade noch erkennbar war.
»Keine Ahnung, Signore«, gestand Pucetti. »Ich muß zugeben, daß ich außer zum Redentore-Fest eigentlich nie auf die Giudecca komme. Daher weiß ich leider auch nicht, wo die Schule ist.«
Daß seine venezianischen Mitbürger durch die Bank zähe Nesthocker waren, wußte Brunetti natürlich, aber von einem wie Pucetti, der so intelligent und weltoffen wirkte, hätte er doch etwas mehr Aufgeschlossenheit erwartet.
Als ob er die Enttäuschung seines Chefs erraten hätte, [17] fuhr Pucetti fort: »Überspitzt gesagt, war die Insel für mich immer fast schon Ausland, Signore. Muß an meiner Mutter liegen: Sie spricht über die Giudecca, als gehörte sie nicht zu Venedig. Man könnte ihr hier das schönste Haus schenken, sie würde es nicht nehmen.«
Brunetti, dem es klüger schien, nicht zu erwähnen, daß seine eigene Mutter ähnlich dachte, ja daß auch er einiges von dieser Mentalität geerbt hatte, sagte nur: »Doch, doch, die Schule liegt dahinten, am anderen Ende des Kanals« und gab zielstrebig die Richtung vor.
Schon von ferne sah er, daß der große portone, der in den Hof der Akademie führte, für jedermann weit offenstand. Er wandte sich nach Pucetti um. »Finden Sie heraus, wann das Tor heute morgen geöffnet wurde und ob beim Verlassen und Betreten des Schulgeländes Meldepflicht besteht.« Bevor Pucetti etwas sagen konnte, fuhr Brunetti fort: »Das gilt auch für die letzte Nacht, wir wissen ja nicht, wie lange der Junge schon tot ist. Und erkundigen Sie sich, wer Schlüssel zum portone hat und wann er abends geschlossen wird.« Pucetti brauchte man die Vernehmungsfragen nicht im Wortlaut vorzubeten: eine willkommene Entlastung bei einer Dienststelle, deren Beamte im Durchschnitt das Niveau eines Alvise hatten.
Vianello stand bereits vor dem portone. Er begrüßte seinen Vorgesetzten mit leicht gerecktem Kinn und nickte Pucetti zu.
Brunetti, der den Vorteil, unangemeldet und in Zivil zu erscheinen, nicht ungenutzt lassen wollte, schickte Pucetti zurück zum Boot; er solle ihnen zehn Minuten Vorsprung geben und dann nachkommen.
[18] Im Hof hatte sich die Nachricht von dem Todesfall offenbar bereits herumgesprochen, auch wenn Brunetti nicht hätte erklären können, woran er das merkte. Vielleicht am Anblick der Knaben und jungen Burschen, die in kleinen Gruppen beisammenstanden und sich mit gedämpfter Stimme unterhielten, vielleicht auch daran, daß einer von ihnen weiße Socken zu den Uniformschuhen trug, ein sicheres Zeichen dafür, daß er sich überstürzt und ohne nachzudenken angekleidet hatte. Außerdem fiel ihm auf, daß keiner der Jungen Bücher dabeihatte. Militärakademie hin oder her – dies war eine Lehranstalt, und Schüler trugen Bücher bei sich, es sei denn, ein Ereignis von höchster Dringlichkeit hätte ihren Alltagsrhythmus außer Kraft gesetzt.
In der Nähe des portone löste sich ein Kadett aus seiner Gruppe und trat Brunetti und Vianello entgegen. »Was kann ich für Sie tun?« fragte er, allerdings in einem Ton, als sei es an ihnen zu erklären, was sie hier verloren hätten. Ein gutaussehender junger Mann, dunkelhaarig, mit markanten Gesichtszügen und fast so groß wie Vianello, auch wenn er sicher noch keine zwanzig war. Seine Kameraden folgten ihm mit den Augen.
Verärgert über den hochfahrenden Ton des Kadetten, sagte Brunetti: »Ich möchte mit dem Schulleiter sprechen.«
»Und wer sind Sie?« fragte der Junge zurück.
Brunetti antwortete nicht, sondern maß sein Gegenüber nur mit einem langen, abschätzigen Blick. Der andere zuckte mit keiner Wimper und wich auch nicht zurück, als Brunetti einen Schritt auf ihn zu trat. Er trug die vorschriftsmäßige Dienstuniform – dunkelblaue Hose und [19] Jacke, weißes Hemd mit Krawatte – und hatte zwei goldene Streifen auf den Ärmelaufschlägen. Während Brunetti beharrlich schwieg, verlagerte der Junge sein Gewicht und starrte ihn, die Hände in die Hüften gestemmt, durchdringend an. Aber er unterließ es, seine Frage zu wiederholen.
»Wie heißt der zuständige Mann hier?« erkundigte sich Brunetti barsch und fügte nicht weniger schroff hinzu: »Ich meine nicht seinen Namen, sondern den Titel.«
»Comandante«, entfuhr es dem überraschten Jungen.
»Ah, wie imposant«, spottete Brunetti, der nicht sicher war, was ihm mehr gegen den Strich ging, die mangelnde Achtung der Jugend vor dem Alter im allgemeinen oder die aufmüpfige Arroganz dieses Knaben im besonderen. »Inspektor, notieren Sie den Namen dieses jungen Mannes«, sagte er an Vianello gewandt und schritt auf die Freitreppe zu, die in den Palazzo führte.
Er ging die fünf Stufen hoch und stieß die Eingangstür auf. Der Fußboden im Foyer war mit einem großflächigen Rautenmuster aus verschiedenfarbigen Hölzern getäfelt. Stiefelbewehrte Füße hatten quer übers Parkett eine dunkle Spur gelegt, die zu einer Tür an der Stirnwand führte. Brunetti folgte der ausgetretenen Fährte durch die menschenleere Halle, öffnete die Tür und gelangte in einen Korridor, dessen Wände über und über mit Regimentsflaggen geschmückt waren. Die meisten trugen den Löwen von San Marco im Wappen, aber auch anderes Getier war vertreten, allesamt in kriegerischer Haltung, mit gebleckten Zähnen, ausgestreckten Krallen oder gesträubtem Nackenhaar.
Über den drei Türen zur Rechten stand jeweils eine Zahl. Als Brunetti an der letzten vorbeiging, trat ein Junge, kaum [20] älter als fünfzehn, auf den Flur hinaus. Erstaunt sah er Brunetti an, der ihm ruhig zunickte und fragte: »Wo finde ich das Büro des Comandante?«
Sein Ton oder sein Auftreten lösten bei dem Jungen eine Art Pawlowschen Reflex aus: Er nahm unverzüglich Haltung an und grüßte zackig. »Eine Treppe höher, Signore. Dritte Tür rechts.«
Brunetti widerstand der Versuchung, »Stehen Sie bequem« zu sagen, und wandte sich mit einem schlichten »Danke« der Treppe zu.
Oben angekommen, folgte er der Weisung des Jungen und fand richtig neben der angegebenen Tür ein Schild mit der Aufschrift: COMANDANTE GIULIO BEMBO.
Brunetti klopfte, zögerte einen Moment und klopfte noch einmal. Als es drinnen stillblieb, beschloß er kurzerhand, die Abwesenheit des Comandante zu nutzen, um sich in dem Büro ein wenig umzusehen. Noch ein rascher Blick den Flur hinunter, dann drückte er auf die Klinke und trat ein. Es ist schwer zu sagen, wer mehr erschrak, Brunetti oder der Mann, der mit einem Stoß Papiere in Händen vor der Fensterfront stand.
»Oh, ich bitte um Verzeihung«, sagte Brunetti. »Einer der Schüler meinte, ich solle hinaufgehen und in Ihrem Büro auf Sie warten. Ich hatte keine Ahnung, daß Sie hier sind.« Er wandte sich halb zur Tür und drehte den Kopf zurück, scheinbar unschlüssig, ob er bleiben oder sich entfernen sollte.
Der Mann am Fenster sah ihn an, doch durch den Lichteinfall geblendet, konnte Brunetti seine Gesichtszüge kaum erkennen. Die Uniform des Comandante war heller als die [21] der Kadetten, auch hatten die Hosen keine farbigen Seitenstreifen, und die Ordensspange auf seiner Brust schätzte Brunetti über eine Handspanne breit.
Der Mann legte die Papiere auf den Schreibtisch, machte aber keine Anstalten, auf Brunetti zuzugehen. »Und Sie sind?« fragte er betont gelangweilt.
»Commissario Guido Brunetti, Signore. Ich habe den Auftrag, einen hier gemeldeten Todesfall zu untersuchen.« Das entsprach nicht ganz der Wahrheit, es sei denn, Brunetti hätte sich selbst beauftragt, doch er sah keinen Grund, dies dem Comandante auf die Nase zu binden. Er trat vor und streckte so unbefangen die Hand aus, als wäre er immun gegen die frostige Kühle, mit der sein Gegenüber ihn offenbar auf Distanz halten wollte.
Nach einer angemessenen Frist, die zeigen sollte, wer hier das Sagen hatte, ließ Bembo sich herab, die Begrüßung zu erwidern. Sein Händedruck war fest, aber irgendwie verhalten – ganz so, als wolle er die Hand des Zivilisten schonen.
»Ach ja«, sagte Bembo, »ein Commissario.« Er legte eine Pause ein, um der herablassenden Feststellung ihre gebührende Wirkung zu verleihen, und fuhr dann fort: »Ich wundere mich, daß mein Freund, Vice-Questore Patta, nicht daran gedacht hat, mich anzurufen und von Ihrem Kommen zu unterrichten.«
Brunetti überlegte, ob der Hinweis auf seinen Vorgesetzten (der im übrigen frühestens in einer Stunde in seinem Büro sein würde) ihn einschüchtern sollte, damit er versprach, alles in seiner Macht Stehende zu tun, um Bembo nur ja nicht mit seinen Ermittlungen zu behelligen. »Ich bin [22] sicher, das wird er nachholen, sobald ich ihm meine ersten Erkenntnisse vorlege, Signore«, sagte Brunetti.
»Natürlich.« Bembo ging um den Schreibtisch herum, nahm in seinem Sessel Platz und bedeutete Brunetti mit einer zweifellos huldvoll gemeinten Geste, er dürfe sich ebenfalls setzen. So angelegentlich, wie der Comandante den Zierrat auf seinem Schreibtisch herumschob, Papiere zu einem Stoß aufeinanderstapelte und zurechtklopfte, schien er nicht übermäßig interessiert daran, daß die Ermittlungen rasch in Gang kamen. Brunetti verharrte schweigend.
»Eine unglückselige Geschichte, das«, sagte Bembo endlich.
Brunetti nickte nur.
»Ist das erste Mal, daß wir in der Akademie einen Selbstmord haben«, fuhr Bembo fort.
»Ja, das muß ein Schock gewesen sein. Wie alt war der Junge?« fragte Brunetti. Er zog ein Notizbuch aus der Jackentasche und bog, sobald er eine leere Seite gefunden hatte, den Falz auseinander. Dann klopfte er mit verlegenem Lächeln seine Taschen ab, beugte sich vor und griff nach einem Bleistift auf dem Schreibtisch. »Wenn Sie erlauben, Signore«, sagte er.
Bembo machte sich nicht die Mühe, auf die Bitte einzugehen. »Siebzehn, glaube ich«, sagte er.
»Und sein Name, Signore?« fragte Brunetti.
»Ernesto Moro.«
Brunetti zuckte erstaunt zusammen, als unvermutet einer der berühmtesten Namen Venedigs fiel.
»Ja«, sagte Bembo, »Fernandos Sohn.«
Dottor Fernando Moro hatte einige Jahre als [23] Abgeordneter in verschiedenen Parlamentsgremien gewirkt – einer der wenigen Politiker, denen man allenthalben attestierte, daß sie ihr Amt redlich und in Ehren versahen. Böse Zungen behaupteten, Moro sei nur deshalb von Ausschuß zu Ausschuß weitergereicht worden, weil den Kollegen ebendiese Redlichkeit unbequem war: Sobald man einsehen mußte, daß er tatsächlich immun war gegen die Verlockungen von Macht und Geld, suchte und fand jedes Komitee Mittel und Wege, sich seiner rasch wieder zu entledigen. Wenn Moro als Politiker dennoch Karriere machte, so bewies das lediglich, daß die Hoffnung nie versiegt: Jeder Vorsitzende, in dessen Ausschuß Moro berufen wurde, war überzeugt, er werde den Dottore umstimmen und auf den Kurs einschwören können, der langsam, aber sicher die Taschen der Minderheit auf Kosten der Mehrheit füllt.
Drei Jahre lang war es offenbar keinem gelungen, Moro zu korrumpieren. Und dann, es war gerade erst zwei Jahre her, hatte er plötzlich und ohne Erklärung sein Mandat niedergelegt und sich von einem auf den anderen Tag von der politischen Bühne zurückgezogen, um sich fortan wieder ausschließlich seiner Arztpraxis zu widmen.
»Hat man ihn schon benachrichtigt?« fragte Brunetti.
»Wen?« fragte Bembo verständnislos zurück.
»Den Vater des Toten.«
Bembo schüttelte den Kopf. »Ich weiß nicht. Ist das nicht Aufgabe der Polizei?«
Brunetti beherrschte sich nur mit Mühe. »Wie lange ist es her, daß die Leiche entdeckt wurde?« sagte er mit einem Blick auf die Uhr, und es gelang ihm nicht, den Vorwurf aus seiner Stimme herauszuhalten.
[24] Bembo richtete sich drohend auf. »Irgendwann heute morgen.«
»Um wieviel Uhr?«
»Ich weiß es nicht. Kurz bevor die Polizei verständigt wurde.«
»Wie kurz davor?«
»Ich habe keine Ahnung. Man hat mich zu Hause angerufen.«
»Um wieviel Uhr?« fragte Brunetti erneut, diesmal mit gezücktem Bleistift.
Bembo preßte in kaum verhohlenem Ärger die Lippen zusammen. »Ich bin mir nicht sicher. So gegen sieben.«
»Waren Sie schon wach?«
»Natürlich.«
»Und dann haben Sie die Polizei verständigt?«
»Nein, das hatte bereits jemand von hier aus getan.«
Brunetti stellte die übereinandergeschlagenen Beine wieder nebeneinander und beugte sich vor. »Comandante, der Anruf bei der Questura wurde um sieben Uhr sechsundzwanzig protokolliert. Also fast eine halbe Stunde, nachdem Sie vom Tod des Jungen unterrichtet wurden.« Nachdem Bembo keine Anstalten machte, sich zu rechtfertigen, fuhr Brunetti fort: »Könnten Sie mir das erklären?«
»Was?«
»Daß die Behörden erst mit einer halben Stunde Verzögerung über einen verdächtigen Todesfall in Ihrer Schule informiert wurden.«
»Verdächtig?« wiederholte Bembo scharf.
»Solange die Rechtsmedizin die Todesursache nicht geklärt hat, ist für uns jeder Todesfall verdächtig.«
[25] »Aber es war doch eindeutig Selbstmord.«
»Haben Sie den Toten gesehen?«
Der Comandante antwortete nicht gleich. Er lehnte sich in seinem Sessel zurück und musterte sein Gegenüber. Endlich sagte er: »Ja, allerdings. Nach dem Anruf kam ich sofort her und habe ihn mir angesehen. Moro hat sich erhängt.«
»Und warum die Verzögerung?«
Bembo wehrte ab. »Keine Ahnung. Meine Leute müssen gedacht haben, ich würde die Polizei verständigen, und ich war sicher, sie hätten das bereits getan.«
Brunetti ließ es dabei bewenden und fragte: »Können Sie mir sagen, wer angerufen hat?«
»Auch wenn ich mich nur ungern wiederhole: Ich weiß es nicht. Aber der Betreffende hat doch sicher seinen Namen angegeben.«
»Sicher«, echote Brunetti und kehrte zum Thema zurück. »Aber Dottor Moro hat niemand verständigt?«
Bembo schüttelte den Kopf.
Brunetti erhob sich. »Ich kümmere mich darum, daß das nachgeholt wird.«
Bembo machte sich nicht die Mühe aufzustehen. Brunetti zögerte einen Moment, gespannt, ob der Comandante wieder seine vermeintliche Überlegenheit herauskehren und sich seinen Schreibtischtrophäen widmen würde, um den Abgang des lästigen Besuchers zu beschleunigen. Aber nein: Bembos Hände ruhten untätig auf der Schreibtischplatte, während seine Augen Brunetti belauerten.
Der Commissario schob das Notizbuch in die Jackentasche, legte den Bleistift sorgsam vor Bembo auf den Schreibtisch und verließ das Zimmer.
[26] 3
Draußen auf dem Korridor entfernte Brunetti sich ein paar Meter von Bembos Tür, bevor er sein telefonino aus der Tasche zog. Er wählte die 12 und wollte sich eben Moros Nummer geben lassen, als ein Wortwechsel im Treppenhaus ihn aufhorchen ließen.
»Wo ist mein Sohn?« fragte eine Männerstimme laut und fordernd. Eine leisere antwortete beschwichtigend, aber die erste blieb hartnäckig: »Wo ist er?« Hastig unterbrach Brunetti die Verbindung und steckte das Handy wieder ein.
Als er sich dem Treppenhaus näherte, wurden die Stimmen noch lauter. »Ich will wissen, wo er ist«, rief aufgebracht der erste Sprecher, den offenbar kein Zuspruch und keine Erklärung besänftigen konnten.
Brunetti beugte sich vorsichtig über das Geländer und sah unter sich einen Mann etwa seines Alters und seiner Größe, den er auf Anhieb erkannte, denn er hatte nicht nur sein Foto in der Zeitung gesehen, sondern war ihm auch schon bei verschiedenen offiziellen Anlässen begegnet: Moro hatte ein asketisch hageres Gesicht, dem die hohen Wangenknochen einen slawischen Anstrich verliehen. Die dunklen Augen und der sonnengebräunte Teint standen in scharfem Kontrast zu seinem dichten, schlohweißen Haar. Der jüngere Mann ihm gegenüber trug die gleiche dunkelblaue Uniform wie die Jungen draußen auf dem Hof.
»Dottor Moro«, sagte Brunetti und ging ihm über die Treppe entgegen.
[27] Der Arzt wandte ihm das Gesicht zu, schien ihn jedoch nicht zu erkennen. Sein Mund stand offen, und er rang mühsam nach Luft. Augenscheinlich stand er unter Schock, verstärkt noch durch das hilflose Ringen mit seinem hartnäckigen Begleiter.
»Ich bin Guido Brunetti, Signore. Von der Polizei«, sagte der Commissario. Als Moro nicht antwortete, wandte Brunetti sich an den Uniformierten und fragte streng: »Wo ist der Junge?«
Vor so viel Autorität und Schützenhilfe für Dottor Moro kapitulierte der Kadett endlich. »Im Waschraum. Oben«, setzte er so unwirsch hinzu, als ob keiner der beiden ein Recht hätte, von ihm Auskunft zu fordern.
»Wo?« fragte Brunetti noch einmal.
Doch da meldete sich über ihnen auf dem Treppenabsatz Vianello. »Er ist hier oben, Signore«, sagte er und deutete in die Richtung, aus der er gekommen war.
Brunetti sah Moro an, dessen Aufmerksamkeit nun auf Vianello gerichtet war. Er stand wie angewurzelt, den Mund zu einem runden O geöffnet, und Brunetti konnte ihn immer noch atmen hören.
Der Commissario trat vor und zog den Arm des Arztes in den seinen. Wortlos führte er ihn die Treppe hinauf, immer Vianellos sich langsam entfernendem Rücken hinterher. Im dritten Stock machte Vianello halt und vergewisserte sich, daß sie ihm folgten, bevor er in einen von vielen Türen gesäumten Flur abbog. An dessen Ende öffnete sich nach rechts ein weiterer Korridor. Hier blieb Vianello vor einer weißlackierten Tür mit rundem Glasfenster in der oberen Füllung stehen. Er fing Brunettis Blick auf und [28] nickte unmerklich. Trotzdem war Moro das Zeichen nicht entgangen, und er stützte sich schwerer auf Brunettis Arm, auch wenn sein Schritt nicht ins Stocken geriet.
Schon im nächsten Moment jedoch machte er sich von ihm los und hastete an Vianello vorbei. Brunetti, der in der Tür stehenblieb, sah ihn wie einen schwarzen Schatten ans andere Ende des Raums taumeln, wo ein dunkles Etwas am Boden lag.
»Ich habe ihn abgenommen, Signore«, sagte Vianello halblaut und legte seinem Vorgesetzten die Hand auf den Arm. »Wir dürfen am Tatort nichts verändern, ich weiß, aber ich konnte den Gedanken nicht ertragen, daß jemand von der Familie den Jungen so sehen würde.«
Brunetti hatte Vianello kaum die Hand gedrückt und ein beifälliges »Schon gut« gemurmelt, da erklang vom anderen Ende des Raums ein unterdrückter tierischer Laut. Moro lag auf den Knien neben dem Leichnam und wiegte ihn in den Armen. Das schaurige Winseln, das keiner menschlichen Sprache glich, kam gleichwohl von ihm. Hilflos sahen die beiden Polizisten zu, wie Moro den Toten fester an sich preßte und den schlaff herabhängenden Kopf zärtlich und behutsam in seine Halsbeuge bettete. Sein dumpfes Gestammel verdichtete sich endlich doch zu Worten, aber weder Brunetti noch Vianello konnten verstehen, was er sagte.
Zögernd traten sie näher. Brunetti blickte auf den Mann, der ihm von Alter und Statur her so sehr glich und nun den Leichnam seines einzigen Sohnes in den Armen hielt, der wiederum kaum älter war als Brunettis eigener. Ihn schwindelte vor Entsetzen, er mußte die Augen schließen, und als [29] er sie wieder öffnete, sah er Vianello hinter dem Arzt knien. Er hatte ihm den Arm um die Schultern gelegt und war ganz dicht an ihn herangerückt, aber ohne den Toten zu berühren. »Lassen Sie ihn, Dottore«, mahnte Vianello leise und lehnte sich fester gegen den Rücken des Mannes. »Lassen Sie ihn«, wiederholte er und rückte langsam seitwärts, um das Gewicht des Toten aufzufangen. Moro schien erst nicht zu begreifen, aber dann drangen Vianellos sanfte Weisungen doch zu ihm durch, und gemeinsam mit ihm legte er den Oberkörper seines toten Kindes auf dem Boden ab und kniete neben ihm nieder, den Blick starr und unverwandt auf das aufgedunsene Gesicht geheftet. So lange, bis Vianello es mit einem Ende des Paletots verhüllte.
Brunetti wartete noch einen Moment, dann beugte er sich zu Moro hinab, schob ihm eine Hand unter den Arm und half dem unsicher Schwankenden auf die Füße.
Vianello stützte ihn von der anderen Seite. Und so verließen sie den Waschraum und gelangten in stockendem Gang über Flure und Treppen hinunter auf den Hof. Als sie ins Freie traten, standen die Kadetten immer noch in Gruppen beisammen. Im ersten Moment reckten sich alle Köpfe nach ihnen, aber ebenso rasch wich man ihren Blicken wieder aus.
Moro schleppte sich vorwärts wie ein Gefangener in Ketten, der nur ganz kurze Schritte machen kann. Einmal blieb er stehen, schüttelte den Kopf wie zur Antwort auf eine Frage, die seine Begleiter nicht hören konnten, und ließ sich dann willenlos weiterführen.
Brunetti, der Pucetti aus einem Gang auf der anderen Hofseite kommen sah, winkte ihn mit der freien Hand [30] herbei. Als der Sergente neben ihm stand, trat Brunetti zur Seite, und Pucetti hakte den Dottore unter, der den Wechsel indes gar nicht zu bemerken schien. »Bringen Sie ihn zurück zum Boot«, sagte Brunetti zu den beiden Polizisten. Und setzte, an Vianello gewandt, hinzu: »Wenn Sie ihn nach Hause begleiten würden?«
Pucetti sah den Commissario fragend an.
»Helfen Sie Vianello, den Dottore an Bord zu schaffen, und dann kommen Sie zurück«, sagte Brunetti, der darauf zählte, daß Pucettis Intelligenz und angeborene Neugier – nicht zu vergessen seine Altersnähe zu den Kadetten – ihm deren Befragung erleichtern würde. Die beiden Beamten setzten sich in Bewegung; Moro taumelte so ungelenk zwischen ihnen, als nähme er seine Helfer gar nicht wahr.
Brunetti sah ihnen nach, während sie den Hof verließen. Die Jungen spähten hin und wieder verstohlen in seine Richtung, aber kaum daß er ihren Blick erwiderte, schauten sie sofort weg oder starrten durch ihn hindurch auf die rückwärtige Mauer, als ob der Commissario Luft wäre.
Als Pucetti nach ein paar Minuten zurückkam, bat Brunetti ihn herauszufinden, ob am Abend zuvor etwas Ungewöhnliches vorgefallen sei, und sich ein Bild von dem jungen Moro zu machen sowie die Meinung seiner Klassenkameraden über ihn einzuholen. Brunetti wußte, daß man diese Dinge jetzt klären mußte, bevor die Zöglinge ihre Aussagen miteinander absprechen konnten und bevor der Tod des Jungen sie veranlaßte, alles, was sie über ihn zu sagen hatten, mit jenem Schwachsinn zu verbrämen, der sich wie klebriger Zuckerguß auf Heiligen- und Märtyrerlegenden legt.
[31] Sobald draußen der ersehnte Zweiklang der Sirene aufheulte, ging Brunetti dem Team von der Spurensicherung bis zur Uferpromenade entgegen. Das weiße Polizeiboot drehte am Kanalufer bei; vier uniformierte Beamte stiegen aus und hievten die Koffer und Taschen mit der Ausrüstung von Bord.
Die beiden Kriminaltechniker folgten zum Schluß. Brunetti winkte ihnen, die Männer griffen nach ihren Tatortkoffern und steuerten auf ihn zu. Als sie vor ihm standen, erkundigte sich Brunetti bei Santini, dem Teamleiter: »Wer kommt von der Rechtsmedizin?«
Die gesamte Kriminaltechnik teilte Brunettis Vorliebe für Dottor Rizzardi, und so befleißigte sich Santini einer besonderen Betonung, als er antwortete: »Venturi« und den Titel bewußt unterschlug.
»Ah«, meinte Brunetti, ehe er kehrtmachte und die Männer in den Hof führte. Die Leiche sei oben, sagte er und ging den anderen voraus in den dritten Stock und den Flur entlang bis zu der offenen Tür des Waschraums.
Daß er Santini und seine Leute nicht hineinbegleitete, geschah nicht aus Sorge, etwaige Spuren am Tatort zu verwischen. Er wollte die Männer einfach in Ruhe arbeiten lassen und kehrte unterdessen in den Hof zurück.
Dort fand er weder Pucetti noch die Kadetten. Letztere waren entweder im Unterricht oder oben auf ihren Zimmern: Im einen wie im anderen Fall hatten sie sich dem Zugriff der Polizei entzogen.
Brunetti ging noch einmal zu Bembo hinauf und klopfte an der Tür. Als keine Antwort kam, klopfte er abermals und drückte dann probeweise auf die Klinke. Die Tür war [32] verschlossen. Er klopfte noch einmal, doch drinnen regte sich nichts.
Auf dem Weg zurück ins Treppenhaus öffnete Brunetti eine nach der anderen die Türen zum Flur und spähte in die dahinter liegenden Klassenzimmer: Im ersten waren die Wände mit Tabellen und Landkarten bedeckt, im nächsten zwei Tafeln mit Algebraformeln vollgeschrieben, und im dritten hing eine riesige Wandtafel, auf der sich ein Heer von Pfeilen und Linien zu einem komplizierten Diagramm zusammenfügte, wie man es aus Geschichtsbüchern zur Illustration von Truppenbewegungen oder Frontverläufen kennt.
Dieser Plan hätte Brunetti, der im Lauf der Jahre schon etliche hundert Militärhistoriker gelesen hatte, normalerweise gewiß interessiert, doch heute schenkte er der Skizze nur einen flüchtigen Blick, bevor er die Tür wieder schloß. Dann stieg er hinauf in den dritten Stock, wo sich früher sehr wahrscheinlich die Dienstbotenkammern befunden hatten, und dort fand der Commissario endlich, was er suchte: die Schlafräume der Kadetten. Zumindest vermutete er das angesichts der nicht zu dicht aufeinanderfolgenden Türen, neben denen jeweils links ein Kärtchen mit zwei Nachnamen in einem adretten Plastikhalter steckte.
Brunetti klopfte an die erste Tür. Keine Antwort. Ebensowenig bei der zweiten. Als er vor der dritten von innen ein schwaches Geräusch zu hören glaubte, trat er ein, ohne die Namen auf der Karte zu lesen. Ein junger Mann saß mit dem Rücken zu Brunetti an einem Schreibtisch vor dem Fenster und wand sich auf seinem Stuhl, als versuche er sich daraus zu befreien. Oder war das ein Anfall? Obwohl [33] Brunetti die heftigen Zuckungen nicht geheuer waren, scheute er sich, näher zu treten, aus Angst, den Jungen zu erschrecken und seinen Zustand zu verschlimmern.
Während er noch unschlüssig auf der Schwelle stand, ließ der junge Mann plötzlich den Kopf auf die Tischplatte sinken, breitete die Arme aus und schlug dreimal mit der flachen Hand aufs Holz. Dazu stimmte er ein durchdringendes »Yaah, yaah, yaah« an und hielt den letzten Ton so lange, bis der Drummer, den Brunetti selbst auf die Entfernung hören konnte, zu einem langgezogenen letzten Riff ansetzte, dessen Rhythmus der Junge zur Begleitung mit den Fingern auf die Tischkante trommelte.
In das Intro zum nächsten Stück hinein bellte Brunetti mit absichtlich überlauter Stimme: »Kadett!«
Der scharfe Kommandoton durchdrang das Wummern in den Kopfhörern, und der Junge sprang auf die Füße. Hastig wandte er sich nach der Stimme um, und seine Rechte schoß salutierend an die Stirn, verfing sich dabei aber so unglücklich im Kabel der Kopfhörer, daß der Discman zu Boden krachte und die Kopfhörer gleich mitriß.
Die CD war bei dem Aufprall offenbar nicht aus der Spur geraten, denn Brunetti erkannte immer noch den Baß, der wummernd bis zu ihm herüberschallte. »Hat Ihnen noch keiner gesagt, wie schädlich das fürs Gehör ist?« erkundigte sich Brunetti im Plauderton. Wenn er die nämliche Frage seinen Kindern stellte, dämpfte er die Stimme für gewöhnlich zu einem Flüstern, was die ersten paar Male erfolgreich dazu geführt hatte, daß sie ihn baten, seine Worte zu wiederholen. Inzwischen aber hatten sie seine Taktik durchschaut und ignorierten ihn einfach.
[34] Der Junge, der völlig verdutzt dreinblickte, ließ langsam den Arm sinken. »Was sagten Sie?« fragte er und fügte, der Macht der Gewohnheit folgend, ein »Signore« an. Er war groß und spindeldürr, und sein schmales Kinn sah aus, als sei eine Hälfte mit einer stumpfen Klinge rasiert worden, während die andere von den Narben einer hartnäckigen Akne gezeichnet war. Seine mandelförmigen Augen aber waren mädchenhaft schön.
Mit zwei Schritten durchmaß Brunetti den Raum. Er merkte wohl, wie der Körper des Jungen sich bei seiner Annäherung versteifte, doch er bückte sich lediglich, um Discman und Kopfhörer aufzuheben, und legte beides vorsichtig auf den Schreibtisch. Das spartanisch eingerichtete Zimmer wirkte eher wie die Behausung eines Roboters als wie die eines oder – wenn er die Stockbetten richtig deutete – zweier junger Männer.
»Ich sagte, zu laute Musik kann Ihr Gehör schädigen. Das predige ich auch meinen Kindern immer, aber sie hören nicht auf mich.«
Die Antwort verwirrte den Jungen noch mehr; offenbar war es ihm ganz ungewohnt, daß ein Erwachsener ihn als Gesprächspartner ernst nahm. »Ja, meine Tante sagt das auch.«
»Aber Sie hören nicht auf sie?« fragte Brunetti. »Oder glauben Sie ihr etwa nicht?« Er war ehrlich neugierig.
»Doch, ich glaube ihr schon«, entgegnete der Junge, der sich immerhin so weit gefangen hatte, daß er seinen Discman ausschaltete.
»Aber?« hakte Brunetti nach.
»Ist nicht weiter wichtig«, sagte der Junge achselzuckend.
[35] »Nein, sagen Sie schon«, beharrte Brunetti. »Es interessiert mich wirklich.«
»Mir ist egal, was mit meinem Gehör passiert«, erklärte der Junge.
»Egal?« fragte Brunetti verständnislos. »Ob Sie taub werden?«
»Nein, das nicht.« Der Junge sah Brunetti aufmerksam an. Offenbar wollte er sich ihm jetzt wirklich verständlich machen. »Aber bis es soweit kommt, das dauert Jahre und Jahre. Darum ist es egal. Genau wie das mit der globalen Erwärmung. Alles, was so lange dauert, kann mir egal sein.«
Brunetti hatte keinen Zweifel daran, daß der Junge es ernst meinte. »Aber Sie gehen zur Schule, bereiten sich auf eine künftige Karriere vor – vermutlich eine militärische Laufbahn. Die wird auch noch etliche Jahre auf sich warten lassen. Ist Ihnen die denn auch egal?«
Der Junge antwortete erst nach einigem Überlegen. »Das ist was anderes.«
Brunetti ließ nicht locker. »Wieso?« fragte er.
Das ungezwungene Gespräch und die Ernsthaftigkeit, mit der Brunetti auf ihn einging, nahmen dem Jungen allmählich seine Befangenheit. Er setzte sich auf den Schreibtisch, griff nach einem Päckchen Zigaretten und hielt es Brunetti hin. Als der verneinend den Kopf schüttelte, fischte der Junge sich eine Zigarette heraus und tastete über die Tischplatte, bis er, unter einer Kladde versteckt, ein Plastikfeuerzeug fand.
Er zündete die Zigarette an, warf das Feuerzeug wieder hin und nahm einen tiefen Zug. Brunetti fiel auf, wie sehr er sich anstrengte, älter und weltläufiger zu wirken, als er [36] war. Dann blickte der Junge zu ihm auf und sagte: »Weil ich mir die Musik aussuchen kann, die Schule aber nicht.«
Brunetti sah zwar ein, daß das für sein Gegenüber einen gewaltigen Unterschied machte, wollte indes nicht näher darauf eingehen und erkundigte sich statt dessen nach dem Namen des Jungen. Wobei er umstandslos zum vertraulichen tu überging, wie er das vom Umgang mit den Freunden seiner Kinder gewohnt war.
»Giuliano Ruffo«, lautete die Antwort.
Nun stellte sich auch Brunetti vor, ganz formlos, also nur mit Namen, ohne Dienstgrad. Dabei machte er einen Schritt auf Ruffo zu, der sich aufrichtete und die Hand schüttelte, die Brunetti ihm entgegenstreckte.
»Kanntest du ihn? Ich meine den Toten.«
Ruffos Miene erstarrte, die Ungezwungenheit war dahin, und er schüttelte nur mechanisch den Kopf. Ehe Brunetti fragen konnte, wie denn jemand in dieser eher kleinen Schule hatte anonym bleiben können, meinte der Junge: »Das heißt, ich habe ihn nicht gut gekannt. Wir hatten nur ein Fach zusammen.« Auch seine Stimme klang nicht mehr unbefangen, und er stieß die Worte so hastig hervor, als wolle er sich von dem Gesagten distanzieren.
»Welches denn?«
»Physik.«
»Und was hast du sonst noch belegt?« fragte Brunetti. »Du bist in der zweiten Jahrgangsstufe, oder?«
»Jawohl. Wir haben Latein, Griechisch, Mathematik, Englisch und Geschichte, und dazu kommen noch zwei Wahlfächer.«
»Und bei dir ist eins davon Physik?«
[37] »Ja, Signore.«
»Und das andere?«