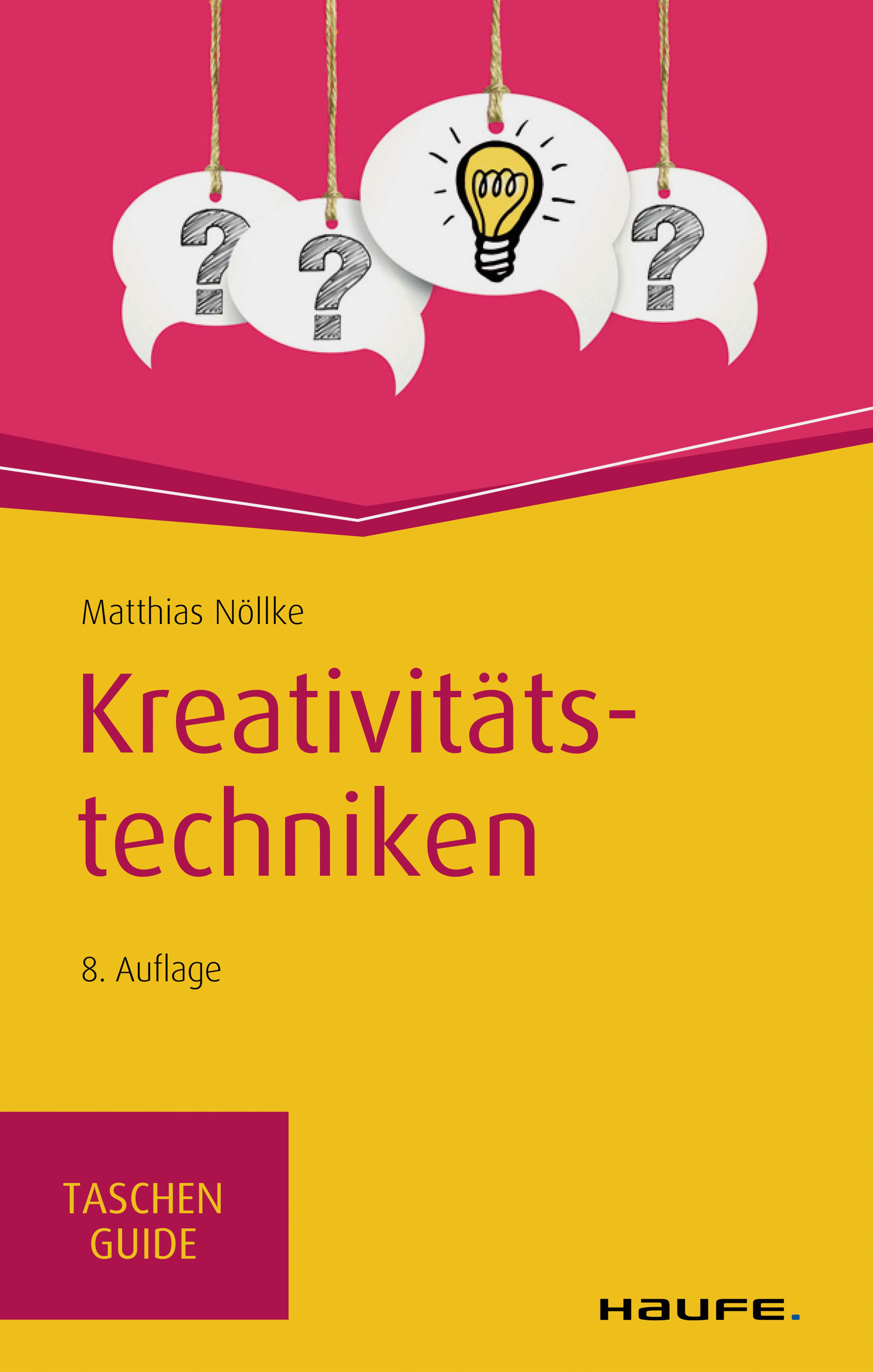28,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Haufe Lexware
- Kategorie: Fachliteratur
- Serie: Haufe Sachbuch Wirtschaft
- Sprache: Deutsch
Auf Vertrauen kommt es an - auch und gerade im Beruf. Welche Vorteile hat eine vertrauensbasierte Zusammenarbeit? Wann ist Vertrauen eine riskante Vorleistung? Wie können Sie verlorengegangenes Vertrauen zurückgewinnen? Dieses Buch gibt Ihnen Auskunft - fundiert, verständlich und praxisnah. Inhalte: - Wie Vertrauen zustandekommt, wie es sich im beruflichen Umfeld entwickelt und sich vom Vertrauen von Freunden unterscheidet - Wo Vertrauen förderlich und wo es eher hinderlich oder riskant ist - Wie es verspielt wird und man es wieder erwirbt - Mit einem Geleitwort von Jochen Mai: "Gesundes Vertrauen kennt Grenzen"
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 357
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Hinweis zum Urheberrecht
Haufe-Lexware GmbH & Co. KG, Freiburg
Impressum
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar.
Print: ISBN 978-3-648-08682-7 Bestell-Nr. 00128-0002ePub: ISBN 978-3-648-08683-4 Bestell-Nr. 00128-0101ePDF: ISBN 978-3-648-08684-1 Bestell-Nr. 00128-0151
Matthias Nöllke
Vertrauen im Beruf
2. Auflage 2016© 2016 Haufe-Lexware GmbH & Co. KG, [email protected]
Produktmanagement: Anne Rathgeber
Lektorat: -
Satz: kühn & weyh Software GmbH, Satz und Medien, FreiburgUmschlag: RED GmbH, KraillingDruck: BELTZ Bad Langensalza GmbH, Bad Langensalza
Alle Angaben/Daten nach bestem Wissen, jedoch ohne Gewähr für Vollständigkeit und Richtigkeit.
Alle Rechte, auch die des auszugsweisen Nachdrucks, der fotomechanischen Wiedergabe (einschließlich Mikrokopie) sowie der Auswertung durch Datenbanken oder ähnliche Einrichtungen, vorbehalten.
Vielen Dank für Ihr Vertrauen!
„Alles Reden ist sinnlos, wenn das Vertrauen fehlt.“
Franz Kafka
Das Berufsleben gilt nicht unbedingt als Hort des Vertrauens. Eher müssen Sie aufpassen. Die Konkurrenz schläft nicht. Wer zu vertrauensselig ist, der hat schnell das Nachsehen. „Nur die Paranoiden überleben”, befand der Gründer des Chipherstellers Intel, Andrew Grove. Ein bisschen Verfolgungswahn kann sich durchaus positiv auf die Karriere auswirken. Auf der andern Seite kommt es – gerade im Beruf – ganz entscheidend auf Vertrauen an. Ob Sie nun Führungskraft sind, Mitarbeiter, Rechtsanwältin, Autor oder Kassiererin im Supermarkt. Wenn Sie kein Vertrauen genießen, können Sie buchstäblich einpacken. Und wenn Sie selbst niemandem so recht vertrauen, dann sind Sie in Ihren eigenen Handlungsmöglichkeiten stark eingeschränkt.[2]
„Vertrauen ist die Strategie mit der größeren Reichweite”, schreibt der Soziologe Niklas Luhmann. Ohne jemandem Vertrauen zu schenken, bleiben Sie auf sich allein gestellt und können kaum etwas bewirken. Und bewirken möchten wir alle etwas. Vor allem auf andere Menschen möchten wir einwirken. Denn wir Menschen sind zutiefst soziale Wesen. Daher beschäftigt uns kaum etwas so sehr wie die Frage, ob wir jemandem trauen können oder nicht. Immer wieder machen wir die Erfahrung: Vertrauen können wir nicht jedem. Und wir können nicht auf alles vertrauen. „Wer damit anfängt, dass er allen traut, wird damit enden, dass er einen jeden für einen Schurken hält”, heißt es warnend in dem Drama Demetrius von Friedrich Hebbel. Die Strategie der größeren Reichweite geht nur dann auf, wenn Sie eine realistische Vorstellung davon haben, wo und wann Sie nicht mehr vertrauen dürfen, wo und wann Misstrauen angebracht ist.
Genau darum geht es in diesem Buch: Gut mit Vertrauen umzugehen im Beruf. Denn Vertrauen ist die Grundlage jeder Kooperation. Dass wir einander vertrauen, auf halbwegs verlässlicher Grundlage, das macht uns so überaus erfolgreich. Allen Klagen über die menschliche Durchtriebenheit zum Trotz, unsere Spezies versteht sich meisterhaft darauf zu kooperieren. Wir sind „superkooperativ”, um mit dem Harvard-Mathematiker und Biologen Martin A. Nowak zu sprechen. Diese Fähigkeit wird angetrieben durch Vertrauen.[3]
Nun ist das Thema Vertrauen immer wieder von der Managementliteratur entdeckt worden. An erster Stelle wäre hier wohl das einflussreiche Buch von Reinhard K. Sprenger zu nennen, das schon in seinem Titel programmatisch verkündet: „Vertrauen führt”. Andere haben Vertrauen als „soziale Ressource” beschrieben, und manche würdigen es gar als „gesellschaftliches Schmiermittel”, das die zahllosen Risse kittet, die sich in unserer unübersichtlichen Welt tagtäglich auftun.
In diesem Zusammenhang taucht auch immer wieder ein Argument auf, mit dem schon Sprenger für mehr Vertrauen in den Führungsetagen geworben hat: Vertrauen sorgt für wirtschaftlichen Erfolg. Es zahlt sich gewissermaßen aus zu vertrauen. Sogar wenn in einzelnen Fällen Vertrauen enttäuscht wird, so überwiegen doch bei weitem die Vorteile. Misstrauen kommt eine Organisation hingegen teuer zu stehen. Margit Osterloh, Professorin an der Universität Zürich, nennt Vertrauen denn auch den „wichtigsten Wettbewerbsvorteil von Nationen und Unternehmen”. Überboten wird sie noch von Managementberater Stephen M. R. Covey, nicht zu verwechseln mit seinem Vater Stephen R. Covey, der den Bestseller „Sieben Wege zur Effektivität” geschrieben hat. Covey Junior hält Vertrauen nicht nur für eine „unterschätzte ökonomische Macht”, sondern den Aufbau von Vertrauen für „die Schlüsselkompetenz für alle Führungskräfte in unserer neuen globalen Wirtschaft”. Denn, so Covey, „nichts wirkt schneller und effektiver als Vertrauen – in allen Situationen”.[4]
Die Argumente für mehr Vertrauen in den Unternehmen lassen sich auf die folgenden Thesen verdichten:
Vertrauen macht vieles einfacher und reduziert Kosten. Es spart Kontrollen, komplizierte Regelungen und Transaktionskosten.
Vertrauen sorgt dafür, dass Abläufe im Unternehmen schneller vonstatten gehen. Auch das erhöht die Wettbewerbsfähigkeit.
Wem Vertrauen geschenkt wird, der ist motiviert, sein Bestes zu geben. Das Leistungsniveau steigt.
Vertrauen im Unternehmen verbessert das Betriebsklima, reduziert die Fluktuation und macht das Unternehmen für qualifizierte Stellenbewerber attraktiv.
Vertrauen macht es möglich, Krisen zu meistern und schmerzhafte Veränderungen durchzustehen.
In diesem Buch wird eine etwas andere Position vertreten. Ohne Zweifel sind die angesprochenen Prinzipien sehr sympathisch und auch wirksam – dauerhaft jedoch nur in einem „Reinraum des Vertrauens”, in dem sich kein Stäubchen Misstrauen mehr auf die empfindlichen Schaltkreise des Vertrauens setzen kann. Doch unsere Beziehungen, in der Arbeitswelt zumal, sind auch von Neid und Misstrauen geprägt. Von Verleumdungen, Gedankenlosigkeit, schmutzigen Tricks und blanker Rücksichtslosigkeit. Was keineswegs ausschließt, dass sich Menschen, die auf ihrem Weg nach oben eine besonders „breite Blutspur” hinterlassen, sehr gerne auf Werte und Vertrauen berufen. Wie überhaupt der Grundsatz gilt: Wer mit dem Vertrauen der anderen glänzende Geschäfte macht, hat es nicht immer verdient.[5]
Und so erscheint es fraglich, ob mehr Vertrauen zu schenken tatsächlich wirtschaftlich erfolgreich macht und die Kosten senkt. Der Blick auf das eine oder andere hochprofitable Erfolgsunternehmen lässt Zweifel aufkommen, ob es sich dabei wirklich um einen Hort des Vertrauens handelt. Und ob sie „noch erfolgreicher” wären, wenn in diesen „Haifischteichen” jetzt vertrauensvoll zusammengearbeitet würde. In manchen Fällen mag es auch geradewegs andersherum sein: Nicht Vertrauen führt zum Erfolg, sondern ein Unternehmen, das wirtschaftlich erfolgreich ist, leitet daraus den Anspruch ab, besonders vertrauenswürdig zu sein. Gerät das Unternehmen in die Krise, bröckelt dieser vertrauenerweckende Nimbus. Gerade jetzt fehlt es an der „sozialen Ressource” Vertrauen. Bei der Belegschaft, aber auch bei den Eigentümern: Nicht selten wird jemand von außen geholt, eine neue integre Führungsfigur, die noch unbelastet ist. Nur ihr traut man zu, das Vertrauen zurückzugewinnen.
Damit soll natürlich nicht das Gegenteil behauptet werden, nämlich dass Vertrauen unwichtig sei oder dem wirtschaftlichen Erfolg sogar im Wege stehe. Ohne ein gehöriges Maß an Vertrauen geht es sogar in den Haifischteichen nicht. Zugleich aber kommen auch Organisationen, in denen vertrauensvoll zusammengearbeitet wird, nicht ohne Konkurrenz, Kontrolle und Misstrauen aus. Misstrauen sorgt dafür, dass wir Selbstverständliches in Frage stellen. Und wenn wir wissen, dass uns jemand sehr genau auf die Finger schaut, muss sich das nicht immer negativ auf unser Arbeitsergebnis auswirken.[6]
Im Übrigen aber sollen die Verdienste der genannten Autoren überhaupt nicht geschmälert werden. Um mit dem bekannten Gleichnis zu sprechen, ist dieses Buch gewissermaßen der Zwerg, der sich auf ihren Schultern niederlässt, um dann aber in eine andere Richtung zu blicken. Vertrauen ist gewiss eine Ressource, die heute in den Unternehmen nicht gerade im Überfluss vorhanden ist, so dass man sich an der einen oder anderen Stelle durchaus mehr Vertrauen wünscht. Die genannten Thesen sind ja nicht falsch, nur ergänzungsbedürftig. Denn Vertrauen ist kein universeller Problemlöser und keine sonnige Siegerstrategie, sondern etwas so Vielschichtiges und Fundamentales, dass Führungskräfte „gut” damit umgehen sollten.
„Gut” bedeutet nicht, dass Führungskräfte möglichst viel und oft vertrauen sollten. Misstrauen ist nicht in jedem Fall schlecht und Vertrauen nicht immer eine rundum erfreuliche Angelegenheit. Das gilt auch für den Fall, dass Ihnen jemand vertraut. Es ist gar nicht so selten, dass sich hinter dem bereitwillig gespendeten Vertrauen eine subtile Form der Vereinnahmung verbirgt. Vertrauen verbindet, es bindet Sie aber auch. Sie sind nicht mehr frei, nach eigenem[7] Willen zu entscheiden und zu handeln. Setzen Sie sich über die Erwartungen der anderen hinweg, was manchmal unvermeidlich ist, verlieren Sie deren Vertrauen. Das kann ohnehin erstaunlich schnell dahinschmelzen. Insoweit ist Stephen M. R. Coveys Aussage, nichts wirke „schneller” als Vertrauen, zu ergänzen durch den Zusatz, „nichts kann sich rascher verflüchtigen als Vertrauen”. Mitunter genügt eine bloße Gedankenlosigkeit, eine unscheinbare Handlung, eine verräterische Geste, und das Vertrauen ist dahin. Versuchen Sie dann mit vertrauensbildenden Maßnahmen dagegen anzusteuern, vergrößern Sie womöglich noch den Argwohn. Wie überhaupt nachträgliche Reparaturmaßnahmen oft wenig ausrichten können.
In anderen Fällen ist das Vertrauen weit robuster, ja, mitunter beängstigend robust. Dann lässt sich der etwas paradoxe Effekt beobachten, dass besonders schwere Vorwürfe und stark belastende Indizien das Vertrauen sogar noch festigen. Es liegt auf der Hand, dass dieses unerschütterliche Vertrauen alles andere als wünschenswert ist. Vielmehr müssen wir aufpassen, nicht in eine solche „Vertrauensfalle” hineinzugeraten. Das führt nämlich zu einem Realitätsverlust, der dramatische Ausmaße annehmen kann.
Überhaupt bietet das Thema Vertrauen manche Überraschungen. So gestaltet sich das Verhältnis von Vertrauen und Misstrauen weit vielschichtiger, als es zunächst den Anschein hat. Und damit ist nicht allein gemeint, dass anfängliches Misstrauen einem besonders belastbaren Vertrauen den Boden bereiten kann. Es ist ebenso möglich, dass Misstrauen oder enttäuschtes Vertrauen dazu führen, einem unbeteiligten Dritten das Vertrauen mehr oder minder unbesehen zufallen zu lassen: Man schenkt ihm sein Vertrauen, weil man einem anderen nicht (mehr) vertraut.[8]
Aber auch das Verhältnis von Vertrauen und Transparenz gestaltet sich nicht immer so, wie wir es erwarten würden: Transparenz gilt als vertrauensbildend. Und in zahlreichen Fällen trifft dies auch unbedingt zu. Aber als Allzweckwaffe und unumstößliches Grundprinzip kann Transparenz vertrauensvolle Beziehungen auch regelrecht zerstören. In manchen Unternehmen findet genau das statt: Alles soll so transparent gemacht werden, dass sich nirgendwo mehr Vertrauen bilden kann. Und als besondere Pointe werden die betreffenden Maßnahmen als Förderung einer „Vertrauenskultur” gepriesen. Dabei zeichnet es Vertrauen aus, dass es eine gewisse Zahl an Fehlern und Abweichungen vom vorgezeichneten Weg toleriert – gerade weil wir gewiss sind, dass die Richtung stimmt.
Ein weiteres wichtiges Thema betrifft Vertrauen und Verantwortung. Auch dort verschieben sich mitunter auf überraschende Weise die Gewichte. So kommt es immer wieder vor, dass ein Vertrauensbruch demjenigen angelastet wird, der ihm zum Opfer fällt. Und in manchen Fällen nicht einmal zu Unrecht. Denn Vertrauen ist eine zweiseitige Angelegenheit. Wir sind auch dafür verantwortlich, wem wir vertrauen und worauf wir unser Vertrauen gründen.
Über solche und ähnliche Mechanismen werden Sie in diesem Buch lesen. Denn mich hat vor allem interessiert, wie Vertrauen „funktioniert”, auf welche Weise es zustande kommt und wieder zerbricht. Im Unterschied zu anderen Publikationen über dieses Thema geht es mir nicht darum, für mehr Vertrauen und Vertrauenswürdigkeit im Management einzutreten. Auch nicht um bestimmte Werte oder ethische Fragen, und zwar ausdrücklich nicht[9], weil ich die für unwesentlich hielte. Das Gegenteil ist der Fall. Doch ich glaube, dass es sehr hilfreich sein kann, das Thema Vertrauen einmal aus dieser „technischen”, ja vielleicht sogar ein wenig „misstrauischen” Perspektive zu betrachten. Gerade nicht, um Vertrauen in Zukunft instrumentell zu gebrauchen, sondern ich bin fest davon überzeugt, dass dieser kühle, distanzierte Blick dafür sorgen wird, Vertrauen besser zu verstehen. So hoffe ich sehr, dass Ihnen dieses Buch helfen wird, „gut” mit Vertrauen umzugehen.
Dabei handelt es sich um die komplett überarbeitete Neuauflage meines Buchs „Vertrauen” aus Jahr 2009, das mittlerweile vergriffen ist. Neue Forschungsergebnisse sind hinzugekommen. Vor allem aber habe ich bei meinen Vorträgen über dieses Thema in den anschließenden Gesprächen sehr viel dazugelernt, das nun in dieses Buch mit einließen soll. Und so hoffe ich, dass Sie es mit Gewinn und Vergnügen lesen werden. Über Ihre Anregungen und Kommentare freue ich mich. Schreiben Sie mir eine E-Mail unter:
Matthias Nöllke, München im Juli 2016[10]
Geleitwort: Gesundes Vertrauen kennt Grenzen
„Vertrauen ist der Anfang von allem” lautete der Slogan, mit dem die Deutsche Bank in den Neunzigerjahren ihre Finanzprodukte bewarb – und damit den Tenor der gesamten Branche traf: Sein sauer verdientes Geld gibt man eben nicht irgendwem, man vertraut es allenfalls einem Menschen mit seriösem Leumund an; einem dunkel gekleideten Finanzexperten, der einen ehrlich berät, der gewissenhaft lukrative Anlageformen auswählt und nahezu selbstlos hilft, den eigenen Wohlstand zu mehren. In der Theorie jedenfalls. Jeder weiß, was in der Praxis geschah: Eine gute Dekade später folgte die Finanzkrise und erschütterte das Vertrauen der Menschen in einem bis dato unbekannten Ausmaß. Weltweit fühlten sich die Menschen durch die so genannten Finanzexperten verraten und verkauft. Das Vertrauen – es war in diesem Fall der Anfang vom Ende.
Vertrauen macht gelassen, bis es enttäuscht wird. „Kann man denn niemandem mehr trauen?”, fragen sich folgerichtig all jene, deren Grundvertrauen zu oft von anderen Menschen enttäuscht wurde. Die einen werden daraufhin misstrauischer, andere regelrecht feindselig. Sie bauen sich eine Art psychosozialen Panzer aus Skepsis und Argwohn auf, um ja nicht noch einmal hinters Licht geführt zu werden, nach dem Motto: Wer mit der Niedertracht der anderen rechnet, kann nicht mehr böse überrascht werden. Das stimmt zweifellos, macht aber einsam.
Obwohl vermutlich jeder schon einmal übers Ohr gehauen wurde oder erlebt hat, dass sein Vertrauen ausgenutzt worden ist, hält die Mehrheit von uns an dem Konzept fest, anderen eine Art sozialen Kredit zu geben. Wir werden sprichwörtlich enttäuscht, ärgern uns, ziehen daraus Konsequenzen, aber vertrauen doch weiterhin – nur vielleicht nicht mehr diesem speziellen Menschen. Warum?[11]
Letztlich ist Vertrauen ein erlerntes Verhalten, das bis in die Kindheit zurückreichen kann. Unsere Vertrauensseligkeit entstammt im Kern zwei Komponenten: dem Selbstvertrauen, also der Zuversicht in die eigenen Fähigkeiten; und dem Fremdvertrauen gegenüber anderen Menschen. Beides sind dem Wesen nach Erfahrungswerte. Wer früh gelernt hat, dass er Erfolge aufgrund seines Könnens wiederholen kann und dass die Mehrheit der Menschen Vertrauen belohnt, bleibt auch später vertrauensvoll bis -selig. Man könnte auch sagen: Vertrauen ist eine erlernte Entscheidung. Wer vertraut, geht willentlich und zuversichtlich davon aus, dass sich eine Sache so entwickelt, wie versprochen oder erhofft. Ob das dann tatsächlich eintritt, steht freilich auf einem anderen Blatt.
Ein Grund für die anhaltende Zuversicht ist deren positive Wirkung – auf uns und andere. Schon 1968 führten die Psychologen Robert Rosenthal und Lenore Jacobson ein Experiment an amerikanischen Schulen durch, das in die Literatur als Rosenthal- oder Pygmalion-Effekt einging. Dazu teilten sie einigen Lehrern mit, dass sie aufgrund bisheriger Leistungen im kommenden Schuljahr eine Klasse übernehmen dürften, die sich aus den intelligentesten und besten Schülern zusammensetze. Nach Ablauf des Schuljahres waren diese Klassen deutlich besser als die anderen, ihre Noten, selbst der IQ der Schüler lag rund 20 Punkte höher als beim Durchschnitt. Nur hatten die Psychologen gelogen. Die Klassen setzten sich gar nicht aus den Besten zusammen, sondern aus einer Zufallsauswahl. Weil aber die Schüler selbst glaubten, zu den Besten zu gehören, und auch die Lehrer ihnen mehr zutrauten, stieg die Leistungs- und Lernkurve.[12]
Der zweite Grund: Vertrauen vollbringt ein kleines kognitives Wunder: Es minimiert Komplexität. Wir alle würden wohl früher oder später verrückt werden, wenn wir allem Neuen oder jedem fremden Menschen mit Angst, Abwehr und Misstrauen begegnen würden. Das gilt noch mehr im Berufsleben. Hier kommt noch hinzu, dass kaum einer von uns einen vollständigen Überblick über das Geschehen in seinem Unternehmen haben dürfte, nicht einmal die Chefs. Deshalb müssen wir uns schlicht auf manche Aussagen von Kollegen, Zulieferern und Kunden verlassen.
Als der Professor für Managementlehre an der McGill Universität in Montreal, Henry Mintzberg, einmal die Tagesabläufe von Managern untersuchte, stellte er überrascht fest, dass kaum einer länger als eine Stunde an einer Sache arbeitete. Weit über 50 Prozent der Tätigkeiten nahmen weniger als neun Minuten in Anspruch. Es lässt sich leicht vorhersagen, dass solche Manager ihre Entscheidungen kaum von ausgiebigen Recherchen oder umsichtigen Planungen abhängig machen. Sie werden sich vielmehr auf die wenigen Informationen verlassen, die ihnen gerade zur Verfügung stehen: Erfahrungen, Referenzen, Hörensagen. Kurzum: Weil ihnen der vollständige Überblick fehlt, müssen sie den wenigen Indizien vertrauen.[13]
Das passt ins Idealbild. Schließlich wünschen sich die meisten Manager ein Betriebsklima, das von Vertrauen und gegenseitigem Respekt geprägt ist. Aber ist das auch realistisch? Spätestens an dieser Stelle wird das Paradoxon des Vertrauens offenbar. Denn trotz der oben aufgeführten Vorzüge werden einige jetzt völlig zu Recht einwerfen, dass es in ihrem Betrieb ganz anders zugeht. Gewiss, man vertraut seinem Büronachbarn, vielleicht noch den Kollegen aus der eigenen Abteilung. Aber dann hört es auch schon auf. Mehrheitlich ist das Unternehmensklima geprägt von Machtspielen, von Konkurrenzdenken, Schuldzuweisungen und mal mehr, mal weniger versteckten Anfeindungen. Kurzum: Je lauter der Wunsch nach einem vertrauensvollen Umfeld formuliert wird, desto wahrscheinlicher ist es, dass dieser Idealzustand real gar nicht existiert (sonst müsste man ihn auch nicht einfordern).
Warum ist das so? Warum vertrauen und misstrauen wir gleichermaßen, obwohl ersteres doch offensichtlich die größeren Vorteile hat? Nur allzu oft wird Vertrauen mit Vertrautheit verwechselt. Letztere entsteht, wenn man sich besser kennen lernt, eine Weile zusammenarbeitet oder miteinander Geschäfte macht. Die jedoch dem Vertrauen innewohnende Gewissheit, sich auf den anderen wirklich verlassen zu können, entsteht jedoch erst unter Krisenbedingungen. Allein solche Schlechtwetterphasen bilden den Rahmen für die anschließende Metamorphose, in der sich die Vertrautheit bewährt und in Vertrauen verwandelt. Oder eben auch nicht, wie die eingangs erwähnte Finanzkrise eindrucksvoll zeigte. Danach war das Vertrauen einer ganzen Branche verspielt.[14]
Lenin wird der Ausspruch in den Mund gelegt „Vertrauen ist gut – Kontrolle ist besser”. Ein hohes Maß an gegenseitigem Vertrauen mag im Privaten wie im Beruf ein ebenso erleichterndes wie erstrebenswertes Ziel sein. In seiner Absolutheit aber wird Vertrauen zu Recht als blind und naiv geächtet und muss zwangsläufig enttäuscht werden. So erstrebenswert gegenseitiges Zutrauen auch ist: Gesundes Vertrauen kennt Grenzen.
Eines dieser Limits steckt allerdings schon in jedem Einzelnen von uns. Weil sich Vertrauen bewähren, sprich: wachsen muss, lässt es sich nicht erzwingen oder gar beschleunigen. Es ist kein Instantprodukt, sondern ein Reifungsprozess. Das bedeutet zugleich, dass es Konsequenzen hat, wenn wir einander mehr vertrauen (wollen). Dazu gehört der Verzicht auf kurzfristige Vorteile, auf all die kleinen fiesen Tricks und Winkelzüge, mit denen man zwar Karriere machen, aber kein Vertrauen bilden kann: Profilieren auf Kosten anderer, das Verschweigen eigener Unzulänglichkeiten, Aufgaben schönreden, Allianzen schmieden, das Ausnutzen von Schwächen bei Kollegen wie Untergebenen. Damit ist es dann vorbei. Das Buch von Matthias Nöllke zeigt sehr plastisch, was Vertrauen ist, wie es entsteht und funktioniert und was wir alle tun können, um schon verspieltes Vertrauen wieder zurückzugewinnen. Der Glaube daran, dass dies gelingen kann, ist bereits der erste Vertrauensakt.[15]
Jochen Mai
Jochen Mai, Kommunikations- und Strategieberater, Autor und Blogger (karrierebibel.de), leitete mehr als zehn Jahre das Ressort „Management und Erfolg” bei der Wirtschaftswoche. Er gehört zu den einflussreichsten Experten im Bereichen Social Media und Content Marketing.
1 Was ist Vertrauen?
„Lieber Geld verlieren als Vertrauen.“
Robert Bosch
Sagen wir es offen: Vertrauen ist ein etwas unscharfer Begriff. Das ist kein Nachteil. Fast könnte man sagen, es ist Teil des Programms. Denn dank dieser Unschärfe lässt sich Vertrauen vielfältig einsetzen, für die kleinen Alltäglichkeiten ebenso wie für die ganz großen Fragen. Und besonders interessant wird es, wenn die Bedeutung von Vertrauen hin- und hergeschoben wird, wenn es einmal ganz klein und einmal ganz groß gemacht wird. Dabei wird die Sache zusätzlich dadurch erschwert, dass sich Vertrauen einem direkten Zugriff überhaupt entzieht und man sich seiner nie so recht sicher sein kann. Je tiefer man nachbohrt und den Begriff hin- und herwendet, umso mehr scheint sich das Vertrauen zu verflüchtigen. Vertrauensvolle Beziehungen zeichnen sich gerade dadurch aus, dass nicht darüber gesprochen wird, wie sehr man sich vertraut; eben weil es sich von selbst versteht. Es erweckt sogar Argwohn, wenn jemand unvermittelt seine Vertrauenswürdigkeit thematisiert. Um Vertrauen werben sollte nur der, der es nicht hat. Ansonsten setzt er sich dem Verdacht aus, dass irgendetwas nicht stimmt.[16]
Vertrauen zu anderen Menschen schätzen wir als etwas sehr Kostbares – und Seltenes. So wurde kürzlich in einem Internetforum die Frage diskutiert, wie vielen Menschen man wirklich vertrauen könne. Die meisten Antworten bewegten sich in einem Bereich zwischen null und drei Personen. Und in keinem Fall war jemand darunter, mit dem die Betreffenden beruflich zu tun hatten. So ist das eben, wenn man Vertrauen mit der Goldwaage misst: Es bleibt nicht viel davon übrig. Und in dunklen Momenten überfällt uns vielleicht sogar die Frage, wie sehr wir uns selbst trauen können. Denn es ist eine menschliche Grunderfahrung, dass wir manchmal ganz anders handeln, als wir möchten, und unseren eigenen Maßstäben nicht gerecht werden. Sogar uns selbst können wir also nicht immer über den Weg trauen. Wir täuschen uns, belügen uns und machen uns etwas vor. Und nach meinem Eindruck sind es gerade die vertrauenswürdigsten Mitmenschen, die zumindest versuchen, sich selbst nicht ganz auf den Leim zu gehen, und die sich deshalb selbst mit einer gewissen Distanz und einem gewissen Misstrauen beobachten. Wem können Sie wirklich vertrauen? Vielleicht nicht einmal sich selbst.
Auf der anderen Seite sind wir dann auch wieder sehr freigiebig mit unserem Vertrauen. Tagtäglich werfen wir damit nur so um uns. Ohne groß nachzudenken verlassen wir uns einfach auf unsere Mitmenschen. Wir vertrauen darauf, dass Züge halbwegs pünktlich fahren, Ärzte uns das richtige Medikament verschreiben, fremde Menschen auf unseren Koffer aufpassen, wenn wir sie freundlich darum bitten. Wir vertrauen einem Babysitter unser Kind an und unterschreiben Verträge, die wir nicht gelesen haben und/oder nicht verstehen. Wir vertrauen unserer Autowerkstatt, der Kassiererin im Supermarkt (wann haben Sie das letzte Mal das Wechselgeld nachgezählt?), wir vertrauen den Empfehlungen von Zeitungsredaktionen, welche Filme wir anschauen und welche Bücher wir lesen sollten. Mit einem Wort: Bei fast allem, was wir tun und lassen, ist ein wenig Vertrauen mit im Spiel, ohne dass wir ein Wort darüber verlieren. Dass wir überhaupt jemandem unser Vertrauen schenken, ist uns oft nicht einmal bewusst. Wir steigen nicht jeden Morgen in die U-Bahn in dem Bewusstsein, dass wir unser Leben jetzt den Bediensteten des öffentlichen Nahverkehrs anvertrauen.[17]
Erst wenn irgendetwas schief geht, werden wir darauf aufmerksam: Wir haben auf etwas vertraut, was keineswegs sicher ist. Es kommt vor, dass Züge nicht pünktlich ankommen, Ärzte fragwürdige Medikamente verschreiben, Verträge, die wir nicht aufmerksam lesen, nachteilige Klauseln enthalten und Zeitungsredaktionen Filme und Bücher empfehlen, die uns langweilen oder verärgern. Wir hätten diesen Menschen nicht trauen dürfen. Haben wir aber doch und müssen nun die unangenehmen Folgen ausbaden. In Zukunft werden wir uns vorsehen: lieber mit dem Auto fahren (weil wir meinen, dann würden wir bestimmt rechtzeitig ankommen), den Arzt wechseln oder überhaupt auf alternative Heilmethoden umschwenken (weil eine Arbeitskollegin da gute Erfahrungen gemacht hat), und die Tipps der betreffenden Zeitungsredaktion werden wir in Zukunft ignorieren, um den Empfehlungen einer anderen Redaktion zu folgen. Kurz gesagt: Enttäuschtes Vertrauen kann dazu führen, dass wir anderen[18] vertrauen, denen wir zuvor noch nicht vertraut haben. Nun bekommen sie auch ihre Chance.
1.1 Grundvertrauen in das Funktionieren der Welt
Uns bleibt eigentlich gar keine andere Wahl: Wir müssen uns auf zahllose Menschen verlassen, wenn wir überhaupt am gesellschaftlichen Leben teilnehmen wollen. In aller Regel bemerken wir dieses Vertrauen gar nicht. Es erscheint uns vollkommen selbstverständlich. Wir verlassen uns einfach darauf, dass die Welt im Wesentlichen funktioniert. Dass Trinkwasser aus der Leitung kommt, der Friseur mit der Schere umgehen kann und wir gefahrlos die Straße überqueren, wenn die Ampel grün für uns zeigt. Würden wir das nicht tun, hätten wir die allergrößten Schwierigkeiten. Wir wären gar nicht in der Lage, unseren Alltag zu meistern. Für dieses niederschwellige „Grundrauschen” an Vertrauen wird im Anschluss an die Terminologie von Niklas Luhmann der Begriff „Zuversicht” oder auch „Zutrauen” gebraucht. „Zuversicht” ist vielleicht kein ganz glücklicher Ausdruck, weil er sich in der Alltagssprache eher mit Hoffnung und Optimismus verbindet. Aber das, was damit bezeichnet ist, spielt für unser Thema eine wichtige Rolle. Es bildet eine Art Vertrauenssockel, auf dem wir unser tägliches Leben organisieren.[19]
Nun kann auch dieser Vertrauenssockel Risse bekommen, wodurch unser gewohntes Leben mehr oder weniger stark beeinträchtigt wird. Wer beispielsweise Opfer eines Einbruchs oder eines Überfalls geworden ist, berichtet häufig, dass dieses Grundgefühl von Sicherheit und Vertrauen abhanden kommt. Und das wird als weit unangenehmer empfunden als der materielle Verlust. Es kann eine ganze Weile dauern, bis man sich wieder gefangen hat und zu seinem gewohnten Leben zurückkehrt. In solchen Phasen der Verunsicherung helfen vertrauensvolle Beziehungen zu den Mitmenschen, allmählich wieder Boden unter den Füßen zu bekommen und Zutrauen zu fassen.
Solange wir auf unserem Vertrauenssockel agieren, ist alles in Ordnung. Wir fühlen uns stark und handlungsfähig – und neigen dazu, den Sockel zu unterschätzen. Daher ist es gewiss hilfreich, sich hin und wieder zu vergegenwärtigen, auf was für einem breiten, stabilen und hohen Sockel an Vertrauen wir unser tägliches Leben bestreiten, ja, bestreiten müssen. Ohne diesen Vertrauenssockel würden wir uns nicht mehr aus dem Haus trauen. Und wir würden uns sogar dort noch bedroht fühlen. In aller Schärfe gesagt: Ohne Vertrauenssockel würden wir zu einem Fall für die Psychiatrie.
Natürlich gibt es auch wesentlich mildere Formen der Beeinträchtigung unseres Grundvertrauens. Wenn sich beispielsweise die gewohnte Situation ändert, der öffentliche Nahverkehr lahm gelegt wird, kein Wasser mehr aus der Leitung kommt oder uns einer der vertrauten Lebensmittelskandale heimsucht, dann stellen wir uns oft erstaunlich schnell um. Wir bilden Fahrgemeinschaften, versorgen uns mit Wasserflaschen aus dem Supermarkt oder ändern zeitweilig unseren Speiseplan. Anders gesagt; Wieder einmal greifen wir auf Alternativen zurück, denen wir nun vertrauen. Oftmals kennen wir diese Optionen schon und wissen, dass wir auf sie ausweichen können. In anderen Fällen sind wir gezwungen, uns auf etwas Neues einzulassen. Aber auch dort taxieren wir im Voraus, wie vertrauenswürdig die Sache ist. Wenn sich keine vertrauenswürdige Alternative findet, gibt es nur die Möglichkeit, gar nichts zu tun oder aber sich auf eine Option einzulassen, der man eigentlich gar nicht richtig traut: Vertrauen in Notwehr sozusagen.[20]
1.2 Vertrauen in Notwehr und Als-ob-Vertrauen
Beim „Vertrauen in Notwehr” und dem „Als-ob-Vertrauen” handelt es sich um eine etwas paradoxe Angelegenheit. Dabei lassen wir uns auf eine Option ein, obwohl wir starke Vorbehalte haben. Wir schlucken gewissermaßen unser Misstrauen herunter, um handlungsfähig zu bleiben. Zum Beispiel misstrauen Sie Ihrem Arzt, der Bahn, den Nahrungsmittelherstellern oder Ihrer Autowerkstatt. Und Sie begeben sich trotzdem in ihre Hände. Was sollen Sie auch machen? Es gibt keine vertrauenswürdigere Alternative. Also entscheiden Sie sich für das kleinste Übel und hoffen das Beste.[21]
Echtes Vertrauen ist das nicht. Denn es fehlt etwas Entscheidendes: Das „gute Gefühl”. Wir schenken doch nur dann Vertrauen, wenn uns einigermaßen wohl dabei ist. Sind wir skeptisch, dann wäre es doch wohl angemessener, von Misstrauen zu sprechen. Wir trauen der Sache ja gerade nicht – verhalten uns aber so, als ob wir es täten. Das unterscheidet das „Vertrauen in Notwehr” vom echten Misstrauen. Da bleiben wir nicht stumm, da teilen wir uns mit, da gehen wir eben nicht das Risiko ein und liefern uns dem Betreffenden aus. Das schließt nicht aus, dass wir mit ihm kooperieren. Aber alles, was er tut, versuchen wir so genau wie möglich zu kontrollieren. Bevor der Arzt mit seiner Behandlung beginnen kann, holen wir eine zweite Meinung ein. Das ist Misstrauen. Weicht die Zweitmeinung ab und begeben wir uns dann in die Behandlung von Arzt Nummer zwei, handelt es sich womöglich um „Vertrauen in Notwehr”, wenn wir dem zweiten Arzt nämlich genauso wenig trauen wie dem ersten, aber der Ansicht sind, dass irgendetwas getan werden muss, um unseren beklagenswerten Gesundheitszustand zu ändern. Die Pointe dabei: In aller Regel hat der zweite Arzt keine Ahnung von unserer „Notwehrsituation”, sondern geht davon aus, dass wir ihm vertrauen.
Ein solches Als-ob-Vertrauen mag etwas sonderbar anmuten. Doch wie meine Gespräche vermuten lassen, ist es weit verbreitet. Und ein besonders fruchtbarer Boden für diese knorrige Pflanze ist das Berufsleben. Sehr oft haben die Vorgesetzten keine Ahnung, wie wenig ihnen die Mitarbeiter vertrauen. Aber die haben ja keine Wahl. Was ihr Vertrauen betrifft, befinden sie sich in einer permanenten „Notwehrsituation”. Einer meiner Gesprächspartner schilderte den fast schon ein wenig traurigen Fall, wie sich ein Vorgesetzter in dem Als-ob-Vertrauen seiner Mitarbeiter geradezu badete: „Er lief durch die Abteilung wie der Kaiser ohne Kleider. Er genoss es, sich bestätigen zu lassen, wie vertrauensvoll wir zusammenarbeiteten. Uns war das unsagbar peinlich.”[22]
Dabei handelt es sich nicht um ein rein vorgetäuschtes Vertrauen. Wer „in Notwehr” vertraut, lässt sich ja auf das Risiko ein, dass die Sache schief geht. Wer hingegen Vertrauen nur vortäuscht, trifft seine Vorkehrungen. Und auch das begegnet uns im Berufsleben nicht selten. Wir kommen auf das „Vertrauen in Notwehr” noch ausführlicher zu sprechen. Hier nur noch so viel: Es handelt sich um ein Vertrauen, das nicht sehr belastbar ist. Sobald sich eine vertrauenswürdige Option abzeichnet, ist die Zeit der „Notwehr” vorbei. Und es kann tatsächlich Vertrauen geschenkt werden. Allerdings sollte man sich nicht täuschen: Manche „Als-ob-Vertrauensverhältnisse” erweisen sich als ausgesprochen zählebig. Und man sollte auch eines nicht übersehen: Mit dem Als-ob-Vertrauen kann sich derjenige, der vertrauen „muss”, auch gegen Enttäuschungen schützen. Jemand, der „wirklich” vertraut, schlägt nach einem Vertrauensbruch nicht nur härter auf dem Boden der Realität auf, sondern seine Kompetenz steht in Frage, seine Mitmenschen zutreffend zu beurteilen. Wenn Sie hingegen „gleich so ein schlechtes Gefühl” bei der Sache hatten, wird Ihre Kompetenz in dieser Angelegenheit sogar noch bestätigt. Das nächste Mal hören Sie besser auf Ihr Bauchgefühl, sagen Sie sich. Haben Sie hingegen „wirklich” vertraut, stellt sich die Frage, woran Sie künftig Ihr Vertrauen festmachen wollen. Vielleicht sollten Sie aufpassen, sollten zusätzliche Informationen einholen oder jemanden um Rat fragen. Natürlich nur jemanden, der Ihr Vertrauen genießt.[23]
1.3 Vertrauen im Beruf
Viele Menschen machen einen deutlichen Unterschied zwischen Vertrauen in ihrer Privatsphäre und Vertrauen in ihrem Berufsleben. Weit verbreitet ist die Auffassung, dass es „echtes Vertrauen” nur im privaten Bereich gebe, in der Partnerschaft, in der Familie und unter Freunden. Im Beruf sei das anders. Hier herrschten Taktik und Konkurrenz. Menschliche Beziehungen seien Mittel zum Zweck und weit weniger verlässlich.
Ob dies tatsächlich so ist, wollen wir mal offen lassen. Auch privat geht gelegentlich Vertrauen zu Bruch, während im Beruf gar nicht selten sehr verlässliche Beziehungen bestehen. Und doch gibt es einen wichtigen Unterschied zwischen beiden Bereichen: Im Beruf erfüllen wir eine bestimmte Funktion, wir handeln in einem vorgegebenen Rahmen, wir folgen einer mehr oder minder festgelegten Rolle. Das kann dazu führen, dass wir uns im Beruf anders verhalten, als wir es als Privatleute tun würden.[24]
Darunter muss jedoch keineswegs unsere Vertrauenswürdigkeit leiden. Im Gegenteil, professionelle Standards sorgen dafür, dass unser Verhalten berechenbarer wird. Unser Gegenüber weiß, was er von uns erwarten kann und wo wir unsere Kompetenzen überschreiten würden. Im Privatleben sind solche Grenzen weit weniger klar gezogen. Wenn Sie sich nicht so verhalten, wie ich es gerne hätte, dann rechne ich das Ihnen zu: Sie wollten das so. Im Berufsleben haben Sie womöglich keine Wahl. Sie müssen so handeln. Und weil ich das weiß, nehme ich Ihnen das auch nicht persönlich übel. Ich erwarte es auch gar nicht anders von Ihnen.
Es kommt noch etwas hinzu: Der berufliche Rahmen stiftet oft überhaupt erst Vertrauen. Ich vertraue Ihnen, weil Sie Ärztin sind oder Busfahrer, bevor ich Sie überhaupt persönlich erlebt habe. Selbstverständlich können Sie dieses Vertrauen sehr schnell verspielen, wenn Sie Ihrer Aufgabe nicht gewachsen sind. Doch bekommen Sie in Ihrem Beruf einen Vertrauensvorschuss, den Sie sich als Privatperson erst verdienen müssten.
Auf der anderen Seite bleibt das Vertrauen im Beruf sehr viel stärker begrenzt, zeitlich und auch in der Sache. Auf die „Betriebstemperatur” des Vertrauens werden wir noch zu sprechen kommen. Es ist ein typisches Kennzeichen von Vertrauen im Beruf, dass es sich eher in gemäßigteren Zonen bewegt. Doch gerade das trägt häufig zu seiner Stabilität bei.
1.4 Vertrautheit als Voraussetzung von Vertrauen
[25]„Ich traue ihm nicht. Wir sind Freunde.“
Bertolt Brecht
Sobald es um echtes Vertrauen geht (und nicht mehr um Notwehr), kommt ein wichtiger Faktor ins Spiel: Vertrautheit. Wir müssen diejenigen, denen wir vertrauen, einschätzen können. Wen wir nicht durchschauen, dem vertrauen wir nicht so recht. Vertrauen gründet in Vertrautheit. Und tiefes, belastbares Vertrauen entsteht nur dort, wo man sich gut kennt. Nach Möglichkeit so gut, dass einem auch die Schattenseiten des anderen nicht verborgen geblieben sind. Dies ist ein Thema, das in anderen Büchern über Vertrauen im Business gewöhnlich mit Stillschweigen übergangen wird und uns auch daher noch eingehender beschäftigen wird.
Dabei wirkt Vertrautheit allein nicht schon vertrauensbildend. Gelegentlich tritt der gegenteilige Fall ein: Allmählich geht uns auf, dass wir dem anderen keineswegs mit Vertrauen begegnen sollten, sondern sehr genau aufpassen müssen. Vertrauen und Misstrauen sind hier „funktional äquivalent”, wie die Soziologen sagen. Das muss die Gegenseite jedoch nicht daran hindern, uns noch näher zu rücken, um unser Vertrauen zu gewinnen, ja uns das Vertrauen regelrecht abzufordern, da wir uns ja nun schon so gut kennen (→ 2.7 „Kennenlernspiele”). Auch ein solches Vertrauen fällt eher in die „Notwehr”-Kategorie, die uns im Geschäftsleben wie erwähnt häufiger begegnet.
Es bleibt aber eine wichtige Tatsache, dass zum Vertrauen ein gewisses Maß an Vertrautheit dazugehört. Wir brauchen die Gewissheit, dass wir den anderen gut genug kennen, um ihm zu vertrauen. Wir brauchen Erfahrungen mit ihm, am besten solche, bei denen er sich bewähren musste. Dann sind wir eher bereit, jemandem Vertrauen zu schenken. Wir unterstellen, dass er oder sie sich in Zukunft ganz ähnlich verhalten wird. Dabei kommt es ganz darauf an, wie viel für uns und die Gegenseite auf dem Spiel steht. In gewissen Angelegenheiten vertrauen wir nur einer Person, die wir außerordentlich gut kennen und für absolut vertrauenswürdig halten. Es wäre fahrlässig und unpassend, jemanden damit zu behelligen, der uns nur oberflächlich bekannt ist. Gar nicht einmal so sehr, weil sich diese Person als unzuverlässig erweisen könnte, sondern weil sie selbst sich überrumpelt fühlt und den Vertrauensspender mit einem gewissen Argwohn betrachten dürfte. Wer allzu leichtfertig vertraut, sozusagen: ohne angemessene Vertrautheit, der erweckt selbst nicht gerade Vertrauen. Er geht nicht sorgfältig genug mit dem Vertrauen um.[26]
Dabei gibt es durchaus Fälle, in denen es angemessen ist, auch völlig Unbekannten Vertrauen zu schenken. Und doch ist auch dort so etwas wie Vertrautheit mit im Spiel. Denn auch wenn wir sie nicht persönlich kennen, so ordnen wir diese Menschen doch in einen vertrauten Rahmen ein. Wir lassen die Leute von den Stadtwerken in unsere Wohnung, bezahlen beim Kellner für unseren Kaffee oder bitten einen Mitreisenden, einen Moment auf unser Gepäck aufzupassen. Wir tun dies, weil uns die betreffende Situation vertraut ist. Bei der Einschätzung der Situation halten wir uns an bestimmte Merkmale. Fehlen die, so werden wir misstrauisch. Sind wir es beispielsweise gewohnt, dass die Stadtwerke jeden Besuch vorher anmelden, lassen wir als rüstige Rentnerin den kräftigen jungen Herrn, der da vor unserer Tür steht, lieber nicht in die Wohnung – auch wenn er mit einem vermeintlichen Dienstausweis herumwedelt. Ebenso funktioniert unser Vertrauen zu dem unbekannten Mitreisenden. Können wir die Situation nicht einschätzen, werden wir ihn kaum mit unserer Bitte behelligen. Ebenso verhalten wir uns, wenn uns der Mitreisende irgendwie seltsam, also unvertraut erscheint. Und noch etwas ist wichtig: Gibt es verschiedene Kandidaten, unter denen wir auswählen können, dann halten wir uns an denjenigen, der uns am vertrautesten erscheint, womöglich weil er derjenige ist, der uns selbst am ähnlichsten ist (→ 2.2 Die „Ich-bin-wie-Sie-Methode”[27]).
1.5 Geber und Nehmer – Push & Pull
Gleich zu Anfang wollen wir zwei begriffliche Unterscheidungen einführen, die uns im Laufe dieses Buches noch weiter begleiten werden. Zunächst sind die beiden Rollen zu trennen, die bei jedem Vertrauensakt zu besetzen sind:
Der Vertrauensgeber ist derjenige, der einem anderen vertraut.
Die Vertrauensnehmerin ist diejenige, der vertraut wird.
Gelegentlich wird die Ansicht vertreten, dass sich „echtes Vertrauen” nur bilden kann, wenn es sich um eine wechselseitige Beziehung handelt. Also jede Vertrauensgeberin muss auch -nehmerin werden und jeder Nehmer muss auch bereit sein, in die Geberrolle zu wechseln – und zwar in der gleichen Beziehung. In diesem Buch teilen wir diese Einschätzung nicht. Eine stabile Vertrauensbeziehung kann durchaus sehr einseitig sein. Mehr dazu im Abschnitt über die unterschiedliche „Betriebstemperatur” von Vertrauen (→ 1.11 „Die unterschiedliche Betriebstemperatur des Vertrauens”[28]).
Mit der anderen Unterscheidung soll beschrieben werden, wer die ganze Sache überhaupt in Gang setzt.
Push: Als Vertrauensgeber trete ich auf Sie zu und schenke Ihnen Vertrauen. Als Vertrauensnehmer biete ich mich an, dass Sie mir vertrauen; ich werbe um Ihr Vertrauen.
Pull: Als Vertrauensgeber nehme ich Ihr Angebot an, Ihnen zu vertrauen. Als Vertrauensnehmer lasse ich mich auf Ihren Vertrauensvorschuss ein; ich bemühe mich, Ihrem Vertrauen gerecht zu werden.
Nicht immer lässt sich ganz klar beurteilen, welche Seite eigentlich „gepusht” hat. Und doch kann uns diese Unterscheidung helfen, einen Vertrauensakt zu beschreiben. Wer ist eigentlich die treibende Kraft dabei? Und wer reagiert und lässt sich auf die Sache ein?
1.6 Der Hebeleffekt von Vertrauen
Auf den ersten Blick scheint es wieder einmal paradox zu sein. Doch je mehr wir anderen vertrauen, desto weiter erstreckt sich unser Einfluss. Ohne Vertrauen sind wir ganz auf uns selbst zurückgeworfen und müssen alles in die eigene Hand nehmen. Und wenn wir uns selbst nicht vertrauen, sind wir völlig handlungsunfähig. Gleichzeitig aber ist es so, dass wir beim Vertrauen unsere Kontrolle und unsere Verantwortung abgeben. Nicht vollständig, wie wir noch sehen werden, aber im Wesentlichen lassen wir die anderen machen. Und zwar lassen wir sie in unserem Sinne agieren. Zumindest glauben wir das. Wir vertrauen darauf.[29]
Der große Vorteil besteht darin, dass wir entlastet werden. Um vieles müssen wir uns nicht mehr kümmern. Manches müssen wir nicht einmal begreifen. Solange wir jemanden haben, der die Angelegenheiten in unserem Sinne regelt, ist alles in Ordnung. Wir können von einem regelrechten „Hebeleffekt des Vertrauens” sprechen. Denn mit einem Mal können wir auch große und entfernte Dinge in Bewegung setzen, die sich vorher unserem Zugriff entzogen haben. In diesem Sinne verleiht Vertrauen fast magische Kräfte, die kein anderes Wesen so gut zu nutzen versteht wie wir Menschen. Pathetisch gesprochen beruht unsere Zivilisation zu einem Gutteil auf dem Hebeleffekt von Vertrauen.
Und doch ist die Sache aus zwei Gründen nicht ganz so einfach. Einmal weil Vertrauen die Gefahr in sich birgt, dass wir betrogen und ausgetrickst werden. Tatsächlich geschieht dies immer wieder. Und diejenigen, die uns hereinlegen, kommen mitunter erstaunlich gut davon, während wir nicht nur den Schaden haben, sondern auch nicht mehr so leicht jemandem vertrauen, was manchmal der noch größere Schaden ist. Einwand Nummer zwei: Diejenigen, die in Ihrem Sinne handeln sollen, müssen daraus ebenfalls ihre Vorteile ziehen. Sie können nicht davon ausgehen, dass die anderen freudig die „Galeere rudern”, während Sie es sich auf dem Sonnendeck bequem machen und darüber sinnieren, welche Ziele als nächstes anzusteuern wären.[30]
Welcher Art aber sind die Vorteile, die jemand erwarten kann, dem Sie vertrauen? In vielen Fällen werden Sie für die Leistung, die der andere erbringt, schlicht zur Kasse gebeten. Dann bedeutet Ihr Vertrauen auch eine Anerkennung seiner Fähigkeiten. Es stärkt sein Selbstbewusstsein und sein Selbstvertrauen. Sie können den anderen regelrecht aufbauen, wenn Sie ihm zu verstehen geben: Ich schenke dir mein Vertrauen, weil ich weiß, du wirst die Leistung schaffen. Wir alle brauchen diese Art der Bestätigung. Bricht sie weg oder dünnt sie aus, fühlen wir uns unnütz.
Was noch hinzukommt, wenn Vertrauen im Spiel ist: Die Beziehung zum anderen wird aufgewertet. Und das kann für ihn aus zwei Gründen vorteilhaft sein: Einmal kann er sich Hoffnungen machen, auf Ihre Hilfe zurückgreifen zu können, wenn er sie benötigt. Eine vertrauensvolle Beziehung lebt davon, dass „eine Hand die andere wäscht” – auf welche Art auch immer. Dann aber empfiehlt er sich auch für andere als zuverlässiger Partner, dem man vertrauen kann. Denn es gibt kaum ein stärkeres Argument für die Vertrauenswürdigkeit eines Menschen, als wenn ihm viele andere ebenfalls vertrauen. Auf diese Weise kann jemand, dem Vertrauen geschenkt wird, mehr und mehr Vertrauen aufbauen – vorausgesetzt, er wird dem Vertrauen auch gerecht, das die anderen in ihn setzen. Und vorausgesetzt, niemand betreibt üble Nachrede und stellt seine Vertrauenswürdigkeit in Frage, um daraus einen Vorteil zu ziehen. Beides kann man leider nicht ohne Weiteres voraussetzen, wie wir noch sehen werden.[31]
1.7 Die riskante Vorleistung
Vertrauen gibt es nicht ohne Risiko. Wer einem anderen vertraut, der erbringt in den Worten von Niklas Luhmann eine „riskante Vorleistung”. Das Riskante ist nämlich: Wem vertraut wird, der kann dem Vertrauensgeber Schaden zufügen, nicht selten ganz erheblichen Schaden, der über den Nutzen, den sich der Vertrauensgeber versprechen mag, weit hinausgeht. Nehmen wir das Beispiel des Babysitters: Dass er den Eltern Gelegenheit gibt, einen Abend außer Haus zu verbringen, ist geradezu nichts im Vergleich dazu, dass dem Kind etwas zustoßen könnte, wenn der Babysitter nicht aufpasst. So gesehen gehen die Eltern ein äußerst hohes Risiko ein. Sie tun dies aber, weil sie unterstellen, dass sich der Babysitter gut um das Kind kümmert. Eben darin besteht ihr Vertrauen. Sie machen sich verletzlich. Der Babysitter könnte ihnen einen vernichtenden Schlag zufügen – und wird genau dies unterlassen. Einer viel zitierten Definition zufolge ist Vertrauen „der Wille, sich verletzlich zu zeigen”.