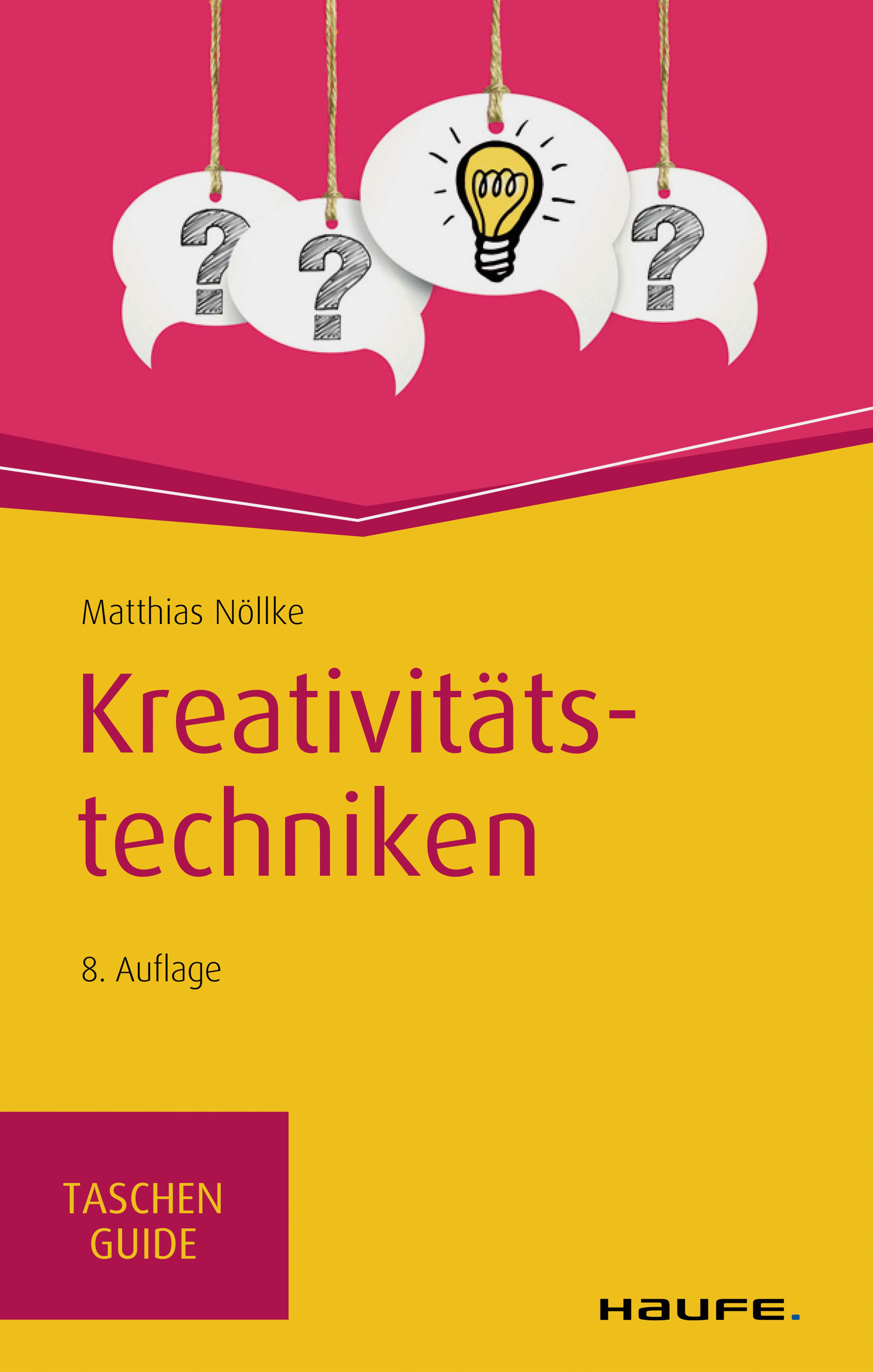15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Haufe Lexware
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Auf Vertrauen kommt es an - auch und gerade im Beruf. Welche Vorteile hat eine vertrauensbasierte Zusammenarbeit? Wann ist Vertrauen eine riskante Vorleistung? Wie können Sie verlorengegangenes Vertrauen zurückgewinnen? Dieses Buch gibt Ihnen Auskunft - fundiert, verständlich und praxisnah.Inhalte:Wie Vertrauen zustandekommt, wie es sich im beruflichen Umfeld entwickelt und sich vom Vertrauen von Freunden unterscheidet.Wo Vertrauen förderlich und wo es eher hinderlich oder riskant ist.Wie es verspielt wird und man es wieder erwirbt.Mit einem Geleitwort von Jochen Mai: "Gesundes Vertrauen kennt Grenzen".
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 337
Veröffentlichungsjahr: 2009
Ähnliche
Geleitwort: Gesundes Vertrauen kennt Grenzen
„Vertrauen ist der Anfang von allem“ lautete der Slogan, mit dem die Deutsche Bank in den Neunzigerjahren ihre Finanzprodukte bewarb – und damit den Tenor der gesamten Branche traf: Sein sauer verdientes Geld gibt man eben nicht irgendwem, man vertraut es allenfalls einem Menschen mit seriösem Leumund an; einem dunkel gekleideten Finanzexperten, der einen ehrlich berät, der gewissenhaft lukrative Anlageformen auswählt und nahezu selbstlos hilft, den eigenen Wohlstand zu mehren. In der Theorie jedenfalls. Jeder weiß, was in der Praxis geschah: Eine gute Dekade später folgte die Finanzkrise und erschütterte das Vertrauen der Menschen in einem bis dato unbekannten Ausmaß. Weltweit fühlten sich die Menschen durch die so genannten Finanzexperten verraten und verkauft. Das Vertrauen – es war in diesem Fall der Anfang vom Ende.
Vertrauen macht gelassen, bis es enttäuscht wird. „Kann man denn niemandem mehr trauen?“, fragen sich folgerichtig all jene, deren Grundvertrauen zu oft von anderen Menschen enttäuscht wurde. Die einen werden daraufhin misstrauischer, andere regelrecht feindselig. Sie bauen sich eine Art psychosozialen Panzer aus Skepsis und Argwohn auf, um ja nicht noch einmal hinters Licht geführt zu werden, nach dem Motto: Wer mit der Niedertracht der anderen rechnet, kann nicht mehr böse überrascht werden. Das stimmt zweifellos, macht aber einsam.
Obwohl vermutlich jeder schon einmal übers Ohr gehauen wurde oder erlebt hat, dass sein Vertrauen ausgenutzt worden ist, hält die Mehrheit von uns an dem Konzept fest, anderen eine Art sozialen Kredit zu geben. Wir werden sprichwörtlich enttäuscht, ärgern uns, ziehen daraus Konsequenzen, aber vertrauen doch weiterhin – nur vielleicht nicht mehr diesem speziellen Menschen. Warum?
Letztlich ist Vertrauen ein erlerntes Verhalten, das bis in die Kindheit zurückreichen kann. Unsere Vertrauensseligkeit entstammt im Kern zwei Komponenten: dem Selbstvertrauen, also der Zuversicht in die eigenen Fähigkeiten; und dem Fremdvertrauen gegenüber anderen Menschen. Beides sind dem Wesen nach Erfahrungswerte. Wer früh gelernt hat, dass er Erfolge aufgrund seines Könnens wiederholen kann und dass die Mehrheit der Menschen Vertrauen belohnt, bleibt auch später vertrauensvoll bis -selig. Man könnte auch sagen: Vertrauen ist eine erlernte Entscheidung. Wer vertraut, geht willentlich und zuversichtlich davon aus, dass sich eine Sache so entwickelt, wie versprochen oder erhofft. Ob das dann tatsächlich eintritt, steht freilich auf einem anderen Blatt.
Ein Grund für die anhaltende Zuversicht ist deren positive Wirkung – auf uns und andere. Schon 1968 führten die Psychologen Robert Rosenthal und Lenore Jacobson ein Experiment an amerikanischen Schulen durch, das in die Literatur als Rosenthal- oder Pygmalion-Effekt einging. Dazu teilten sie einigen Lehrern mit, dass sie aufgrund bisheriger Leistungen im kommenden Schuljahr eine Klasse übernehmen dürften, die sich aus den intelligentesten und besten Schülern zusammensetze. Nach Ablauf des Schuljahres waren diese Klassen deutlich besser als die anderen, ihre Noten, selbst der IQ der Schüler lag rund 20 Punkte höher als beim Durchschnitt. Nur hatten die Psychologen gelogen. Die Klassen setzten sich gar nicht aus den Besten zusammen, sondern aus einer Zufallsauswahl. Weil aber die Schüler selbst glaubten, zu den Besten zu gehören, und auch die Lehrer ihnen mehr zutrauten, stieg die Leistungs- und Lernkurve.
Der zweite Grund: Vertrauen vollbringt ein kleines kognitives Wunder: Es minimiert Komplexität. Wir alle würden wohl früher oder später verrückt werden, wenn wir allem Neuen oder jedem fremden Menschen mit Angst, Abwehr und Misstrauen begegnen würden. Das gilt noch mehr im Berufsleben. Hier kommt noch hinzu, dass kaum einer von uns einen vollständigen Überblick über das Geschehen in seinem Unternehmen haben dürfte, nicht einmal die Chefs. Deshalb müssen wir uns schlicht auf manche Aussagen von Kollegen, Zulieferern und Kunden verlassen.
Als der Professor für Managementlehre an der McGill Universität in Montreal, Henry Mintzberg, einmal die Tagesabläufe von Managern untersuchte, stellte er überrascht fest, dass kaum einer länger als eine Stunde an einer Sache arbeitete. Weit über 50 Prozent der Tätigkeiten nahmen weniger als neun Minuten in Anspruch. Es lässt sich leicht vorhersagen, dass solche Manager ihre Entscheidungen kaum von ausgiebigen Recherchen oder umsichtigen Planungen abhängig machen. Sie werden sich vielmehr auf die wenigen Informationen verlassen, die ihnen gerade zur Verfügung stehen: Erfahrungen, Referenzen, Hörensagen. Kurzum: Weil ihnen der vollständige Überblick fehlt, müssen sie den wenigen Indizien vertrauen.
Das passt ins Idealbild. Schließlich wünschen sich die meisten Manager ein Betriebsklima, das von Vertrauen und gegenseitigem Respekt geprägt ist. Aber ist das auch realistisch? Spätestens an dieser Stelle wird das Paradoxon des Vertrauens offenbar. Denn trotz der oben aufgeführten Vorzüge werden einige jetzt völlig zu Recht einwerfen, dass es in ihrem Betrieb ganz anders zugeht. Gewiss, man vertraut seinem Büronachbarn, vielleicht noch den Kollegen aus der eigenen Abteilung. Aber dann hört es auch schon auf. Mehrheitlich ist das Unternehmensklima geprägt von Machtspielen, von Konkurrenzdenken, Schuldzuweisungen und mal mehr, mal weniger versteckten Anfeindungen. Kurzum: Je lauter der Wunsch nach einem vertrauensvollen Umfeld formuliert wird, desto wahrscheinlicher ist es, dass dieser Idealzustand real gar nicht existiert (sonst müsste man ihn auch nicht einfordern).
Warum ist das so? Warum vertrauen und misstrauen wir gleichermaßen, obwohl ersteres doch offensichtlich die größeren Vorteile hat? Nur allzu oft wird Vertrauen mit Vertrautheit verwechselt. Letztere entsteht, wenn man sich besser kennen lernt, eine Weile zusammenarbeitet oder miteinander Geschäfte macht. Die jedoch dem Vertrauen innewohnende Gewissheit, sich auf den anderen wirklich verlassen zu können, entsteht jedoch erst unter Krisenbedingungen. Allein solche Schlechtwetterphasen bilden den Rahmen für die anschließende Metamorphose, in der sich die Vertrautheit bewährt und in Vertrauen verwandelt. Oder eben auch nicht, wie die eingangs erwähnte Finanzkrise eindrucksvoll zeigte. Danach war das Vertrauen einer ganzen Branche verspielt.
Lenin wird der Ausspruch in den Mund gelegt „Vertrauen ist gut – Kontrolle ist besser“. Ein hohes Maß an gegenseitigem Vertrauen mag im Privaten wie im Beruf ein ebenso erleichterndes wie erstrebenswertes Ziel sein. In seiner Absolutheit aber wird Vertrauen zu Recht als blind und naiv geächtet und muss zwangsläufig enttäuscht werden. So erstrebenswert gegenseitiges Zutrauen auch ist: Gesundes Vertrauen kennt Grenzen.
Eines dieser Limits steckt allerdings schon in jedem Einzelnen von uns. Weil sich Vertrauen bewähren, sprich: wachsen muss, lässt es sich nicht erzwingen oder gar beschleunigen. Es ist kein Instantprodukt, sondern ein Reifungsprozess. Das bedeutet zugleich, dass es Konsequenzen hat, wenn wir einander mehr vertrauen (wollen). Dazu gehört der Verzicht auf kurzfristige Vorteile, auf all die kleinen fiesen Tricks und Winkelzüge, mit denen man zwar Karriere machen, aber kein Vertrauen bilden kann: Profilieren auf Kosten anderer, das Verschweigen eigener Unzulänglichkeiten, Aufgaben schönreden, Allianzen schmieden, das Ausnutzen von Schwächen bei Kollegen wie Untergebenen. Damit ist es dann vorbei. Das Buch von Matthias Nöllke zeigt sehr plastisch, was Vertrauen ist, wie es entsteht und funktioniert und was wir alle tun können, um schon verspieltes Vertrauen wieder zurückzugewinnen. Der Glaube daran, dass dies gelingen kann, ist bereits der erste Vertrauensakt.
Jochen Mai
Jochen Mai, Diplom-Volkswirt und Wirtschaftsjournalist. Er leitet das Ressort „Beruf und Erfolg“ bei der Wirtschaftswoche, ist Autor des Buchs „Die Karrierebibel“ und bloggt unter http://karrierebibel.de.
Vielen Dank für Ihr Vertrauen!
„Alles Reden ist sinnlos, wenn das Vertrauen fehlt.“ – Franz Kafka
Auf Vertrauen kommt es an. Für jeden von uns. Ob Sie nun Führungskraft sind, Mitarbeiter, Rechtsanwältin, Autor oder Kassiererin im Supermarkt. Wenn Sie kein Vertrauen genießen, können Sie buchstäblich einpacken. Und wenn Sie selbst niemandem Vertrauen, dann sind Sie in Ihren eigenen Handlungsmöglichkeiten stark eingeschränkt. „Vertrauen ist die Strategie mit der größeren Reichweite“, schreibt der Soziologe Niklas Luhmann. Ohne jemandem Vertrauen zu schenken, bleiben Sie auf sich allein gestellt und können kaum etwas bewirken. Und bewirken möchten wir alle etwas. Vor allem auf andere Menschen möchten wir einwirken. Denn wir Menschen sind zutiefst soziale Wesen. Daher beschäftigt uns kaum etwas so sehr wie die Frage, ob wir jemandem trauen können oder nicht. Es ist nämlich so: Vertrauen können wir nicht jedem. Und wir können nicht auf alles vertrauen. „Wer damit anfängt, dass er allen traut, wird damit enden, dass er einen jeden für einen Schurken hält“, heißt es warnend in dem Drama Demetrius von Friedrich Hebbel. Die Strategie der größeren Reichweite geht nur dann auf, wenn Sie eine realistische Vorstellung davon haben, wo und wann Sie nicht mehr Vertrauen dürfen, wo und wann Misstrauen angebracht ist.
Nun hat das Thema Vertrauen im Umfeld von Management und Unternehmensführung bereits in den vergangenen Jahren eine regelrechte Konjunktur erlebt. Dafür mag es eine Reihe von Gründen geben, die im Zuge der aktuellen Finanzkrise noch stärker zum Tragen kommen: Es fehlt gerade an Vertrauen und Verlässlichkeit. Wir wissen nicht, woran wir uns halten sollen. Unternehmen werden umstrukturiert, Abteilungen umgebaut, aufgelöst, neu zusammengesetzt oder sie arbeiten plötzlich als interne Dienstleister. Mitarbeiter sind Intrapreneure, kooperieren und konkurrieren gleichzeitig miteinander. Zuständigkeiten sind unscharf oder werden immer wieder neu aufgeteilt. Über allem lastet ein immer stärkerer Wettbewerbsdruck. Und die einzige Gewissheit, an die wir uns halten können, lautet: Die Welt ist voller Überraschungen.
In diesem Durcheinander suchen wir Halt und Orientierung. Vertrauen in das Ganze, in das System, können nur noch wenige aufbringen. Dazu verstehen wir zu wenig, was um uns herum geschieht. Und auch die Experten zeigen sich vom Gang der Ereignisse immer wieder überrascht. Unabhängig davon, ob die Wirtschaft wächst, einbricht oder sich überraschend schnell (doch nicht) erholt. Woran wir uns noch halten können und wonach wir uns sehnen, das ist die persönliche Integrität von Menschen. Ihnen möchten wir Vertrauen schenken, um wieder Boden unter die Füße zu bekommen.
Zugleich aber hat die Managementliteratur das Vertrauen neu entdeckt. An erster Stelle wäre hier wohl das einflussreiche Buch von Reinhard K. Sprenger zu nennen, das schon in seinem Titel programmatisch verkündet: „Vertrauen führt“. Andere, wie der Sozialwissenschaftler Olaf Geramanis, haben Vertrauen als „soziale Ressource“ beschrieben, und manche würdigen es gar als „gesellschaftliches Schmiermittel“, das die zahllosen Risse kittet, die sich in unserer unübersichtlichen Welt tagtäglich auftun.
In diesem Zusammenhang taucht auch immer wieder ein Argument auf, mit dem schon Sprenger für mehr Vertrauen in den Führungsetagen geworben hat: Vertrauen sorgt für wirtschaftlichen Erfolg. Es zahlt sich gewissermaßen aus zu vertrauen. Misstrauen kommt eine Organisation hingegen teuer zu stehen. Margit Osterloh, Professorin an der Universität Zürich, nennt Vertrauen denn auch den „wichtigsten Wettbewerbsvorteil von Nationen und Unternehmen“. Überboten wird sie noch von Managementberater Stephen M. R. Covey, nicht zu verwechseln mit seinem Vater Stephen R. Covey, der den Bestseller „Sieben Wege zur Effektivität“ geschrieben hat. Covey Junior hält Vertrauen nicht nur für eine „unterschätzte ökonomische Macht“, sondern den Aufbau von Vertrauen für „die Schlüsselkompetenz für alle Führungskräfte in unserer neuen globalen Wirtschaft“. Denn, so Covey, „nichts wirkt schneller und effektiver als Vertrauen – in allen Situationen“.
Die Argumente für mehr Vertrauen in den Unternehmen lassen sich auf die folgenden Thesen verdichten:
Vertrauen macht vieles einfacher und reduziert Kosten. Es spart Kontrollen, komplizierte Regelungen und Transaktionskosten.
Vertrauen sorgt dafür, dass Abläufe im Unternehmen schneller vonstatten gehen. Auch das erhöht die Wettbewerbsfähigkeit.
Wem Vertrauen geschenkt wird, der ist motiviert, sein Bestes zu geben. Das Leistungsniveau steigt.
Vertrauen im Unternehmen verbessert das Betriebsklima, reduziert die Fluktuation und macht das Unternehmen für qualifizierte Stellenbewerber attraktiv.
Vertrauen macht es möglich, Krisen zu meistern und schmerzhafte Veränderungen durchzustehen.
In diesem Buch wird eine etwas andere Position vertreten. Ohne Zweifel sind die angesprochenen Prinzipien sehr sympathisch und sogar wirksam – dauerhaft jedoch nur in einem „Reinraum des Vertrauens“, in dem sich kein Stäubchen Misstrauen mehr auf die empfindlichen Schaltkreise des Vertrauens setzen kann. Doch unsere Beziehungen, in der Arbeitswelt zumal, sind auch von Neid und Misstrauen geprägt. Von Verleumdungen, schmutzigen Tricks und blanker Rücksichtslosigkeit. Was keineswegs ausschließt, dass sich Menschen, die auf ihrem Weg nach oben eine besonders „breite Blutspur“ hinterlassen, sehr gerne auf Werte und Vertrauen berufen. Wie überhaupt der Grundsatz gilt: Wer mit dem Vertrauen der anderen glänzende Geschäfte macht, hat es nicht immer verdient.
Und so erscheint es fraglich, ob mehr Vertrauen zu schenken tatsächlich wirtschaftlich erfolgreich macht und die Kosten senkt. Der Blick auf das eine oder andere hochprofitable Erfolgsunternehmen lässt Zweifel aufkommen, ob es sich dabei wirklich um einen Hort des Vertrauens handelt. Und ob sie „noch erfolgreicher“ wären, wenn in diesen „Haifischteichen“ jetzt vertrauensvoll zusammengearbeitet würde. In manchen Fällen mag es auch geradewegs andersherum sein: Nicht Vertrauen führt zum Erfolg, sondern ein Unternehmen, das wirtschaftlich erfolgreich ist, leitet daraus den Anspruch ab, besonders vertrauenswürdig zu sein. Gerät das Unternehmen in die Krise, bröckelt dieser vertrauenerweckende Nimbus. Gerade jetzt fehlt es an der „sozialen Ressource“ Vertrauen. Bei der Belegschaft, aber auch bei den Eigentümern: Nicht selten wird jemand von außen geholt, eine neue integre Führungsfigur, die noch unvorbelastet ist. Nur ihr traut man zu, das Vertrauen zurückzugewinnen.
Damit soll allerdings nicht das Gegenteil behauptet werden, nämlich dass Vertrauen unwichtig sei oder dem wirtschaftlichen Erfolg sogar im Wege stehe. Ohne ein gewisses Maß an Vertrauen geht es sogar in den Haifischteichen nicht. Zugleich aber kommen auch Organisationen, in denen vertrauensvoll zusammengearbeitet wird, nicht ohne Konkurrenz, Kontrolle und Misstrauen aus. Misstrauen sorgt dafür, dass wir Selbstverständliches in Frage stellen. Und wenn wir wissen, dass uns jemand sehr genau auf die Finger schaut, muss sich das nicht immer negativ auf unser Arbeitsergebnis auswirken.
Im Übrigen aber sollen die Verdienste der genannten Autoren überhaupt nicht geschmälert werden. Um mit dem bekannten Gleichnis zu sprechen, ist dieses Buch gewissermaßen der Zwerg, der sich auf ihren Schultern niederlässt, um dann aber in eine andere Richtung zu blicken. Vertrauen ist gewiss eine Ressource, die heute in den Unternehmen nicht gerade im Überfluss vorhanden ist, so dass man sich an der einen oder anderen Stelle durchaus mehr Vertrauen wünscht. Die genannten Thesen sind ja nicht falsch, nur ergänzungsbedürftig. Denn Vertrauen ist kein universeller Problemlöser und keine sonnige Siegerstrategie, sondern etwas so Vielschichtiges und Fundamentales, dass Führungskräfte „gut“ damit umgehen sollten. „Gut“ bedeutet nicht, dass Führungskräfte möglichst viel und oft vertrauen sollten. Misstrauen ist nicht in jedem Fall schlecht und Vertrauen nicht immer eine rundum erfreuliche Angelegenheit. Das gilt auch für den Fall, dass Ihnen jemand vertraut. Es ist gar nicht so selten, dass sich hinter dem bereitwillig gespendeten Vertrauen eine subtile Form der Vereinnahmung verbirgt.
Das heißt gar nicht mal, dass Kalkül hinter der Sache steckt. Obwohl das natürlich auch vorkommt, wie wir noch sehen werden. Vertrauen verbindet, es bindet Sie aber auch. Sie sind nicht mehr frei, nach eigenem Willen zu entscheiden und zu handeln. Setzen Sie sich über die Erwartungen der anderen hinweg, was manchmal unvermeidlich ist, verlieren Sie deren Vertrauen. Das kann ohnehin erstaunlich schnell dahinschmelzen. Insoweit ist Stephen M. R. Coveys Aussage, nichts wirke „schneller“ als Vertrauen, zu ergänzen durch den Zusatz, „nichts kann sich rascher verflüchtigen als Vertrauen“. Mitunter genügt eine bloße Gedankenlosigkeit, eine unscheinbare Handlung, eine verräterische Geste, und das Vertrauen ist dahin. Versuchen Sie dann mit vertrauensbildenden Maßnahmen dagegen anzusteuern, vergrößern Sie womöglich noch den Argwohn. Wie überhaupt nachträgliche Reparaturmaßnahmen oft wenig ausrichten können.
In anderen Fällen ist das Vertrauen weit robuster, ja, mitunter beängstigend robust. Dann lässt sich der etwas paradoxe Effekt beobachten, dass besonders schwere Vorwürfe und stark belastende Indizien das Vertrauen sogar noch festigen. Es liegt auf der Hand, dass dieses unerschütterliche Vertrauen alles andere als wünschenswert ist. Vielmehr müssen wir aufpassen, nicht in eine solche „Vertrauensfalle“ (→ S. 163) hineinzugeraten. Das führt nämlich zu einem Realitätsverlust, der dramatische Ausmaße annehmen kann. In seiner milden Form ist er jedoch gar nicht so selten, wie man annehmen möchte. Auch im Berufsleben nicht, wie wir sehen werden.
Überhaupt bietet das Thema Vertrauen manche Überraschungen. So gestaltet sich das Verhältnis von Vertrauen und Misstrauen weit vielschichtiger, als es zunächst den Anschein hat. Und damit ist nicht allein gemeint, dass anfängliches Misstrauen einem besonders belastbaren Vertrauen den Boden bereiten kann. Es ist ebenso möglich, dass Misstrauen oder enttäuschtes Vertrauen dazu führen, einem unbeteiligten Dritten das Vertrauen mehr oder minder unbesehen zufallen zu lassen: Man schenkt ihm sein Vertrauen, weil man einem anderen nicht (mehr) vertraut.
Ein aktuelles Beispiel bietet die Finanzkrise. Vielleicht sind Sie ja auch wie viele andere dem Rat Ihres Bankberaters gefolgt und haben Wertpapiere oder neuartige Finanzprodukte gekauft, die beträchtlich an Wert verloren haben. Nun haben Sie kein Vertrauen mehr in die Beratung Ihrer Bank. Und was tun Sie? Wie die Frankfurter Allgemeine Ende Juni 2009 meldete, hat mehr als ein Viertel aller Vermögenden in Deutschland die Geschäftsbeziehung zu ihrem bisherigen Vermögensverwalter beendet oder das Kapitalvolumen stark verkleinert. Billionen von Euro sind „verschoben“ worden, an welche vertrauenswürdigere Stelle auch immer. Denn das Problem ist natürlich, dass wir in solchen Fällen jemandem vertrauen müssen. Sogar wenn Sie Ihre gesamten Ersparnisse in Ihrer Matratze verstecken, gibt es vermutlich den einen oder anderen Mitwisser, auf den Sie sich nun bei 0 Prozent Rendite verlassen müssen. Kurzum, haben Sie Ihr Vertrauen verloren, löst es sich oftmals keineswegs in Luft auf. Vielmehr sind Sie regelrecht gezwungen, es irgendwohin zu verschieben. Das Bemerkenswerte dabei ist, dass manche ganz erheblich von solchen Verschiebungen profitieren. Ihnen wird vertraut, weil die anderen kein Vertrauen mehr genießen.
Aber auch das Verhältnis von Vertrauen und Transparenz gestaltet sich nicht immer so, wie wir es erwarten würden: Transparenz gilt als vertrauensbildend. Und in einigen Fällen trifft dies auch unbedingt zu. Aber als Allzweckwaffe und unumstößliches Grundprinzip kann Transparenz vertrauensvolle Beziehungen auch regelrecht zerstören. In manchen Unternehmen findet genau das statt: Alles soll so transparent gemacht werden, dass sich nirgendwo mehr Vertrauen bilden kann. Und als besondere Pointe werden die betreffenden Maßnahmen als Förderung einer „Vertrauenskultur“ gepriesen.
Ein weiteres wichtiges Thema betrifft Vertrauen und Verantwortung. Auch dort verschieben sich mitunter auf überraschende Weise die Gewichte. So kommt es immer wieder vor, dass ein Vertrauensbruch demjenigen angelastet wird, der ihm zum Opfer fällt. Und in manchen Fällen nicht einmal zu Unrecht (→„Verantwortungsloses Vertrauen“, S. 197). Denn Vertrauen ist eine zweiseitige Angelegenheit. Wir sind auch dafür verantwortlich, wem wir vertrauen und worauf wir unser Vertrauen gründen.
Über solche und ähnliche Mechanismen werden Sie in diesem Buch lesen. Denn mich hat vor allem interessiert, wie Vertrauen „funktioniert“, auf welche Weise es zustande kommt und wieder zerbricht. Im Unterschied zu anderen Publikationen über dieses Thema geht es mir nicht darum, für mehr Vertrauen und Vertrauenswürdigkeit im Management einzutreten. Auch nicht um bestimmte Werte oder ethische Fragen, und zwar ausdrücklich nicht, weil ich die für unwesentlich hielte. Das Gegenteil ist der Fall. Doch ich glaube, dass es sehr hilfreich sein kann, das Thema Vertrauen einmal aus dieser „technischen“, ja vielleicht sogar ein wenig „misstrauischen“ Perspektive zu betrachten. Gerade nicht, um Vertrauen in Zukunft instrumentell zu gebrauchen, sondern ich bin fest davon überzeugt, dass dieser kühle, distanzierte Blick dafür sorgen wird, Vertrauen besser zu verstehen. So hoffe ich sehr, dass Ihnen dieses Buch dabei helfen wird, „gut“ mit Vertrauen umzugehen.
Die Idee zu diesem Projekt ist mir bei meiner Arbeit an dem Buch „Machtspiele“ gekommen. Damals bin ich darauf gestoßen, wie mit Vertrauen und Misstrauen gearbeitet wird, um seinen Willen durchzusetzen. Das hat mich weiter beschäftigt und schließlich dazu gebracht, dieses Buch dem Haufe-Verlag vorzuschlagen. Wie schon bei den „Machtspielen“, so habe ich auch diesmal eine Reihe von Interviews und Hintergrundgespräche geführt, mit Führungskräften, Wissenschaftlern und Mitarbeitern aus verschiedenen Branchen und Hierarchieebenen. Die meisten von ihnen möchten lieber ungenannt bleiben. Doch selbstverständlich gilt auch ihnen mein Dank. Meine Gesprächspartner haben mir sehr viele Anregungen und Hinweise gegeben. Ohne ihre Hilfe hätte ich dieses Buch gar nicht schreiben können. Namentlich bedanken möchte ich mich bei Dr. Ursula Bohn, die über das Thema „Vertrauen in Organisationen“ promoviert hat, Olaf Geramanis, Professor an der Fachhochschule Nordwestschweiz in Basel, der sich eingehend mit der „sozialen Ressource Vertrauen“ beschäftigt hat, bei Bettina de Mattia vom Deutschen Herzzentrum in München, bei Dr. Harald Henzler von der Haufe-Mediengruppe, bei Werner Neumann von Steria Mummert, bei Gregor Vogelsang, Vice-President der Unternehmensberatung Booz & Co., und Thomas Zimmermann von Synthesis Persönlichkeits- und Unternehmensentwicklung in Berlin.
Schließlich gilt mein Dank aber auch Ihnen, den Leserinnen und Lesern. Dass Sie sich auf dieses Buch einlassen, erfordert ein gewisses Maß an Vertrauen. Ich hoffe, diesem Vertrauen gerecht zu werden.
Matthias Nöllke, München im September 2009
Was ist Vertrauen?
Lieber Geld verlieren als Vertrauen.“ – Robert Bosch
Sagen wir es offen: Vertrauen ist ein etwas unscharfer Begriff. Das ist kein Nachteil. Fast könnte man sagen, es ist Teil des Programms. Denn dank dieser Unschärfe lässt sich Vertrauen vielfältig einsetzen, für die kleinen Alltäglichkeiten ebenso wie für die ganz großen Fragen. Und besonders interessant wird es, wenn die Bedeutung von Vertrauen hin- und hergeschoben wird, wenn es einmal ganz klein und einmal ganz groß gemacht wird. Dabei wird die Sache zusätzlich dadurch erschwert, dass sich Vertrauen einem direkten Zugriff überhaupt entzieht und man sich seiner nie so recht sicher sein kann. Je tiefer man nachbohrt und den Begriff hin- und herwendet, umso mehr scheint sich das Vertrauen zu verflüchtigen. Vertrauensvolle Beziehungen zeichnen sich gerade dadurch aus, dass nicht darüber gesprochen wird, wie sehr man sich vertraut; eben weil es sich von selbst versteht. Es erweckt sogar Argwohn, wenn jemand unvermittelt seine Vertrauenswürdigkeit thematisiert. Um Vertrauen werben sollte nur der, der es nicht hat. Ansonsten setzt er sich dem Verdacht aus, dass irgendetwas nicht stimmt.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!