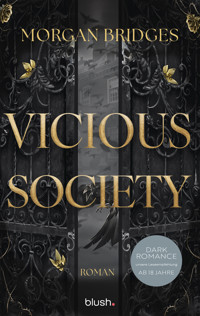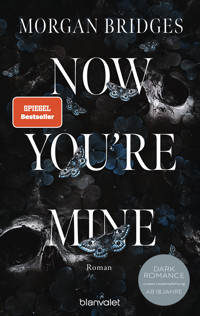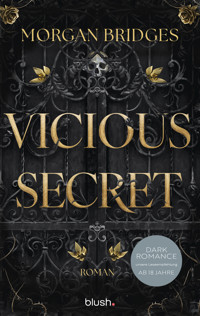
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Taschenbuch Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Obsidian Order
- Sprache: Deutsch
Mors solum initium, der Tod ist erst der Anfang. Betritt die verruchte Welt des Obsidian-Ordens, wenn du dich traust …
Nachdem ein Unbekannter Delilahs Pflegevater getötet und sie damit vor einem seiner Übergriffe bewahrt hat, kann Delilah den geheimnisvollen Fremden auch Jahre später nicht vergessen – genauso wenig wie Ben, ihren Pflegebruder und einstigen Vertrauten, der inzwischen an der Uni studiert. Sobald sie alt genug ist, schreibt auch sie sich dort ein und macht ihn auf dem Campus ausfindig. Unerwartet trifft sie auf Xavier Donovan, den Mörder ihres Pflegevaters und Mitglied eines geheimen Ordens. Und er hat ausgerechnet Delilah zum Objekt seiner Begierde erwählt. Ein auswegloses Spiel nimmt seinen Anfang …
Das neue fesselnde Stalker-Romance-Duett mit College-Setting und den Tropes Touch-Her-and-Die und He-Falls-First.
Bei diesem Buch handelt es sich um Dark Romance mit einer Leseempfehlung ab 18 Jahren. Im Buch sind Triggerwarnungen enthalten.
Books that make you – blush.
Du suchst Liebesgeschichten mit reichlich Spice, mitreißenden Tropes oder morally grey book boyfriends? Dann entdecke weitere Bücher von Blush!
Enthaltene Tropes: Dark Romance
Spice-Level: 4 von 5
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 395
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Buch
Nachdem ein Unbekannter Delilahs Pflegevater getötet und sie damit vor einem seiner Übergriffe bewahrt hat, kann Delilah den geheimnisvollen Fremden auch Jahre später nicht vergessen – genauso wenig wie Ben, ihren Pflegebruder und einstigen Vertrauten, der inzwischen an der Uni studiert. Sobald sie alt genug ist, schreibt auch sie sich dort ein und macht ihn auf dem Campus ausfindig. Unerwartet trifft sie dort auf Xavier Donovan, den Mörder ihres Pflegevaters und Mitglied eines geheimen Ordens. Und er hat ausgerechnet Delilah zum Objekt seiner Begierde erwählt. Ein auswegloses Spiel nimmt seinen Anfang …
Autorin
Morgan Bridges ist eine erfolgreiche Dark-Romance-Autorin mit einer Vorliebe für Antihelden, schön geschriebene Worte und viel Spice. Sie schreibt Heldinnen, die sie so sehr inspirieren, dass sie am liebsten deren Platz einnehmen würde – zumindest in ihrer Fantasie. Ihre Dark-Romance-Geschichten haben Tausende Fans: Nach dem beliebten Possessing-Her-Duett auch ihre Obsidian-Order-Reihe zu einem viralen Hit. Die Autorin lebt mit ihrer Familie in der Nähe von Dallas, Texas.
Von Morgan Bridges bereits erschienen
Once You’re Mine · Now You’re Mine
Morgan Bridges
Vicious Secret
Roman
Deutsch von Leena Flegler
Die Originalausgabe erschien 2024 unter dem Titel Vicious Secret.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung des urheberrechtlich geschützten Inhalts dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Copyright der Originalausgabe © 2024 by Building Bridges Publishing
Copyright der deutschsprachigen Ausgabe © 2025 by blush. Blanvalet in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München
(Vorstehende Angaben sind zugleich Pflichtinformationen nach GPSR.)
Redaktion: Susann Rehlein
Umschlaggestaltung: www.buerosued.de nach einem Entwurf von Silviya Andreeva unter Verwendung von Bildmaterial von Shutterstock.com (S.Borisov, KHIUS, revers, Cranach, Belikova Oksana, ALEX S); Depositphotos (monkeypapa)
Vignette: © Adobe Stock/Illustrator marinavorona
JS · Herstellung: DiMo · SaVo
Satz: satz-bau Leingärtner, Nabburg
ISBN 978-3-641-33311-9V002
LIEBE*R LESER*IN,
dieses Buch enthält potenziell triggernde Inhalte. Deshalb findest du am Ende des Buchs auf [siehe hier] eine Triggerwarnung.
Achtung:
Diese enthält Spoiler für das gesamte Buch.
Wir wünschen allen das bestmögliche Leseerlebnis.
Morgan Bridges und der Blush Verlag
Wenn bei dem Bad Boy in diesem Buch deine Alarmglocken wie Sirenengesang klingen – vergnügliche Lektüre!
Kapitel 1
Xavier
Drei Jahre zuvor …
Wer ist sie?
Ich wünschte mir, die junge Frau auf dem körnigen Schwarz-Weiß-Monitor wäre besser zu erkennen. Zornig marschiert sie auf mein Zielobjekt Benjamin McKenzie zu und tippt ihm mehrmals nachdrücklich mit dem Zeigefinger auf die Brust. Obwohl ich eigentlich ihn observieren soll, kann ich den Blick nicht von ihr abwenden.
»Du gibst diese Möglichkeit nicht meinetwegen auf!«
Sie legt ihre Hände an seine Hüften und sieht zu ihm hoch. Resolutes Mädchen.
»Dieses Stipendium ist eine viel zu große Sache. Das kannst du nicht sausen lassen. Ich meine es ernst.«
Er legt ihr eine Hand an die Wange.
»Ich wüsste nicht, was ich tun würde, wenn dir irgendwas passiert«, flüstert er. »Du bedeutest mir alles, Lilah.«
Benjamin hat also eine Achillesferse. Diese junge Frau könnte ihn das Leben kosten.
Wenn der Obsidian-Orden von ihr erfährt …
Ich atme tief aus, und das Geräusch verhallt in dem leeren Zimmer. Dieser Teil seines Lebens wird – genau wie die junge Frau – schon bald ausgelöscht und vergessen sein. So vergessen wie das leer stehende Haus, in dem ich meinen Posten bezogen habe. Die schmuddelig weiße Farbe blättert von den Wänden, und die Fenster haben so viele Risse, dass sie wie riesige Spinnweben aussehen. Der Raum wirkt wie eine tödliche Falle.
Aber auch ich sitze in einer Falle. Nur dass meine immer schon luxuriös eingerichtet war.
Die junge Frau verdreht die Augen. »Mir passiert schon nichts. Immerhin hast du mir selbst beigebracht, wie ich mich verteidigen kann. Schon vergessen?«
Benjamin schüttelt den Kopf. »Selbstverteidigung reicht nicht mehr. Komm mit. Irgendwie finde ich eine Möglichkeit, dich …«
»Mich was, Ben? Mich in den kommenden drei Jahren in deinem Wohnheimzimmer zu verstecken? Hör mal, ich weiß, dass du ein Technik-Crack bist, aber das dürfte sogar für dich ein Problem darstellen.« Sie hält kurz inne, und in ihrem Blick steht Entschlossenheit. »Außerdem weißt du genau, dass ich die Kleinen nicht allein lassen kann.«
Mein Zielobjekt wirkt angespannt. Selbst durch die Überwachungskamera ist gut zu erkennen, wie sich jeder seiner Muskeln verkrampft.
»Ich weiß«, flüstert er schließlich.
Mit einem schiefen Lächeln tritt sie von ihm zurück und streicht ihr schäbiges blaues Tanktop glatt. »Wenn dieser Widerling von unten noch mal irgendwas versucht, kriegt er einen Arschtritt von mir. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen.«
Ich mustere sie von Kopf bis Fuß. Sie ist gerade mal gute eins sechzig groß, zierlich und hat kaum Muskeln. Wenn sie für irgendwen eine Bedrohung darstellen soll, bin ich die Zahnfee.
Benjamin legt ihr die Hände auf die Schultern und schüttelt sie leicht. Er strahlt pure Verzweiflung aus.
»Vergiss das gleich wieder«, sagt er. »Frank ist ein Idiot. Trotzdem ist er stärker als du.«
Sie reißt sich so jäh von ihm los, dass ihre langen blonden Haare auffliegen. »Dann bin ich eben schneller.«
»Verdammt noch mal, Delilah!«
Er ist so laut, dass ich ihn allen Ernstes sowohl quer über die Straße als auch durch meine Laptop-Lautsprecher hören kann.
Er fährt sich durch die Haare. »Sei nicht so naiv! Du weißt genau, was Frank macht, sobald ich morgen früh wegfahre.«
»Das werde ich verhindern.« Sie kraust zornig die Nase und kneift die Augen zusammen. Ich wünschte mir, ich könnte sehen, welche Augenfarbe sie hat. »Den Mädchen und mir tut keiner etwas an!«
»Du kannst ihm nicht für die nächsten drei Jahre aus dem Weg gehen«, wendet Benjamin ein. »Stell dich nicht dumm!«
Ihre Unterlippe fängt an zu zittern, und unwillkürlich starre ich ihren sinnlichen Mund an. Sie ist höchstens fünfzehn, sechzehn Jahre alt, sieht aber aus wie eine erwachsene Frau. Klar, dass sie Aufmerksamkeit auf sich zieht, ob sie es will oder nicht.
»So sprichst du nicht mit mir«, entgegnet Delilah trotzig. »Wenn Frank mich, Emily oder Sandra auch nur anfasst, bringe ich ihn um.«
Benjamin verschränkt die Arme vor der Brust. »Ich sollte ihn umbringen. Dann müsste ich mir um euch keine Sorgen mehr machen.«
Genau das würde ich ebenfalls tun. Aber im Gegensatz zu dir bin ich auch dafür ausgebildet. Das wirst du schon bald am eigenen Leib erfahren, Rekrut.
Delilah seufzt. »Nein, Ben. Du würdest im Gefängnis landen.« Sie reckt trotzig ihr Kinn. »Und ich streite auch nicht mehr mit dir. Wenn du fertig damit bist, sauer auf mich zu sein, kannst du ja kommen und dich verabschieden.«
Mein Zielobjekt zuckt sichtlich zusammen, als sie die Tür hinter sich zudonnert. Ich schnaube. Wer immer diese junge Dame ist – sie hat Benjamin eindeutig fest im Griff.
Ich schalte auf die Kamera in Delilahs Zimmer um. Dort sieht es genauso aus wie in Benjamins Zimmer: ein Einzelbett, ein Nachttisch, kaum persönliche Gegenstände oder Deko.
Solange man über ihre überaus dekorative Erscheinung hinwegsieht.
Ich bin mit Geld und Frauen aufgewachsen, die ihr Äußeres zu nutzen wussten. Kleidung, Make-up, hier und da chirurgische Eingriffe. Mir ist alles bekannt, was mit Geld zu bezahlen ist. Daher bringt mich Delilahs Attraktivität auch nicht aus der Fassung.
Der einzige Grund, warum ich sie noch ein paar Minuten lang observiere, ist, dass sie meinem Zielobjekt wichtig zu sein scheint. Sie lässt sich auf ihr Bett mit der fadenscheinigen Decke sinken. Dann greift sie nach einer Schneekugel mit einem Märchenschloss und fährt mit den Fingern über die durchsichtige Plastikkuppel.
Ich bin fasziniert, wie ausdrucksstark ihr Gesicht ist. Sie versucht gar nicht erst, ihre Gefühle zu verbergen. Man fühlt sich fast verpflichtet …
Eilig schalte ich zurück zu Benjamins Zimmer. Als auf dem Monitor niemand zu sehen ist, klicke ich hektisch die übrigen Kameras an, um ihn aufzuspüren. Doch er ist weder im Wohnzimmer noch auf dem Flur.
Ich presse kurz die Lippen zusammen, doch dann entdecke ich ihn in der Tür zur Küche, und mein Puls beschleunigt sich. Er hat die Fäuste geballt, während Frank Goldstein, sein Pflegevater, sich ein Bier aus dem Kühlschrank nimmt.
»Was willst du?«, fragt er mit verwaschener Stimme.
Benjamin betritt die Küche und steigt über auf dem rissigen Linoleumboden verstreute Gegenstände hinweg. Die Arbeitsflächen sind mit leeren Bierdosen und zerdrückten Snacktüten übersät, und die Oberschränke hängen so schief, dass sie jeden Moment runterzukrachen drohen. Kurz regt sich Abscheu in mir, doch dann hebt mein Zielobjekt die Stimme, und die Drohung, die darin liegt, jagt mir sofort das Adrenalin durch die Adern.
»Du weißt genau, was ich will«, blafft er.
Frank winkt ab. »Es geht um deine kleine Freundin.« Als Benjamin nickt, grinst der ältere Mann nur. »Was soll mit ihr sein?«
»Halt dich von ihr und den anderen fern.«
Der Mann schnaubt bloß. »Sonst was?«
Benjamin macht einen Schritt auf ihn zu, und unwillkürlich springe ich auf. Obwohl mein Auftrag lautet, den unehelichen Sohn des kürzlich verstorbenen Harold McKenzie auszuspionieren, bin ich mir verdammt sicher, dass die Gründerfamilien es nicht gutheißen würden, wenn er stirbt.
Was unter meiner Aufsicht nicht geschehen wird.
Denn wenn er stirbt, wäre das mein Todesurteil.
Ich ziehe meine Kapuze über, um mein Gesicht zu verbergen, und renne die windschiefe Treppe nach unten, durch die Hintertür nach draußen und quer über die Straße auf das Haus zu, das ich seit Tagen observiere. Meine Stiefelsohlen krachen über den Asphalt, ehe meine Schritte von einem ungepflegten Rasenstreifen gedämpft werden. Im Kopf gehe ich sämtliche Szenarien durch, die diese bevorstehende Konfrontation nach sich ziehen könnte. Keins davon ist optimal.
Die Waffe an meinem Gürtel beruhigt meinen dröhnenden Puls ein wenig. Trotzdem muss ich jetzt vorsichtig sein – auch wenn sich in dieser lausigen Nachbarschaft garantiert niemand über einen Schuss wundern würde.
Ich greife zu dem Messer in meinem Stiefelschaft, und meine Finger krümmen sich mit einer Routiniertheit um den Griff, die von einem Horror herrührt, der mich bis heute verfolgt.
Nur dass ich heute Abend zum Horror für jemand anderen werde.
Noch während ich auf die Hintertür zustürme, die in die Küche führt, höre ich einen Mann brüllen und dann einen lauten Knall. Bereits durchs Fenster kann ich all das erkennen, was mir mit Sicherheit Ärger mit dem Orden – nein, schlimmer: Probleme mit meinem Vater – einhandeln wird.
Frank hat Benjamin gegen den Kühlschrank gewuchtet und drischt mit der freien Hand auf ihn ein, dass die Flaschen im Getränkefach nur so klirren. Mein Zielobjekt muss den ersten harten Faustschlag einstecken, doch dabei wird es nicht bleiben.
Wenn ich nicht sofort dazwischengehe, ist er innerhalb weniger Minuten tot.
Ich habe gerade die Hand an den Türknauf gelegt, als etwas Blondes an mir vorbeischießt. Delilah stürmt in die Küche, ihre Haare wehen hinter ihr her, und ihre Augen lodern vor Wut.
In einer einzigen Bewegung schnappt sie sich ein Küchenmesser von der Arbeitsfläche und stößt es Frank zwischen die Rippen. Er brüllt auf und wirft den Kopf in den Nacken. Die junge Frau zieht die Klinge heraus und sticht ein zweites Mal zu.
Die wilde Schönheit verschlägt mir die Sprache.
Ich schnappe regelrecht nach Luft, bekomme Franks Schmerzensschreie und Benjamins angestrengtes Keuchen nur noch am Rande mit. Delilah stellt sich schützend vor mein Zielobjekt und dreht sich zu ihrem Pflegevater um. Blut trieft zu Boden, und an ihrem erhobenen Unterarm schlängelt sich ein Rinnsal hinab.
Sie ist unfassbar.
»Wenn du ihn noch einmal anrührst, bringe ich dich um«, faucht sie – so leise, dass ich sie kaum hören kann, doch das Feuer in ihrer Stimme ist glühend heiß. »Ich meine es ernst, Frank.«
Delilah ist eine biblische Figur, die jenen Mann verriet, den sie hätte lieben sollen. Die junge Frau in der Küche sollte besser ihrem Beispiel folgen.
Aber natürlich tut sie das nicht.
Ich habe mich geirrt. Sie ist eine Bedrohung, ja, aber nicht nur für Benjamin. In mir macht sich Begierde breit – so jäh und heftig, dass ich rückwärts taumele und den Griff um meine Waffe lockere.
Delilah ist keine normale Frau. Ich wusste nicht, dass diese Sorte existiert. Sie begibt sich für eine andere Person in Gefahr, ja sogar in Lebensgefahr. Diese tiefe, unerschütterliche Loyalität …
Die will ich.
Die brauche ich.
Ich brauche sie.
Mir doch egal, wofür ihr Name steht.
Delilah gehört mir.
Kapitel 2
Delilah
»Verdammte heilige Scheiße …«
Ich lehne mich laut seufzend gegen die Schlafzimmertür. Ben muss angesichts meines Fluchs leise kichern, fasst sich dann aber mit schmerzverzerrtem Gesicht an die Rippen. »Bring mich jetzt bloß nicht zum Lachen!«
Ich reiße verzweifelt die Arme hoch. Wahrscheinlich sehe ich dabei aus wie eine dieser aufblasbaren Winkefiguren. »Ich versuche gerade wirklich nicht, lustig zu sein.« Ich sehe ihn finster an. »Mal ernsthaft, was hast du dir dabei gedacht, Frank dermaßen zu provozieren?«
»Ich?« Mein Stiefbruder starrt mich ungläubig an. »Hab ich etwa auf ihn eingestochen? Du musst gerade was sagen!«
»Stimmt …« Behutsam schiebe ich ihn aufs Bett zu. Sobald er liegt, halte ich ihm die Tüte mit tiefgefrorenem Gemüse hin. »Guck nicht so«, sage ich. »In diesem Dreckloch gibt’s nun mal keine schickeren Ice-Packs.«
Ben nimmt mir die Tüte ab und atmet scharf ein, als er sie sich gegen die Schläfe drückt. Kurz huscht ein Stirnrunzeln über mein Gesicht, doch dann reiße ich mich zusammen. Wenn mein Pflegebruder eines hasst, dann wenn ich aufgewühlt bin.
Und nachdem ich eben erst jemandem ein Messer in die Rippen gestoßen habe, bin ich gerade ziemlich aufgewühlt. Zum Glück habe ich Frank nicht umgebracht. Dieser Arsch blutet hoffentlich nicht aus, sonst bin ich geliefert.
»Setz dich, Lilah.«
Dass er mich bei meinem Kosenamen nennt, entspannt mich ein wenig. Mit einem schiefen Lächeln lasse ich mich neben ihn auf die Matratze sinken. Bei der Bewegung zuckt er zusammen.
»Tut mir leid!«
Er schüttelt den Kopf. »Ich wäre draufgegangen, wenn du nicht eingegriffen hättest.«
»Das hätte ich nicht zugelassen.« Ich drücke leicht seine Hand. »Immerhin sind wir Familie.«
Quälend langsam nimmt er mich ins Visier. »Stimmt. Familie …«
Unter seinem intensiven Blick steigt mir die Röte am Hals hinauf, und ich ziehe meine Hand zurück, damit es nicht peinlich wird. Eigentlich dürfte nichts zwischen uns stehen, immerhin ist Ben derjenige, der mit mir Sport-BHs und Binden einkaufen gegangen ist, als ich zwölf und er fünfzehn war. Er war für mich da, wenn ich mir wegen meiner nichtsnutzigen Mutter, die mich vor die Tür gesetzt hatte, die Augen ausheulte …
Trotzdem hat sich in letzter Zeit etwas verändert.
Vielleicht liegt es daran, dass Ben inzwischen hochoffiziell erwachsen ist und ich fünfzehn und aus seiner Sicht immer noch ein Kind. Oder es liegt daran, dass er auszieht – und mich neuerdings auf Abstand hält, damit sich die Trennung ein wenig erträglicher anfühlt. Ich weiß jetzt schon, dass ich komplett durchdrehe, wenn er nicht mehr da ist.
Der Einzige, der mich hier beschützen kann, wird morgen früh weg sein. Zumindest hab ich das Messer behalten.
»Und was jetzt?«, frage ich. »Hörst du mal langsam auf, auf mich sauer zu sein?«
Er atmet laut aus und starrt zur Zimmerdecke. »Ich hab noch nie lange sauer auf dich sein können. Das weißt du doch.«
»Schon. Aber das hier ist anders. Entweder hat Frank endlich kapiert, dass er sich besser nicht mit mir anlegt, oder er wird unerträglicher denn je. Egal – die Mädels lasse ich jedenfalls nicht allein. Das musst du doch verstehen.«
»Ich verstehe es ja. Ich finde bloß die Vorstellung grässlich, nicht da zu sein, falls du mich brauchst.«
»Du tust gerade so, als würden wir uns nie wiedersehen.«
»Lilah …«
»Ich suche mir einen Job, kaufe mir ein Handy, und dann können wir uns ja schreiben.« Ich verpasse ihm einen leichten Knuff gegen die Schulter. »Und anschließend lerne ich mir den Arsch ab, damit ich ebenfalls auf dieses feine College komme. Ich meine – es muss doch auch ein Stipendium für Leute geben, die supersmart und bettelarm sind, oder?«
Mein Pflegebruder verdreht die Augen. »Was meinst du wohl, wie ich da rangekommen bin?«
»Siehst du?«
»Okay.«
»Wie heißt das College gleich wieder? South Harbor Institute of Technology?« Ich grinse ihn breit an. »Hoffentlich! Weil es dann nämlich SHIT abgekürzt wird!«
Seine Mundwinkel zucken. »Du weißt genau, dass es anders heißt. South Harbor University.«
»Schade, schade. Und dann ist Boston auch noch zwei Stunden entfernt, also nicht gerade in Laufnähe.«
Ben streckt sich nach mir aus und fährt mir mit der Rückseite seines Zeigefingers über die Wange.
Ich bin wie erstarrt. Nicht dass er mich nie zuvor berührt hätte. Als er mir beigebracht hat, wie ich mich verteidigen muss, gab es immer wieder Körperkontakt, aber der war rein platonisch.
Das hier fühlt sich … intim an.
»Lilah, ich komme dich bei jeder Gelegenheit besuchen, okay?«
Ich nicke, und er lässt die Hand wieder sinken. »Ich geh besser mal nach den Mädels sehen. Bei dir alles im grünen Bereich? Oder willst du den Tiefkühlmais?«
Schief lächelnd schüttelt er den Kopf. »Alles bestens. Sind bloß blaue Flecken. Du solltest den anderen sehen.«
Ich zwinkere ihm zu. »Wirklich? Hoffentlich kannst du schlafen. Wenn du irgendwas brauchst, sag Bescheid!«
»Danke«, sagt er. »Ich meine das wirklich ernst.«
»Klar. Du hättest das Gleiche für mich gemacht.«
»Jederzeit!«
Ein wenig steif gehe ich auf die Zimmertür zu. Meine Arme und Beine kribbeln, und ich muss mich zusammenreißen, um nicht loszurennen, sobald ich draußen auf dem Flur stehe. Ich will nicht nur nach den Mädchen sehen. Irgendwas liegt in der Luft. Wenn man ständig in Gefahr schwebt, lernt man, auf seine Instinkte zu vertrauen.
Und den Menschen zu misstrauen.
Das Haus – oder vielmehr: diese zweistöckige Bruchbude – entwickelt abends ein Eigenleben. Die verzogenen Bodendielen knarzen, als ich über den schmalen Flur zum Zimmer der Mädchen gehe. Ich konzentriere mich auf ungewöhnliche Geräusche, die signalisieren könnten, dass Frank auf Rache aus ist, doch ich kann nur meine eigenen leisen Schritte und entferntes Verkehrsrauschen hören.
Ich lege die Hand an den Türknauf und drehe ihn langsam herum. Dann schiebe ich die Tür einen Spaltbreit auf, spähe nach drinnen und sehe die Doppelmatratze am Boden vor mir, die beinahe das ganze Zimmer einnimmt. Emily und Sandra haben sich zusammengekuschelt wie zwei Kätzchen. Ihre süßen Gesichter sind vollkommen entspannt, obwohl in der Dunkelheit Monster lauern.
Besonders das Monster im Erdgeschoss.
Dass sie fest schlafen, erleichtert mich ein wenig. Keine von ihnen hat mir je erzählt, was sie durchgemacht haben, bevor sie hier bei uns untergebracht wurden, aber mit elf und neun Jahren wirken sie bereits dermaßen erfahren, dass es mir das Herz zerreißt. Trotzdem sind sie unter Bens und meiner Aufsicht und Liebe richtiggehend aufgeblüht.
»Ich beschütze euch«, flüstere ich eher mir selbst als den beiden zu. Dieses Versprechen ist zu meinem Lebenszweck geworden. In den kommenden drei Jahren werde ich ihm womöglich nicht immer gerecht werden können, trotzdem bin ich wenn nötig bereit, für diese Mädchen mein Leben zu opfern.
Abgesehen von Ben hat sich für mich nie jemand opfern wollen, aber damit kann ich leben. Dass ich solches Glück hatte, ihn als Pflegebruder zu bekommen, macht fast sämtliche schlimmen Erfahrungen wett. Er hat mit seiner Bruderliebe so viel Gutes bewirkt.
An eine andere Art der Liebe will ich gar nicht mehr glauben.
Ich nehme das Puppenbett hoch, eine der wenigen Spielsachen der Mädchen, ziehe die Tür wieder zu und gehe in mein Zimmer. Das Messer, mit dem ich auf Frank eingestochen habe, liegt immer noch auf meinem Nachttisch. Sogar in der Dunkelheit erkennt man die roten Flecken auf der Klinge. Ich frage mich, ob sie schon getrocknet sind …
Der Anblick beschert mir ein flaues Gefühl in der Magengrube. Allerdings nicht, weil ich es bereuen würde. Niemals.
Ich atme tief ein und langsam wieder aus, ehe ich das Messer hochnehme und die Klinge abwische. Mit Panzertape habe ich ein zweites Messer unter den Bettrahmen geklebt, allerdings ist es kürzer und weniger scharf. Das zweite stammt aus meinem früheren Zuhause. Nein, das war kein Zuhause. Es war bloß ein Haus.
Ein echtes Zuhause hatte ich nie.
Was einem Zuhause noch am nächsten kommt, sind Ben und die Mädels.
Mit dem Puppenbett unter dem Arm und dem abgenutzten Messer in der Hand schleiche ich zurück zur Treppe. Ich stelle das Puppenbett auf die sechste Stufe, ganz nach links.
Dann schleiche ich die Treppe wieder hoch und kauere mich an die Wand. Heute Nacht – und von nun an für immer – bin ich die Wächterin in meiner kleinen Pflegefamilie.
Wenn Frank sich auch nur in die Nähe des ersten Stocks wagt, wird er es bereuen.
Kapitel 3
Delilah
Die Sekunden werden nur langsam zu Minuten, die ihrerseits zu Stunden werden. Meine Muskeln entspannen sich, allerdings nicht ausreichend, als dass ich richtig einschlafen würde. Jahre der Wachsamkeit haben meine Sinne geschärft. Manchmal frage ich mich, ob ich je wieder friedlich werde schlafen können.
Womöglich erst, wenn ich tot bin.
Als hätte ich sie mit meinen Befürchtungen überhaupt erst heraufbeschworen, nehme ich plötzlich eine düstere Präsenz wahr, an der die Luft abkühlt. Ich habe Gänsehaut und reiße die Augen auf. Während mein Herz anfängt zu rasen und mich zur Flucht treiben will, gehe ich vorsichtig in die Hocke und verstärke den Griff um mein Messer.
Wenn das hier auf Kampf oder Flucht hinausläuft, dann wähle ich den Kampf.
In Dunkelheit gehüllt, nähert sich ein Eindringling und kommt sekündlich näher. Seine Bewegungen sind eindeutig zu kontrolliert und zielsicher, als dass es Frank sein könnte. Nicht dass ich die Person von meinem Posten aus klar und deutlich sehen könnte. Aber ich kann sie spüren.
Einen Augenblick später wandert ein Schatten die Wand empor und auf die Stufe mit dem Puppenbett zu. Ein lautes Splittern stört die Stille, als wäre ein Hammer auf einem Spiegel gelandet. Der Krach ist mein Startsignal.
Jedes Zögern könnte mich umbringen.
Rein instinktgetrieben stürme ich mit dem Messer voran los. Die Klinge dringt in etwas ein, noch ehe meine Augen die Gestalt vor mir richtig erkannt haben. Ein männliches Grunzen weht an meinem Ohr vorbei, als ich meinen Arm auch schon zurückreiße, um erneut zuzustechen.
Doch der Angreifer reagiert schnell. Er verhindert die neuerliche Attacke, indem er meinen Arm packt, zurückreißt, und der jähe Ruck fährt mir durch Mark und Bein. Noch bevor ich zum Gegenschlag ansetzen kann, krallt er sich in mein Handgelenk, und seine Finger bohren sich erbarmungslos in meine Haut. Mir rutscht das Messer aus der Hand, und mit einem dumpfen Geräusch fällt es auf den Teppichboden. Das Klappern fühlt sich an wie der Vorbote meines Untergangs.
Dann übertönt eine Stimme alle anderen Geräusche – tief, samtig und mit einem Hauch Amüsiertheit unterlegt, die mich verwirrt.
»Nicht übel«, sagt der Mann und nickt auf die Stichwunde in seiner Schulter hinab, »aber bei Weitem nicht gut genug.«
In seinem festen Griff kribbelt mein Handgelenk, aber das ist nichts im Vergleich dazu, wie sehr er meine Sinne im Griff hat. Ich spähe zu ihm hoch, kann ihn jedoch immer noch kaum erkennen, weil er eine schwarze Kapuze trägt.
Wer immer der Mann ist – es handelt sich auf alle Fälle nicht um einen Obdachlosen oder Junkie, wie ich zuerst gedacht habe. Er spricht artikuliert, wohlüberlegt und klingt gebildet. Ich würde meine linke Titte darauf verwetten, dass der Typ auch noch wohlhabend ist. Was also führt ihn an dieses gottverdammte Ende der Stadt?
»Wer sind Sie?«
Zur Antwort stößt er mich von sich weg, sodass ich mit dem Rücken gegen die Wand krache. Die Luft entweicht aus meiner Lunge, und ich starre unverwandt in seine Richtung. Er ist reglos auf der Treppe stehen geblieben, und auf dem Treppenabsatz befinde ich mich mit ihm auf Augenhöhe. Er muss also gute eins achtzig groß sein – ziemlich einschüchternd für eine wie mich, die keine eins fünfundsechzig groß ist.
Ich richte mich kerzengerade auf, beuge aber leicht die Knie, um sofort in den Gegenangriff übergehen zu können. »Wer sind Sie, verdammt?«
»Du zuerst, kleiner Greif.«
»Ich bin doch kein Vogel, verdammt!«
»Nein, aber du bist doch ein kluges Mädchen. Hast dieses Spielzeug dort auf die Treppe gestellt, damit ich drum herumgehen muss und das Holz quietscht?«
Ich nicke und frage mich gleichzeitig, wie es kommt, dass diese Unterhaltung eine solche Wendung genommen hat. »Hören Sie, wenn Sie nicht sofort von hier verschwinden, schreie ich.«
»Ach ja?« Er schnalzt missbilligend mit der Zunge. »Benjamin muss sich ja erst von seiner Tracht Prügel erholen. Der wird dir also nicht helfen. Außerdem willst du die Mädchen doch bestimmt nicht wecken, oder?«
Keine Ahnung, woher dieser Typ all das weiß, aber er soll sich verdammt noch mal verpissen. Und zwar augenblicklich.
»Was wollen Sie hier?«, blaffe ich ihn an.
Auch wenn ich seine Augen nicht erkennen kann, spüre ich Hitze in mir aufsteigen, als er mich von Kopf bis Fuß beäugt und den Blick dann wieder auf mein Gesicht richtet. Ich mustere ihn meinerseits und wünschte mir, dass Blicke wirklich töten könnten.
»Was ich will und was ich gleich tun werde, sind zwei Paar Schuhe«, erwidert er. Ich hab keinen Schimmer, was er damit meint – was mir gleichzeitig Angst macht und meine Neugier weckt. »Du musst lediglich wissen, dass dir nichts passieren wird.«
Ich lache auf. »Ach ja, wirklich? Ich glaub Ihnen kein Wort.«
Er nickt. Mondlicht fällt durchs Fenster und erhellt die untere Hälfte seines Gesichts – scharf konturierte Lippen, die zu einem Lächeln verzogen sind, kantiges Kinn. Eine wie mit dem Lineal gezogene Nase. Die jugendliche Wirkung steht im scharfen Kontrast zu der Gefahr, die er ausstrahlt. Er dürfte kaum älter als Ben sein, trotzdem dominiert er den Raum wie jemand, der ein gutes Jahrzehnt älter ist.
Ich spähe zu dem Messer am Boden und überschlage im Kopf, wie schnell ich sein müsste, um den Typen damit zu erwischen. Ein zweites Mal. Nur dass ich diesmal nicht das Überraschungsmoment auf meiner Seite hätte.
»Denk nicht mal darüber nach«, sagt er.
»Und ich dachte, mir passiert nichts?«
»Vor der Welt bist du sicher. Aber nicht vor mir.«
Die blanke Angst schießt mir in die Adern, und mein Herz schlägt schmerzhaft schnell. Ich balle die Fäuste, um nicht dem Impuls nachzugeben, mich nach der heruntergefallenen Waffe zu bücken. »Was soll das heißen?«
»Hör mir gut zu, kleiner Greif.«
Bei dem bescheuerten Kosenamen sträubt sich alles in mir. Trotzdem verkneife ich mir eine Erwiderung.
»Frank wird weder dir noch den anderen je wieder etwas tun. Das verspreche ich dir, Delilah.«
Ich weiß nicht, was mich mehr schockiert: dass mein Pflegevater urplötzlich keine Gefahr mehr darstellen soll oder dass dieser Fremde meinen Namen benutzt, als würde er mich kennen. Meine Knie drohen unter mir nachzugeben, als erneut Adrenalin in meine Adern schießt. Ich sehe den Mann ungläubig an und muss jeden Muskel in meinem Körper zügeln, um nicht blindlings draufloszuschlagen.
»Was wollen Sie? Und ist Frank verschwunden? Was Sie da sagen, ergibt keinen Sinn.«
»Nicht?« Er neigt den Kopf zur Seite. »Nur damit wir uns richtig verstehen: Ich habe ihn umgebracht … allerdings erst, nachdem ich ihm stellvertretend für dich eine Entschuldigung abgefoltert habe. Sobald ihm dein Name über die Lippen kam, hab ich ihm die Zunge abgeschnitten, weil er ihn auszusprechen gewagt hat. Kapierst du es jetzt?«
Gewalt hängt in der Luft, sickert in meinen Körper, blockiert meine Lunge und erschwert mir das Atmen. Ich bringe nur noch ein flaches Japsen zustande, als mir nach und nach dämmert, was er gerade gesagt hat.
Mit einer tödlichen Eleganz, die ich widerwillig bestaune, obwohl ich das nie zugeben würde, kommt der Fremde näher. Er ist zwar jung, aber seine Bewegungen strahlen Autorität und Macht aus. Angeborene Macht.
Ich strecke abwehrend die Hände aus und presse meinen Rücken gegen die Wand. »Bleiben Sie stehen!« Beim schrillen Klang meiner Stimme beiße ich mir insgeheim auf die Zunge. Meine Aufforderung klingt genauso hilflos, wie ich mich fühle.
Dennoch bleibt er stehen. Verdattert sehe ich zu, wie er bedächtig die Arme vor der Brust verschränkt. Jetzt, da er ebenfalls auf dem Treppenabsatz steht, überragt er mich und blickt auf mich nieder wie ein Dämon, der sich soeben selbst zu meinem Schutzengel ernannt hat.
»Warum?« Meine geflüsterte Frage ist das einzige Geräusch in der Dunkelheit. Während ich auf seine Antwort warte, befürchte ich schon, dass mir das Herz aus der Brust springen könnte.
»Warum?«, wiederholt er leise. »Weil niemand sich an etwas vergreift, was mir gehört.«
Obwohl der Mann bei uns eingebrochen ist und soeben einen Mord gestanden hat, verspüre ich schlagartig rechtschaffene Empörung. »Ich gehöre Ihnen nicht!«
»Noch nicht.«
Ich will auf diese lächerliche Aussage etwas erwidern wie: »Fick dich!«, oder: »Leck mich doch am Arsch!« Doch im selben Moment macht er kehrt und geht ohne ein weiteres Wort die Treppe hinunter.
Mir schwirrt der Kopf. Irgendwann ist mir so schwindlig, dass ich mich sogar hinsetzen muss, um nicht umzukippen.
Was ist da verdammt noch mal gerade passiert?
Kapitel 4
Xavier
Kühle Morgenluft weht mir entgegen und zerrt an meiner Kleidung wie eine anhängliche Frau. Mein Motorrad dröhnt lauter, sobald ich Gas gebe. Ich fahre schneller als erlaubt über den Freeway, und es ist mir egal. Dies ist einer der wenigen Augenblicke, in denen ich mein Leben vollkommen im Griff habe.
Viel zu schnell kommt das riesige Tor vor dem Anwesen meiner Familie in Sicht, und ich gehe vom Gas. Dann richte ich meine Gedanken wieder auf die Realität. Das schmiedeeiserne Tor schwingt langsam auf, und ich fahre angesichts der bevorstehenden Begegnung mit einem mulmigen Gefühl hindurch.
Mein Vater hat mich gerufen, und ich habe keine andere Wahl, als zu gehorchen, wenn ich weiter am Leben bleiben will. Einige der Gründerfamilien betrachten ihre Söhne als Mittel zum Zweck, um ihre mächtigen Dynastien weiterzuführen. Und auch Edward Donovan hat lediglich sein Reich im Blick.
Leider macht mich das zu einem Soldaten in seiner Armee.
Ich parke auf dem Hof und ziehe den Zündschlüssel ab. Nachdem ich den Helm abgenommen und auf den Sitz gelegt habe, fahre ich mir durch die dunklen Haare, hole tief Luft und wappne mich für das, was mir gleich bevorsteht.
Das Herrenhaus sieht mit jedem Schritt, den ich darauf zugehe, bedrohlicher aus. Ich trete durch die Eingangstüren auf den Marmorboden unter der hohen Decke. Hier bin ich mein Lebtag ein und aus gegangen, trotzdem wird es nie mein Zuhause sein.
Auf dem Flur komme ich an den Porträts meiner Vorfahren vorbei. Der Stammbaum reicht bis weit vor den Unabhängigkeitskrieg zurück. All die Personen, die ringsum hängen, sind seit Langem tot. Doch sie haben dieses Land gegründet. Genau wie den Obsidian-Orden. Den Musterungsbescheid habe ich schon erhalten.
An diesem Ort – hinter der feindlichen Linie – sind meine Sinne wie immer geschärft. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich mir meiner Umgebung und sämtlicher Menschen hier drin je nicht übermäßig bewusst gewesen wäre. Sofern ich diese Schwäche je gehabt haben sollte, hat mein Vater sie mir mit den ersten Schlägen ausgetrieben. Oder meine Mutter, indem sie danebenstand und tatenlos zusah.
Als ich um die Ecke biege, steht sie prompt vor mir, als hätte ich sie mit meinen Überlegungen heraufbeschworen. Meine Mutter ist bildschön, vornehm und ein Muster der Eleganz – wie eine Statue, hart, kalt und unfähig, Gefühle zu zeigen.
Oder sich schützend vor einen zu stellen.
»Xavier.« Sie nickt mir zu.
Ich bleibe stehen und sehe sie reglos an. »Mutter.«
Ihr eisblauer Blick bohrt sich in mich. Dann sieht sie weg. Man könnte glatt glauben, Gewissensbisse würden sie daran hindern, mich richtig anzusehen, nur leider weiß ich genau, dass ich ihr gleichgültig bin.
»Wie geht es dir?«, fragt sie in ihrer gewohnt förmlichen Art.
»Gut.«
Ich mache mir nicht die Mühe, die Gegenfrage zu stellen. Im Gegensatz zu ihr will ich meine Zeit nicht mit Höflichkeiten vergeuden. Es gab mal eine Zeit, in der ich alles für ein freundliches Wort von ihr gegeben hätte. Doch ihre Loyalität gilt ausschließlich meinem Vater. So war es immer und wird auch so bleiben.
Nur dass ihre Loyalität aus Angst und Drohungen gespeist wird, nicht aus Liebe und Respekt. Nicht so, wie Delilah loyal gegenüber Benjamin ist.
Ich möchte, dass sie das Gleiche für mich empfindet.
Meine Mutter räuspert sich diskret. »Dein Vater erwartet dich.«
»Ich weiß«, antworte ich bloß.
»Na dann.«
Ich nicke ihr knapp zu und setze meinen Weg fort. Weitere Worte sind hier nicht nötig. Die Möglichkeit, ein ehrliches Gespräch zu führen, war im selben Moment zunichte, da sie mich ausgeliefert hat.
Ich erreiche die espressobraune Tür zum Arbeitszimmer meines Vaters. Ein Klopfen und er erteilt mir die Erlaubnis, einzutreten.
In das Heiligtum, wie er es nennt.
Erst indem ich die Tür hinter mir schließe, habe ich es vollends betreten. Die Erhabenheit dieses Raums ist eines Königs würdig. Der Geruch von Leder hängt in der Luft, genau wie eine Spur Zigarrenrauch. Mein Vater sitzt hinter seinem riesigen Eichenschreibtisch und ist umgeben von Bücherregalen.
»Xavier.« Er legt die Unterlagen beiseite, die er in der Hand hatte, und blickt zu mir auf. »Ich gehe davon aus, dass du mir etwas über den McKenzie-Jungen berichten kannst.«
Benjamin und ich sind beide achtzehn, doch mein Vater betrachtet mich als Kind, das an der kurzen Leine gehalten werden muss, damit es nicht auf dumme Gedanken kommt.
»Er ist heute Morgen nach South Harbor gefahren und sollte inzwischen eingezogen sein.«
Mein Vater mustert mich einen Augenblick lang aus seinen grauen Augen. Wir haben die gleiche Augenfarbe – und die gleiche Kälte und Härte im Blick. »McKenzie dort hinzuschaffen ist nur der erste Schritt. Ihn dortzubehalten wird das größere Problem sein.«
Ich erwidere nichts darauf. Ein falscher Zug, und ich verliere mehr als bloß einen Bauern.
»Gibt es irgendwas, womit wir ihn dazu bringen könnten zu gehorchen?«, will er von mir wissen.
Delilah.
Sofort steht mir ihr Gesicht vor Augen, die funkelnd grünen Augen und die lächelnden Lippen. Für einen kurzen Augenblick vergesse ich mich – und die Bedrohung, die mir an diesem Ort gegenübersitzt.
Allein an sie zu denken bringt mich in Gefahr.
Ich mache ein regloses Gesicht, damit er mir nichts ansehen kann. Ich versuche, jeden Gedanken an Delilah beiseitezuschieben. Die im Umgang mit ihm nötige mentale Disziplin habe ich mir über Jahre angeeignet. Alles Gute in meinem Leben kommt für meinen Vater einem Risiko gleich, das er eliminieren muss.
»Ihn auf Spur zu halten sollte kein Problem darstellen.« Ich formuliere meine Antwort mit Bedacht. »Es gibt nichts mehr, was ihn noch zu Hause hält.«
»Keine Freundin?«
Keine Ahnung, ob die beiden zusammen sind, aber es spielt auch gar keine Rolle mehr. Mag sein, dass ich Benjamin nicht umbringen kann, nur um ihn von Delilah fernzuhalten. Aber es gibt andere Mittel und Wege.
Als mein Vater mir auftrug, unterschiedliche Selbstverteidigungs- und Kampftechniken zu erlernen, hatte er unter Garantie nicht im Sinn, dass ich sie gegenüber einer Frau anwenden müsste. Und um der Wahrheit die Ehre zu geben: ich ebenso wenig. Allerdings habe ich auch nicht kommen sehen, dass ich jemandem wie Delilah begegnen würde.
Und jetzt kann ich sie nicht mehr vergessen.
Ich will sie nicht mehr vergessen.
»Ich habe ihn tagelang observiert. Keinerlei Hinweise auf eine Beziehung.«
»Mhm.« Mein Vater streicht sich nachdenklich über das Kinn. »Wäre auch egal. Es gibt andere Möglichkeiten, um jemanden auf Spur zu halten. Bleib an ihm dran, finde heraus, was seine Schwächen sind und wie wir sie für uns nutzen können. Der McKenzie-Erbe ist bis auf Weiteres deine einzige und vorrangige Aufgabe.«
Ich nicke ihm zu. »Verstehe.«
»Hoffentlich.«
Über die Beleidigung gehe ich geflissentlich hinweg. »Noch irgendwas? Ich muss zur Gelöbnisfeier auf den Campus.«
Mein Vater lehnt sich auf seinem Stuhl zurück. »Die ist doch nur Show. Die wahre Initiation erfolgt später, Rekrut.«
Inzwischen rede ich nicht mehr mit Edward Donovan, sondern mit einem der drei Ratsoberen des Obsidian-Ordens, eines Assassinenordens.
»Der Orden …«
»Der Orden«, unterbricht er mich, »hat sich der Geheimhaltung verschworen. Trotzdem habe ich dich dein Leben lang auf nichts anderes vorbereitet.«
In seinen Worten schwingen Familientraditionen mit und die Andeutung eines Erbes, das auf Manipulation, Gewalt und Macht beruht. Ich starre den Mann an, dem ich so ähnlich sehe, und bin mir in diesem Augenblick nur zu bewusst, dass ich meinem Schicksal genauso wenig entgehen kann wie meiner DNA. Mein Dasein hat nur einen Zweck: einer Geheimgesellschaft zu dienen, über die ich kaum etwas weiß, der ich aber mein Leben opfern muss.
Bis zum letzten Atemzug.
Diese Verbindung ist verbindlicher als eine Ehe – und weit herausfordernder.
Sein Blick verschärft sich, und das Grau seiner Augen sieht stählern aus. »Du kannst gehen«, sagt er. »Aber ich behalte dich im Blick, Xavier. Das tun wir alle.«
Zehn Gründerfamilien. Geschichtsträchtige Jahrhunderte. Tausende Mitglieder, die vor meiner Zeit gestorben sind.
Und ein Mädchen, das meinem Leben einen neuen Sinn zu verleihen scheint.
Kapitel 5
Xavier
South Harbor University, einige Wochen später …
Mors solum initium.
Der Tod ist erst der Anfang.
Die alte Parole hallt in meinem Kopf wider, in beiden Sprachen – erst auf Latein, dann auf Englisch. Die schicksalhaften Worte schneiden in meine Psyche wie eine Axt ins Holz und zerschlagen Stück für Stück meine Beherrschung. Ich wusste, dass dieser Tag kommen würde. Immerhin wird das hier nicht mein letzter auf Erden sein.
Für einen Schwächeren wäre es so.
Jemand reißt mir den Sack vom Kopf, den sie mir aufgezogen haben, und ich blinzele in die Dunkelheit. Nur langsam stellen sich meine Augen auf die Lichtverhältnisse ein, doch meine Instinkte sind schlagartig hellwach und wollen, dass ich handele. Sie wollen, dass ich töte.
Ich würde glatt mein komplettes Erbe verwetten, dass die Assassinengilde mich nur deshalb hergebracht hat.
Im Handumdrehen habe ich die Umgebung erfasst und die anderen in Augenschein genommen. Meine Konkurrenten. Die Männer, die entweder zu Waffenbrüdern werden … oder meinen Tod bedeuten.
Die Initiation findet in einem Schlossverlies statt, in einem Teil des Schlosses, der möglicherweise älter ist als der Obsidian-Orden selbst. Hier unten riecht es nach Dreck, Staub und Angst. Eine blakende Fackel hängt an der Wand, damit wir etwas sehen können, doch im Großen und Ganzen ist der Raum immer noch dunkel genug, um eine bedrohliche Atmosphäre zu erzeugen.
Der kalte, harte Steinboden entzieht meinem Körper Wärme, und die klirrenden Ketten, die sie mir um Hand- und Fußgelenke gelegt haben, reiben – auch an meiner Geduld. Das Gefühl, jemandes Gefangener zu sein, weckt unwillkommene Erinnerungen in mir und schreit nach Rache.
Ich bin mehr als bereit dazu, Blut zu vergießen, und wenn es nur dazu dient, den finsteren Bildern, die in mir aufkommen, Einhalt zu gebieten.
Ich lasse den Blick über die übrigen zwölf Männer schweifen, die sich in der gleichen Lage befinden wie ich. Sie alle entstammen einer der zehn Gründerfamilien. Wir alle wurden genau hierfür geboren.
Nur einer nicht.
Der Neuling hat die Stirn gerunzelt und scheint sich eindeutig zu wundern. Er gibt sich nicht die geringste Mühe, seine Überraschung und noch viel mehr den Frust darüber, dass er gefesselt ist, zu verbergen. Sollte er aber besser. Können sie einen lesen, ist man im Nachteil.
Was er in Kürze lernen wird … oder er überlebt es nicht.
In der Mitte des Raums steht mit verschränkten Armen ein Mann, zu dessen Füßen ein Haufen schwarzer Säcke liegt. So wie ich Mark Barnum kenne, hätte er auch gegen einen Haufen Leichen nichts einzuwenden, solange er damit davonkäme. Ich kenne niemanden, der erbarmungsloser ist als er und der im selben Maße alles tun würde, um zu überleben.
Abgesehen von mir selbst.
»Hört her, Rekruten«, ruft Mark und sorgt damit schlagartig für Stille im Raum. Ich beschwöre meine innere Stärke, die mich schon mein ganzes qualvolles Leben lang immer wieder gerettet hat – körperlich wie mental. Es gibt nichts, was er gleich sagen und womit ich nicht klarkommen könnte.
Mark grinst. »Ihr Arschlöcher kommt hier nicht raus, bevor einer von euch tot ist.«
Und damit wird aus dem Schlossverlies binnen eines Wimpernschlags ein Schlachtfeld. Blut wird fließen. Wenn auch nicht meins.
Aus den Augenwinkeln sehe ich, wie der Neuling sich durch die blonden Haare fährt, an seinen Ketten zerrt und damit sämtliche Aufmerksamkeit auf sich zieht. Der arme Wicht hat sich gerade selbst zum Opfer erklärt.
Wir Übrigen sind genau hierfür ausgebildet. Wir sind hierfür gedrillt worden. Dem Obsidian-Orden als Elite-Assassinen zu dienen heißt, der Familie zu dienen. Es ist angeblich eine Ehre.
Den Dienst abzulehnen wäre ein Ding der Unmöglichkeit.
»Damit das hier spannender wird«, fährt Mark fort und zieht das Wort in die Länge, »habe ich mir eine besondere Belohnung ausgedacht.« Er zieht drei Messer aus seiner Gesäßtasche und lässt sie vor sich zu Boden fallen. »Mors solum initium, ihr Wichser.«
Im selben Moment, da er das Verlies verlässt und die Tür verriegelt, bricht Hektik aus, als alle zu den Messern stürzen. Das laute Klirren der Ketten wird nur durch wüste Beschimpfungen übertönt.
Ich selbst sehe dem Treiben in der Mitte des Raums konzentriert zu und stehe erst einen Moment später langsam auf. Adrenalin pumpt durch meine Adern, ein vertrautes, potentes Gefühl, das mir signalisiert, dass ich für die bevorstehende Schlacht gewappnet bin.
Ich brauche keine Klinge, um jemanden zu töten.
Der erste Schmerzensschrei ist zu hören, als Eric Gage jemanden mit der eben erst vom Boden aufgeklaubten Klinge erwischt.
Mit verzerrtem Gesicht presst Ryan Emerson sich die Hände auf den Bauch. Auf dem teuren Stoff seines Hemdes breitet sich ein roter Fleck aus, und der metallische Geruch von Blut vermischt sich mit dem Kellergestank.
»War das alles, Eric?« Ryan spuckt verächtlich aus. »Sieht fast so aus, als hättest du mehr Zeit damit verbracht, high zu sein, als für den Kampf zu trainieren. Die Drogen haben dir die Gehirnzellen zerfressen, und leider hattest du ja von Haus aus nicht viele.«
»Von wegen!« Eric verzieht das Gesicht, doch unter der spöttischen Fassade ist eindeutig Wut zu erkennen. »Wenn ich mit dir fertig bin, fick ich deine Freundin.«
Erics Klinge schnellt im weiten Bogen auf Ryan hinab. Doch der weicht geschickt aus, nutzt den Moment, da Eric nur auf sein Messer konzentriert ist, und tritt ihm das Knie weg. Eric knickt um, taumelt rückwärts und entkommt nur knapp Ryans Gegenschlag. Sogar verwundet ist der Erbe des Emerson-Vermögens ein verdammt guter Kämpfer.
Aus dem rückwärtigen Teil des Verlieses studiere ich ihre Bewegungen und die der anderen. Alle sind voll auf den Kampf konzentriert, und garantiert hofft die Mehrheit, dass Ryan Eric umbringt, damit sie selbst niemanden töten müssen.
Zumindest heute noch nicht.
Für sie alle wird der Tag kommen.
Als Mitglied einer Assassinengilde gehört Mord nun mal zum Alltag. Unsere Väter und Onkel haben alle die gleiche Initiation durchgemacht, doch weil der Orden ein Geheimbund ist, muss all das natürlich heimlich geschehen. Was meinen Vater nicht davon abgehalten hat, mich an jedem verdammten Tag meines Lebens auf diese Aufgabe vorzubereiten. Dies ist nicht mein erster Besuch im Kerker.
Und auch nicht die erste Aufforderung, jemanden umzubringen.
Von uns allen war Eric immer schon der Unbeständigste. Die Söhne sämtlicher Gründerfamilien besuchen alle dieselbe angesehene Uni und diverse elitäre Veranstaltungen, deshalb bin ich von seinem Verhalten auch kein bisschen überrascht. Tatsächlich gibt es nur wenig, was mich je im Leben überrascht hätte.
Kürzlich erst ein Mädchen mit grünen Augen, honigblonden Haaren und einem Messer in der Hand. Sie war die Letzte, die eine Waffe gegen mich erhoben hat. Kurz muss ich unwillkürlich lächeln.
Eric richtet sich auf. Seine Brust hebt und senkt sich, und blonde Strähnen fallen ihm in die Stirn. Selbst quer durch den Raum kann ich den genauen Moment erkennen, da er seine Chancen abwägt, gegen Ryan zu gewinnen. Der Bruchteil einer Sekunde, in dem er die Augen aufreißt, verrät ihn.
»Zumindest wartet auf mich eine warme Pussy«, sagt Ryan mit einem breiten Grinsen und lacht herablassend. Schweiß perlt auf seiner Stirn. »Das Einzige, was auf dich wartet, ist eine Spritze. Schwierig, so was zu ficken, aber vielleicht nicht unmöglich, was weiß denn ich.«
Gedämpftes Kichern weht zu mir her, das sofort von unbehaglichem Räuspern verdrängt wird.
Röte steigt an Erics Hals empor. Sein Zorn ist unverkennbar. Eine Sekunde lang lasse ich die Maske fallen, als mir durch den Kopf schießt, dass Eric tatsächlich dumm genug sein könnte, sich auf den eindeutig überlegenen Ryan zu stürzen. Doch schlussendlich muss sogar der arrogante Eric anerkennen, was seine Instinkte längst wissen: dass er diesen Kampf niemals gewinnen könnte.
»Fick dich«, knurrt er. »Mein Vater ist einer der drei Ratsoberen, und eines Tages nehme ich seinen Platz ein. Unser Drogenimperium bringt dem Orden mehr Geld und Macht ein, als du es dir je vorstellen könntest. Du brauchst die Blowjobs deiner Freundin doch nur, damit du der Realität nicht ins Gesicht sehen musst.«
Dann wirbelt Eric herum, dass die Ketten rasseln, und sein lodernder Blick sucht den Raum nach einem geeigneteren Gegner ab. Oder vielmehr: nach einem leichten Opfer.
In derselben Sekunde, da er bei dem Neuling verharrt, spannt sich in mir alles an. Trotzdem gucke ich weiter gelangweilt. Niemand hier kennt meinen Auftrag, nicht mal mein Zielobjekt.
Benjamin McKenzie guckt alarmiert, als er bemerkt, dass Eric ihn im Visier hat, springt auf und ballt die Fäuste. Obwohl auch er kämpfen kann, wird es nicht reichen: Selbst wenn er ein Messer hätte, sind seine Chancen gleich null.
Erics Mundwinkel verziehen sich zu einem höhnischen Grinsen, als er auf den Neuling zugeht. »Na, Schönling? Wo kommst du denn her, verdammt?« Er bleibt ein paar Schritte vor Benjamin stehen und mustert ihn misstrauisch. »Du bist keiner von uns. Wie bist du hierhergekommen?«
Benjamin antwortet nicht. Eine Sekunde nach der anderen verstreicht, und wenn ich nicht bald einschreite, ist ihm der Tod sicher. Ich sehe zu Declan Kent. Der Erbe eines Klinikimperiums zieht eine Augenbraue hoch und sieht mich ratlos an. Ich nicke diskret auf das Messer in seiner Hand hinab.
Zugegeben, es ist viel verlangt. Aber wenn je der Moment war, das Vertrauen zwischen Declan und mir auf die Probe zu stellen, dann jetzt. Der Einzige, der sonst noch ein Messer hat, ist Simon Paine, und es ihm abzunehmen ginge höchstwahrscheinlich mit einer Verletzung einher.
Declan sieht mich vielsagend an, und ich erwidere seinen Blick. Wir haben uns verstanden. Ich hab ihn nie als meinen Freund betrachtet. Das ist jetzt anders. Ab sofort stehe ich in seiner Schuld.
Mit skeptisch gerunzelter Stirn überreicht er mir das Messer. Ich nehme die Klinge zwischen Daumen und Zeigefinger. Das Messer ist leichter, als ich es gewohnt bin. Dann lege ich die Hand an den Griff.
»Ein paar letzte Worte vielleicht?« Eric hebt den Arm, und das Flackern der Fackel schimmert bedrohlich von seiner Stahlklinge wider. Als Benjamin weiterhin kein Wort sagt, verdreht Eric die Augen. »Du kannst dich gern weigern zu sprechen, aber du wirst nicht verhindern können, gleich laut zu schreien.«
In Benjamins Blick lodern Verzweiflung und Anspannung um die Wette und untermalen die verkrampfte Haltung seiner Schultern. Und seine mangelnde Erfahrung. Eric hingegen bewegt sich mit einer Geschmeidigkeit, die auf jahrelanges Training schließen lässt – teilweise erzwungen, teils aber auch angefeuert von dem Vergnügen, jemand anderem Leid zuzufügen.
Er wirft das Messer von einer Hand in die andere und spielt mit seinem Gegenüber Katz und Maus. »Das wird ein Spaß!«
Eric täuscht mit links einen Angriff an, und der Neuling weicht zurück, manövriert sich allerdings zusehends in eine Ecke, aus der er kaum entkommen dürfte.
Ich trete in Aktion, bevor Eric es tut: Mit Präzision und tödlicher Wucht stoße ich die Klinge in Erics ungeschützte Seite. Sie trifft auf befriedigenden Widerstand, als sie durch Fleisch und Sehnen schneidet.
Jemand brüllt laut auf – und es ist nicht Benjamin.
Keuchend zieht Eric das Messer heraus und wirbelt zu mir herum, während er nun zwei Messer wild um sich schwingt und nach dem Angreifer Ausschau hält. Der Kupfergeruch frischen Blutes wird immer stärker. Doch noch verströmt er mehr Zorn als Blut.
»Was sollte das werden, X?«