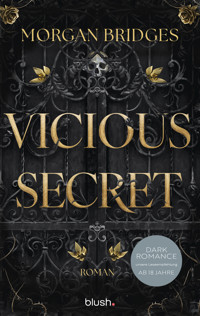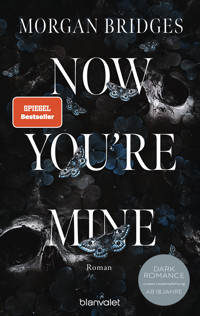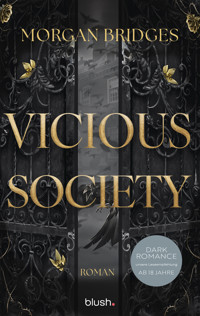
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Taschenbuch Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Obsidian Order
- Sprache: Deutsch
Amor est finis, die Liebe ist das Ende. Hat Delilahs und Xaviers Liebe eine Chance, obwohl sie mit dem Tod bedroht werden?
Xavier Donovan nimmt sich immer, was er will – auch Delilah, von der er seit ihrer ersten Begegnung besessen ist. Um endgültig Mitglied im Obsidian-Orden zu werden, muss der Rekrut einen Geheimauftrag erfüllen, doch er ist abgelenkt. Dafür drohen ihm Strafen – und seiner schönen Geliebten der Tod. Xavier muss Delilah retten! Er und Ben, ebenfalls Ordensanwärter, müssen sich tödlichen Prüfungen stellen. Die beiden sind die einzigen Männer, die Delilah je am Herzen lagen. Jetzt muss sie um ihre Leben fürchten. Dass sie alle drei dieses perfide Spiel unbeschadet überstehen, scheint unmöglich …
Das neue fesselnde Stalker-Romance-Duett mit College-Setting und den Tropes Touch-Her-and-Die und He-Falls-First.
Bei diesem Buch handelt es sich um Dark Romance mit einer Leseempfehlung ab 18 Jahren. Im Buch sind Triggerwarnungen enthalten.
Books that make you – blush.
Du suchst Liebesgeschichten mit reichlich Spice, mitreißenden Tropes oder morally grey book boyfriends? Dann entdecke weitere Bücher von Blush!
Enthaltene Tropes: Dark Romance
Spice-Level: 4 von 5
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 468
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Buch
Xavier Donovan nimmt sich immer, was er will – auch Delilah, von der er seit ihrer ersten Begegnung besessen ist. Um endgültig Mitglied im Obsidian-Orden zu werden, muss der Rekrut einen Geheimauftrag erfüllen, doch er ist abgelenkt. Dafür drohen ihm Strafen – und seiner schönen Geliebten der Tod. Xavier muss Delilah retten! Er und Ben – ebenfalls Ordensanwärter – müssen sich tödlichen Prüfungen stellen. Die beiden sind die einzigen Männer, die Delilah je am Herzen lagen. Jetzt muss sie um ihre Leben fürchten. Dass sie alle drei dieses perfide Spiel unbeschadet überstehen, scheint unmöglich …
Autorin
Morgan Bridges ist eine erfolgreiche Dark-Romance-Autorin mit einer Vorliebe für Antihelden, schön geschriebene Worte und viel Spice. Sie schreibt Heldinnen, die sie so sehr inspirieren, dass sie am liebsten deren Platz einnehmen würde – zumindest in ihrer Fantasie. Ihre Dark-Romance-Geschichten haben Tausende Fans: Nach dem beliebten »Possessing Her«-Duett wurde auch ihre Obsidian-Order-Reihe zu einem viralen Hit. Die Autorin lebt mit ihrer Familie in der Nähe von Dallas, Texas.
Von Morgan Bridges bereits erschienen
Once You’re Mine · Now You’re Mine · Vicious Secret
Morgan Bridges
Vicious Society
Roman
Deutsch von Leena Flegler
Die Originalausgabe erschien 2024 unter dem Titel Vicious Society.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung des urheberrechtlich geschützten Inhalts dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Copyright der Originalausgabe © 2024 by Building Bridges Publishing
Copyright der deutschsprachigen Ausgabe © 2025 by blush. Blanvalet in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München
(Vorstehende Angaben sind zugleich Pflichtinformationen nach GPSR.)
Redaktion: Susann Rehlein
Covergestaltung: www.buerosued.de nach einem Entwurf von Silviya Andreeva und unter Verwendung von Bildmaterial von Shutterstock/ S.Borisov, KHIUS, revers, Cranach, Belikova Oksana, ALEX S und Depositphotos/monkeypapa
Vignette: © Adobe Stock/Illustrator marinavorona
JS · Herstellung: DiMo
Satz: satz-bau Leingärtner, Nabburg
ISBN 978-3-641-33312-6V001
LIEBE*R LESER*IN,
dieses Buch enthält potenziell triggernde Inhalte. Deshalb findest du am Ende des Buchs eine Triggerwarnung.
Achtung:
Diese enthält Spoiler für das gesamte Buch.
Wir wünschen allen das bestmögliche Leseerlebnis.
Morgan Bridges und der Blush Verlag
Für alle, die auf Leute ohne jede Moral stehen.
In diesem Band macht Xavier ein paar echt fiese Sachen!
Kapitel 1
Xavier
»Xavier …«
Die Stille, die auf Delilahs gequältes Flüstern folgt, ist ohrenbetäubend; meine Alarmglocken hingegen sind noch viel lauter. Sie schrillen mir zu, dass ich zu ihr laufen und das Blut stillen muss, das aus ihrem Bauch strömt.
Um ihr das Leben zu retten.
Und meins gleichermaßen. Denn wenn sie stirbt, nehme ich das Messer, das in ihrem Bauch steckt, und schlitze mir damit die Kehle auf. In einer Welt, in der sie nicht mehr lebt, kann auch ich nicht mehr leben.
Die Oberhäupter der Gründerfamilien beäugen uns mit morbider Faszination. Die Männer tragen Masken, trotzdem ist das teuflische Blitzen in ihren Augen deutlich zu erkennen. Ist ihr Schweigen anerkennend? Oder ist die Prüfung damit noch immer nicht bestanden – wollen sie wirklich sehen, wie ich reagiere, wenn Delilah vor meinen Augen verblutet?
Ich drehe mich zu ihnen um, behalte Delilah aber aus den Augenwinkeln im Blick. Sie legt die Hände an den Messergriff, und ich beiße die Zähne zusammen, weil ich aus eigener Erfahrung weiß, welche Schmerzen sie gerade haben muss.
Mein Mädchen zieht sich ächzend und schwer atmend die Klinge aus dem Leib, die ich hineingestoßen habe. Blut strömt aus der Wunde, und ich kann nicht verhindern, dass mein Blick immer wieder zu ihr huscht.
»Nicht übel«, sagt sie und sieht auf die Wunde hinab, »aber bei Weitem nicht gut genug.«
Ihre Stimme ist dünn, kaum ein Hauch, und zugleich stark – von dem Feuer angeheizt, das in ihr lodert und das ich so sehr liebe. Delilah wiederholt gerade, was ich vor Jahren einmal zu ihr gesagt habe, als sie mit dem Messer auf mich losgegangen war. Wenn die Umstände anders wären und sie nicht in Lebensgefahr schweben würde, hätte ich jetzt eine Erektion.
Sie wartet nicht auf meine Reaktion, sondern wirft einfach das Messer beiseite. Es klappert über die Holzplattform und zerschneidet die Anspannung. Dann macht sie einen Schritt vor und stöhnt leise, während sie beide Hände auf die Bauchwunde presst.
Ich muss mich zwingen, stehen zu bleiben. Wenn ich ihr das Leben retten will, muss ich stoische Härte zeigen, selbst wenn es mich innerlich zerreißt, dass sie solche Schmerzen hat. Doch als Delilah mit einem leisen Schmerzenslaut auf die Knie fällt, sind all meine strategischen Gedanken zunichte. Ich gerate in Panik.
»Meine Braut braucht medizinische Hilfe«, sage ich mit beherrschter Stimme. Was mich alle Kraft kostet. »Wenn sie nicht überlebt, falle ich in den Zölibat zurück, was verdammt scheiße wäre.«
Die Oberen reagieren nicht auf meinen Einwurf. Mein Herz schlägt in wilder Panik. Mein Blick huscht erneut zu Delilah, die kurz ins Leere stiert, ehe sie die Augen schließt und hintüberkippt. Mit einem dumpfen Geräusch schlägt sie auf den Bodenplanken auf, und ich warte darauf, dass sie stöhnt oder flucht – doch als nichts kommt als Stille, packt mich das kalte Grauen.
Hab ich doch eine Arterie erwischt?
Ich weiß, dass ich gut zielen kann, besser als jeder andere Rekrut, aber das heißt nicht, dass ich sie nicht doch tödlich verletzt haben könnte. Wenn ich der Grund dafür bin, dass sie stirbt …
Ich wirbele herum und will bereits auf sie zustürzen.
Scheiß. Auf. Alles.
»Stehen bleiben, Rekrut!«
Als ich einen Blick über die Schulter werfe, sieht Daniel Kent, der Anführer des Medizinimperiums, mir unverwandt ins Gesicht. Sein Blick ist eine Kriegserklärung, eine Aufforderung, mich zu unterwerfen. Ich halte ihm stand. Ich werde nicht zurückweichen.
»Sie stirbt«, stoße ich zwischen zusammengebissenen Zähnen hervor.
»Das wissen wir.«
Ich habe größte Mühe, meinen Zorn zu zügeln. Er wird mit jedem Moment übermächtiger und durchzuckt meinen Körper wie Stromschläge, bis ich drauf und dran bin zu explodieren.
»Was soll das hier?« Als er nicht antwortet, fahre ich fort: »Tun Sie etwas, oder ich werde etwas tun!«
Kents Blick wird stählern. Tadelnd fragt er: »Soll das eine Drohung sein, Rekrut?«
»Nein, eine faktische Aussage. Sie ist mein Eigentum, und es ist mein Recht zu bestimmen, ob sie leben darf oder nicht.«
Er sieht mich unverwandt an, als würde er in meinem Gesichtsausdruck nach irgendetwas suchen. Trotz? Entschlossenheit? Angst? Ich sehe ihn meinerseits ausdruckslos an, lasse die Arme locker hängen. Was immer er sucht: Er wird es nicht finden.
Sofern ich meine Schwäche für Delilah nicht sowieso längst offenbart habe.
Im selben Moment, am Abgrund zum Wahnsinn, schießt mir durch den Kopf, welche Auswirkungen meine Aussage haben könnte. Sie könnte als Akt der Rebellion, des mangelnden Respekts gedeutet werden – als Missachtung des Protokolls und der Befehlskette. Oder als Beweis meiner Stärke: ein künftiger Anführer, der sein Recht auf etwas wahrnimmt, was ihm anvertraut wurde.
Zwischen Ungehorsam und Selbstbewusstsein verläuft ein verdammt schmaler Grat.
»Du hast deine Prüfung bestanden, Rekrut«, sagt Kent zu guter Letzt. »Durch den Kuss der Klinge ward Treue geschworen.«
»In der Finsternis wurden die Schwüre geboren«, erwidern die anderen Anführer gedämpft im Chor.
Ich neige den Kopf, nicht nur, um ihnen Respekt zu erweisen, sondern auch, damit sie mir die Erleichterung nicht ansehen. Als ich erneut zu Kent aufblicke, habe ich mich wieder komplett unter Kontrolle.
»Votum meum tibi«, sage ich, meine aber kein einziges Wort davon. Als ich den Schwur letztmals ausgesprochen habe, hab ich damit meinen Vater verärgern wollen, doch im Augenblick würde ich alles sagen, nur um ihnen nicht zu offenbaren, dass mein kleiner Greif mir alles bedeutet.
Kent nickt salbungsvoll. »Votum tuum receptum est.«
Ich muss selbst das letzte bisschen Beherrschung aufbringen, um nicht auf Delilah zuzustürzen. Gemessenen Schrittes betrete ich die Plattform und gehe neben ihr in die Hocke. Meine sonst so zupackenden Hände zittern, als ich mich nach dem Messer ausstrecke, das mit ihrem Blut befleckt ist.
Meine Braut blinzelt ein paarmal, als würde sie wieder zu sich kommen. Ich kann ihr die Schmerzen ansehen – und eine Regung, die ich lieber nicht benennen will.
»Beweg dich nicht«, flüstere ich.
»Beim letzten Mal, als du das gesagt hast, ist es nicht gerade gut für mich ausgegangen.«
Die Ironie in ihrer Stimme bringt mich trotz allem zum Lächeln.
»Halt durch, kleiner Greif«, flüstere ich so leise, dass die Oberen mich nicht hören.
Delilah so blass und verletzt zu sehen, jagt mir Angst ein. Ich hole tief Luft, zwinge meine Hände zur Ruhe und schneide einen Streifen Stoff aus ihrem Kleid, mit dem ich die Wunde verbinde, die immer noch viel zu stark blutet.
Vorsichtig, aber effizient wickele ich den Stoff um ihre Taille und verknote ihn mit gerade genügend Druck, um den Blutfluss zu stoppen. Jede Sekunde fühlt sich wie eine Ewigkeit an, und jeder Schmerzenslaut schneidet mir tiefer ins Herz, als es eine Klinge je könnte.
So behutsam, wie es nur geht, nehme ich sie in die Arme. Sie stöhnt und verspannt sich, versteift sich am ganzen Leib, als ich sie die Stufen von der Plattform hinuntertrage. Meine Schritte sind gemessen und kontrolliert, doch sobald wir außer Sicht sind, renne ich los in Richtung Krankenstation.
Delilahs flacher, unregelmäßiger Atem streicht mir über den Hals und jagt mir Adrenalin durch die Adern. Jeder gehauchte Atemzug von ihr ist eine geflüsterte Bitte, ein Mantra, ihr das Leben zu retten. Ich darf jetzt nicht versagen.
Die Flure im Schloss verschwimmen vor meinen Augen, bis ich endlich unseren schlosseigenen Arzt vor mir sehe, der sich im Wartezimmer die Zeit vertreibt: ein weiteres Mitglied der Familie Kent, eine Krähe, die sich sechs Jahre zuvor ihre Schwingen verdient hat. Als ich einfach an ihm vorbei ins Behandlungszimmer marschiere und Delilah auf die Behandlungsliege lege, runzelt er die Stirn.
»Sie hat eine Stichwunde«, erkläre ich mit fester Stimme und sehe ihm ins Gesicht. »Wenn sie stirbt, sterben Sie ebenfalls.«
Der Arzt zuckt angesichts meiner Drohung nicht mit der Wimper. Im Gegensatz zu meinen Händen zittern seine nicht, als er beginnt, sie zu untersuchen. Er ist einzig und allein auf mein Mädchen konzentriert.
»Zurücktreten«, befiehlt er mir, und sein selbstsicheres, ruhiges Auftreten gibt mir ein wenig Zuversicht. Er entfernt den Verband auf ihrem Bauch. Seine Bewegungen sind methodisch, seine Untersuchung effizient. »Sie hat viel Blut verloren, aber die Klinge hat keine lebenswichtigen Organe beschädigt. Ich muss die Blutung stoppen und die Wunde sofort vernähen.«
»Tun Sie, was Sie tun müssen«, murmele ich.
»Das war keine Bitte um Erlaubnis, sondern eine schlichte Aussage.« Dr. Kent blickt auf, als sein Assistenzarzt den Kopf zur Tür hereinsteckt. »Mach sie für die OP fertig.«
»Ja, Sir«, sagt der junge Mann.
Ich verschränke die Arme. »Wie lange dauert die OP?«
Dr. Kent sieht mir gelassen ins Gesicht. »So lange es eben dauert, Rekrut. Hör zu, das hier ist nicht das erste Mal, dass ich eine Stichwunde versorge. Sie wird es überleben.«
Ich nicke ihm knapp zu. Eine der härtesten Lektionen im Leben ist, zu akzeptieren, dass ein anderer gewisse Dinge besser beherrscht als man selbst. Und im Augenblick kann dieser Arzt Delilah auf eine Art und Weise helfen, zu der ich nicht imstande wäre. Auch wenn es mir schwerfällt, sie bei ihm zurückzulassen, und ich ihm am liebsten an die Gurgel gehen würde, weil er sie berühren wird, ist dies die einzige Möglichkeit, ihr das Leben zu retten.
Kapitel 2
Xavier
Dr. Kent hält meine Welt in seinen Händen.
Ich tigere auf und ab, und der kalte Steinfliesenboden im Wartebereich spiegelt meine Verfassung wider. Die Erinnerung daran, wie Delilah ohnmächtig geworden und ihr Körper leblos zusammengesackt ist, nagt an meiner Psyche wie ein Rudel tollwütiger Hunde und raubt mir die Fähigkeit, rational zu denken.
Nur so kann ich mir erklären, warum ich Dr. Kents Leben bedroht habe. Wenn er das dem Rat meldet, bin ich geliefert.
Doch wenn sie stirbt, spielt es keine Rolle mehr.
Ich spähe zu der geschlossenen Tür zum OP. Dann wische ich mir die schweißnassen Hände an meiner Hose ab und rufe mir nachdrücklich in Erinnerung, dass ich nur für einen tödlichen Fehler sorgen würde, wenn ich jetzt durch diese Tür stürzen würde. Dass ich die quälende Unsicherheit loswerden will, darf jetzt nicht dazu führen, dass ich ihr Leben aufs Spiel setze.
Es ist still im Wartebereich, und wie aus weiter Ferne höre ich durch die dicken Wände das Klappern der medizinischen Gerätschaften und die gedämpfte Unterhaltung des Ärzteteams. Erst als meine Beine anfangen zu krampfen, setze ich mich hin. Der Holzstuhl knarzt unter meinem Gewicht.
Das Warten ist eine Qual und schlimmer als die psychische Folter, der mein Vater mich in jüngeren Jahren unterzogen hat.
Ungebeten erwachen in mir Erinnerungen an die dunklen Tunnel unter der Universität: ein Labyrinth aus Finsternis und Stille. Wie viele Nächte musste ich dort unten verbringen, und nur das Grauen leistete mir Gesellschaft?
Mein Vater glaubte fest daran, dass ich an Widrigkeiten und Schmerzen wachsen würde. Das erste Mal ließ er mich in einem der Tunnel zurück, als ich noch ein kleiner Junge war – bewaffnet mit nichts als einer Taschenlampe und der Anweisung, den Weg nach draußen zu finden, sofern ich meine Mutter wiedersehen wollte. Was nach und nach keine allzu große Motivation mehr darstellte.
In den unterirdischen Tunneln gewöhnte ich mich an die Bedrohlichkeit des Unbekannten, ließ mich von Angst und Panik nicht brechen. Doch jetzt gerade trifft das Echo meiner Vergangenheit auf die Ängste der Gegenwart. Hier im Wartebereich kann ich gewisse Hindernisse nicht aus eigener Kraft überwinden. Ich bin gezwungen, mein Vertrauen in andere zu setzen.
Die Hilflosigkeit droht mich zu zerreißen.
Rastlos stehe ich wieder auf, die Zeit dehnt sich, jede Sekunde fühlt sich länger an als die vorige. Ich balle die Fäuste, bis meine Arme zittern und meine Fingerknöchel weiß sind. Das Vertrauen des Arztes in seine Fähigkeiten sollte mir eigentlich Sicherheit vermitteln, aber es funktioniert nicht.
Meine Angst, Delilah zu verlieren, ist schlichtweg zu groß.
Irgendwann – endlich! – geht die Tür auf, Dr. Kent kommt heraus und nimmt seine OP-Maske ab. Angst schnürt mir die Brust zusammen, als ich sein Gesicht auf Hinweise auf den Ausgang der OP absuche.
»Ihr Zustand ist jetzt stabil«, sagt er. »Sie ist noch jung, das sollte zu einem zügigen Heilungsprozess beitragen. Ich behalte sie über Nacht hier oder wie lange es eben dauert, bis ich sehen kann, dass kein Risiko mehr besteht. Hast du das verstanden, Rekrut?«
Ich nicke, weil ich kein Wort herausbringe.
Dr. Kent neigt leicht den Kopf und mustert mich. »Du kannst jetzt zu ihr. Allerdings schläft sie noch. Aber das Narkosemittel wird allmählich nachlassen. Außerdem habe ich ihr etwas gegen die Schmerzen gegeben. Es wird noch Stunden dauern, bis sie wieder normal ansprechbar ist.«
»Ich muss da sein, wenn es so weit ist.«
Ich muss wissen, ob sie mich hasst. Ob ich sie für alle Zeiten verloren habe.
Der Arzt zuckt mit den Schultern. »Vielleicht schläfst du erst noch ein bisschen. Ich kann dich ja anrufen, wenn sich ihr Zustand verändert.«
»Nein, ich bleibe, bis sie das Bewusstsein wiedererlangt hat.«
»Meinetwegen«, sagt er. »Warte hier, während meine Leute sie in den Aufwachraum bringen. Ich will, dass der OP bereit ist, falls er noch für einen Rekruten gebraucht wird.«
»Verständlich.«
Ich sehe ihm hinterher, und im selben Moment überkommt mich die Erschöpfung. Trotzdem will ich bei Delilah bleiben. Wenn nötig, schlafe ich eben auf dem Boden im Aufwachraum.
Einen Augenblick später wird eine Liege herausgerollt. Darauf liegt Delilah. Ihre Haut ist fast so weiß wie die Laken.
Ich atme tief durch, um den Schrecken zurückzudrängen, weil sie derart geschwächt aussieht. Und um zu verhindern, dass ich mich auf sie stürze. Am liebsten würde ich sie in meine Arme schließen.
Der OP-Pfleger sieht mich beunruhigt an. Dann schiebt er meine Braut an mir vorbei in Richtung Aufwachraum. Dort fährt er die Liege neben ein Krankenbett und beugt sich vor, um sie umzubetten.
»Fass sie nicht an!«, fauche ich. »Ich übernehme das.«
Der Pfleger zögert, weicht dann aber zurück und sieht mich misstrauisch an. Ich schiebe die Hände unter Delilahs Rücken und Beine und ziehe sie an mich. Als ich sie in meinen Armen halte, empfinde ich tiefste Euphorie. Fast muss ich schluchzen, wie irgend so ein erbärmliches Weichei.
Unter dem wachsamen Blick des OP-Pflegers lege ich meine Braut auf das Krankenbett, decke sie zu und stecke vorsichtig die Decke um ihren Körper fest. Sie sieht winzig und zerbrechlich aus. Der Anblick ist fast zu viel für mich.
»Ich sehe nachher noch mal nach ihr«, teilt der Pfleger mir mit.
Ich nicke bloß, lasse Delilah aber keine Sekunde aus den Augen. Sie schläft. Ihr Gesicht ist entspannt und die Atmung gleichmäßig. Von den Überwachungsmonitoren kommt ein regelmäßiges leises Piepen – eine Erinnerung daran, dass sie nicht einfach nur schläft, sondern eine schwere Verletzung erlitten hat.
Wird sie mir glauben, dass ich keine andere Wahl hatte? Dass ich sie nur deshalb verletzt habe, damit sie überlebt?
Genau wie ich Delilahs Liebe und Loyalität will, will ich auch, dass sie mir vergibt. Sofern ihr immer noch nicht klar sein sollte, was ich tun würde, um sie zu bekommen, wird sie es schon bald erfahren. Wenn ich je aufgegeben hätte, wäre ich längst tot.
Meine Entschlossenheit, ihr Herz zu erobern, ist fester als der Diamant, den ich ihr an den Finger stecken werde.
Nach den Prüfungen.
Ich setze mich auf den Stuhl neben ihrem Bett und betrachte sie. Ihre Brust hebt und senkt sich, und die gleichmäßige Bewegung beruhigt mich und vertreibt ein wenig von der Anspannung aus meinem Körper. Ich nehme ihre Hand, genieße die Weichheit und Wärme ihrer Haut und streife die Innenseite ihres Handgelenks mit meinen Lippen.
»Tibi semper sum. Für immer dein.«
Kapitel 3
Delilah
Boah, ey …
Ich fühle mich, als wäre ich von einem Schwerlaster überrollt worden. Als hätte der Fahrer den Rückwärtsgang eingelegt und wäre einfach aus reiner Boshaftigkeit noch ein paarmal über mich drübergebrettert. Ich verspüre eine unvertraute Enge am ganzen Körper, die meine Arme festhält, meine Brust, die Beine, und die meine Blutzirkulation behindert. Meine Lider sind schwer, und ich bekomme die Augen kaum auf. Als ich es endlich schaffe, sehe ich nur langsam verschwommene Konturen eines Zimmers vor mir.
Und dann sehe ich ihn. Xavier.
Er sitzt an meinem Bett und hält meine Hand fest, als hätte er Angst, ich könnte abhauen. Seine Haltung ist angespannt, und in seinem Gesicht zeichnen sich Emotionen ab, die ich nicht deuten kann. Besorgnis? Ein schlechtes Gewissen? Oder einfach nur Erschöpfung? Dass Sonnenlicht durchs Fenster fällt, ist ein Hinweis darauf, dass mehrere Stunden vergangen sein müssen …
Seit er versucht hat, mich umzubringen.
Sämtliche Erinnerungen auf einmal prasseln auf mich ein: wie ich auf diese Dachplattform geschleift wurde. Die Mitglieder des Obsidian-Ordens. Die Schmerzen, als die Messerklinge in meinen Bauch eindrang.
Warum?
Die Frage hallt in meinem Kopf wider, dennoch bin ich unerklärlicherweise erleichtert über seine Anwesenheit. Xavier hat mich niedergestochen – trotzdem sitzt er hier und wacht über mich. Er scheint sich seit gestern nicht umgezogen zu haben und hat dunkle Ringe unter den Augen. Anscheinend ist er mir nicht von der Seite gewichen.
Ich fange seinen Blick auf und atme scharf ein, weil ich das Unbehagen, das prompt durch meine Adern strömt, nicht unterdrücken kann.
»Du bist wach«, flüstert er.
Womöglich sollte ich Angst haben. Doch wenn Xavier mich hätte umbringen wollen, hätte er es jederzeit tun können, während ich nicht bei Bewusstsein war.
»Warum?«, ist das Einzige, was ich herausbekomme – ein Flüstern, das durch das stille Zimmer weht und von der Schwere meiner Gefühle spricht.
Xavier sieht mich unverwandt an, und Schmerz huscht über sein Gesicht. Dann scheint er sich zusammenzureißen und legt ein neutrales Gesicht auf, das zu seiner beherrschten Stimme passt.
»Ich musste es tun.«
»Das reicht mir nicht, Xavier.«
»Nur so konnte ich sicherstellen, dass du überlebst.«
Er sieht mir immer noch unverwandt in die Augen und scheint um Verständnis zu heischen, doch das bekommt er von mir nicht.
Ich entziehe ihm meine Hand. »Das alles ergibt keinen Sinn. Wie soll eine Messerattacke mein Überleben gewährleisten?«
»Wenn ich das Messer nicht geworfen hätte, hätten sie dich umgebracht.«
Er beugt sich vor, und obwohl sich alles in mir dagegen sträubt, vernebelt sein herrlicher Duft mir die Sinne. Sein Geruch dringt bis in meine Lunge vor, die sich zusammenzieht; ich muss meine flachen Atemzüge zur Gleichmäßigkeit zwingen und darüber hinweghören, dass sich mein Herzschlag beschleunigt.
»Das war die erste Prüfung«, erklärt er. »Ich hatte keine Wahl.«
»Man hat immer die Wahl.«
»Die andere Alternative hätte ich nicht ertragen.«
Ich runzele die Stirn. »Was soll das heißen?«
Er sieht kurz weg, und zwischen uns breitet sich Stille aus, bis sie sich wie ein unüberwindlicher Abgrund anfühlt, den ich nicht überbrücken kann, was ich womöglich auch gar nicht will. Sich in der Nähe dieses Mannes aufzuhalten, ist ein Risiko.
»Xavier«, spreche ich ihn zaudernd an, »erkläre es mir.«
Als er mich wieder ansieht, ist sein Blick schuldbeladen – eine Gefühlsregung, die in den Augen eines Mörders irgendwie fehl am Platz wirkt. Ich habe ihn nie so … menschlich erlebt.
»Sie wissen es«, sagt er leise.
»Wer?«
»Alle. Die Oberhäupter der Gründerfamilien wissen, was ich für dich empfinde. Wenn nicht, hätten sie dich nicht ausgewählt … um mich auf die Probe zu stellen. Wenn ich das Messer nicht geworfen hätte, hätten sie dich umgebracht. Meine Weigerung hätte ihnen nur gezeigt, dass meine Loyalität nicht beim Orden liegt … sondern bei dir.«
»Ist das so?«
Er zieht die Brauen hoch. »Was glaubst du denn?«
»Ich liege hier mit einer Stichwunde und bin mir echt nicht sicher, was ich noch glauben soll. Du warst so … kalt und distanziert, als ich dich zuletzt gesehen habe.«
»Ich musste so tun, als würde es mir nichts ausmachen, dass du verletzt warst.«
Ich beiße mir auf die Lippe. »Aber …«
Er steht auf und ballt die Fäuste. »Natürlich hat es mir etwas ausgemacht! Zu sehen, wie sie dich dort hochgezerrt und an dieses Brett gefesselt haben … und wie du geblutet hast …« Er schließt kurz die Augen, als hätte er Schmerzen. »Ich will das nie wieder durchmachen. Das ertrage ich nicht.«
Ich starre ihn an, und mir schwirrt der Kopf. Xavier behauptet, sich um mich zu sorgen. Weil ich seine Braut bin? Sein Eigentum, so wie es der Orden vorsieht? Oder gibt es noch irgendwas jenseits dieser Geheimgesellschaft, was womöglich nur mit uns beiden zu tun hat?
»Du hättest mich vorwarnen müssen.«
»Bis ich dich dort oben auf dem Dach gesehen habe, wusste ich doch gar nicht, was sie vorhatten!« Er verschränkt die Arme vor der breiten Brust. »Wie haben sie dich überhaupt aus meinem Zimmer gekriegt? Sie hätten niemals dort eindringen können … Es sei denn, du hast ihnen die Tür geöffnet.«
Ich erstarre. Das ist nun wirklich das Letzte, was ich ihm erzählen will. Der Grund, warum ich dort oben gefesselt und geknebelt wurde, war schließlich … dass die Person vor der Tür behauptet hatte, Xavier würde in Lebensgefahr schweben, und nur ich könnte die Gefahr abwenden. Das allein hat ausgereicht, um mich zu überzeugen.
Vielleicht ist er ja nicht der Einzige, der eine Loyalitätsprüfung bestehen musste …
»Ich bin müde«, sage ich nur, weil ich darüber im Moment nicht reden will.
Er mustert mich schweigend. »Dann schlaf noch ein bisschen.«
Ich schließe gehorsam die Augen und höre, wie der Holzstuhl kurz über den Boden schrammt. Anscheinend hat Xavier beschlossen, bei mir zu bleiben.
»Du musst nicht hierbleiben und auf mich aufpassen«, flüstere ich. »Ich bin mir sicher, die Ärzte machen ihren Job, auch ohne dass du danebensitzt.«
»Ich bleibe trotzdem.«
Ich zucke leicht mit den Schultern, ehe ich mich vorsichtig auf die Seite drehe und ihm den Rücken zuwende. Ich habe das Gefühl, dass ich nicht einschlafen könnte, während er mich anstarrt.
»Delilah?«
»Hm?«
»Ich bin froh, dass du nicht gestorben bist«, sagt er, und es klingt halb, als wollte er mich damit aufziehen.
Widerwillig muss ich lächeln. »Ich auch.«
Ich wache auf, als die Tür zum ansonsten stillen Zimmer aufgeht. Ich liege auf dem Rücken, und es fühlt sich an, als läge ich unter einer schweren Decke. Medikamente halten die Schmerzen in Schach, und dafür bin ich dankbar; ich wünschte mir nur, dass es auch Medikamente gegen den Aufruhr in meinem Kopf gäbe.
»Lilah?«
Bens Stimme weht zu mir herüber, und bei der Sorge darin zieht sich in mir alles zusammen. Einerseits will ich ihn sehen, andererseits hab ich nicht die Kraft, ihn jetzt zu beschwichtigen, und was sollte ich auch sagen?
Mir geht’s priiiima. Ich bin niedergestochen worden, aber anscheinend hat Xavier es nicht so gemeint, okay?
Ehe ich auch nur den Mut aufbringe, die Augen zu öffnen und ihn anzusehen, höre ich Xaviers scharfe, autoritäre Stimme.
»Sie muss sich ausruhen, McKenzie. Verzieh dich wieder.«
Die Atmosphäre schlägt sofort um, und es liegt Feindseligkeit in der Luft. Ein Teil von mir will sich einmischen, der andere Teil hören, was sie einander zu sagen haben, solange sie glauben, dass ich schlafe.
Gott, ich bin so eine Bitch …
»Ich wollte nur sehen, wie es ihr geht, X. Das ist auch schon alles.«
Bens Stimme klingt gepresst, kontrolliert, doch da ist noch etwas anderes: ein Anflug von Wut, die unter der Oberfläche brodelt. Wenn er Xavier jetzt irgendwie angreift, muss ich einschreiten.
Männer und Testosteron … Das ist der Stoff, aus dem Legenden entstehen. Und Dummheiten.
»Ihr geht’s gut«, sagt Xavier mit unverändert scharfer Stimme. »Dass du jetzt hier reinplatzt, hilft ihr kein bisschen. Sie hat schon genug durchgemacht und sollte nicht auch noch mit dir klarkommen müssen.«
»Mit mir?« Ben lacht ungläubig und bitter. »Du meinst, das Problem ist, dass ich hier bin? Doch wohl eher, dass du sie niedergestochen hast!«
Die Anschuldigung hängt eine Weile unkommentiert in der Luft. Ich atme tief durch, um meine Panik niederzuringen. Sie werden einander nicht umbringen, weil sie das nicht dürfen … glaube ich zumindest.
»Woher weißt du das?«, fragt Xavier schließlich. »Du warst doch gar nicht dabei.«
»Du bist nicht der Einzige, der gestern Nacht seine erste Prüfung hatte.«
»Wen hat der Orden für dich als Ziel ausgewählt?«
Stille macht sich breit und fühlt sich an wie dichter Nebel. Ich muss Bens Antwort hören. Vielleicht ist sie der Schlüssel, um alles zu verstehen, was passiert ist. Und ich würde erfahren, was er durchmachen musste. Er ist immerhin mein Bruder, meine Familie, ganz gleich, was er für Verbrechen verübt hat.
»Dieses Mädchen, mit dem ich letztes Jahr mal was hatte …«, sagt er leise.
»Und?«
»Und was?« Ben atmet hörbar aus. »Du kannst dir ja wohl denken, wie es ausgegangen ist, X.«
Ich öffne die Lider ein Stück und spähe unter meinen Wimpern hervor. Bens Gesicht ist eine Fratze aus Zorn und Selbsthass. Bei seinem gequälten Anblick wünschte ich mir, ich hätte ihn nie so gesehen. Eilig kneife ich die Augen wieder zu.
»Nein, kann ich nicht, McKenzie. Und bevor du mir irgendwas vorwirfst, solltest du erst mal erzählen, was du getan hast.«
»Ich wollte das nicht.« Betäubende Stille entsteht. Und dann: »Ich hab sie umgebracht.«
»Warum?«, fragt Xavier.
Seine Stimme klingt beherrscht und völlig urteilsfrei, während sich in mir eisiges Grauen breitmacht. Ich weiß, dass sie beide Assassinen sind, dass sie bereits zuvor Menschen umgebracht haben. Keine Ahnung, wie oft ich es noch hören muss, damit ich die Vorstellung ertragen kann.
»Ich hatte zuvor überlegt, was der Orden von mir verlangen könnte«, führt Ben aus. »Mir war klar, dass es eine Loyalitätsprüfung werden würde – aber wie weit würden sie gehen? Würde ich bestehen, wenn ich sie bloß verwunden würde? Oder ging es von Anfang an darum, sie umzubringen, und zwar ohne mit der Wimper zu zucken?« Er ächzt gedämpft, und es klingt, als hätte er die Hände vors Gesicht geschlagen. »Ich konnte einfach nicht riskieren durchzufallen.«
»Und ich nehme an, du hast …«
»Ich habe bestanden«, sagt Ben, und seine Antwort trieft vor Selbstekel. »Aber musste sie wirklich sterben? Das wird mir noch lange nachhängen.«
»Dir ist also klar, in welcher Zwangslage wir stecken«, entgegnet Xavier. »Ich musste mit dem Messer auf Delilah werfen, um ihr Leben zu retten. Sonst hätten sie sie umgebracht.«
»Bestimmt hast du recht. Ich kann es nur nicht ertragen, sie so zu sehen …« Ben seufzt niedergeschlagen. »Es hätte doch eine Alternative geben müssen!«
Xavier schnaubt. »Der Orden erlaubt keine Alternativen, das weißt du genau, McKenzie.«
»Hast du … bestanden?«
»Ja.«
»Das heißt, ich bin ein Haufen Scheiße, weil ich dieses Mädchen abgestochen habe, statt sie nur zu verletzen!«
So viel Unausgesprochenes hängt in der Luft, Andeutungen, denen nicht weiter nachgegangen wird, dabei will ich nichts lieber, als zu verstehen, was die beiden durchmachen. Doch die Wahrheit ist auch: Diese Männer haben eine gemeinsame Geschichte, die ich nie vollends durchdringen werde. Oder ihnen vergeben könnte. Ich kann nur die stille Beobachterin ihres inneren Widerstreits sein und hoffen, dass ich eines Tages dem Orden entkomme.
»Hör zu«, sagt Xavier mit fester Stimme, »wir wissen beide nicht, was für verquere Spielchen der Orden noch spielen will, und wir wissen ebenso wenig, wie wir dieses Spiel zu unseren Gunsten wenden können. Wir können nur unsere eigenen Entscheidungen treffen und hoffen, dass wir dabei nicht draufgehen.«
»Delilah hätte in diese Sache nie mit reingezogen werden dürfen.«
»Kann gut sein, dass der Orden sie zu deinem Ziel gemacht hätte, wenn sie nicht bereits meins gewesen wäre.«
Ben seufzt. »Gut möglich. Ihr Schicksal war am selben Tag besiegelt, da wir uns begegnet sind. Irre, oder? Dabei wollte ich immer nur auf sie aufpassen. Tja, und jetzt liegt die Verantwortung bei dir. Du … passt doch auf sie auf, oder? Sie bedeutet mir weit mehr, als du ahnst, X.«
Xaviers Antwort ist so leise, dass ich sie kaum verstehen kann. »Ich weiß. Das Gleiche gilt für mich.«
Kapitel 4
Delilah
Xavier bleibt die ganze Zeit bei mir. Immerhin geht er zwischendurch duschen und lässt uns von Declan frische Klamotten bringen.
Ich vermeide das Gespräch mit ihm, indem ich viel schlafe, allerdings ist mir klar, dass das nicht ewig so weitergeht. Irgendwann wird er mich löchern, wie ich in die Klauen des Ordens geraten bin und sie mich auf das Dach des Schlosses schleifen konnten. Dann werde ich zugeben müssen, dass ich eine Idiotin bin, wenn es um ihn geht.
Xavier nimmt meine Hand und sieht mich besorgt an. »Wie geht es dir?«
Ich schürze die Lippen. »Ich fühle mich, als wäre ich niedergestochen worden.«
»Schmerzen?«, fragt er und geht über meinen Seitenhieb hinweg.
»Schon, aber sie sind erträglich.«
Erleichterung zeichnet sich auf seinem Gesicht ab. »Gut. Ich will nicht, dass dir etwas wehtut.«
»Eine Entschuldigung würde schon helfen«, murmele ich.
Er verstärkt den Griff um meine Hand. »Ich werde mich niemals dafür entschuldigen, dass ich dir das Leben gerettet habe.«
»Ist das dein Ernst?«
»Absolut.« Er nickt nachdrücklich. »Ich würde dich jederzeit noch mal niederstechen, anschießen und auf jede andere erdenkliche Weise verletzen, wenn es deinem Überleben dient.«
»Ach du Scheiße …«
Er atmet frustriert aus. »Du darfst mich gern als schlechten Menschen betrachten, aber ich würde alles tun, was nötig ist, um dich bei mir zu behalten.«
»Bei dir behalten?!«
Ich ziehe meine Hand zurück. Xavier steht langsam von seinem Stuhl auf. Dann streckt er die Hand aus, um mich beim Kinn zu nehmen. Er dreht meinen Kopf zu sich, bis ich ihm ins Gesicht sehen muss.
Ich mache mich steif und senke den Blick.
»O ja, meine Zukünftige, du gehörst mir. Ich allein darf dich anfassen, ficken und …« Er hält inne und schüttelt den Kopf. »Und beschützen. Was immer dafür nötig ist.«
Mein Puls beschleunigt sich, und mein Herz hämmert gegen meine Rippen. »Soll das ein Antrag sein?«
»Nein, eine Feststellung.«
»Ich habe zu nichts Ja gesagt.«
Er beugt sich zu mir herunter, bis ich seinen Atem auf meinen Lippen spüren und das Glitzern in seinen Augen sehen kann. »Ich hab dich auch nicht gefragt, Braut.«
In seinem Gesicht stehen Entschlossenheit und Besitzerstolz. Ich zucke zusammen, als sich sowohl Begierde als auch Nervosität in mir breitmachen.
Sein Mundwinkel zuckt leicht nach oben. »Ich will jetzt keine Widerworte mehr hören …«
Meine natürliche Reaktion wäre, zu widersprechen und mit ihm zu streiten, zugleich sind seine Worte ein verlockendes Versprechen. Eine Sicherheit, nach der ich mich verzweifelt sehne, nachdem mein Leben bislang aus Sorgen und Turbulenzen bestanden hat.
Nur dass Xavier Donovan mich nicht liebt. Zumindest nicht so, wie ich allmählich beginne, mich in ihn zu verlieben. Ich darf das nicht zulassen. Mein Herz an einen Assassinen zu verschenken, ist reinste Idiotie. Er lebt nicht nur in ständiger Gefahr – er selbst ist quasi die Verkörperung von Gefahr.
»Das ist aber nicht gerade romantisch«, brummele ich.
»Was ich dir geben will, geht über Romantik hinaus. Es ist weit mehr. Es geht tiefer, als Worte es beschreiben könnten.«
Ich presse die Lippen zusammen, damit ich nicht sage, was mir auf der Zunge liegt. Sein Geständnis entzündet etwas in mir, allerdings bin ich mir unsicher, ob er zu tieferen Gefühlen imstande ist. Zu Besessenheit – eindeutig. Aber zu etwas so Reinem und Selbstlosem wie Liebe? Weiß er überhaupt, was Liebe ist?
»Du bist die Einzige, die je meinen Namen tragen wird«, sagt er. »Die Einzige, die je Mutter meiner Kinder sein wird. Und die Einzige, der meine ganze Loyalität gehört.«
Sein Blick ist ebenso klar und kraftvoll wie seine Worte und spricht gleichermaßen von Commitment und Intensität. Ich bin drauf und dran, in dieses Meer aus Irrsinn abzutauchen, der Tiefe nachzugeben und mich hinabziehen zu lassen.
Ein leises Klopfen an der Tür zerreißt den intimen Moment, und ein Arzt tritt ein. Er sieht abwechselnd mich und Xavier an.
»Ich will nicht stören, aber ich hätte hinsichtlich Ihrer weiteren Versorgung ein paar wichtige Informationen für Sie.«
Xavier lässt mein Kinn los und richtet sich zu voller Körpergröße auf, verschränkt die Arme vor der Brust. Die Wärme seiner Berührung und die Leidenschaft in seinem Geständnis umwehen mich noch immer und machen meine Hand schweißnass. Er hingegen wirkt kontrolliert, allenfalls einen Hauch neugierig.
Der Arzt tritt mit einem Klemmbrett an mein Bett. »Zuallererst muss die Wunde sauber und trocken bleiben. Im Augenblick besteht die größte Gefahr in einer Infektion.« Er wirft einen Blick auf mein Krankenblatt. »Reinigen Sie die Umgebung der Wunde zweimal am Tag mit milder Seife und Wasser. Nehmen Sie weder eine Alkohollösung noch Peroxid, weil das den Heilungsprozess verzögert. Sobald die Haut sauber und trocken ist, tragen Sie eine dünne Schicht Wundsalbe auf und decken die Wunde mit einem sterilen Verband ab.«
»Wann darf ich duschen?«
»Seit der OP sind fast achtundvierzig Stunden vergangen, insofern ist es heute okay.«
Xavier nickt. »Was ist mit Schmerzmitteln?«
»Verschreibe ich ihr, außerdem ein Antibiotikum, Wundsalbe und Verbandsmaterial. Und sie soll auf körperliche Betätigung verzichten.«
Der ältere Mann nimmt Xavier streng ins Visier, während mir die Röte in die Wangen steigt.
»Ich meine es ernst. Keine anstrengenden Bewegungen, Rekrut.«
Der Arzt hält seinen Blick auf Xavier gerichtet, bis der sein Einverständnis durch ein Nicken signalisiert.
»Ich hab’s beim ersten Mal schon kapiert.«
»Umso besser.« Dann wendet der Arzt sich wieder an mich. »Sie sind jung, deshalb wird Ihnen die Verletzung in ein paar Tagen kaum noch Schwierigkeiten machen. Wenn Sie irgendwas brauchen sollten, sprechen Sie jederzeit wieder bei mir vor.«
»Danke.«
Er nickt mir zu. »Der Pfleger kommt gleich mit den Medikamenten. Anschließend dürfen Sie gehen.«
Sobald er verschwunden ist, setze ich mich ächzend auf und schiebe die Beine über die Bettkante. Doch noch ehe ich mein Gewicht auf meine Füße verlagern kann, legt Xavier mir die Hand auf die Schulter.
»Lass mich dich tragen«, sagt er leise, aber nachdrücklich. »Ich will kein Risiko eingehen.«
»Aber ich kann selbst gehen«, entgegne ich und ignoriere die ziehenden Schmerzen in meinem Bauch. »Der Arzt meinte: ›keine anstrengenden Bewegungen‹, und nicht: ›überhaupt keine Bewegung‹.«
Xavier schüttelt den Kopf. »Ich kümmere mich um dich, ob dir das nun passt oder nicht.«
Ich verdrehe die Augen. »Ich verstehe schon, dass du dich verantwortlich fühlst. Aber Helikoptern ist echt nicht nötig. Ich habe mein Leben lang auf mich selbst aufgepasst.«
»Das wurde am selben Tag anders, da wir uns begegnet sind.«
»Was soll das denn heißen?« Ich senke die Stimme. »Redest du von Frank oder von etwas anderem?«
Xaviers ungerührte Fassade bekommt für einen Augenblick Risse und gestattet mir einen Blick auf einen Hauch von Verunsicherung.
»Seit der Nacht, in der wir uns begegnet sind, hab ich über dich gewacht und sichergestellt, dass dir nichts passiert. Ich habe alles und jeden ferngehalten, der eine Bedrohung sein könnte – für dich … oder für mich.«
»Für dich?« Ich runzele verwirrt die Stirn. »Das kapiere ich nicht.«
»Ist aber ganz einfach: Wenn ein Mann sich für dich interessiert, räume ich ihn aus dem Weg. Außer McKenzie – das aber auch nur, weil es dich verletzen würde, wenn ich ihn verletzen würde.« Xavier atmet hörbar aus. »Trotzdem strapaziert er meine Geduld aufs Äußerste.«
Ich bin froh, dass ich sitze, sonst wäre ich glatt auf dem Boden zusammengesackt. Mein Kopf versucht, die Tragweite dessen zu begreifen, was bei seinem Geständnis mitschwingt. Und mit einem Mal fallen sämtliche Puzzleteile an ihren Platz und ergeben ein Gesamtbild, das ich mir lieber gar nicht genau ansehen will.
»Dann hast du … was? Mein Privatleben sabotiert? Klingt mir verdammt danach.«
Als Xavier nicht widerspricht, sehe ich ihn finster an.
»Und ich dachte, irgendwas stimmt nicht mit mir! Die ganze Zeit über hab ich mich gefragt, warum keiner der Jungs um mich herum je interessiert an mir war. Dabei hatte das mit mir überhaupt nichts zu tun! Dass ich mich ungeliebt und unattraktiv gefühlt habe, ist deine Schuld!«
Xaviers Erklärung löst ein Rätsel, das mir lange zugesetzt hat.
»Drei Jahre lang habe ich dich beschützt – ich habe das beschützt, was ich mit niemandem zu teilen bereit bin.«
Ich kralle mich in die Matratze. Dann war ich in Wahrheit also nie ungeliebt, sondern Xavier hat mich so sehr begehrt, dass er sichergestellt hat, dass ich mit niemand anderem zusammenkam.
»Das hier ist mein Leben«, sage ich. »Du kannst nicht jede Entscheidung und jedes Ergebnis bestimmen!«
Er fängt meinen Blick auf. »Doch, kann ich«, sagt er ungerührt, als wäre es das Normalste auf der Welt. »Ich werde dir alles geben, was du dir nur wünschen kannst. Aber ich werde mich nicht dafür entschuldigen, dass ich verhindert habe, dass du mit jemandem zusammenkamst, der deiner nicht wert gewesen wäre.«
»Wie willst du denn wissen, was ich will, ohne meine Gefühle dabei zu bedenken?«
»Weil deine Gefühle – wie auch alles andere – nur mir gehören.«
Als ich zurückzucke, schnellt seine Hand vor, und er packt mich an der Kehle. Dann beugt er sich zu mir runter, und seine Lippen streifen meine bei jedem Wort, das er sagt, während seine Finger mit festem Griff jeder Silbe Nachdruck verleihen.
»Du wirst mich lieben, Delilah. Nichts anderes werde ich akzeptieren.«
Das Zimmer scheint zu schrumpfen, und die Wände rücken näher, als die Ungeheuerlichkeit seiner Worte und seine Entschlossenheit in mich einzusickern beginnen. Ich schwanke zwischen Wut und Hingabe und fühle mich innerlich derart zerrissen, dass ich schreien könnte. Wie kann ich mit jemandem zusammen sein, der so skrupellos ist, dass er mir all meine Freiheiten raubt und mir im selben Atemzug verspricht, mir die Welt zu Füßen zu legen?
Allmählich verliere ich den Verstand …
Als die Tür erneut aufgeht, lässt Xavier mich nicht sofort los wie gedacht; stattdessen hält er mich weiter fest und schert sich kein bisschen darum, dass wir Publikum haben.
»Diese Unterredung ist noch nicht vorbei, kleiner Greif.« Erst nach einem strengen Blick lässt er mich los, dreht sich zu dem Pfleger um und streckt die Hand aus. »Geben Sie mir die Tüte, damit wir endlich gehen können.«
Kapitel 5
Xavier
Ich habe nicht geschlafen und wohl auch nicht normal geatmet, seit mir zwei Nächte zuvor bei der Prüfung auf dem Schlossdach Delilah vor die Nase gestellt wurde. Dieses Mädchen macht mich echt fertig.
Trotzdem ist sie es wert.
Ein Teil der Anspannung der vergangenen Wochen fällt von mir ab, als wir mein Zimmer betreten und die Tür hinter uns ins Schloss fällt. Auch wenn Delilah hier endlich in Sicherheit ist, will ich sie immer noch nicht aus meiner Umarmung entlassen; sie ist verspannt, gibt sich anscheinend alle Mühe, mich emotional nicht an sich heranzulassen, doch das wird nicht lange anhalten.
Dafür werde ich sorgen.
Nachdem ich sie sachte auf der Bettkante abgesetzt habe, lasse ich meine Hände noch einen Moment auf ihr verharren und genieße es, ihren Körper zu spüren. Sie runzelt die Stirn, doch der missbilligende Gesichtsausdruck kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass sich ihr Puls beschleunigt – einzig und allein aufgrund meiner Berührung … Die minimale Reaktion sorgt dafür, dass sich sofort mein Schwanz in meiner Hose regt.
Ich werde sie um den Verstand ficken, sobald sie sich erholt hat.
Ich würde gerade alles geben, um sie vögeln zu dürfen, um das Grauen abzustreifen, das mich während der Prüfung im Klammergriff hatte, aber das darf ich noch nicht. Deshalb gehe ich nur vor ihr in die Hocke und ziehe ihr nacheinander die Krankenhaussocken aus, wobei ich extra behutsam vorgehe. Sie sagt kein Wort, nicht einmal Danke.
Dieses Mädchen hat garantiert eine Million Fragen und süffisante Kommentare in petto, die sie mir an den Kopf werfen will. Doch für den Moment wirkt sie eher in sich gekehrt. Mich macht rasend, dass in ihrem Kopf Dinge vor sich gehen, zu denen ich keinen Zutritt habe.
Ihre Atmung ist flach, und sie krallt sich so fest ins Laken, dass ihre Knöchel weiß werden. Ich blicke zu ihr hoch und rechne insgeheim damit, dass sie mich finster ansieht. Doch Delilah starrt ins Leere. Ist sie immer noch sauer auf mich? Oder hat sie Schmerzen?
Dass sie Schmerzen haben könnte, alarmiert mich. Ich nehme – immer noch vor ihr kniend – ihre Hand. »Hey …«
Sie blinzelt und schaut mich an. »Was?«
»Rede mit mir«, sage ich behutsam.
Sie schluckt, und meine Aufmerksamkeit ist sofort auf die Bewegung an ihrem zarten, femininen Hals gerichtet.
Langsam stehe ich auf und streiche ihr mit dem Daumen übers Kinn.
»Was willst du von mir hören?«, flüstert sie.
»Ich weiß, dass du immer noch sauer bist. Sag mir, was das Problem ist.«
Sie starrt mich an. »Das Problem ist dein Verhalten.«
»Da musst du schon genauer werden«, zitiere ich sie selbst, als es mal um ihr Verhalten ging.
»Du bist ein Psychopath …«
Ihre Aussage verletzt mich nicht im Geringsten. Ich weiß, dass ich mich nicht so verhalte, wie sie es vielleicht erwartet. Delilah glaubt, dass Reue und Schuld dasselbe wären, aber das sehe ich anders. Ich würde mich niemals dafür entschuldigen, dass ich ihr das Leben gerettet habe. Aber natürlich habe ich Schuldgefühle, wann immer ich ihr ins schmerzverzerrte Gesicht sehe. Das Brandzeichen und die Stichwunde hab ich mir so nicht ausgesucht. Trotzdem will ich, dass sie bei mir in Sicherheit ist.
»So siehst du mich wirklich?«, hake ich eher neugierig als beleidigt nach.
»Ja. Nein. Ach, ich weiß auch nicht.« Sie schüttelt den Kopf und seufzt. »Du bist echt … schwierig.«
»Inwiefern?«
»Erst verletzt du mich, und dann behauptest du, dass du das nur tätest, um mir das Leben zu retten, und weichst nicht mehr von meiner Seite. Du erzählst dem Orden, dass ich dein Eigentum wäre, behandelst mich aber, als wäre ich dir wichtig. An dir ist alles so … widersprüchlich.«
Ich zucke mit den Schultern. »Ich kann es dir auch nicht erklären, weil ich es selbst nicht begreife.«
Ich war bereits brutal und skrupellos, bevor ich sie kennengelernt habe. Aber jetzt? Was sie angeht, kenne ich tatsächlich keine Grenzen mehr. Liebe ist einfach fucking verrückt.
»Das reicht mir als Erklärung nicht, Xavier.«
»Muss es aber.« Als sie erneut den Mund aufmacht, bringe ich sie mit einem Finger auf ihren Lippen zum Schweigen. »Ich kann dir ansehen, dass du Schmerzen hast. Brauchst du Medikamente?«
Sie nickt, und in ihrem Blick spiegelt sich immer noch Unbehagen. Ich greife zu der Tüte, die mir der Pfleger mitgegeben hat, und nehme eine Schachtel mit Schmerzmitteln heraus. Dann hole ich ihr ein Glas Wasser. Nach kurzem Zögern schiebt sie sich zwei Tabletten in den Mund und schluckt sie.
»Und jetzt muss ich duschen.«
»Ich helfe dir dabei.«
Sie atmet keuchend aus. »Das kriege ich aber auch alleine hin.«
»Das bezweifle ich keine Sekunde lang.«
Ich lege ihr die Hände auf die Knie und schiebe sie unter den Saum ihres Krankenhausnachthemds, schiebe den Stoff behutsam nach oben, bis ich an ihren Hüften angelangt bin. Sie errötet und weicht meinem Blick aus, doch ihre Scheu hält mich nicht ab. Sie ist eher wie eine Droge – genau wie ihr inneres Lodern und die Momente, in denen sie sich mir ausliefert.
Sie nimmt die Arme hoch, und ich ziehe ihr in einer einzigen behutsamen Bewegung das Nachthemd aus, wobei ich sorgsam darauf achte, ihre Wunde nicht zu berühren. Der Verband ist blütenweiß wie der Spitzenbesatz an ihrem Slip …
Delilah beißt sich auf die Lippe, als ich die Finger unter den Saum ihres Slips schiebe.
»Hör sofort auf damit«, sage ich mit einem knappen Nicken in Richtung ihres Mundes, »du tust dir doch weh.«
»Aber dass du mich niederstichst, ist schon in Ordnung?!«
Ich muss mich zusammenreißen, um nicht zu lachen, weil sie so schnippisch ist. »Das war was anderes. Außerdem sagte der Arzt, du darfst dich nicht anstrengen.«
»Ich glaube nicht, dass er damit meinte, dass ich mich nicht selbst ausziehen darf«, murmelt sie.
»Lass es einfach zu, kleiner Greif.« Ich kann mein Grinsen nicht länger unterdrücken. »Es ist ja nun nicht so, als hätten wir Sex. Das Einzige, was ich fürs Erste mit dir vorhabe, ist, mich um dich zu kümmern.«
»Weil ich deine Braut bin? Oder dein Eigentum?«
»Nein. Weil du die Einzige auf der Welt bist, die mir etwas bedeutet.«
Bei meinen Worten löst sich ihre Anspannung. Jeder Muskel in ihrem Leib scheint zu erschlaffen. Sie rührt sich immer noch nicht, doch ihre Widerborstigkeit ist fast vollkommen verflogen.
Ich zupfe an ihrem Slip, und sie schiebt die Hüfte hoch. Der Stoff gleitet über ihren runden Hintern, und dann liegt ihre Pussy entblößt vor mir. Mein Schwanz zuckt. Bei diesem Anblick bin ich schlagartig härter denn je.
Sobald ich den Slip von ihren Knöcheln gezogen habe, stehe ich auf und reiche ihr die Hand. Delilah sieht mich mit weit aufgerissenen Augen an, und ihre Brust hebt sich in schnellem Takt. Ihre Nippel sind hart – und sie muss dermaßen feucht sein, dass ich ihre Erregung riechen kann.
Sie wird meine Selbstbeherrschung bis aufs Äußerste strapazieren.
Ich nehme sie hoch und drehe mich zum Bad um. Delilah schmiegt ihr Gesicht an meine Brust. Im Bad setze ich sie auf den Waschtisch, und auf dem kalten Marmor erschaudert sie. Sobald das Wasser warm genug ist, ziehe auch ich mich aus und trage sie in die Dusche.
»Das hier ist peinlich«, murmelt sie.
Ich blicke auf sie runter. »Warum? Du bist bildschön.«
»Aber so siehst du mich …«
»Ich hab dich doch längst nackt gesehen. Schon vergessen?«
»Da war es aber dunkel.«
»Gewöhn dich daran.« Ich stelle Delilah auf die Füße, lege ihr aber den Arm um die Taille, während ich die Duschkabinentür hinter uns zumache. »Ich hab vor, dich in Zukunft öfter nackt zu sehen. Und. Zwar. Jeden. Zentimeter. Von. Dir. Außerdem werde ich der Einzige sein.«
Sie schürzt die Lippen. »Und was ist mit Ärzten?«
»Die würde ich am liebsten umbringen … Aber die OP war nun mal nötig, um dein Leben zu retten.«
»Du bist wirklich vollkommen verrückt.«
Ich grinse. »Stimmt. Verrückt nach dir.« Ich greife zur Shampoo-Flasche und drücke etwas davon in meine offene Hand. »Mach deine Haare nass.«
Erst verdreht sie die Augen, tut dann aber, was ich sage. Ich arbeite das Shampoo in ihre Haare ein, massiere ihr die Kopfhaut und Schläfen, und sie ächzt leise. Der Laut vibriert über ihre Haut und bis in meine Fingerspitzen. Mein Schwanz schnellt vor und landet an ihrem unteren Rücken.
»Daran gewöhnst du dich besser auch«, murmelt sie hämisch und wackelt mit ihrem Hintern. »Keine anstrengenden Aktivitäten!«
Ich muss mich zusammenreißen, um ihr nicht einen Klaps zu verpassen. Dann greife ich zum Conditioner. Ihre Schultern entspannen sich, und sie genießt seufzend die Berührungen. Ich wasche ihr gründlich die Haare, während ich insgeheim die ganze Zeit in mich hineinfluche, weil ich geglaubt habe, ich könnte das hier schaffen, ohne die Beherrschung zu verlieren.
So schnell ich nur kann, spüle ich ihr den Schaum aus den Haaren und wickele sie in ein Handtuch. Ihre Nacktheit zu bedecken, ist das Beste, was ich gerade tun kann, allerdings hält es mich nicht davon ab, sie zu begehren.
Heute Nacht werde ich mir einen runterholen müssen, so viel ist sicher.
Kapitel 6
Xavier
»Leg dich hin«, sage ich.
Delilah sieht zu mir hoch und klammert sich an ihr Handtuch, als würde ein Stück Frotteestoff mich davon abhalten, mir zu nehmen, was mir gehört.
»Warum?«
»Ich will deine Wunde kontrollieren.«
Sie tut wie geheißen, sieht mich aber weiterhin misstrauisch an. »Sei vorsichtig …«
»Jederzeit.«
»Was war das gerade?«
Ich halte inne. »Ich hab ›jederzeit‹ gesagt. Warum?«
Sie hält den Atem an. »Weil das Ben und ich immer zueinander gesagt haben. Als eine Art Versprechen.«
In der Düsterheit meiner Seele flammt Eifersucht auf und entzündet finstere Gedanken. Ich muss mir ins Gedächtnis rufen, dass ich ihren Pflegebruder nicht umbringen darf, wenn ich ihr Herz erobern will. »Wenn du McKenzies Versprechen annehmen kannst, dann nimmst du meins besser auch an.«
Sie schließt die Augen. »Mach einfach. Ich sehe lieber nicht hin, sonst falle ich noch in Ohnmacht.«
»Ich beeile mich auch.«
Am liebsten würde ich sie dazu zwingen, mir zu vertrauen, so wie sie Benjamin vertraut. Aber ich weiß selbst, dass das noch eine Weile dauern wird. Dass sie mir während der Prüfung bedingungslos gehorcht hat, hat mir gezeigt, dass schon Vertrauen da war. Jetzt wieder von vorn anzufangen, wird meine Geduld an ihre Grenzen bringen.
Vorsichtig ziehe ich den Verband ab und inspiziere die OP-Narbe. Wenn man bedenkt, was passiert ist, sieht es gar nicht mal so schlimm aus. Eine Narbe wird zwar zurückbleiben, doch die wird Delilahs Schönheit keinen Abbruch tun.
Mein Blick wandert hoch zu dem Brandmal auf ihrer Schulter. Die Haut ist immer noch nicht vollends verheilt, allerdings ist sie schon weniger gerötet. Auch wenn das nichts war, was ich ihr hätte antun wollen, muss ich zugeben, dass der Anblick mich erregt. Mein Mädchen mit meinem Initial auf dem Körper? Allein das könnte mir einen Orgasmus bescheren.
»Was sagst du?«, fragt sie leise.
»Sieht gut aus. Kein Hinweis auf eine Entzündung.«
»Oh, gut.« Sie öffnet die Augen und blinzelt ein paarmal. »Das Zimmer dreht sich ein bisschen …«
»Das kommt von den Medikamenten. Bleib ruhig liegen, dann wechsele ich den Verband.«
Ich trage eine dünne Schicht Wundsalbe auf und lege den frischen Verband darauf. Delilah lässt mich die ganze Zeit nicht aus den Augen, und ihr Blick wird sekündlich vernebelter.
»Heb den Hintern an, damit ich das Handtuch unter dir wegnehmen kann«, sage ich.
Als sie tut wie geheißen, ziehe ich eilig das Handtuch unter ihr hervor. Es hilft alles nichts – mein Gehirn steht bereits in Flammen von ihrem Anblick und will sich auch nicht mehr beruhigen.
»Hast du Hunger?«, frage ich.
Sie winkt ab. »Ein bisschen, aber erst will ich schlafen.«
Ich lasse den Blick über ihren Körper schweifen. An diesen Anblick könnte ich mich gewöhnen. Sie ist von Kopf bis Fuß weich, rosig, und ihr nasses Haar lockt sich um ihr Gesicht. Und dann dieser sanftmütige Ausdruck, die leicht geöffneten Lippen, der vernebelte Blick …
»Was machst du in der Zwischenzeit, wenn ich schlafe?«
»Ich masturbiere.«
Sie bricht in Gelächter aus. »Bleib ernst!«
Ich bin ernst. »Ich bleibe hier und passe Tag und Nacht auf dich auf.«
»Das ist ja auch gar nicht gruselig, Edward Cullen!«
Ich lächele sie an. »Schlaf jetzt.«
»Mal ernsthaft, du musst doch auch müde sein? Ich kann mir nicht vorstellen, dass du im Krankenhaus allzu gut schlafen konntest.«
»Glaubst du wirklich, ich hätte überhaupt schlafen können, während du im OP fast ausgeblutet wärst? Da kennst du mich aber schlecht.«
»Und was war, während ich im Aufwachraum lag?«
Ich schüttele den Kopf. »Solange es dir nicht zu hundert Prozent gut geht, bin ich zu hundert Prozent auf Habacht. So läuft das von nun an zwischen uns beiden. Und jetzt schlaf.«
»Ja, Daddy.«
Leise schnaubend schließt Delilah die Augen.
Trotz allem, was uns an diesen Punkt gebracht hat, werde ich es genießen, mich um sie zu kümmern und ihr alles zu geben, was sie braucht. Zwar beschwert sie sich über das Übermaß an Aufmerksamkeit, aber das Flackern in ihren Augen hat sie verraten.
»Delilah?«
»Hm?«
»Wie konnte der Orden dich aus meinem Zimmer holen?«
Sie runzelt die Stirn, hält aber die Augen geschlossen. »Das will ich nicht erzählen. Du würdest mich bloß anschreien.«
»Warum sollte ich?«
»Weil ich dumm war.«
Fast muss ich lachen, weil sie so geknickt klingt. »Ich schreie nicht. Und jetzt erzähl, was passiert ist.«
Sie ächzt leise in sich hinein. »Na gut. Der Typ auf dem Flur meinte, dein Leben wäre in Gefahr.«
Mein Puls beschleunigt sich, und ich balle die Fäuste. Die Krähe wusste genau, was sie tat – dieser hinterhältige Motherfucker. Mir egal, ob er nur auf einen Befehl hin gehandelt hat. Ich will ihn trotzdem umbringen.
Ich streiche ihr eine Haarsträhne aus dem Gesicht. »Du hast die Tür aufgemacht … um mich zu retten?«
»Japp. Dumm von mir.«
»Nein, kleiner Greif, überhaupt nicht dumm.«
Sie schüttelt den Kopf. »Ich hätte wissen müssen, dass der Typ Scheiße labert, als er meinte, ich solle mein Brautkleid anziehen. Aber ich konnte die Vorstellung nicht ertragen, dass du in Gefahr schwebst. Deshalb hab ich mich umgezogen und bin zur Tür rausgerannt, als hätte mein Arsch in Flammen gestanden.«
Ihr Geständnis trifft mich wie eine Kugel ins Herz. Ich hätte niemals gewollt, dass meine Braut sich um meinetwillen in Gefahr bringt – doch dass sie es aus eigenem Antrieb getan hat, beweist mir ihre Gefühle für mich.
Oder was immer davon jetzt noch übrig ist.
Ich werde sie noch dazu bringen, mir zu verfallen, ganz gleich, was dafür nötig ist oder wie lange es dauert. Sie wird mir gehören, bis dass der Tod uns scheidet.
»Hat er noch irgendwas zu dir gesagt?«, will ich wissen.
Als Delilah nicht antwortet, drücke ich ihr einen Kuss auf die Stirn. Ich bin mir nicht sicher, ob sie wirklich schläft oder nur so tut, wie im Krankenhaus, als Benjamin zu Besuch kam. Mein Mädchen steht eindeutig auf Geheimniskrämerei – und ich wünschte mir, ich müsste selbst keine Geheimnisse vor ihr haben.
Wenn Delilah nur wüsste, was ich vorhabe … Sie würde mich auf der Stelle umbringen wollen. Schon wieder.
Kapitel 7
Delilah
Das Schrillen des Weckers bohrt sich in mein Bewusstsein und zerrt mich aus den düsteren Tiefen eines unruhigen Schlafs in die harte Realität des nächsten Morgens. Ich drehe mich zur Seite, um mein Handy auszuschalten, allerdings unter lautem Stöhnen, weil die Schmerzen im Bauch bis in die Fingerspitzen ausstrahlen. Es ist eine brutale Erinnerung an meine Stichwunde und nur eins von zahlreichen Beispielen dafür, in welches Chaos ich gestürzt bin.
Sobald der Handywecker ausgestellt ist, wälze ich mich zurück auf den Rücken und starre an die Decke. Heute ist der Montag aller Montage.
Wenn es schon wehtut, mich im Bett umzudrehen, wie soll ich dann in meine Seminare kommen, verdammt? Allein bei der Vorstellung, den Campus zu überqueren, krampft sich in mir alles zusammen.
Ich werde durch die Prüfungen fallen, mein Stipendium verlieren und von der Uni geworfen werden. Alles, wofür ich so hart gekämpft habe, all die Opfer, die ich erbracht habe, waren umsonst, und mir wird nichts weiter bleiben als schlechte Erinnerungen und Verbitterung.
Nur wegen der verkorksten Spielchen dieses Ordens.
Xaviers Zimmer ist abgedunkelt, und die Morgensonne späht nur verhalten durch die Vorhänge. Trotzdem sehe ich augenblicklich sein Gesicht auf dem Kissen neben mir. Der sanfte Rhythmus seines Atems ist beruhigend im ansonsten stillen Zimmer. Die sonst so harten Konturen um seinen Mund und die Augen herum sind geglättet, sodass er weit weniger einschüchternd und Respekt einflößend aussieht. Er hat sogar einen Anflug von Verletzlichkeit im Gesicht.