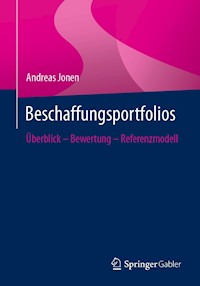Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fachliteratur
- Serie: Mannheimer Beiträge zur Betriebswirtschaftslehre
- Sprache: Deutsch
Immer wieder wird der Balanced Scorecard vorgeworfen, dass diese lediglich ein Modeprodukt sei und ihren Zenit längst überschritten hätte. Diese Kritik wird in diesem Beitrag analysiert. Diese Prüfung wird aus vier Perspektiven vor-genommen. Zunächst wird eine umfassende Diskussion sämtlicher in der Literatur vertretenen Vor- und Nachteile des Konzeptes auf sachlogischer Ebene durchgeführt. Anschließend wird mit Hilfe von drei empirischen Ansätzen die Analyse fortgesetzt: 1. Zeitliche Entwicklung der Verbreitung in der Praxis 2. Erfolgswirkungen auf verschiedenen Ebenen im Rahmen einer Meta-Studie 3. Analyse der Intensität der Beschäftigung der wissenschaftlichen Literatur mit der Thematik Der Vorwurf des Modeproduktes kann mit Blick auf die Inhaltsanalyse der wissenschaftlichen Literatur bestätigt werden. Die Intensität der Beschäftigung mit der Balanced Scorecard folgt dem für Moden typischen glockenförmigen Verlauf. Die Analyse der Lehrbücher und der Verbreitung in der Praxis (Meta-Studie über 32 empirische Analysen im deutschsprachigen Raum) zeigt eine weiter hohe Vitalität in der Praxis. Differenzierter müssen die Ergebnisse der sachlogischen Analyse und der Erfolgswirkung betrachtet werden. Ein Exodus der Balanced Scorecard kann hier jedoch auch nicht abgeleitet werden. Dies indiziert, dass der Verlauf der Verbreitung zumindest in Teilen keine Welle mit einem schmalen Wellenberg ist. Für die Wellenform, die beobachtet werden kann, findet sich im Surfjargon die Bezeichnung 'onaula-loa'; einer Welle, die groß und lang anhaltend ist.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 97
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
FSC®-Siegel
Die Mannheimer Beiträge zur Betriebswirtschaftslehre werden von den Professor*innen der Fakultät Wirtschaft Duale Hochschule Baden-Württemberg Mannheim (DHBW) seit dem Jahr 2004 herausgegeben. Diese werden durch ein Editorial Board vertreten.
Die DHBW ist die erste staatliche duale Hochschule in Deutschland mit dem besonderen Merkmal der konsequenten Verzahnung des wissenschaftlichen Studiums mit anwendungsbezogenem Lernen in der Arbeitswelt. Sie wurde am 1. März 2009 gegründet und führt das seit über 45 Jahren erfolgreiche duale Modell der früheren Berufsakademie Baden-Württemberg fort.
Zielsetzung der Mannheimer Beiträge ist, die Diskussion zwischen Hochschule, Wissenschaft und Praxis zu fördern. Das Themenspektrum erstreckt sich auf Forschungsfragen aus dem gesamten Spektrum der anwendungsbezogenen Wirtschaftswissenschaften und fokussieren insbesondere den Theorie-Praxis-Transfer.
Die jeweiligen Bände unterliegen einem internen Begutachtungsprozess, sodass der wissenschaftliche Anspruch, die Aktualität und die thematische Passung sichergestellt werden.
Weitere Informationen auch zu den bisher erschienen Bänden erhalten Sie unter: https://www.mannheim.dhbw.de/forschung-lehre/schriftenreihe
Abstract
Immer wieder wird der Balanced Scorecard vorgeworfen, dass diese lediglich ein Modeprodukt sei und ihren Zenit längst überschritten hätte. Diese Kritik wird in diesem Beitrag analysiert. Diese Prüfung wird aus vier Perspektiven vorgenommen. Zunächst wird eine umfassende Diskussion sämtlicher in der Literatur vertretenen Vor- und Nachteile des Konzeptes auf sachlogischer Ebene durchgeführt. Anschließend wird mit Hilfe von drei empirischen Ansätzen die Analyse fortgesetzt:
Zeitliche Entwicklung der Verbreitung in der Praxis
Erfolgswirkungen auf verschiedenen Ebenen im Rahmen einer Meta-Studie
Analyse der Intensität der Beschäftigung der wissenschaftlichen Literatur mit der Thematik
Der Vorwurf des Modeproduktes kann mit Blick auf die Inhaltsanalyse der wissenschaftlichen Literatur bestätigt werden. Die Intensität der Beschäftigung mit der Balanced Scorecard folgt dem für Moden typischen glockenförmigen Verlauf. Die Analyse der Lehrbücher und der Verbreitung in der Praxis (Meta-Studie über 32 empirische Analysen im deutschsprachigen Raum) zeigt eine weiter hohe Vitalität in der Praxis. Differenzierter müssen die Ergebnisse der sachlogischen Analyse und der Erfolgswirkung betrachtet werden. Ein Exodus der Balanced Scorecard kann hier jedoch auch nicht abgeleitet werden. Dies indiziert, dass der Verlauf der Verbreitung zumindest in Teilen keine Welle mit einem schmalen Wellenberg ist. Für die Wellenform, die beobachtet werden kann, findet sich im Surfjargon die Bezeichnung ‚onaula-loa‘; einer Welle, die groß und lang anhaltend ist.
Inhaltsverzeichnis
Abstract
Abbildungsverzeichnis
Tabellenverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
Einleitung
Grundkonzept der Balanced Scorecard
Kritik an der Balanced Scorecard
3.1 Theoretische Fundierung
3.2 Ursache-Wirkungs-Ketten
3.3 Perspektiven
3.4 Strategische Komponente
Vorteile der Balanced Scorecard
4.1 Integration nichtfinanzieller Aspekte
4.2 Integration von Frühindikatoren
4.3 Kommunikationsunterstützung
4.4 Strategische Ausrichtung
4.5 Offenheit des Konzeptes
4.6 Einbezug der Ursache-Wirkungs-Ketten
4.7 Moderner Charakter
Empirische Analysen zur Relevanz der Balanced Scorecard
5.1 Zielsetzung
5.2 Anwendungsanalysen
5.2.1 Grundgesamtheit
5.2.2 Anwendungsintensität
5.2.3 Intensität des geplanten Einsatzes der Balanced Scorecard
5.2.4 Kritische Analyse der Auswertung
5.3 Erfolgsanalysen
5.4 Literaturanalyse
5.4.1 Intensität der wissenschaftlichen Beschäftigung
5.4.2 Verankerung in der betriebswirtschaftlichen Standardliteratur
Fazit
Literaturverzeichnis
Anhang
Der Autor
Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1: Vorgehensmodell der Analysen
Abbildung 2: Grundmodell Balanced Scorecard
Abbildung 3: Kausalkette der Balanced Scorecard
Abbildung 4: Anzahl deutschsprachiger empirischer Befragungen nach Jahren (polynomische Trendlinie)
Abbildung 5: Anwendungsintensität - Studien ohne reine KMU-Betrachtung
Abbildung 6: Geplanter Einsatz der BSC in Zukunft
Abbildung 7: Veröffentlichungen zur Balanced Scorecard 1992-2008 mit Näherungsfunktion, Wendepunkt und Maximum
Abbildung 8: Anzahl Zeitschriftenpublikationen "Balanced Scorecard" pro Jahr
Tabellenverzeichnis
Tabelle 1: Zusammenfassung der Kritik an Balanced Scorecard
Tabelle 2: Positive Aspekte der Balanced Scorecard
Tabelle 3: Übersicht einbezogene Studien in Analyse
Tabelle 4: Ergebnisse der Studien zur Erfolgswirkung der Balanced Scorecard
Tabelle 5: Instrumentenrelevanz in Standard-BWL-Literatur
Tabelle 6: Ergebnis Prüfung Testkriterien
Abkürzungsverzeichnis
BSC
Balanced Scorecard
PKR
Prozesskostenrechnung
1 Einleitung
Jede Forschungsdisziplin wird an ihren Ergebnissen gemessen. Als Vertreter des Controllings war es schon immer problematisch, aufzuzeigen, wo die innovativen instrumentellen Beiträge in diesem Bereich zu verorten sind. Seit mindestens zwei Jahrzehnten wird bei der Frage nach Controlling-Innovationen auf ursprünglich amerikanische und häufig aus der Unternehmensberatung stammende Instrumente wie die Prozesskostenrechnung [PKR] (Activity Based Costing), das Target Costing und die Balanced Scorecard [BSC]1 verwiesen. 2
Gerade bei der BSC herrscht seit Jahren die Meinung, dass sie keine besonders hohe Akzeptanz erfährt, 3 dass sie basierend darauf mittlerweile keine Relevanz mehr habe4 und möglicherweise auch nie gehabt hätte;5 und lediglich eine Modewelle 6 bzw. ein Modeprodukt7 oder sogar lediglich eine Management-Marotte8 gewesen sei. 9 Auch eine ‚BSC-Müdigkeit‘ wird in der Praxis beobachtet.10 Der BSC wird ein „schlechtes Zeugnis“ 11 ausgestellt und ihr wird bescheinigt, dass diese „ihren Zenit überschritten“12 habe. Außerdem handele es sich nach Auffassung ausgewählter Autoren aufgrund verschiedener gescheiterter Implementierungen um einen „verbrannte[n] Begriff“ 13, sogar von einer Tyrannei der BSC 14 ist die Rede.
Auf der anderen Seite besteht die diametral zu verortende Ansicht, dass die BSC in der Betriebswirtschaftslehre und der Unternehmenspraxis „große Beachtung erfahre“ 15 und als „nützlich empfunden und eingesetzt“ 16 werde17, dass sie „weithin akzeptiert wird“18, ein „Mainstream Management Tool“ 19 bzw. „das dominierende Konzept eines modernen Performance Measurement“ 20 wäre, 21 sogar „ein geeignetes Instrument [sei], die Neuausrichtung des Controllings voranzutreiben“22, das „mit Abstand […] populärste Konzept“23 sei bzw. „auf dem besten Weg [wäre], zum Klassiker zu werden“24 und dass es sich gerade „nicht um eine kurzfristige Modeerscheinung handelt“25.26 Weber, J./ Schäffer, U./ Ahn, H. (2000) bezeichnen die BSC sogar als “eine Art Klammer um einige ‚Management-Modewellen‘ der jüngsten Vergangenheit“27. Die hohe Relevanz der BSC zieht sich bis in die Gegenwart hinein, in der die BSC auf Basis einer empirischen Befragung von Managern immerhin noch zu den Top 100 der Managementinstrumente gerechnet wird.28
Diese Diskussion bildet die Grundlage der folgenden Ausarbeitung. Dazu wird analysiert, inwieweit die BSC tatsächlich nur eine Modeerscheinung war. Mode ist generell und in diesem Zusammenhang häufig mit einem abwertenden Unterton behaftet, 29 da sie in den meisten Fällen kurzfristiger Natur ist und aus ihrem Selbstverständnis heraus „kontinuierlichen Selbstmord“ 30 begeht.31
Die Überprüfung, inwieweit die BSC (noch) relevant ist, wird in diesem Beitrag aus verschiedenen Richtungen angegangen. Dies ist zunächst die theoretische Herangehensweise über die sachlogische Abwägung der Vor- und Nachteile (Kapitel 3 und Kapitel 4). Anschließend werden die Akzeptanz auf Basis des Nutzungsgrades (Kapitel 5.2) und der Erfolg bei der praktischen Anwendung, also der Nutzung (Kapitel 5.3)32 Dazu wird eine Meta-Studie über alle vorhandenen empirischen Erhebungen zum BSC-Einsatz im deutschsprachigen Raum durchgeführt. mit einem besonderen Fokus auf den zeitlichen Verlauf betrachtet. Abschließend werden die Intensität der wissenschaftlichen Auseinandersetzung (Kapitel 5.4.1) sowie die Durchsetzung in der Lehre (Kapitel 5.4.2) analysiert. In Abbildung 1 wird das analytische Vorgehen in dieser Ausarbeitung veranschaulicht. Das Bild des richterlichen Hammers (‚gavel‘) symbolisiert, dass über die Relevanz der BSC aus unterschiedlichen Blickwinkeln ein Urteil gesprochen wird.
Abbildung 1: Vorgehensmodell der Analysen
1 Beachtung fand das Konzept seit 1992 mit der ersten Veröffentlichung im Harvard Business Review. Siehe Kaplan, R. S./ Norton, D. P. (1992).
2 Vgl. Biel, A. (2017), Schwarzmaier, U. (2013): S. 29, Hiebl, M. R. W. (2021): S. 7 und Horváth, P. et al. (1999): S. 290.
3 Vgl. Kunz, J. (2009): S. 106. In der Befragung von Tomschi, P. et al. (2002) nennen lediglich 5,6 % die hohe Akzeptanz der BSC als nutzenstiftenden Faktor der BSC-Einführung (9. Platz von 10 abgefragten Gründen). Vgl. Tomschi, P. et al. (2002): S. 26.
4 Schäffer, U./ Matlachowsky, P. (2008) zeigen in einer fallstudienbasierten Analyse auf, dass die Mehrzahl der Unternehmen die BSC sogar rückentwickeln. Vgl. Schäffer, U./ Matlachowsky, P. (2008): S. 220.
5 Schmid, S. (2003) stellt die kommerziellen Erwägungen im Hintergrund der BSC heraus und konstatiert, dass Kaplan und Norton „vor allem an der Vermarktung und weniger an wissenschaftlichen Erkenntnissen interessiert“ seien. Schmid, S. (2003): S. 13.
6 Hinsichtlich Moden bei Managementinstrumenten stellen Cox, A. et al. (2014) bei ihrer Analyse von Beschaffungsinstrumenten bei 122 Unternehmen fest, dass Manager zwar teilweise leichtgläubig sind und dazu tendieren, einigen modischen Ideen zu folgen, sie jedoch nicht jedes Instrument, welches ihnen präsentiert wird, einsetzen. 35 % der in der Analyse vorgestellten Instrumente wurde bei keinem der einbezogenen Unternehmen eingesetzt. Vgl. Cox, A. et al. (2014): S. 256.
7 Vgl. Kieser, A. (2000): S. 123f., Pascale, R. T. (1991): S. 22 und Weber, J./ Schäffer, U. (1998): S. 342 und 362 und Weber, J./ Schäffer, U./ Ahn, H. (2000): S. 173. Speckbacher, G./ Bischof, J. (2000) sehen den Eindruck des Modeproduktes verstärkt „durch die recht unreflektierte, leitfadenartige und durch Erfolgsgeschichten aufbereitete Darstellung in der Originalliteratur und in weiten Teilen der Sekundärliteratur.“ Speckbacher, G./ Bischof, J. (2000): S. 796. Zimmermann, G./ Jöhnk, T. (2000) verwenden den Begriff „Modeerscheinung“. Zimmermann, G./ Jöhnk, T. (2000): S. 602.
8 Vgl. Greiling, D. (2010): S. 538.
9 Vgl. Speckbacher, G./ Bischof, J. (2000) und Stöger, R. (2007): S. 25. Allgemein zu Moden bei Managementinstrumenten siehe Kieser, A. (1996): S. 21ff. und Pascale, R. T. (1991): S. 24.
10 Vgl. Finckh, C. A. (2019): S. 22.
11 Stöger, R. (2007): S. 28. In einer Untersuchung von Rigby, D./ Bilodeau, B. (2005) hinsichtlich der Zufriedenheit mit Instrumenten wird die BSC unterdurchschnittlich auf Platz 18 (von 25 untersuchten Instrumenten) eingeordnet. Vgl. Rigby, D./ Bilodeau, B. (2005): S. 6. Auf der anderen Seite stellten sie fest, dass die BSC unter den TOP4 Instrumenten mit den höchsten Zuwächsen hinsichtlich der Nutzung einzuordnen ist. Vgl. Rigby, D./ Bilodeau, B. (2005): S. 11.
12 Schrank, R. (2003): S. 28.
13 Biel, A. (2017): S. 8. Beispielsweise Schäffer, U. (2018) verwendet die Einordnung „verbrannt“ für das Beyond Budgeting. Siehe Schäffer, U. (2018): S. 2.
14 Vgl. Voelpel, S. C./ Leibold, M./ Eckhoff, Robert, A. (2006): S. 43.
15 Becker, A. (2001): S. 108. Gilles, M. (2003) spricht von einer „Boomperiode“ und „einem stark exponentiellen Wachstum“. Gilles, M. (2003): S. 23. Zimmermann, G./ Jöhnk, T. (2000) Stellen fest, dass die BSC „sowohl in der Anwendungspraxis als auch in der Wissenschaft große Aufmerksamkeit“ findet. Zimmermann, G./ Jöhnk, T. (2000): S. 601.
16 Seiter, M. (2018): S. 18.
17 Vgl. Nørreklit, H. (2000): S. 67.
18 Karau, I./ Bach, N. (2005): S. 17.
19 Gardiner, C. (2002): S. 136.
20 Reinecke, S. (2007): S. 114.
21 Klingebiel, N. (2000) Konstatiert, dass „zwischenzeitlich der Themenbereich Performance Measurement inhaltlich mit dem Balanced Scorecard-Ansatz gleichgesetzt“ wird. Klingebiel, N. (2000): S. 67.
22 Weber, J./ Schäffer, U./ Ahn, H. (2000): S. VI
23 Tomschi, P. et al. (2002): S. 23.
24 Morganski, B. (2003): S. 243.
25 Zdrowomyslaw, N./ Eckern, V. von/ Meißner, A. (2003): S. 356 und Kudernatsch, D. (2001): S. 19.
26 Vgl. Schäffer, U./ Matlachowsky, P. (2008): S. 207, 227, Kaufmann, L. (1997): S. 428, Wallenburg, C. M./ Weber, J. (2006): S. 245, 253 und Drews, H. (2001): S. 163.
27 Weber, J./ Schäffer, U./ Ahn, H. (2000): S. V.
28 Vgl. Schawel, C./ Billing, F. (2014): S. 3 und 37ff.
29 Gerade bei Konzepten oder Instrumenten wird verlangt, dass diese „rational“ sind. Dies wird üblicherweise nicht mit einer „Mode“ assoziiert, welcher eher eine gewisse Oberflächlichkeit attestiert wird. Vgl. Röbken, H. (2007): S. 270 und Pascale, R. T. (1991): S. 22.
30 Vgl. Röbken, H. (2007): S. 270.
31 Vgl. Osterloh, M./ Frost, J. (1994): S. 356, 361.
32 Vgl. Biel, A. (2017): S. 7.
2 Grundkonzept der Balanced Scorecard
Ein Performance Measurement System33 ist die Zusammenstellung abhängiger oder sich ergänzender Kennzahlen, die auf einen übergeordneten Sachverhalt (Unternehmensstrategie) ausgerichtet sind.34 Das System unterstützt Planungs-, Kontroll- und Analysezwecke, 35 wobei es einen höheren Aussagewert als die Einzelkennzahlen hat.36 Die BSC, welche auch als „multikriterieller Berichtsbogen“ 37 oder „ausgewogene Ergebnistafel“ 38 übersetzt wird, wird in den Bereich der