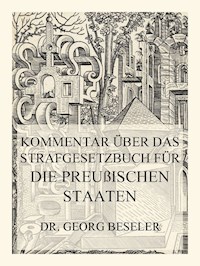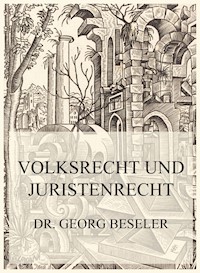
8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Der Verfasser hat sich die Aufgabe gestellt, das im 19. Jahrhundert im deutschen Rechtsleben geltende "Volksrecht" zum wissenschaftlichen Verständnis zu bringen und das Wesen und den Wert des "Juristenrechtes" einer Prüfung zu unterwerfen. Er beginnt sein Werk mit einer Übersicht der geschichtlichen Entwicklung des deutschen Rechts von den ältesten Zeiten bis auf die Gegenwart und sucht nachzuweisen, dass ungeachtet der Aufnahme des römischen Rechts und der dadurch herbeigeführten Entfremdung des Volks von seinen eigensten Angelegenheiten , in der Tiefe des nationalen Lebens noch immer eine schöpferische Kraft tätig geblieben sei und dass diese, obschon unter sehr verschiedenen Formen und mit oft geringem Erfolg, doch im Gegensatz zum fremden Recht das nationale Element zu vertreten nie aufgehört habe. Es stellt sich ihm demnach die Herrschaft des römischen Rechts, die nie eine abgeschlossene, zum Stillstand gekommene Tatsache geworden sei , sondern in verschiedenen Perioden der deutschen Rechtsentwicklung eine verschiedene Bedeutung gehabt habe, nur als eine Episode in der deutschen Rechtsgeschichte dar, und er schöpft daraus die Hoffnung , dass der Kampf der widerstrebenden Elemente zu deren organischer Verbindung führen werde, in welcher ein wesentlich nationales Prinzip die Herrschaft habe. Bei der Feststellung der Begriffe von Volks - und Juristenrecht geht der Verfasser von der "geschichtlichen Rechtsansicht", wie sie Savigny in seinem System des römischen Rechts entwickelt hat, aus, erörtert von seinem Standpunkt aus den Begriff des gemeinen Rechts und der Gegensätze desselben und geht sodann im ersten Hauptabschnitt auf das damals im deutschen Rechtsleben geltende über. Zuvörderst unterwirft er die Erkenntnisquellen desselben einer genaueren Untersuchung, gibt sodann eine allgemeine Charakteristik des Einflusses, welchen das im Gebiet des gemeinen Landrechts und gemeinen Ständerechts gehabt habe, und sucht den Wert desselben durch eine detailliertere Erörterung der rechtlichen Natur der Genossenschaft oder Assoziation anschaulicher nachzuweisen. Endlich behandelt er in diesem Abschnitt das Verhältnis des Volksrechts zur Gesetzgebung und zum Gerichtswesen. Weniger ausführlich wird im zweiten Hauptabschnitt das s . g . Juristenrecht besprochen. Er handelt hier in drei Kapiteln von der Methode des Juristenrechts, vom Umfang seiner Geltung und vom Wert desselben.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 399
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Volksrecht und Juristenrecht
DR. GEORG BESELER
Volksrecht und Juristenrecht, G. Beseler
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
86450 Altenmünster, Loschberg 9
Deutschland
ISBN: 9783849662455
Beseler, Georg: Volksrecht und Juristenrecht. Leipzig, 1843. In: Deutsches Textarchiv <https://www.deutschestextarchiv.de/beseler_volksrecht_1843>, abgerufen am 27.07.2022. Der Text wurde lizenziert unter der Creative Commons-Lizenz CC-BY-SA-4.0. Näheres zur Lizenz und zur Weiterverwendung der darunter lizenzierten Werke unter https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.de. Der Originaltext aus o.a. Quelle wurde so weit angepasst, dass wichtige Begriffe und Wörter der Rechtschreibung des Jahres 2022 entsprechen.
www.jazzybee-verlag.de
INHALT:
Vorrede.1
Erstes Kapitel. Historische Einleitung.2
Zweites Kapitel. Feststellung des Gegenstandes.35
Drittes Kapitel. Das gemeine Recht und seine Gegensätze.55
I. Das Volksrecht.65
Viertes Kapitel. Erkenntnisquellen des Volksrechts.65
Fünftes Kapitel. Das Volksrecht als gemeines Landrecht.84
Sechstes Kapitel. Fortsetzung. — Das Recht der Genossenschaft.96
Siebtes Kapitel. Das Volksrecht als gemeines Ständerecht.119
Achtes Kapitel. Das Volksrecht in seinem Verhältnis zur Gesetzgebung.140
Neuntes Kapitel. Das Volksrecht in seinem Verhältnis zum Gerichtswesen.150
II. Das Juristenrecht.181
Zehntes Kapitel. Methode des Juristenrechts.181
Elftes Kapitel. Das Juristenrecht nach dem Umfang seiner Geltung.199
Zwölftes Kapitel. Wert des Juristenrechts.208
Vorrede.
Es war ursprünglich meine Absicht, den Inhalt dieser Schrift, welche jetzt ein zusammenhängendes Ganzes bildet, in einer Reihe einzelner Abhandlungen zu bearbeiten, und zwar nach der Beschaffenheit des Gegenstandes teils in der Form einer freien wissenschaftlichen Erörterung, teils als ausführliche, mit dem vollständigen gelehrten Apparat ausgestattete Monographien. Ich weiß nun freilich sehr wohl, dass ich, indem ich von diesem Plane abging und die gegenwärtige Form des Werkes wählte, den wichtigen Vorteil aus der Hand gab, auch die einzelnen darin behandelten Lehren so, wie es die unbefangene Darlegung einer genauen Forschung allein vermag, zu begründen. Indessen schien es mir doch vor allem darauf anzukommen, die leitenden Gedanken, um deren Ausführung es mir zunächst zu tun war, zur gehörigen Klarheit und Anschaulichkeit zu erheben, und so trug ich kein Bedenken, in ihrem Dienst das von mir zusammen gebrachte Material zu verwenden. Mag diese Schrift dadurch auch nach einer Seite hin an Wirksamkeit verloren haben, so gelingt es ihr dafür vielleicht umso eher, eine allgemeinere und lebendigere Teilnahme zu erregen, und das würde ich für einen entschiedenen Gewinn halten. Denn es kommen hier Fragen zur Erwägung, bei deren Lösung nicht allein die Juristen beteiligt sind und die Entscheidung abzugeben haben.
Greifswald im Juli 1843.
G. B.
Erstes Kapitel. Historische Einleitung.
Um Wiederholungen zu vermeiden und für die weitere Entwicklung die rechte Grundlage zu gewinnen, habe ich es für nötig gehalten, bevor ich zu dem eigentlichen Gegenstande dieser Abhandlung übergehe, eine kurze historische Einleitung vorauszuschicken. Die Aufgabe derselben ist leicht zu bestimmen: sie soll in wenigen, einfachen Zügen die Geschichte des deutschen Rechts von den ältesten Zeiten bis auf die Gegenwart geben, und nicht bloß zeigen, in welcher Weise und aus welchen Elementen sich der heutige Rechtszustand in Deutschland gebildet hat, sondern auch namentlich dartun, wie zu allen Zeiten die Beschaffenheit des Rechts mit dem ganzen öffentlichen Leben der Nation in dem engsten Zusammenhange gestanden und von demselben bedingt worden ist. Durch eine solche Betrachtung wird sich über Manches, was bei einer einseitigen, bloß juristischen Auffassung kaum erklärlich scheint, das rechte Verständnis gewinnen lassen, vor allem auch über die Aufnahme des römischen Rechts in Deutschland und deren Bedeutung für die Gegenwart. Aber es stehen auch einer Darstellung, welche den angegebenen Zweck erreichen soll, keine geringen Schwierigkeiten entgegen. Aus dem ganzen reichen Material kann nur mit einer, allein durch den richtigen Takt bestimmten Auswahl das Allerwesentlichste hervorgehoben werden; und, was besonders zu erwägen ist, der Stoff darf nicht bloß aus den eigentlichen Rechtsquellen entnommen werden, da diese teils unzureichend sind, teils aber häufig das geltende und zur Anwendung gebrachte Recht nicht genau angeben. Denn die Wirklichkeit und namentlich die des germanischen Mittelalters sieht oft ganz anders aus, als die dafür gesetzten Rechtsnormen es erwarten lassen, und selten kommt eine in dem inneren Rechtsleben einer Nation vorgehende Veränderung zum Durchbruch, ohne dass nicht vorher in langem Kampfe ein Teil des positiven Rechts der neuen Idee hat unterliegen müssen, bis diese sich auch äußerlich und förmlich sanktioniert an dessen Stelle setzt, um dann vielleicht schon wieder von einer anderen Richtung, die sich geltend machen will, bedroht zu werden. So muss die Rechtsgeschichte, wenn sie nicht bloß das Werk einer einseitigen, toten Quellenforschung sein soll, als integrierender Teil der allgemeinen politischen Geschichte in ihrem weitesten Umfang aufgefasst werden; sie muss das Rechtsleben der Nation in seiner Fülle und seinem Wechsel zur deutlichen Anschauung zu bringen wissen. — Bei dieser Höhe der Aufgabe darf die folgende Skizze freilich nur ein bescheidenes Verdienst für sich in Anspruch nehmen.
Die ältesten Nachrichten über unser Volk zeigen dasselbe noch nicht in einer formell ausgeprägten, politischen Vereinigung. Die ungebundene Freiheit roher Naturmenschen, welche nur in dem Willen jedes Einzelnen und in der Macht des Stärkeren ihre Beschränkung findet, treffen wir freilich bei den Deutschen, wie sie zuerst in der beglaubigten Geschichte auftreten, nicht mehr an; es zeigt sich vielmehr bei ihnen schon jede Anlage, welche zur höheren menschlichen Bildung befähigt, und der Anfang geordneter politischer Verhältnisse. Aber diese waren doch erst im Entstehen begriffen, und hatten noch nicht die Kraft, die Einzelnen zu einer bewussten Volkseinheit zusammen zu führen. Auf der allgemeinen Grundlage menschlicher Verbindungen, der Familie, waren die weiteren Vereine erwachsen, welche sich genossenschaftlich abschlossen, und insofern sie sich an einen bestimmten Grundbesitz knüpften, zu Gemeinden sich ausbildeten. Aus diesen traten wieder Einzelne zu freien Gefolgschaften zusammen, indem sie sich unter gefeierten Häuptlingen zu Kämpfen und Abenteuern verbanden, und über die Grenzen hinausschweifend, der nachdrängenden Volksmacht oft die Bahn zu Eroberungen und neuen Ansiedlungen wiesen. So entwickelten sich die einzelnen Völkerschaften und Stammesgenossenschaften, welche aber erst im fünften Jahrhundert nach Christus unter dem Einfluss der durch die Römerkriege hervorgerufenen Bündnisse zu einer gewissen Stätigkeit und Abgeschlossenheit kamen. Sie standen äußerlich getrennt nebeneinander, ja oft feindlich sich gegenüber; aber alle hielt doch das Band gleicher Abstammung zusammen: Religion, Sprache, Sitte und Recht waren aus derselben Wurzel hervorgegangen, und entfalteten sich, ungeachtet so vieler und bedeutender Abweichungen, im Ganzen doch in einer bewunderungswürdigen Harmonie. Tritt dieser Bildungsprozess äußerlich auch nur bei den einzelnen Stämmen hervor, so zeigt sich der tieferen Betrachtung doch bald, dass hier eine nationale Entwicklung vor sich gehe, der später auch die mehr formelle Vereinigung nicht fehlen werde.
Dem ganzen Stammesleben aber entsprach das Recht der älteren Zeit: es war noch ganz mit der Religion und der Sitte verwachsen, wenn es sich auch schon, trotz der symbolischen Umkleidung, in bestimmten Instituten erkennbar herausstellt; es ging unmittelbar aus den Lebensverhältnissen hervor, wie sie sich bei der allgemeinen nationalen Anlage und den besonderen Bedürfnissen der engeren Kreise gestalteten. Die freien Genossen der Volksgemeinde sind die eigentlichen Träger der öffentlichen Gewalt; der Unfreie ist außer dem Volksrechte gestellt, ohne politische Berechtigung. Jene aber treten im Thing zusammen, und verhandeln hier ihre Angelegenheiten, — bald nach kleineren Bezirken, wie das Interesse der Familie, der Mark, des Gaus es erheischt; bald in größeren Versammlungen, welche in wichtigen Fällen den ganzen Stamm darstellen können. Doch ist auch unter den Freien keine völlige Gleichheit: das Ansehen des Hausvaters, des Hofbesitzers mit einer selbständigen Berechtigung am Gemeindeland musste sich unter natürlichen Verhältnissen von selbst geltend machen; für gemeinschaftliche Opfer und andere religiöse Handlungen konnten Priester nicht entbehrt werden; es zeigen sich früh einzelne hervorragende Geschlechter mit einer bevorzugten Stellung in der Gemeinde und bei den Versammlungen, ja selbst das Königtum, wie man die beschränkte Macht der Stammeshäuptlinge zu nennen pflegt, ist schon zu Tacitus Zeiten bei den meisten Völkerschaften hergebracht. Aber wenigstens bei denen, welche frühe zu festen Sitzen gekommen waren und sich unvermischt mit den Römern erhielten, blieb die gemeine Freiheit doch der eigentliche Mittelpunkt und Kern der Verfassung. So war auch die Handhabung des Rechts bei der Gemeinde, welche den Volksfrieden zu schützen hatte; nur griff sie nicht in regelmäßiger Wirksamkeit ein, sondern überwachte und leitete hauptsächlich, so gut es ging, die Fehden der einzelnen Genossen, die aber seltener mit Waffen als mit Eiden ausgekämpft wurden, und in der Zahlung einer Buße an den Verletzten regelmäßig ihre Erledigung fanden. Doch erhob sie vom Friedbrecher in selbständiger Berechtigung auch noch das Fredum, und wer sich direkt an der Gesamtheit verging, den traf die Strafe des Verräters. Im Felde wird aber überhaupt ein strengeres Kriegsrecht gegolten haben.
In dieser Lage blieben die im heutigen Deutschland angesessenen Volksstämme, (denn nur mit diesen haben wir es hier zunächst zu tun) bis zwei Ereignisse eintraten, welche zueinander in naher Beziehung stehend, einen welthistorischen Einfluss auf sie ausübten: ihre Bekehrung zum Christentum und ihre Einverleibung in die fränkische Monarchie. Die christliche Religion, für welche gerade bei den Germanen die größte Empfänglichkeit vorhanden war, hat sie befähigt, an der allgemeinen Entwicklung der abendländischen Kultur Teil zu nehmen, und überhaupt auf das Rechtswesen bedeutungsvoll einwirkend, vor allem in der eigentümlichen Stellung der Geistlichkeit ein neues Element der Verfassung hervorgerufen. In der fränkischen Monarchie aber kamen die Deutschen unter die Gewalt des auf dem eroberten römischen Boden entwickelten Königtums, welches die Souveränität der einzelnen Volksstämme und ihrer Herzöge beschränkte, und sie zu einer, wenn auch nur äußerlichen politischen Einheit zusammenführte, in der sich schon ein geordnetes Staatsleben geltend machte. Karls des Großen Sieg über die Sachsen bildet den Wendepunkt in dieser Periode der deutschen Geschichte, wie denn überhaupt die Bedeutung des fränkischen Einflusses sich am entschiedensten in der Regierung dieses gewaltigen Fürsten darstellt, dessen Schöpfungen die sicherste Gewähr der Dauer in sich trugen, weil sie dem Geiste der Zeit und wahrhaft nationalen Bedürfnissen entsprachen.
Um nun die Stellung der Deutschen in der fränkischen Monarchie richtig aufzufassen, muss die eigentümliche Lage der öffentlichen Verhältnisse gehörig gewürdigt, und namentlich der Gegensatz, in welchem sich die rein deutschen Stämme zu den in den römischen Provinzen angesiedelten befanden, bestimmt hervorgehoben werden. Die letzteren, als deren Repräsentanten die in Gallien ansässig gewordenen Franken genommen werden können, waren früh christianisiert, der äußern Kultur und mancher Verwaltungsformen der Provinzialen teilhaftig geworden; sie waren ferner, was besonders zu erwägen, zum großen Teile aus Gefolgschaften hervorgegangen, und deswegen geneigt, in ein bestimmtes Dienstverhältnis zum Könige zu treten, welches dem ursprünglichen Prinzip der gemeinen Freiheit, wenn auch nicht geradezu widerstrebte, doch wesentlichen Abbruch tat. Dieses tritt daher bei den Franken allmählich zurück, und die hohe Geistlichkeit und die vornehmen Dienstmannen, in der Reichsversammlung vereinigt, erscheinen neben dem König als der politisch berechtigte Teil der Nation. Als nun nach und nach die in Deutschland gebliebenen Völkerschaften unterworfen, und den Franken als freie Genossen zugesellt wurden, so kam zu dem fränkischen Dienstmannenrecht, welches schon das Lehenwesen im Keim in sich trug, die alte germanische Volksfreiheit hinzu, welche in der Heimat treu bewahrt worden war. Daraus ergab sich nun ein doppeltes Element der Verfassung, welches wir unter den ersten Karolingern, und namentlich unter Karl dem Großen gleichmäßig gewahrt sehen. Das fränkische Element überwog, wo es sich von allgemeinen Reichsangelegenheiten handelte, und das eigentliche Staatsprinzip zur Frage stand; namentlich die Reichsversammlung und die Stellung der königlichen Beamten war darauf basiert. Die Volksfreiheit dagegen blieb mit voller Wirksamkeit in den engeren Kreisen der Stämme, Provinzen und Gemeinden bestehen, nur dass ein königlicher Beamter die formelle Leitung hatte und namentlich den Bann (das imperium) handhabte; ja mit einer großartigen Konsequenz hatte Karl das Kriegswesen auf die Volksbewaffnung (den Heerbann) zurückgeführt.
Bei dieser Verfassung war nun allerdings schon ein energisches Eingreifen der höchsten Gewalt in der Monarchie möglich, und unter kräftigen Herrschern kommt es auch mit entschiedenem Erfolg vor. Es wurden allgemeine Reichsgesetze von großer Bedeutung erlassen; die Verwaltung, nach bestimmten Regeln geordnet, war schon vielfach im Interesse des öffentlichen Wohles tätig; die öffentlichen Strafen mehrten sich; die Rechtspflege trat der Privatgewalt der Einzelnen bestimmter gegenüber, und das Fehdewesen ward beschränkt. Doch führte dies zu keiner Unterdrückung des alten Volksrechts, weil sich dasselbe in den engeren Kreisen des öffentlichen Lebens frei bewegen durfte. Kein Gesetz ist unter Karl dem Großen für einen einzelnen Volksstamm ohne dessen Zustimmung erlassen worden; auf den Provinziallandtagen, in den Versammlungen der Gaue, Hunderte und Gemarkungen wurden noch immer die Geschäfte von den freien Eingesessenen selbständig abgemacht. Auch die Rechtspflege lag in ihren Händen, denn die Quelle des Rechts war noch die Überzeugung der Gemeinde: gesetzliche Verfügungen kommen namentlich für das Privatrecht nur selten vor. Aber eine große, lebhaft bewegte Versammlung, bei der kein parlamentarisch geordneter Geschäftsgang angenommen werden darf, passt nicht für eine sich regelmäßig wiederholende richterliche Tätigkeit; es kommt nur darauf an, dass diese unter der Aufsicht und Billigung der Gemeinde geübt werde. Daher findet sich schon frühe, dass nach Verhandlung der Sache, die in lebendiger Rede und Gegenrede vor sich ging, einer oder mehrere der Genossen das Urteil einsetzten, welches bestehen blieb, wenn die Übrigen (der Umstand) es nicht verwarfen. Auf diesem Prinzip beruhte auch die sogenannte Karolingische Schöffenverfassung, indem unter Leitung eines Sendboten von dem Grafen und seiner Gemeinde bestimmte Personen aus dieser für die Dauer erwählt wurden, um vorstimmend das Urteil zu finden, was denn in den gebotenen Gerichten, wo die Gemeinde nicht gegenwärtig zu sein brauchte, als eine wahre Jurisdiktion sich darstellen musste.
Auf diese Weise schien für einen großen Teil des Abendlandes eine Staatsform gefunden zu sein, welche die verschiedenen Völkerschaften, durch gemeinschaftliche Abstammung und das Band des Christentums untereinander verbunden, auf die Dauer zu einem Staatsganzen vereinen, und ihnen doch zugleich die ihrer Eigentümlichkeit entsprechende Freiheit der Bewegung gewähren könne. Aber als Karls starke Hand nicht mehr über das Reich waltete, da zeigte sich doch bald, wie äußerlich die Einheit desselben gewesen war; die Nationalität der Deutschen trat immer entschiedener im Gegensatz zu der der Romanen hervor, und musste über kurz oder lang eine Trennung herbeiführen. Mit der Auflösung der fränkischen Monarchie hörte jedoch nicht der Einfluss auf, den sie auf den Charakter und die Staatsbildung der Deutschen ausgeübt hatte. Manches ward freilich leicht wieder ausgestoßen: so die isolierten Vorschriften des römischen Rechts, welche in die Gesetze einzelner Volksstämme übergegangen waren; auch das Fehdewesen war bald wieder mehr im Schwange. Aber viele und wichtige Einrichtungen blieben als die Grundlage der weiteren Entwicklung im Mittelalter bestehen. Dahin ist, wenigstens teilweise, das Recht der Kirche zu zählen; desgleichen die Grafengewalt, die Schöffenverfassung und das Lehenwesen. Doch hat das Letztere in Deutschland, wo das Prinzip der gemeinen Freiheit lange noch festgehalten ward, nie die tief eingreifende Bedeutung erhalten, wie bei den romanischen Völkern und namentlich den Franzosen; es ist oft nur die äußere Form für Verhältnisse geworden, die einen selbständigen Charakter hatten, und sich diesem gemäß entwickelten.
Mit dieser Ausrüstung nun begannen die Deutschen nach dem Ausgang der Karolinger ihr selbständiges politisches Leben. Anfangs schien es freilich zweifelhaft, ob es nur zu einer dauernden Vereinigung der wichtigsten Volksstämme kommen werde; denn diese, die Franken, Schwaben, Sachsen und Bayern, standen noch in schroffer Abgeschlossenheit nebeneinander; es entwickelte sich unter ihnen wieder die volkstümliche Gewalt des Herzogtums, welches mit dem bloß eine Amtswürde darstellenden fränkischen Dukate nicht verwechselt werden darf, und das Bewusstsein einer nationalen Einheit war noch nicht allgemein vorhanden. Indessen trat es doch bald hervor, und fand namentlich in den großen Königen der sächsischen Dynastie seine lebendige Vertretung. So bekam Deutschland in dem Königtum einen politischen Mittelpunkt, und der Glanz desselben ward noch wesentlich durch die damit verbundene Kaiserwürde erhöht. Aber die Deutschen haben die Ehre, dass ihr König an der Spitze der Christenheit stand, auch teuer bezahlen müssen; es lag darin für sie ein wesentliches Hindernis, zu einer fest bestimmten Staatseinheit zu gelangen; die besten Kräfte, welche auf deren Pflege hätten verwandt werden können, gingen in Italien verloren, oder wurden doch im Kampfe mit dem Papsttum verzehrt. Die fränkischen Kaiser und die Hohenstaufen wussten freilich noch das Reich in seiner Einheit zusammen zu halten und zu vertreten; aber der Trieb nach Vereinzelung, der von jeher bei den Deutschen stark war, fand doch in dem eigentlichen Nationalsinn und in den Formen der Verfassung kein entsprechendes Gegengewicht, und so konnte es geschehen, dass, als die Stammesverschiedenheit sich mehr zu verwischen begann, in der Territorialität dem gemeinen Wesen ein noch gefährlicherer Feind erwuchs. Ein solcher Umwandlungsprozess, der im Inneren einer Nation vor sich geht, lässt sich nur in seinen allmählichen Übergängen historisch verfolgen und begreifen; doch kommen wohl bestimmte Epochen vor, in denen es wenigstens deutlich hervortritt, nach welcher Seite hin sich unter den im Kampf begriffenen Gegensätzen der Sieg neigen wird. Für Deutschland war die erste Hälfte des 13. Jahrhunderts eine solche Zeit der Entscheidung, in welcher die spätere Geschichte der Nation ihre bestimmte Richtung erhielt; es ist daher angemessen, bei der Betrachtung des deutschen Rechts im Mittelalter hier einen Abschnitt zu machen, um den eigentümlichen Charakter der verschiedenen Perioden gehörig feststellen zu können.
Bis zu jener Zeit nun kommt es im deutschen Rechtswesen hauptsächlich noch auf den Gegensatz zwischen Freiheit und Unfreiheit an. Jene entspricht im Wesentlichen noch dem in der alten Volksverfassung gewährten Rechte, nur dass an dem allgemeinen Reichsregiment nicht alle Freien Teil nehmen konnten; insofern bildete sich früh eine Abstufung der politischen Berechtigung, welche man in die Formen des Lehenwesens brachte. Aber eine Verschiedenheit der Stände im späteren Sinne ward dadurch nicht begründet; auch der Gemeinfreie nahm sein Recht nur von seinen Genossen, vor einem unter dem Königsbann gehegten Gerichte, dem auch, wenn nicht besondere Verhältnisse in Betracht kamen, die Herren aus den ersten Geschlechtern unterworfen waren. Wer von einem anderen als dem König ein Lehen annahm, der erniedrigte freilich seinen Heerschild, und trat in seinem Range zurück; aber das Lehenrecht selbst enthielt doch im Allgemeinen ganz gleichmäßige Bestimmungen, und in dem Landrecht war das gemeine Recht der Freien enthalten, welches noch in allen Fällen zur Anwendung kam, die nicht speziell unter dem Lehenrecht standen, ja noch im 12. Jahrhundert zuweilen gegen dessen Prinzipien aufrecht erhalten ward. Nimmt man nun dazu die beschränkte Erblichkeit der deutschen Lehen, welche nicht an die Seitenverwandten kamen, und sieht man, wie hoch noch in späten Zeiten das Glück und die Ehre, auf freiem Allod zu sitzen, von den Deutschen angeschlagen wurden, so tritt die Bedeutung des Landrechts mit überwiegender Wichtigkeit hervor. — Für die rechte Kunde und Würdigung dieser Verhältnisse ist uns aus der Zeit Friedrich Barbarossas eine unschätzbare Quelle erhalten worden, — nämlich das Rechtsbuch des Sachsenspiegels, welches nicht bloß das Verständnis der damaligen Zustände eröffnet, sondern auch für die spätere Entwicklung des deutschen Rechts einen festen Anhalt gewährt hat. Denn es findet sich in diesem Werk nicht bloß das partikuläre Recht des sächsischen Volksstammes verzeichnet; der Inhalt desselben ist viel weiter und bedeutender. Es verhält sich nämlich damit also. Die nationale Einheit des deutschen Rechts, welche sich in allen wesentlichen Punkten schon für die ältere Zeit der noch gesonderten Stammesverfassung nachweisen lässt, war während der Vereinigung der einzelnen Völkerschaften in der fränkischen Monarchie und später im deutschen Reich noch erhöht und verstärkt worden; denn das gemeinsame Staatsleben führte auch in anderen Beziehungen zur größeren Einheit zusammen. So stellt sich ein gemeines deutsches Recht, ein Kaiserrecht, dar, welches in seinen Grundprinzipien übereinstimmend, zum Teil selbst auf Reichsgesetzen beruhend, für alle freien Reichssassen gleichmäßig zur Anwendung kam. Aber neben diesem gemeinen Land- und Lehenrecht machten sich von jeher eigentümliche Grundsätze des Rechts der einzelnen Stämme geltend, wodurch jenes modifiziert ward und seine besondere Färbung erhielt. Der Sachsenspiegel gibt nun das gemeine Recht, wie es sich bei dem sächsischen Volksstamme besonders gestaltet hatte; seine wesentliche Grundlage war aber durchaus dem ganzen freien Volke gemeinsam, so dass er, auch abgesehen von den Lehren, welche das Reich als Gesamtheit betrafen, für die Bearbeitung des Rechts der anderen Stämme benutzt werden konnte. Man musste dann nur das besondere sächsische Element des Rechtsbuches mit dem Recht des Stammes, dem es angeeignet werden sollte, vertauschen. Aus einer solchen Überarbeitung ist der sogenannte Schwabenspiegel hervorgegangen. Eine ähnliche Operation war nötig, wenn man das Landrecht, welches sich zunächst auf die Verhältnisse der freien Grundbesitzer bezog, in ein Stadtrecht umarbeiten, und der eigentümlichen Entwicklung, welche das städtische Bürgertum genommen hatte, anpassen wollte.
Dem Recht der Freien stand nun das der Unfreien gegenüber. Diesem aber fehlte das einheitliche Prinzip, aus welchem es sich selbständig hätte entwickeln können; denn die Stellung des Hörigen zu seinem Herrn gab doch zunächst die Norm des Verhältnisses, so dass Herkommen und Vertrag die verschiedenartigsten Rechtsformen hervorrufen konnten, welche nicht bloß zwischen den entferntesten Gliedern der Kette, den leibeigenen Bauern und den zu Kriegs- und Hofdiensten verwandten Dienstmannen, einen großen Abstand möglich machten, sondern auch in derselben Klasse der unfreien Bevölkerung zu einer vielgestaltigen Rechtsbildung führten. Zwar zeigt sich auch hier eine gewisse Regelmäßigkeit der Entwicklung, welche unter gleichen Verhältnissen ziemlich denselben Gang nahm. Das Hofrecht tritt in bestimmten Instituten auf, deren allgemeine Bedeutung leicht erkennbar ist, und welche sich meistens als Nachbildungen freiheitlicher Einrichtungen in schwächeren Formen darstellen; die wichtigsten Institute des Familienrechts, eine Gewähre am Grundbesitz, eine Vereinigung in Genossenschaften und Gemeinden fehlte nicht; die mächtigeren Dienstmannen, namentlich der geistlichen Stifter, brachten es schon zu einer Art politischer Berechtigung, und deuteten ihre später eintretende Verschmelzung mit den gemeinfreien Grundbesitzern an, ja sie nahmen wohl gar vor den Geringeren unter diesen, in Folge des Ritterdienstes, des Reichtums und der Macht ihrer Herren, einen Vorzug in Anspruch. Aber das Alles gibt keinen sicheren Anhalt für die genauere Beurteilung dieser Verhältnisse, welche stets den speziellen Rechtsquellen entnommen werden muss. Das ist auch sehr bestimmt von dem Verfasser des sächsischen Landrechts (III. 42.) ausgesprochen worden, indem er sagt: „Nu ne latet jük nicht wunderen, dat dit buk so lüttel seget von dienstlüde rechte, went it is so manich valt, dat is nieman to ende komen kan; under jewelkem bischope unde abbede unde ebbedischen (Aebtissin) hebben die dienstlüde sunderlik recht, dar umme ne kan ik is nicht besceiden.“
Dagegen entwickelte sich mit umso größerer Konsequenz und Selbständigkeit neben dem gemeinen Landrecht das besondere Standesrecht der Geistlichkeit, nachdem es der römischen Curie gelungen war, der Kirche eine unabhängige Stellung im Staate zu verschaffen, und die geistlichen Gerichtshöfe, von der immer tätiger werdenden päpstlichen Gesetzgebung beherrscht, sich eine weite Kompetenz verschafft hatten, welche sie stets in ihrem Interesse auszudehnen strebten. — Ähnlich erhoben sich seit dem 11. Jahrhundert die deutschen Städte zu einer selbständigen Bedeutung, und indem sie von dem Gauverband eximiert, das Landrecht nach ihren besonderen Bedürfnissen autonomisch umbildeten, legten sie den Grund zu einer neuen Rechtsentwicklung, welche sich nicht mehr in den Grenzen der alten Freiheit und Unfreiheit bewegte.
Fragt man nun, wie dies verschiedenartige Recht in seinen mannigfaltigen Erscheinungen doch mit Sicherheit hat erkannt und angewandt werden können, so lässt sich dies aus seiner allgemeinen Beschaffenheit, mit welcher die Gerichtsverfassung durchaus übereinstimmte, zur Genüge erklären. Denn es war fast ganz ein Volksrecht, aus den Lebensverhältnissen unmittelbar hervorgegangen, und in seinen Grundzügen wie in seiner speziellen Gestaltung jedem geschäftserfahrenen Manne bekannt und geläufig, insofern es überhaupt in den Kreis seiner bürgerlichen Tätigkeit eingriff. Daher konnte die alte Schöffenverfassung sich auch noch in voller Wirksamkeit erhalten, und selbst in der Sphäre des Hofrechts sich in verwandten Instituten wiederholen. Die Schöffen, durch Rechtskunde und Erfahrung ausgezeichnet, waren die Vertreter des Volkes in seinen gerichtlichen Funktionen, ohne deswegen einen besonderen Stand zu bilden, und eine juristische Geheimlehre zu besitzen, welche nur ihnen zugänglich gewesen wäre. Es war ihr Ruhm und ihre Pflicht, dass sie das Organ für die Überzeugung der Gemeinde wurden; gelang ihnen dieses nicht, so mochte ihr Urteil mit Fug gescholten werden, — gewiss ein schlimmes Ereignis, welches bei einer Stellung, die wesentlich auf dem Vertrauen der Genossen beruhte, empfindlich gefühlt werden musste. — Dazu kam noch, dass die freien Landgerichte von Reichs wegen gehegt wurden, unter dem Vorsitz eines Beamten, welcher den Königsbann unmittelbar vom Kaiser empfing, wenn er auch mit seinem Amte, welches regelmäßig die Grafschaft war, oft nur zur zweiten Hand beliehen ward. Das gab dem ganzen Verfahren eine besondere Würde, und erhielt auch die einzelnen Dingpflichtigen in lebendiger Beziehung zur Gesamtheit. Freilich ward dadurch auch in dieser Rechtssphäre nicht immer die Vollziehung der gefundenen Urteile gesichert; neben dem gerichtlichen Verfahren bestand noch immer das Recht der Selbsthilfe in einer gewissen gesetzlichen Sanktion, wodurch die Mächtigen, welchen ihr Rechtsgefühl und die Reichsgewalt nur zu oft keine festen Schranken setzten, zu den schlimmsten Gewalttaten hingerissen wurden. Aber das lag doch zunächst in dem allgemeinen Charakter der Zeit, welche sich noch nicht zu einem vollkommen geordneten Staatswesen erheben konnte, zum Teil freilich auch in dem Verhängnis der größten Kaiser und namentlich der Hohenstaufen, ihre besten Kräfte im Kampfe mit dem Papsttum und in Italien verzehren zu müssen.
Wenden wir uns nun nach dieser kurzen Betrachtung des Rechtszustandes, welcher sich in Deutschland bis zum 13. Jahrhundert findet, zu der weiteren Entwicklung desselben in den späteren Zeiten. Dabei ist vor allem der Umstand hervorzuheben, dass während bei fast allen anderen europäischen Völkern Alles auf die Ausbildung einer bestimmten Nationalität und einer in der Erbmonarchie dargestellten Staatseinheit hinstrebte, in Deutschland die Kraft und Bedeutung der Reichsgewalt immer mehr abnahm, und das Gemeinsame und Nationale vor dem Partikularismus entschieden zurücktrat. Die letzten Hohenstaufen, durch Parteiungen und fremde Interessen, die sich in die Nation eingeschlichen hatten, so vielfach gehemmt, waren schon nicht mehr die Herren dieser Bewegung; aber in ihnen war doch noch das lebendige Bewusstsein von der Würde und Macht des alten Kaisertums. Ihre Nachfolger, ohne höheren Schwung und großartige Begabung, an eigener Macht den schnell erstarkten Landesherren kaum gewachsen, nur durch Wahl im persönlichen Besitz des Thrones, fassten ihre Stellung unter einem weit beschränkteren Gesichtspunkt auf. Das Kaisertum verlor dadurch die Höhe seiner nationalen Bestimmung; es ward, statt die Einheit und Majestät des deutschen Volkes würdig zu vertreten, mehr eine äußere Zierde, eine persönliche Machtvermehrung, ein Mittel für den Inhaber, sich egoistisch eine blühende Hausmacht zu begründen. Selbst einzelne bedeutendere Erscheinungen, wie Heinrich VII. mit seiner deutschen kaiserlichen Gesinnung, ziehen nach kurzem Glanze spurlos vorüber; das Deutsche Reich hört auf, der Mittelpunkt der deutschen Geschichte zu sein, und die einzelnen Teile treten in selbständiger Bedeutung an die Stelle des Ganzen.
Hier sind nun zunächst die vornehmen Geschlechter zu erwähnen, welche durch Geburt und Macht unter den Gemeinfreien hervorragend, auf die Angelegenheiten des Reichs den entschiedensten Einfluss gewannen, und demselben gegenüber eine selbständige Territorialgewalt begründeten. Sie zogen vor allem Vorteil aus dem Sturz der großen Stammesherzogtümer, welche noch eine Art Vermittlung zwischen dem Kaiser und den Reichsangehörigen gebildet hatten; die großen Reichsämter, und namentlich die Grafschaft, welche sie, nachdem die Bischöfe dem Sonderinteresse der Kirche ausschließlich gewonnen waren, fast ohne Ausnahme verwalteten, wurden der eigentliche Kern für ihre politische Berechtigung. Denn indem dieselben nach den Grundsätzen des Lehenrechts verliehen wurden, verwandelten sie sich in einen erblichen Besitz, und erhielten den Charakter einer selbständigen Gewalt, welche auf Kosten des Reichs immer mehr erweitert ward, so dass die meisten Gemeinfreien in die Pflege der Landesherren kamen, und die letzteren schon wichtige Regalien im eigenen Namen ausüben konnten. An diese öffentliche Gewalt setzte sich nun Alles an, was zur weiteren Ausbildung der Hausmacht dienen konnte: lehensherrliche und vogteiherrliche Rechte und dazu die großen Grundherrschaften, welche in dem echten Eigentum ihrer Inhaber waren. Allein diese verschiedenen Rechte bestanden doch ursprünglich nur nebeneinander, und gaben den weltlichen Großen (denn bei den geistlichen verhielt es sich anders) keine Sicherheit der vollkommenen Konzentration und der Dauer, solange ihre Familien dem gemeinen Land- und Lehenrecht unterworfen waren. Daher entwickelte sich allmählich auf dem Wege der Autonomie das besondere Familienrecht des hohen Adels, welches das Haus in seiner genossenschaftlichen Gestaltung als selbständiges Rechtssubjekt erscheinen lässt, dem sich das Sonderinteresse der einzelnen Mitglieder fügen muss, — eine Rechtsbildung, welche zuletzt in den Primogeniturordnungen zum Abschluss kam.
Allein nicht alle Reichsangehörigen wurden der Territorialgewalt der Landesherren unterworfen. Ein großer Teil derselben trug noch das starke Bewusstsein deutscher Reichsfreiheit in sich, und war keineswegs geneigt, sich derselben zu begeben. Dahin gehörten die mächtigeren Städte, denen es gelang, die landesherrliche Vogtei fernzuhalten oder wohl auch, wenn sie begründet war, von sich abzuschütteln; ferner einige gemeinfreie Landkommunen; endlich die alten freien Geschlechter, welche von jeher nur dem Reichsbanner gefolgt waren, nur kaiserliche Gerichte besucht hatten, und die Fürsten als ebenbürtige, wenn auch bevorzugte Genossen ansahen. Einzeln waren diese alle freilich nicht im Stande, sich eine selbständige und gesicherte Stellung zu verschaffen, und in dem Kaisertum fanden sie auch nicht den gehörigen Anhalt; aber indem das Gleichartige sich genossenschaftlich zusammen schloss, und seinem besonderen Zwecke diente, entstanden allenthalben Assoziationen, Eidgenossenschaften, Städte- und Adelsbündnisse, welche ihren Schwerpunkt und ihre Haltung vor allem in sich selbst suchen mussten, und oft, je kräftiger sie sich entwickelten, dem Reiche fast ganz entfremdet wurden. Doch war in diesen Elementen, welche noch zu Ende des 15. Jahrhunderts in voller Kraft bestanden, offenbar ein hinreichender Stoff vorhanden, um eine politische Regeneration Deutschlands im nationalen Interesse zu verwirklichen, zumal wenn auch die Reichsfürsten geneigt wurden, von ihrer Territorialgewalt etwas aufzuopfern, um dafür eine würdige Stellung in einem großen einheitlichen Staatsverband einzutauschen. Und in der Tat findet sich, dass von den Reichsständen selbst, unter Leitung eines patriotischen Mannes, des Churfürsten Berthold von Mainz, ein solcher Versuch unternommen worden ist. Aber weder Friedrich III. noch Maximilian I. waren geneigt, sich an die Spitze dieser Bestrebungen zu stellen, welche doch auch zunächst nur bezweckten, ein aristokratisches Reichsregiment in kräftiger Haltung an die Stelle des schwachen Kaisertums zu setzen, ohne dem Werk eine breite, volkstümliche Basis zu geben. So scheiterte dieser Plan, und nur die Aufregung des reichsfreien Adels, der Missmut der Städte, die schrecklichen Bauernkriege zeigten, wie tief die Bewegung und das Bedürfnis einer politischen Reform in der Nation gewesen waren. Inzwischen kam die kirchliche Reformation zum Durchbruch, und zog fast alle Kräfte und alles Interesse an sich; aber auch sie ward nicht als ein gemeinsames, nationales Werk durchgeführt, und vollendete die innere Zerrüttung und Zersplitterung Deutschlands, welches nun bloß in seinen einzelnen Territorien die Form des modernen Staates auszubilden vermochte. Doch währte es auch hier lange, bis sich die verschiedenen Elemente der landesherrlichen Gewalt zu dem bestimmten staatsrechtlichen Begriff der Landeshoheit konsolidierten. Denn die Rechte der einzelnen Distrikte und der nach Ständen geschiedenen Bevölkerung konnten in demselben Lande sehr voneinander abweichen, und es war nicht bloß die autonomisch abgeschlossene Stellung des regierenden Hauses, sondern auch die Vereinigung der einzelnen politisch berechtigten Stände zur landständischen Korporation nötig, um eine Territorialeinheit zu begründen. Wo das eine oder das andere fehlte, da blieb die Verbindung meistens eine sehr zufällige und lose, und griff nicht tief in das partikuläre Rechtsleben ein, welches überhaupt noch vorzugsweise in den einzelnen Genossenschaften und Gemeinden konzentriert war.
Werfen wir nach dieser allgemeinen Betrachtung nun einmal einen prüfenden Blick auf den Rechtszustand, welcher am Schluss des Mittelalters in Deutschland begründet war. Der alte Gegensatz von Freiheit und Unfreiheit hatte sich verwischt; nur die einer Grundherrschaft fronenden Bauern galten noch für Hörige: in der landsässigen Ritterschaft, der städtischen Bürgerschaft und dem vogteipflichtigen Landvolk waren aus freien und unfreien Elementen gemischt neue Rechtsbildungen erwachsen, welche wir als Stände bezeichnen. Denn entsprechend den verschiedenen Kreisen des öffentlichen Lebens, in denen sich jetzt die Nation, ohne von einem gemeinschaftlichen Prinzip beherrscht zu werden, bewegte, bildeten sich auch für dieselben besondere Rechte und Vorrechte aus. Voran das Standesrecht des hohen Adels, in verschiedenen Formen, aber im Wesentlichen doch gleichartig durch die Familienautonomie ausgeprägt; dann in eigentümlicher Haltung das Recht der landsässigen Ritterschaft, für welche, wie für die reichsfreien Geschlechter, welche es nicht zur Reichsstandschaft brachten, die autonomische Beliebung der einzelnen Familie freilich keine volle Geltung hatte, welche aber in den Prinzipien der alten Allodialsukzession, des Lehenrechts und in den Statuten und Observanzen der neu entstandenen genossenschaftlichen Verbindungen einigen Ersatz fanden; in freien Landkommunen die alte Sitte und das alte Recht; unter den hörigen und vogteipflichtigen Landleuten ein durch Herkommen und Vertrag sehr verschiedenartig gestaltetes Bauernrecht mit beschränkter Freiheit des Eigentums und, bei ersteren wenigstens, auch der Personen; in den Städten ein auf der Herrschaft des Verkehrs und des beweglichen Vermögens basiertes Statutarrecht, welches die überwiegende Bedeutung des Grundbesitzes und die strengen Familienbande in den freieren Organismus der Gemeinde hatte aufgehen lassen; für die Geistlichkeit endlich das römisch-kanonische Recht in der Verarbeitung der Kanonisten, auf welches das deutsche Volksrecht nur noch einen sehr geringen und sehr indirekten Einfluss ausübte. — Betrachtet man diese so mannigfach gestalteten Rechtsformen, wie sie ohne einen bestimmten gemeinsamen Anhalt unter dem Einfluss der Stammesverschiedenheit, der territorialen Trennung und der gesonderten Standesinteressen aus dem bewegten Volksleben hervorgegangen sind: so muss man allerdings die Energie des schaffenden Triebes in der Nation bewundern; aber die Befürchtung liegt auch nahe, dass Alles ohne einheitliche Prinzipien aus einander gefahren sei, und dass eigentlich von einem gemeinsamen deutschen Rechte gar nicht mehr die Rede sein könne.
In der Tat lässt es sich auch nicht verkennen, dass mit der Schwächung des Kaisertums und mit dem allmählichen Zurücktreten der gemeinen Freiheit, welche als der eigentliche Kern des älteren deutschen Rechts erscheint, die wichtigsten Stützen für die gemeinsame Entwicklung desselben gefallen waren, und dass sich stattdessen, der politischen Lage des Reichs entsprechend, eine krause Mannigfaltigkeit der äußeren Formen gebildet hatte. Allein man darf dieser Erscheinung, so bedeutungsvoll sie auch war, doch auch kein zu großes Gewicht beilegen. Denn der Einfluss der Stammesverschiedenheit war nicht mehr von solchem Belang wie früher; die Zersplitterung in einzelne Territorien, welche zum Teil ganz zufälligen Umständen ihre Entstehung verdankten, hatte auf die Rechtsbildung noch nicht wesentlich eingewirkt, da eine Landesgesetzgebung noch so gut wie gar nicht bestand, und die unmittelbare Entwicklung des Rechts im Volke auf dem Wege der Gewohnheit und der Autonomie im Ganzen unabhängig von der Territorialität vor sich ging. Desto nachhaltiger war dagegen allerdings der Einfluss geworden, welchen die im späteren Mittelalter schroff ausgebildete Sonderung der Stände auf das Rechtswesen ausgeübt hatte, indem nur für die einzelnen Klassen der Bevölkerung gleichartige Institute galten, welche wieder in dem statutarischen Recht der einzelnen Korporationen ihre genauere Bestimmung erhielten. Indessen ist dabei auch nicht zu übersehen, dass die Grundlage in dem Recht der verschiedenen Stände doch etwas Gemeinsames und Nationales war, welches bei aller Mannigfaltigkeit im Einzelnen einen gewissen inneren Zusammenhang bewahrte, und das Verständnis des Rechts auch über den nächsten Lebenskreis hinaus, in dem sich jeder bewegte, ausnehmend befördern musste. Denn so schroff, wie in früheren Zeiten die Freiheit und Unfreiheit, standen sich jetzt doch die Prinzipien, welche das Recht der einzelnen Stände beherrschten, nicht mehr gegenüber, wenigstens nicht in denjenigen, welche eben aus einer Vermischung jener älteren Volksklassen hervorgegangen waren, also bei der landsässigen Ritterschaft, den Stadtbürgern und den vogteipflichtigen Landleuten. Und je mehr in der allmählichen Entwicklung des modernen Staatsbürgertums diese ständischen Gegensätze sich verwischten und zur Ausgleichung kamen, desto entschiedener musste wieder das Gemeinsame, dem alten Landrecht vergleichbar, hervortreten und zur Geltung gelangen, was denn für die einheitliche Entwicklung des deutschen Rechts, wenn sie ungehindert hätte vor sich gehen können, sehr förderlich gewesen wäre. Dazu kam, dass es auch nicht an äußeren Hilfsmitteln fehlte, welche selbst im späteren Mittelalter auf die äußere Gleichmäßigkeit der Rechtsbildung nachhaltig einwirkten; man braucht bloß an die große und allgemeine Verbreitung der Rechtsbücher und an die tief eingreifende Tätigkeit der bedeutenderen Oberhöfe zu denken, welche, auch wenn sie nicht zu den noch bestehenden kaiserlichen Hof- und Landgerichten gehörten, eine sehr ausgebreitete Kompetenz hatten.
Bei dieser Lage der Sachen wird es nur natürlich erscheinen, dass in den engeren Kreisen des öffentlichen Lebens, und namentlich in den Genossenschaften und Gemeinden, welche sich im Allgemeinen, soweit nicht Vogtei- und Hörigkeitsverhältnisse einwirkten, der freiesten Bewegung erfreuten, die volle Anschauung des sie betreffenden Rechts noch in dieser Periode vorhanden war. Konnte es auch in einer vielbewegten, gewaltigen Zeit nicht fehlen, dass manche Verhältnisse sich verwirrten und sich nicht allenthalben zu einer festen Ordnung durchzubilden vermochten, so sind das doch nur vereinzelte Erscheinungen, welche, wenn sie nicht die Reichsverfassung betrafen, die allerdings im Argen lag, — ein allgemeines Urteil nicht bestimmen dürfen. Namentlich hatte sich die alte Gerichtsverfassung, insofern sie auf dem Schöffentum gebaut war, im Wesentlichen erhalten, und wirkte noch wie früher fort, wenn auch der Königsbann zum großen Teil in die Hände der Landesherren übergegangen war. So fand das Recht in den Volksgerichten noch sein natürliches Organ, durch welches es auf eine dem Bedürfnis entsprechende Weise gehandhabt ward. Man braucht nur die Schöffenurteile und Weistümer aus dem 15. und dem Anfang des 16. Jahrhunderts, von denen gerade in neuester Zeit manche interessanten Sammlungen veröffentlicht sind, zu betrachten, um sich zu überzeugen, wie lebendig das Recht noch im Volke war, und mit welcher Sicherheit und Gewandtheit die Schöffen es anzuwenden wussten. Denselben Eindruck machen die zahlreichen Statute, welche namentlich aus dem 15. Jahrhundert erhalten worden sind, und welche es bezeugen, dass man wichtige Institute des geltenden Rechts klar und bestimmt aufzufassen und festzustellen wusste. — Aber diesen erfreulichen Erscheinungen ist doch auch kein zu hoher Wert beizulegen; denn sie beweisen nur, dass das deutsche Volksleben in seiner korporativen Vereinzelung noch eine kerngesunde Natur hatte, und dass es in dieser Beschränkung seine Tüchtigkeit bewährte. Ist es nun eine alte Wahrheit, dass die Gesundheit eines organischen Wesens nicht bloß von der Beschaffenheit der einzelnen Glieder, sondern vor allem von dem Gesamtorganismus und dessen Befinden abhängt, und dass hier der eigentliche Sitz der Lebenskraft ist; so kann auch der damalige Zustand des deutschen Volkes, dessen Reichsverfassung ganz und gar zerrüttet war, unmöglich sich als befriedigend herausstellen. Es fehlte ja eben, wie wir gesehen haben, an einem festen politischen Mittelpunkt, an welchen sich die nationale Entwicklung hätte ansetzen können; bei Kaiser und Reich war nicht die gehörige Macht, um Recht und Ordnung kräftig zu schützen; jeder Teil sorgte zunächst für sich selbst, und war, wollte er nicht dem Mächtigeren unterliegen, auf die eigene Faust und den Beistand seiner Genossen angewiesen. So standen die einzelnen Stände, Fürsten, Bündnisse und Korporationen einander drohend gegenüber und der Fehden und Vergewaltigungen wurde kein Ende.
Es war aber überhaupt die Zeit des 15. und 16. Jahrhunderts eine Übergangsperiode von einer solchen Bedeutung, wie sie selten in der Weltgeschichte vorgekommen ist. Das Mittelalter hatte sich überlebt; der Geist des klassischen Altertums war über das germanische Wesen gekommen, und rief die Kultur der modernen Welt hervor. Das Feudalwesen und die korporative Beschränkung entsprachen der politischen Aufgabe der abendländischen Völker nicht mehr, welche in ihrer weiteren Entwicklung die Verwirklichung des höheren Staatsprinzips anstrebten. Im Recht aber waren überhaupt tief eingreifende Reformen unabweisbar geworden, welche nur von der bewussten Kraft einer großartigen Gesetzgebung durchgeführt werden konnten. Nicht bloß das Fehdewesen und die Unsicherheit der Urteilsvollstreckung war zu beseitigen; dem Kirchenrecht stand eine völlige Umänderung bevor; auch das Strafrecht verlangte eine neue Gestaltung; der Prozess, zum Teil mit unnötigen Formalitäten überhäuft, war auf einfachere Grundsätze zurückzubringen, und das ganze Beweisverfahren musste eine andere Grundlage erhalten, da Gottesurteile und Eideshelfer der juristischen Überzeugung nicht mehr genügten. Sollte es aber überhaupt zu einem einheitlichen Staatswesen in Deutschland kommen, so musste auch das Privatrecht in seiner regellosen Mannigfaltigkeit beschränkt und auf einfachere Formen zurückgeführt werden. Denn man konnte sich dann nicht mehr damit begnügen, dass in den kleineren Kreisen des öffentlichen Lebens jeder sein spezielles Recht genau kenne; auch für den Gesetzgeber und die höchsten Gerichtsund Verwaltungsbehörden war dieselbe Kunde unerlässlich, und überdies gibt es ja manche Institute, deren Geltung sich nicht auf bestimmte, enge Grenzen beschränken lässt, welche vielmehr, namentlich bei dem erweiterten Verkehr, eine allgemeinere Teilnahme in Anspruch nehmen und deswegen eine gemeinsame Feststellung verlangen. Freilich wird ein gesundes Volksleben selbst in dieser Beziehung schon das meiste tun, und auch die Wissenschaft kann wesentlich zur größeren Vereinfachung und zu einer prinzipienmäßigen Beherrschung des Rechtsstoffs beitragen; aber auch die Gesetzgebung muss sich dabei tätig zeigen, namentlich wenn es darauf ankommt, positive Hindernisse und unorganische Gestaltungen, welche gegen die freie Entwicklung einen hartnäckigen Widerstand leisten, zu beseitigen.
Obgleich nun, wie früher gezeigt worden, die Reform der deutschen Reichsverfassung im Geiste des nationalen Bedürfnisses misslungen ist, so ward doch Einzelnes von der soeben angedeuteten Aufgabe der damaligen Zeit gelöst. Das Fehdewesen ward durchaus verboten, für die Rechtssicherheit überhaupt durch die Einsetzung des Reichskammergerichts gesorgt; das Strafrecht neu geordnet, das Beweisverfahren, wenigstens in Kriminalsachen, wenn auch nicht glücklich, so doch nach bestimmten Prinzipien festgestellt. Aber freilich blieb dies Alles ein morscher, unvollendeter Bau, in dem für ein großes, nationales Volksleben keine sichere Stätte war, und der auch bald im Vergleich mit der weiteren Entwicklung der Territorialverfassung fast alle Bedeutung verlor. Es trat aber außerdem noch ein Ereignis ein, welches auf das deutsche Rechtswesen einen ganz außerordentlichen Einfluss ausgeübt, und dessen eigentümliche Gestaltung in der neueren Zeit vorzugsweise bestimmt hat. Das ist die Aufnahme des römischen Rechts, von welcher hier etwas umständlicher gehandelt werden muss.
Schon früher, als die Germanen den großen Kampf gegen die Römer siegreich beendigt hatten, und mit ihnen durch die Eroberung in dauernde Verbindung getreten waren, machte sich der Einfluss des römischen Rechts auf die Sieger geltend. Doch war dies nur für die romanischen Völker, welche ja gerade aus einer Mischung germanischer und römischer Elemente hervorgingen, von dauernder Wirkung; den rein deutschen Stämmen blieb jenes Recht fast ganz fern, und wenn ausnahmsweise einzelne Sätze desselben bei der Aufzeichnung der Volksrechte oder durch die Kapitularien der fränkischen Könige ihnen zugekommen waren, so stießen sie dieselben doch nach der Auflösung der großen fränkischen Monarchie wieder von sich. Selbst die Geistlichkeit, welche doch schon frühe vorzugsweise auf das römische Recht als ihr Personalrecht hingewiesen war, scheint dasselbe bis ins 12. Jahrhundert in Deutschland so gut wie gar nicht gebraucht zu haben, was aus der geringen Kenntnis, die man davon hatte, und aus der größeren Unabhängigkeit, deren sich die deutsche Kirche bis dahin erfreute, sehr wohl erklärt werden kann. Seit Gregor VII. entwickelte sich die Herrschaft der römischen Curie über dieselbe freilich sehr schnell, und als spätere Päpste, namentlich Innozenz III, gestützt auf das wieder mehr zugänglich gewordene römische Recht, eine umfassende kirchliche Gesetzgebung in den Dekretalen begründeten, und besonders auch ein eigentümliches Verfahren für die geistlichen Gerichte ausbildeten, so konnte es freilich nicht anders kommen, als dass auch die deutsche Kirche dem römisch-kanonischen Rechte, wie es sich in den Dekretalen, der Praxis der Gerichtshöfe, namentlich der Rota romana, und den Schriften der Dekretisten entwickelte, unterworfen ward. Aber auf die Rechtsverhältnisse der Laien hatte das ursprünglich keinen unmittelbaren Einfluss; nur die rein geistlichen Sachen, z. B. die Eheverbote wegen Verwandtschaft, wurden allgemein davon berührt. Sonst galt noch im 13. Jahrhundert der Grundsatz, welcher gerade im Gegensatz zu einem Gesetze Innozenz III. in den späteren Rezensionen des Sachsenspiegels ausgesprochen ist: „Wende de paves ne mach nen recht setten, dar he unse lantrecht oder lenrecht mede erger.“
Indessen konnte es doch nicht fehlen, dass der große Einfluss der Geistlichkeit ihrem Standesrecht eine gewisse, wenn auch anfangs sehr beschränkte Einwirkung auf das Recht der Laien bereitete, sei es nun, dass ein solches Übergreifen im besonderen Interesse der Geistlichkeit unmittelbar von ihr erstrebt ward, oder dass die Anerkennung gewisser Grundsätze für sie auch wiederum die Geltung derselben für die Laien zur Folge hatte. Aus dem ersteren Grunde erklärt sich die frühe Verbreitung der dem römischen Recht nachgebildeten letztwilligen Verfügungen, weil dadurch die den Geistlichen so wichtigen Seelgeräte auf dem Totenbett möglich wurden, und sich zugleich für das in den Städten vorherrschende Mobiliarvermögen eine bequeme Form der Zuwendung darbot. Zu den Rechtsinstituten der anderen Art, welche man dem geistlichen Recht nachbildete, ist die Verjährung zu rechnen, welche auch, da das Prinzip der rechten Gewähre nur eine bestimmte Sphäre beherrschte, eine Lücke des deutschen Rechts ausfüllen konnte. Desgleichen hat bei den Schwankungen, welche über die Anwendung der wichtigsten germanischen Beweismittel im späteren Mittelalter eintraten, das geistliche Recht in dieser Lehre schon früh einen bedeutenden Einfluss ausgeübt, und auch sonst finden sich, namentlich im südwestlichen Deutschland, seit dem Ende des 13. Jahrhunderts, einzelne Sätze des römischen Rechts auf die Verhältnisse der Laien angewandt, namentlich in dem, wahrscheinlich von einem Pfaffen verfassten Schwabenspiegel. Aber das Alles hat das unabhängige Leben und den inneren Zusammenhang des einheimischen Rechts unmittelbar noch gar nicht gefährdet; dasselbe bewahrte vielmehr noch bis ans Ende des 15. Jahrhunderts durchaus seine selbständige Haltung, und selbst die späteren Rechtsbücher nach dem Sachsenspiegel haben von dem römisch-kanonischen Recht wohl kaum so viel aufgenommen, als es nur das englische Rechtsbuch des Brakton getan hat. Man muss sich nur nicht durch einzelne Erscheinungen irreleiten lassen, welche allerdings die allgemeinere Geltung des römischen Rechts in einer früheren Zeit zu beweisen scheinen, aber, richtig verstanden, nichts der Art dartun. So hat man ein besonderes Gewicht daraufgelegt, dass schon seit dem 13. Jahrhundert in Urkunden häufig Verzichte auf römische Klagen, Einreden u. dgl. vorkommen; aber das erklärt sich einfach daraus, dass die Notare, welche meistens Geistliche oder doch in den geistlichen Gerichten eingeübt waren, die dort gebräuchlichen Formulare mit den hergebrachten Kautelen, oft ungeschickt genug, auch den unter Laien abgeschlossenen Geschäften bei der schriftlichen Redaktion zu Grunde legten. Einen anderen Umstand, der allerdings von größerer Bedeutung ist, hebt Eichhorn (Staats- und Rechtsgesch. III. §. 444. Note e) hervor. Seit der Mitte des 14. Jahrhunderts kommen nämlich Glossen zum Sachsenspiegel vor, welche den Inhalt des Rechtsbuchs aus dem fremden Recht zu erklären suchen, und zwar in einer wiederholten Überarbeitung, so dass es scheint, als ob diese an sich freilich widersinnige Methode einem Bedürfnisse entsprochen, und in der Praxis Beifall gefunden habe, worauf auch die ziemlich beträchtliche Anzahl der von dieser Glosse erhaltenen Handschriften hinweist. Allein auf diesen letzteren Punkt ist doch wenig Gewicht zu legen, weil auch eine gelehrte Ostentation und das Interesse, welches die Geistlichkeit an dem in den weltlichen Gerichten geltenden Rechte nehmen musste, die Verbreitung der scheinbar gelehrten Arbeiten veranlassen konnten. Die Entstehung derselben aber erklärt sich wohl zur Genüge, wenn man bedenkt, dass bei dem damaligen Zustande der Kritik ein in dem geistlichen Recht bewanderter Mann sich leicht aufgefordert finden konnte, das einheimische Rechtsbuch nach den ihm geläufigen Namen zu erklären, wozu die Veranlassung umso näher lag, da schon im 14. Jahrhundert ein großer Teil des Sachsenspiegels antiquiert, und in den Gerichten durch eine neuere Rechtsbildung ersetzt war. Dass jene Glossen praktisch keine irgendwie bedeutende Geltung erlangt haben können, folgt schon aus ihrem Inhalt, welcher dazu ganz unbrauchbar war, und in seinen wesentlichen Bestandteilen den noch fungierenden Volksschöffen durchaus unzugänglich sein musste, wenn sie sich auch vielleicht das Werk, namentlich in Verbindung mit dem Text, manchmal abschreiben ließen. Dass aber dennoch ein so verkehrtes Unternehmen, wie jene Glossierung, später von mehreren Personen fortgesetzt werden konnte, darf billig nicht Wunder nehmen, wenn man nur erwägt, dass die Gründe, welche die erste Veranlassung dazu gaben, auch später noch wirksam waren, ja bei dem größeren Andringen des römischen Rechts noch verstärkt wurden, und dass überhaupt manche literarischen Arbeiten des späteren Mittelalters bei einer kritischen Betrachtung als rein unsinnig erscheinen. Ob noch speziell die besonderen Verhältnisse der Mark, in welcher das römische Recht früher als in manchen anderen Gegenden zur Geltung kam, auf die Beschaffenheit jener Glossen einen bestimmten Einfluss ausgeübt haben, wage ich nicht zu entscheiden. Jedenfalls irrt Eichhorn ganz entschieden, wenn er aus diesen fortgesetzten Versuchen, den Sachsenspiegel aus dem fremden Recht zu erklären, den Schluss zieht, dass das Verständnis des einheimischen Rechts sich während des 15. Jahrhunderts allmählich verloren habe. Dafür spricht außerdem keine einzige Tatsache, während umgekehrt aus den früher schon angeführten Gründen das Gegenteil bestimmt hervorgeht. Gerade bei den sächsischen Schöffen hat sich, ungeachtet jener Glossen, noch ins 16. Jahrhundert hinein eine umfassende und lebendige Kunde des einheimischen Rechts erhalten. Wir haben aus der ersten Hälfte des genannten Jahrhunderts eine Sammlung sächsischer Schöffenurteile (abgedruckt im Anhange zu Zobels Ausgabe des sächsischen Weichbildes), welche deutschrechtliche Institute der verschiedensten Art mit der größten Sicherheit behandeln, und selbst da, wo einzelne römischrechtliche Grundsätze angewandt werden, wie bei der Verjährung und bei den Kaufverträgen, dies mit entschiedener Klarheit und Mäßigung tun. Woher kämen auch wohl die Klagen der Romanisten aus dem 15. und dem Anfange des 16. Jahrhunderts über die geringe Geltung des römischen Rechts in den deutschen Gerichten und über die Bevorzugung einheimischer Gewohnheiten, wenn diese nicht in voller Wirksamkeit gewesen wären?
Es ist jedoch nicht in Abrede zu stellen, dass seit dem 14. Jahrhundert der Einfluss der Romanisten in Deutschland anfing sich geltend zu machen, und dass dieselben im Laufe des 16. Jahrhunderts zu einer fast unumschränkten Herrschaft über das ganze Rechtswesen gelangten. Fassen wir die Ursachen dieser allerdings einzigen Erscheinung etwas näher ins Auge. Einmal kommt dabei die enge Verbindung zwischen Deutschland und Italien, wo das römische Recht bald festen Fuß fasste, in Betracht, — eine Verbindung, welche namentlich unter den Luxemburgern wieder erneuert ward, und auf die Ansichten der höheren Kreise in Deutschland einen großen Einfluss ausübte. Man fing nun an, in einer der wunderlichen Ideenverwirrungen, woran das Mittelalter so reich ist, die Justinianische Kompilation als das Gesetzeswerk eines römischen Kaisers und zwar eines Vorgängers im deutschen Reich anzusehen, durch welche Auffassung freilich die unmittelbare Geltung des römischen Rechts nicht allein, und nicht einmal vorzugsweise herbeigeführt worden ist, welche aber doch in Verbindung mit dem Einfluss der Kirche und bei der allgemeinen Verbreitung von Rechtsbüchern, zu denen auch das Corpus Juris gerechnet werden konnte, wesentlich darauf eingewirkt hat, namentlich insofern Kaiser und Reich dabei beteiligt waren. Wir wissen ja aber auch schon, dass einzelne Lehren des römischen Rechts bereits in weltlichen Sachen Anwendung gefunden hatten, was denn zur Folge hatte, dass für deren richtige Beurteilung hie und da einzelne Romanisten bei der Rechtspflege beteiligt wurden. Allein darauf beschränkte sich deren Geschäftstätigkeit nicht. Ihnen kam überhaupt die Achtung zu Statten, welche ein nach geistiger Bildung ringendes Geschlecht vor den, wenn auch noch so rohen Vertretern klassischer Studien hegte, — eine Achtung, welche auch dadurch nicht beseitigt werden konnte, dass die gepriesene Weisheit der Doktoren zum großen Teile nur im Nachbeten ihrer welschen Autoritäten bestand, und welche gerade bei der halbgebildeten vornehmen Welt am Größten gewesen sein wird, während der gesunde Witz und das tiefere Rechtsgefühl des Volkes den Schein eher von der Wirklichkeit zu unterscheiden wusste 1). Aber die Romanisten hatten doch in jedem Fall den Vorzug einer größeren formellen Geisteskultur voraus; sie waren der lateinischen Sprache mächtig und hatten sich überhaupt den Geschäftsstyl der damaligen Zeit angeeignet, was sie namentlich zu diplomatischen Verhandlungen befähigte und in den Rat der Fürsten und der angesehenen Korporationen brachte. Hier vertraten sie, im Gegensatz zu den konvulsivischen Bewegungen einer anarchischen Zeit, die Herrschaft des geschriebenen Rechts, dem sie fast blindlings folgten, und wussten dadurch nicht bloß das Interesse der Mächtigen, denen sie dienten, zu fördern, sondern trafen auch mit dem Bestreben der Besseren zur Herstellung eines geordneten Rechtszustandes in Deutschland zusammen.
Zu diesem allen kam nun noch ein äußeres Ereignis hinzu, welches für die Aufnahme des römischen Rechts in Deutschland von der größten Bedeutung geworden ist. Im Jahre 1495 ward das Reichskammergericht eingesetzt, und da man schon auf die Geltung römischrechtlicher Lehren Rücksicht nehmen musste und in den Doktoren die gewandtesten Geschäftsleute hatte, so ward die Hälfte der Stellen mit diesen besetzt. Nun war es aber nicht anders möglich, als dass sie gerade in dem höchsten Reichsgericht bald das allerentschiedenste Übergewicht bekamen. Denn es ward hier für ganz Deutschland Recht gesprochen. Das deutsche Recht aber hatte, wie wir gesehen haben, nicht den Charakter eines gemeinen Nationalrechts gewonnen, sondern lebte nur in den engeren Kreisen, vor allem in den Genossenschaften und Gemeinden, welche die allgemeinen Institute, schon durch die Einflüsse der Ständeunterschiede durchbrochen, in spezieller Gestaltung ausgebildet hatten. Kamen auch noch tief eingreifende Grundsätze und Rechtsformen in einer allgemeinen Geltung vor, so werden sie als ein gemeinsames, nationales Recht doch nur selten im Bewusstsein der Einzelnen lebendig gewesen sein.