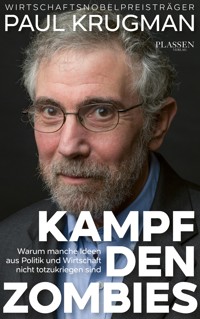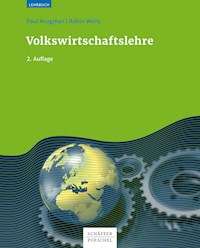
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Schäffer Poeschel
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Mit ihrem erzählerischen Ansatz, der klaren Sprache und aktuellen Beispielen gelingt den Autoren eine spannende und äußerst praxisorientierte Einführung in die Volkswirtschaftslehre. - Eine einleitende Geschichte zu Beginn jedes Kapitels erleichtert den Zugang zum jeweiligen Thema und hilft, die Inhalte besser im Gedächtnis zu verankern. - Alle vorgestellten Konzepte und Theorien werden durch einprägsame Beispiele aus dem Wirtschaftsalltag veranschaulicht. - In jedem Kapitel sichern vorformulierte Lernziele, Schnelltests, Übungsaufgaben und Hinweise auf Denkfallen den optimalen Lernerfolg. International ausgerichtet und gleichzeitig optimal auf das deutsche Umfeld anwendbar, ist das Buch ein unverzichtbares Grundlagenwerk. In der 2. Auflage neu strukturiert und ergänzt um Kapitel zur Ökonomie des Wohlfahrtsstaates, den Ursachen von Bankenkrisen und Finanzmarktpaniken und deren Auswirkungen. Mit Downloadmaterial auf myBook+.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 2585
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Hinweis zum UrheberrechtImpressumDie AutorenDie ÜbersetzerVorwort der ÜbersetzerNeu in der 2. AuflageZentrale Kapitel und optionale KapitelAbkürzungen für ökonomische FachbegriffeEinführung: Alltägliche GeschäfteI Was ist Volkswirtschaftslehre?1 Grundprinzipien1.1 Individuelle Entscheidung: Der Kern der Wirtschaftswissenschaften1.2 Interaktion: Wie Wirtschaften funktionieren1.3 Gesamtwirtschaftliche InteraktionUnternehmen in Aktion: Wie Priceline.com die Reisebranche revolutionierteZusammenfassung2 Ökonomische Modelle: Zielkonflikte und Handel2.1 Modelle in den Wirtschaftswissenschaften: Einige wichtige Beispiele2.2 Die Verwendung von ModellenUnternehmen in Aktion: Effizienz, Opportunitätskosten und das Prinzip der „schlanken Produktion“ZusammenfassungAnhang zu 2Grafische Darstellungen in den Wirtschaftswissenschaften2A.1 Grafische Darstellungen, Variablen und ökonomische Modelle2A.2 Grundlagen der grafischen Darstellung2A.3 Ein Schlüsselkonzept: Die Steigung einer Kurve2A.4 Diagramme zur Darstellung quantitativer InformationenII Angebot und Nachfrage3 Angebot und Nachfrage3.1 Angebot und Nachfrage: Modell eines Wettbewerbsmarktes3.2 Die Nachfragekurve3.3 Die Angebotskurve3.4 Angebot, Nachfrage und Gleichgewicht3.5 Änderungen von Angebot und Nachfrage3.6 Wettbewerbsmärkte – und was es sonst noch gibtUnternehmen in Aktion: Unterwegs mit UberZusammenfassung4 Konsumentenrente und Produzentenrente4.1 Konsumentenrente und Nachfragekurve4.2 Produzentenrente und Angebotskurve4.3 Konsumentenrente, Produzentenrente und Handelsgewinne4.4 Eine MarktwirtschaftUnternehmen in Aktion: Wie Online–Ticketverkäufer Künstler dumm aussehen lassenZusammenfassung5 Preisvorschriften und Mengenbeschränkungen: Der Markt schlägt zurück5.1 Warum Regierungen Preisvorschriften einführen5.2 Höchstpreisvorschriften5.3 Mindestpreise5.4 MengenbeschränkungenUnternehmen in Aktion: Geschäfte mit MedaillonsZusammenfassung6 Elastizität6.1 Elastizitätsbegriff und Elastizitätsmessung6.2 Interpretation der Preiselastizität der Nachfrage6.3 Andere Nachfrageelastizitäten6.4 Die Preiselastizität des Angebotes6.5 Übersicht ElastizitätenUnternehmen in Aktion: Die Luftfahrtindustrie – Weniger fliegen für mehr GeldZusammenfassungIII Individuen und Märkte7 Steuern7.1 Die ökonomischen Auswirkungen von Steuern: Eine vorläufige Einschätzung7.2 Nutzen und Kosten der Besteuerung7.3 Steuergerechtigkeit und Steuereffizienz7.4 Wichtige Aspekte des deutschen SteuersystemsUnternehmen in Aktion: Amazon gegen BarnesandNoble.comZusammenfassung8 Internationaler Handel8.1 Komparativer Vorteil und internationaler Handel8.2 Angebot, Nachfrage und internationaler Handel8.3 Die Wirkungen von Handelsprotektionismus8.4 Die politische Ökonomie des HandelsprotektionismusUnternehmen in Aktion: Li & Fung – Von Guangzhou zu Ihnen nach HauseZusammenfassungIV Wirtschaft und Entscheidungen9 Die Entscheidungsfindung von Personen und Unternehmen9.1 Kosten, Vorteile und Gewinne9.2 „Wie viel“-Entscheidungen: Die Bedeutung der Marginalanalyse9.3 Versunkene Kosten9.4 VerhaltensökonomikUnternehmen in Aktion: J. C. Penney verärgert seine KundenZusammenfassungAnhang zu 9Entscheidungen, bei denen Zeit eine Rolle spielt: Der BarwertV Die Konsumentscheidung10 Der rationale Verbraucher10.1 Nutzen: Befriedigung aus Konsum10.2 Budget und optimaler Konsum10.3 Den marginalen Euro ausgeben10.4 Vom Nutzen zur NachfragekurveUnternehmen in Aktion: Ein Happy Meal bei McDonald’sZusammenfassungAnhang zu 10Konsumentenpräferenzen und Konsumentscheidung10A.1 Eine Abbildung der Nutzenfunktion10A.2 Indifferenzkurven und Konsumentscheidung10A.3 Anwendung von Indifferenzkurven: Substitute und Komplementärgüter10A.4 Preise, Einkommen und NachfrageVI Die Produktionsentscheidung11 Hinter der Angebotskurve: Inputs und Kosten11.1 Die Produktionsfunktion11.2 Zwei entscheidende Kostengrößen: Grenzkosten und Durchschnittskosten11.3 Kurzfristige versus langfristige KostenUnternehmen in Aktion: Die Herausforderungen des WeihnachtsgeschäftsZusammenfassung12 Vollständige Konkurrenz und die Angebotskurve12.1 Vollständige Konkurrenz12.2 Produktion und Gewinn12.3 Die MarktangebotskurveUnternehmen in Aktion: Shopping-Apps, Showrooming und andere Probleme für traditionelle EinzelhandelsgeschäfteZusammenfassungVII Marktstruktur: Über vollkommenen Wettbewerb hinaus13 Monopol13.1 Marktformen13.2 Was bedeutet Monopol?13.3 Wie ein Monopolist seinen Gewinn maximiert13.4 Monopol und Wirtschaftspolitik13.5 PreisdifferenzierungUnternehmen in Aktion: Amazon und Hachette bekriegen sichZusammenfassung14 Oligopole14.1 Die Verbreitung von Oligopolen14.2 Oligopolverhalten14.3 Oligopol-Spiele14.4 Oligopole in der PraxisUnternehmen in Aktion: Das vermeintliche GeständnisZusammenfassung15 Monopolistische Konkurrenz15.1 Was bedeutet monopolistische Konkurrenz?15.2 Wie funktioniert monopolistische Konkurrenz?15.3 Monopolistische Konkurrenz versus vollständige Konkurrenz15.4 Kontroversen über ProduktdifferenzierungUnternehmen in Aktion: Gillette versus Wilkinson – Ein Fall von Rasurbrand?ZusammenfassungVIII Mikroökonomik und staatliche Politik16 Externalitäten16.1 Externer Nutzen und externe Kosten16.2 Instrumente der Umweltpolitik16.3 Positive Externalitäten16.4 NetzwerkexternalitätenUnternehmen in Aktion: Sind wir immer noch Freunde? Die Geschichte von Facebook, MySpace und FriendsterZusammenfassung17 Öffentliche Güter und Allmendegüter17.1 Private Güter – und andere17.2 Öffentliche Güter17.3 Allmendegüter17.4 KlubgüterUnternehmen in Aktion: Wie das Jagen von bedrohten Tieren ihren Bestand sichertZusammenfassung18 Die Ökonomie des Wohlfahrtsstaates18.1 Armut, Ungleichheit und staatliche Politik18.2 Der Wohlfahrtsstaat in den Vereinigten Staaten18.3 Die Ökonomik der Gesundheitsfürsorge18.4 Die Diskussion über den WohlfahrtsstaatUnternehmen in Aktion: Unternehmer in einem WohlfahrtsstaatZusammenfassungIX Faktormärkte und Risiko19 Faktormärkte und Einkommensverteilung19.1 Die Produktionsfaktoren einer Volkswirtschaft19.2 Grenzproduktivität und Faktornachfrage19.3 Trifft die Grenzproduktivitätstheorie der Einkommensverteilung wirklich zu?19.4 Das ArbeitsangebotUnternehmen in Aktion: Beschäftigte und Löhne bei Costco und WalmartZusammenfassungAnhang zu 19Indifferenzkurvenanalyse des Arbeitsangebotes19A.1 Die Zeitbudgetgerade19A.2 Die Wirkung eines höheren Lohnsatzes19A.3 Indifferenzkurvenanalyse20 Unsicherheit, Risiko und private Informationen20.1 Eine ökonomische Betrachtung der Risikoaversion20.2 Kaufen, Verkaufen und Risikominderung20.3 Private Informationen: Was man nicht weiß, kann einem schadenUnternehmen in Aktion: Die Probleme von AIGZusammenfassungX Einführung in die Makroökonomik21 Makroökonomik: Ein Überblick21.1 Makroökonomik21.2 Der Konjunkturzyklus21.3 Langfristiges Wirtschaftswachstum21.4 Inflation und Deflation21.5 Die offene VolkswirtschaftUnternehmen in Aktion: Die gesamtwirtschaftliche Entwicklung und der Niedergang von Montgomery WardZusammenfassung22 BIP und Inflation: Die quantitative Erfassung des makroökonomischen Geschehens22.1 Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung22.2 Das reale BIP: Ein Maß für die gesamtwirtschaftliche Produktion22.3 Preisindizes und das PreisniveauUnternehmen in Aktion: Warten auf das BIPZusammenfassung23 Arbeitslosigkeit und Inflation23.1 Die Arbeitslosenquote23.2 Arbeitslosigkeit23.3 Inflation und DeflationUnternehmen in Aktion: Arbeitsuche im InformationszeitalterZusammenfassungXI Die Volkswirtschaft auf lange Sicht: Wachstum24 Das langfristige Wachstum24.1 Ein Vergleich von Volkswirtschaften über Zeit und Raum24.2 Die Ursachen für das langfristige Wachstum24.3 Warum unterscheiden sich Wachstumsraten weltweit?24.4 Erfolg, Enttäuschung und Versagen24.5 Ist das Wirtschaftswachstum auf der Welt nachhaltig?Unternehmen in Aktion: Wie Boeing immer besser wurdeZusammenfassung25 Sparen, Investitionsausgaben und das Finanzsystem25.1 Sparen und Investitionsausgaben in Übereinstimmung bringen25.2 Das Finanzsystem25.3 FinanzmarktschwankungenUnternehmen in Aktion: Die Grameen Bank – eine Bank gegen die ArmutZusammenfassungXII Die Volkswirtschaft auf kurze Sicht: Konjunktur26 Einnahmen und Ausgaben26.1 Der Multiplikator: Eine einfache Einführung26.2 Die Konsumausgaben26.3 Die Investitionsausgaben26.4 Das Einnahmen-Ausgaben-ModellUnternehmen in Aktion: Was gut für Amerika ist, ist auch gut für General Motors (GM)ZusammenfassungAnhang zu 26Die mathematische Herleitung des Multiplikators27 Gesamtwirtschaftliches Angebot und gesamtwirtschaftliche Nachfrage27.1 Gesamtwirtschaftliche Nachfrage27.2 Gesamtwirtschaftliches Angebot27.3 Das AS-AD-Modell27.4 Makroökonomische WirtschaftspolitikUnternehmen in Aktion: Langsame FahrtZusammenfassungXIII Stabilisierungspolitik28 Fiskalpolitik28.1 Die Grundlagen der Fiskalpolitik28.2 Fiskalpolitik und der Multiplikator28.3 Der Saldo des Staatshaushalts28.4 Die langfristigen Auswirkungen der FiskalpolitikUnternehmen in Aktion: Hier scheint die SonneZusammenfassungAnhang zu 28Steuern und der Multiplikator29 Geld, Banken und Zentralbanken29.1 Die Bedeutung von Geld29.2 Die geldpolitische Rolle der Banken29.3 Bestimmung der Geldmenge29.4 Zentralbanken29.5 Die Finanzkrise und das BankensystemUnternehmen in Aktion: Was ist das perfekte Geschenk: Geld oder Geschenkkarten?Zusammenfassung30 Geldpolitik30.1 Die Geldnachfrage30.2 Geld und Zinssätze30.3 Geldpolitik und gesamtwirtschaftliche NachfrageUnternehmen in Aktion: Wetten auf billiges GeldZusammenfassungAnhang zu 30Die zwei Modelle zur Erklärung des Zinssatzes zusammenführen30A.1 Die kurzfristige Bestimmung des Zinssatzes30A.2 Die langfristige Bestimmung des Zinssatzes31 Inflation, Desinflation und Deflation31.1 Geld und Inflation31.2 Moderate Inflation und Desinflation31.3 Inflation und Arbeitslosigkeit auf lange Sicht31.4 DeflationUnternehmen in Aktion: Lizenzen zum GelddruckenZusammenfassung32 Krisen und Konsequenzen32.1 Das Bankgeschäft: Nutzen und Gefahren32.2 Bankenkrisen und Finanzmarktpaniken32.3 Die Folgen von Bankenkrisen32.4 Die Finanzkrise und ihre FolgenZusammenfassungXIV Ereignisse und Ideen33 Makroökonomik: Ereignisse und Ideen33.1 Die Klassische Makroökonomik33.2 Die Weltwirtschaftskrise und die Keynesianische Revolution33.3 Herausforderungen der Keynesianischen Lehre33.4 Rationale Erwartungen, reale Konjunkturzyklen und Neue Klassische Makroökonomik33.5 Konsens und Widerspruch in der modernen MakroökonomikZusammenfassungXV Die offene Volkswirtschaft34 Die Makroökonomik der offenen Volkswirtschaft34.1 Kapitalströme und die Zahlungsbilanz34.2 Die Rolle der Wechselkurse34.3 Wechselkurspolitik34.4 Wechselkurse und makroökonomische PolitikUnternehmen in Aktion: Ein Yen für japanische AutosZusammenfassungStichwortverzeichnisHinweis zum Urheberrecht:
Alle Inhalte dieses eBooks sind urheberrechtlich geschützt.
Bitte respektieren Sie die Rechte der Autorinnen und Autoren, indem sie keine ungenehmigten Kopien in Umlauf bringen.
Dafür vielen Dank!
Schäffer-Poeschel Verlag für Wirtschaft - Steuern - Recht GmbH
Impressum
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar.
Dieses Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
© 2017 Schäffer-Poeschel Verlag für Wirtschaft · Steuern · Recht [email protected]
Umschlagentwurf: Goldener Westen, BerlinUmschlaggestaltung: Kienle gestaltet, StuttgartSatz: Dörr + Schiller GmbH, Stuttgart
März 2017
Schäffer-Poeschel Verlag StuttgartEin Tochterunternehmen der Haufe Gruppe
Die Autoren
Paul Krugman ist Wirtschafts-Nobelpreisträger des Jahres 2008 und lehrte 14 Jahre lang an der Universität Princeton. Seit Juni 2015 ist er Mitglied der Fakultät des Graduate Center der City University of New York (CUNY). Seit 2014 ist er mit dem LIS assoziiert, einer Forschungseinrichtung in Luxemburg, die weltweit Einkommensungleichheit erfasst und analysiert. Den BA erwarb Krugman in Yale und seinen Doktortitel am MIT (Massachusetts Institute of Technology). Er lehrte in Yale, Stanford und am MIT. Paul Krugman ist Kolumnist der New York Times und hat mehrere Bücher für ein ökonomisch nicht vorgebildetes Publikum geschrieben.[2]
Robin Wells war Lehrbeauftragte und Forscherin im Fach Wirtschaftswissenschaften an der Universität Princeton. Den BA erwarb sie an der Universität Chicago, ihren Doktortitel in Berkeley an der University of California. Danach arbeitete sie als Postdoc am MIT. Sie unterrichtete an der Universität von Michigan, der Universität von Southampton (Vereinigtes Königreich), in Stanford und am MIT.
Die Übersetzer
Professor Dr. Klaus Dieter John (†) war seit 1992 Professor für Volkswirtschaftslehre an der Technischen Universität Chemnitz. Er promovierte mit einer Arbeit über die Zusammenhänge von Beschäftigung, Inflation und Einkommensverteilung. Klaus Dieter John habilitierte sich zum Thema „Optimale Entwicklungspfade für Ökonomie und Umwelt“.
Sarah Lisanne John hat an den Universitäten Tübingen und Heidelberg Volkswirtschaftslehre und Europastudien studiert. Sie arbeitet seit 2016 bei der Deutschen Bundesbank.
Dr. Marco Herrmann hat an der Freien Universität Berlin Volkswirtschaftslehre studiert und am Institut für Empirische Wirtschaftsforschung der Universität Leipzig promoviert. Er ist heute bei der VNG – Verbundnetz Gas AG in Leipzig als Leiter der Abteilung Analyse beschäftigt.[3]
Vorwort der Übersetzer
Lange mussten sich die Leserinnen und Leser gedulden, aber nun liegt die zweite Auflage der deutschen Ausgabe des weltweit erfolgreichen Standardlehrbuches der Volkswirtschaftslehre „Economics“ von Paul Krugman und Robin Wells vor. Die neue deutsche Ausgabe basiert auf der vierten Auflage des US-amerikanischen Lehrbuches.
In seiner zweiten Auflage erscheint das Lehrbuch in einem neuen, modernen Layout und bildet die inhaltlichen und strukturellen Änderungen der US-amerikanischen Vorlage ab. Die Inhalte sind in vielen Teilen neu strukturiert und ergänzt worden. Gleichzeitig gibt es komplett neue Darstellungen. Kapitel 18 gibt einen Einblick in die Ökonomie des Wohlfahrtsstaates. Im Kapitel 32 werden unter der Überschrift „Krisen und Konsequenzen“ die Ursachen von Bankenkrisen und Finanzmarktpaniken sowie ihre Auswirkungen auf die gesamtwirtschaftliche Entwicklung dargestellt.
Mit der zweiten Auflage der deutschen Ausgabe von „Economics“ setzen wir den Ansatz des leider verstorbenen Klaus Dieter John konsequent fort, das US-amerikanische Lehrbuch nicht einfach Wort für Wort ins Deutsche zu übersetzen, sondern den US-amerikanischen Fokus durch eine europäische und deutsche Perspektive zu ergänzen. Den Ausführungen in den einzelnen Kapiteln werden in bewährter Form Themen aus „Wissenschaft und Praxis“, „Denkfallen!“ und „Vertiefung“ zur Seite gestellt. Neu hinzugekommen ist die Rubrik „Länder im Vergleich“, in der ökonomische Sachverhalte aus einer internationalen Perspektive anhand von Daten und Fakten dargestellt und analysiert werden. Am Ende eines Kapitels gibt es nun außerdem eine Fallstudie zu „Unternehmen in Aktion“, in der herausgearbeitet wird, wie sich wichtige ökonomische Grundprinzipien im Unternehmensalltag widerspiegeln.[4]
Durch die Vielzahl der neuen Inhalte ist es notwendig geworden, die Aufgaben am Ende eines jeden Kapitels aus dem Lehrbuch „auszulagern“. Die Aufgaben sind aber nicht verloren gegangen, sondern werden in einem separaten Arbeitsbuch aufgegriffen und ausführlich beantwortet (Marco Herrmann / Sarah Lisanne John: Arbeitsbuch Volkswirtschaftslehre, 2017, ISBN 978-3-7910-3868-1).
Unser Dank gilt Herrn Dipl.-Volksw. Frank Katzenmayer und Herrn Dipl.-Volksw. Bernd Marquard, die maßgeblich zum Gelingen der neuen Auflage beigetragen haben.
Nach getaner Arbeit bleibt zu hoffen, dass für die neue Auflage des Lehrbuches – in Abwandlung einer alten Volksweisheit – gilt: „Was lange währt, wird richtig gut“.
Sarah Lisanne John und Marco Herrmann
Tübingen und Leipzig, im Oktober 2016
Neu in der 2. Auflage
Kapitel 32 Krisen und Konsequenzen charakterisiert zunächst das Bankgeschäft. Bankenkrisen können Finanzmarktpaniken auslösen. Diese haben langanhaltende und gravierende Auswirkungen auf Volkswirtschaften, weshalb regulatorische Vorkehrungen gegen Bankenkrisen getroffen werden. Die Finanzkrise 2008 ist auf eine Bankenkrise zurückzuführen und hatte schwere wirtschaftliche Auswirkungen.
Kapitel 18 Die Ökonomie des Wohlfahrtsstaates[5] enthält den Teil über Armut, Ungleichheit und staatliche Politik aus dem Kapitel 21 der 1. Auflage und wurde zusätzlich um die Themen Wohlfahrtsstaat in den USA, Ökonomik der Gesundheitsfürsorge (ACA, Medicare, Medicaid) und Diskussion über den Wohlfahrtsstaat erweitert.
Das Kapitel Steuern (Kapitel 7) fasst Ausführungen zu Steuern aus verschiedenen Kapiteln der 1. Auflage zusammen und wurde ergänzt um wesentliche Aspekte des deutschen Steuersystems.
Die Kapitel zu Fiskalpolitik (Kapitel 28), Geld, Banken und Zentralbanken (Kapitel 30) und Geldpolitik (Kapitel 31) wurden stärker auf deutsche bzw. europäische Verhältnisse ausgerichtet.
Das Kapitel 11 der 1. Auflage über Konsumentenpräferenzen und Konsumentscheidung wurde in den Anhang zu Kapitel 10 Der rationale Verbraucher integriert.
Das Kapitel 16 Externalitäten enthält jetzt das Kapitel 22 der 1. Auflage zu Technologie, Informationsgütern und Netzwerkexternalitäten in kompakterer Form.
Die Rubrik Länder im Vergleich untersucht Themen aus einer internationalen Perspektive, z. B. den Zusammenhang zwischen Produktivität und Reallöhnen, die Beziehung zwischen Wirtschaftswachstum und CO2-Emissionen oder Umverteilung und Ungleichheit in Industrieländern.
Am Ende jedes Kapitels präsentiert Unternehmen in Aktion einen zentralen Inhalt des Kapitels (z. B. Preisstrategien, Opportunitätskosten, Banken und Armut) anhand von Entscheidungen oder der wirtschaftlichen Situation eines Unternehmens. Dazu gehören unter anderem Priceline, Uber, Amazon, McDonald’s, Virgin Airways, Facebook, MySpace, Friendster und Walmart.[6]
In den Mikroökonomik-Kapiteln 1 bis 20 wird mit den praktischen Beispielen vor allem untersucht, wie technologische Neuerungen die Wirtschaft verändern. Wie verändert das Auftreten von Uber das Marktgleichgewicht? Smart Grids zeigen die Bedeutung einer exakten Messung von Kosten, „Showrooming“ und Showing Apps bringen den Markt für Konsumgüter näher an die vollständige Konkurrenz heran.
In den Makroökonomik-Kapiteln 21 bis 34 werden in praktischen Beispielen besonders die Nachwirkungen der Finanzkrise analysiert. Konzepte wie Massenarbeitslosigkeit, Nominallohnrigidität, Fiskalpolitik und der Multiplikator oder die Nullzins-Untergrenze der Geldpolitik werden durch aktuelle Beispiele (Ländervergleich, Länder in Südeuropa) illustriert statt durch Rückgriff auf die Wirtschaftsgeschichte.
Zentrale Kapitel und optionale Kapitel
Abkürzungen für ökonomische Fachbegriffe
Einführung: Alltägliche Geschäfte
Irgendein Sonntag
Es ist ein Sonntagnachmittag im Frühling des Jahres 2014. Die Route 1 im mittleren New Jersey ist stark belebt. Tausende von Menschen bevölkern die Einkaufszentren, die sich über 20 Meilen links und rechts der Straße von Trenton bis nach New Brunswick erstrecken. Die meisten von ihnen sind in aufgekratzter Stimmung – und warum auch nicht? Die Geschäfte in den Einkaufszentren bieten eine außergewöhnliche Auswahl. Es gibt einfach alles: von neuester Unterhaltungselektronik über modische Kleidung bis hin zu Biomöhren.[10]
Grob geschätzt werden wahrscheinlich weit über 100.000 verschiedene Waren entlang dieser 20 Meilen angeboten. Dabei sind die meisten dieser Waren keine Luxusgüter, die sich nur die Reichen leisten können. Vielmehr handelt es sich um Produkte, die sich Millionen von Amerikanern kaufen könnten – und die sie auch tatsächlich jeden Tag kaufen.
Die eben beschriebene Szene an der Route 1 ist natürlich überhaupt nichts Ungewöhnliches. Ähnliche Szenen findet man am selben Nachmittag auch an Hunderten von anderen Einkaufsstraßen in Amerika. Aber die Wirtschaftswissenschaften beschäftigen sich vorwiegend auch mit ganz gewöhnlichen Dingen. Wie der große Ökonom Alfred Marshall feststellte, sind Wirtschaftswissenschaften „die Analyse des menschlichen Verhaltens bei den ganz alltäglichen Geschäften“.
Was können die Wirtschaftswissenschaften über die „ganz alltäglichen Geschäfte“ sagen? Wie sich zeigen wird: eine ganze Menge. Wir werden in diesem Buch sehen, dass uns auch ganz vertraute Szenen des Wirtschaftslebens einige sehr wichtige Fragen aufwerfen – Fragen, auf die uns die Wirtschaftswissenschaften Antworten liefern können. Zu diesen Fragen gehören:[11]
Wie funktioniert unser Wirtschaftssystem? Wie bewirkt es also, dass wir mit einer ausreichenden Menge von Gütern versorgt werden?
Wann und warum führt uns unser Wirtschaftssystem in die falsche Richtung und verleitet Menschen zu unproduktivem Verhalten?
Warum gibt es das Auf und Ab in der Wirtschaft? Warum gibt es also manchmal wirtschaftlich „schwierige Zeiten“?
Schließlich: Warum überwiegt langfristig das Auf und nicht das Ab? Warum hat der volkswirtschaftliche Reichtum vieler entwickelter Nationen im Zeitverlauf so stark zugenommen?
Wir wollen im Folgenden einen näheren Blick auf diese Fragen werfen und einen kurzen Überblick über das bieten, was wir in diesem Buch lernen können.
Die unsichtbare Hand
Überhaupt nicht alltäglich hätte die beschriebene Szene aus dem mittleren New Jersey auf einen Amerikaner der Kolonialzeit gewirkt, etwa auf einen der einfachen Soldaten, mit deren Hilfe George Washington die Schlacht von Trenton im Jahr 1776 gewonnen hat. (Zu dieser Zeit war Trenton ein kleines Dorf, die Bauerngehöfte erstreckten sich längs der unbefestigten Straße, aus der schließlich die Route 1 wurde – Einkaufszentren waren nicht in Sicht.)
Nehmen wir einmal an, wir könnten einen Bürger aus dem 18. Jahrhundert in unsere eigene Zeit holen. Worüber würde unser Zeitreisender wohl staunen?
Das, was ihn sicherlich am meisten verwundern würde, wäre der enorme Wohlstand, den er sehen würde – die riesige Palette an Waren und Dienstleistungen, die sich eine ganz normale Familie heute leisten kann. Mit Blick auf diesen ganzen Reichtum würde sich unser Zeitreisender wohl fragen: „Wie kann ich davon wohl etwas abbekommen?“ oder vielleicht auch: „Wie könnte meine eigene Gesellschaft etwas Ähnliches erreichen?“[12]
Als Wirtschaft bezeichnet man das System zur Koordination der produktiven Aktivitäten einer Gesellschaft.
Als Wirtschaftswissenschaften bezeichnet man die wissenschaftliche Analyse von Wirtschaften, und zwar sowohl auf Ebene der Individuen als auch auf Ebene der Gesellschaft insgesamt.
Die Antwort auf diese Fragen lautet: Um einen vergleichbaren Wohlstand und ein vergleichbares Maß an Prosperität zu erreichen, ist ein gut funktionierendes System zur Koordination der produktiven Aktivitäten vonnöten – der Aktivitäten, mit denen die gewünschten Güter geschaffen und zu den Menschen gebracht werden, die diese Güter haben möchten. Diese Art von System ist es, die wir meinen, wenn wir über die Wirtschaft sprechen. Als Wirtschaftswissenschaften bezeichnen wir die Lehre von der Wirtschaft, sowohl auf der Ebene der Individuen als auch auf der Ebene der Gesellschaft insgesamt.
Der Erfolg einer Wirtschaft zeigt sich daran, in welchem Ausmaß sie Güter bereitstellen kann. Ein Zeitreisender aus dem 18. Jahrhundert, ja selbst einer aus dem Jahr 1950, wäre erstaunt darüber, wie viele Waren und Dienstleistungen moderne industrialisierte Volkswirtschaften bieten und wie viele Leute sich diese Güter leisten können. Verglichen mit jeder Volkswirtschaft der Vergangenheit und verglichen mit fast allen Ländern heute, weisen Nordamerika und die meisten europäischen Länder einen unglaublich hohen Lebensstandard auf.[13]
Eine Marktwirtschaft ist eine Wirtschaft, in der die Entscheidungen über Produktion und Konsum von den einzelnen Produzenten und Konsumenten getroffen werden.
So gesehen müssen diese Volkswirtschaften irgendetwas richtig machen und vielleicht würde der Zeitreisende der für diesen Erfolg verantwortlichen Person gerne gratulieren. Er hätte mit diesem Wunsch aber ein Problem: Es gibt keine einzelne Person, welche die Verantwortung für die Wirtschaft trägt. Bei den beschriebenen Volkswirtschaften handelt es sich um Marktwirtschaften, in denen Produktion und Konsum das Ergebnis dezentralisierter Entscheidungen von vielen Unternehmen und Individuen sind. Es gibt keine zentrale Behörde, die den Leuten sagt, was und wie viel sie produzieren sollen. Es gibt auch keine Behörde, die ihnen sagt, an wen sie ihre Produkte liefern sollen. Jeder einzelne Produzent produziert genau das, was nach seiner Einschätzung am profitabelsten ist. Jeder Konsument kauft genau das, was seinen Wünschen entspricht.
Die Alternative zur Marktwirtschaft ist die Planwirtschaft, in der es tatsächlich eine zentrale Institution gibt, welche die Entscheidungen über Produktion und Konsum trifft. Planwirtschaftliche Systeme wurden in der Realität ausprobiert. Als prominentes Beispiel mag die Sowjetunion zwischen 1917 und 1991 gelten. Diese planwirtschaftlichen Systeme waren aber nicht besonders erfolgreich. Die Produzenten in der Sowjetunion fanden sich regelmäßig in der Lage, bestimmte Dinge nicht produzieren zu können, weil ihnen wichtige Rohstoffe fehlten. Manchmal konnten sie zwar produzieren, fanden dann aber niemanden, der ihre Produkte kaufen wollte. Auf der anderen Seite war es für die Konsumenten oft unmöglich, die für sie notwendigen Produkte kaufen zu können. Sichtbares Zeichen hierfür waren die langen Warteschlangen vor den Geschäften.[14]
Marktwirtschaften sind demgegenüber in der Lage, selbst extrem komplexe Aktivitäten zu koordinieren und die Konsumenten zuverlässig mit den Waren und Dienstleistungen zu versorgen, die sie wünschen. Wenn man es genau nimmt, vertrauen die Menschen ohne zu zögern sogar ihr Leben dem Marktsystem an: Die Einwohner jeder größeren Stadt würden innerhalb von wenigen Tagen sterben, wenn die ungeplanten – und dennoch in gewisser Weise geordneten – Aktionen von Tausenden von Unternehmen sie nicht mit einem stetigen Fluss an Lebensmitteln versorgen würden. Zur Überraschung des Betrachters ist in diesem Sinne das ungeplante „Chaos“ einer Marktwirtschaft im Ergebnis viel strukturierter als die „Planung“ einer zentralen Verwaltungswirtschaft.
Der Begriff der unsichtbaren Hand bezieht sich darauf, wie die Verfolgung der Einzelinteressen durch die Individuen zu guten Ergebnissen für die Gesellschaft insgesamt führen kann.
Einer der Gründerväter der Volkswirtschaftslehre, der schottische Wirtschaftswissenschaftler Adam Smith, schrieb 1776 in einem berühmten Abschnitt seines Buches Der Reichtum der Nationen[15], dass die Individuen mit der Verfolgung ihrer eigenen Interessen oft dazu beitragen, den Interessen der Gesellschaft insgesamt zu dienen. Über einen Geschäftsmann, dessen Streben nach Gewinn die gesamte Gesellschaft reicher macht, schrieb Smith: „Er verfolgt nur seinen eigenen Vorteil, und er wird dabei, wie es auch in vielen anderen Fällen geschieht, von einer unsichtbaren Hand geführt, etwas zu befördern, das kein Element seines Strebens war.“ Seit dieser Zeit verwenden Wirtschaftswissenschaftler den Begriff der unsichtbaren Hand, um die Art und Weise zu beschreiben, wie eine Marktwirtschaft die Kraft des Egoismus in einen Vorteil für die Gesellschaft transformiert.
Als Mikroökonomik bezeichnet man den Zweig der Wirtschaftswissenschaften, der sich damit beschäftigt, wie Menschen Entscheidungen treffen und wie diese Entscheidungen zusammenwirken.
Der Bereich der Wirtschaftswissenschaften, der sich damit beschäftigt, wie Individuen ihre Entscheidungen treffen und wie diese Entscheidungen miteinander interagieren, wird als Mikroökonomik bezeichnet. Ein zentrales Thema der Mikroökonomik ist die Gültigkeit der Einsicht von Adam Smith: Individuen, die ihre eigenen Interessen verfolgen, befördern oft die Interessen der gesamten Gesellschaft.
Wenn also unser Zeitreisender die Frage stellt „Wie kann meine Gesellschaft dieses Ausmaß an Wohlstand erreichen, das den entwickelten Ländern hier auf der Erde als selbstverständlich gilt?“, dann ist ein Teil der Antwort, dass seine Gesellschaft die Vorteile von Marktwirtschaften und die Kraft der unsichtbaren Hand ausreichend würdigen sollte.[16]
Allerdings erweist sich die unsichtbare Hand nicht in jedem Fall als Freund der Gesellschaft. Es ist daher wichtig zu verstehen, wann und warum das individuelle Eigennutzstreben zu kontraproduktivem Verhalten führen kann.
Mein Nutzen, deine Kosten
Eine Sache, die ein Zeitreisender vermutlich bei modernen Einkaufsstraßen wie der Route 1 nicht schätzen würde, ist der Verkehr. Und tatsächlich: Die meisten Dinge in Nordamerika und Europa sind besser geworden, die Verkehrsbelastung ist aber bedeutend schlimmer geworden.
Kommt es im Straßenverkehr zu Verstopfungen oder Staus, bürdet jeder Fahrer allen anderen Fahrern, welche die betreffende Straße benutzen, Kosten auf. Er steht ihnen – wörtlich – im Wege (und die anderen stehen ihm im Wege). Diese Kosten können erheblich sein: Fährt jemand in größeren Ballungsgebieten mit seinem Auto und nicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln zur Arbeit oder nach Hause, dann können sich die verborgenen Kosten, die er anderen Fahrern aufbürdet, nach vorliegenden Schätzungen auf rund 15 Euro belaufen. Bei der Entscheidung, ob sie mit ihrem eigenen Pkw fahren sollen oder nicht, gibt es für Pendler aber keinen Anreiz, diese Kosten, die sie anderen auferlegen, in ihre Planung einzubeziehen.
Führt die Verfolgung der Einzelinteressen zu für die Gesellschaft insgesamt ungünstigen Ergebnissen, liegt Marktversagen vor.
[17]Verkehrsstaus sind ein spezifisches Beispiel für einen deutlich breiteren Problemkreis: In bestimmten Fällen führt das individuelle Verfolgen der eigenen Interessen nicht auch gleichzeitig zu einer Beförderung der Interessen der Gesellschaft insgesamt, sondern im Gegenteil zu einer Verschlechterung der gesellschaftlichen Situation. Tritt dieser Fall auf, spricht man von Marktversagen. Andere wichtige Beispiele für derartiges Marktversagen sind Luft- und Wasserverschmutzung sowie die Übernutzung natürlicher Ressourcen, wie Fisch- und Waldbestände.
Es gibt aber auch eine gute Nachricht: Sie werden in diesem Buch lernen, wie man mithilfe von ökonomischen Analysen diese Fälle von Marktversagen diagnostizieren kann. Darüber hinaus lassen sich mithilfe der ökonomischen Analyse auch Lösungen für die beschriebenen Probleme entwickeln.
Gute Zeiten – schlechte Zeiten
Die Route 1 war an jenem Frühlingstag im Jahr 2014 belebt – bei einem Besuch der dortigen Einkaufszentren im Jahr 2008 wäre die Stimmung jedoch nicht so aufgekratzt gewesen. Das liegt daran, dass die Wirtschaft New Jerseys, genau wie die gesamte amerikanische Wirtschaft, im Jahr 2008 sehr angeschlagen war: Zu Beginn des Jahres 2007 entließen die Unternehmen immer mehr Arbeitnehmer und die Beschäftigung nahm erst im Sommer 2009 wieder zu.
Als Rezession bezeichnet man eine Verschlechterung der gesamtwirtschaftlichen Lage.
[18]Solche schwierigen Perioden treten in modernen Volkswirtschaften regelmäßig auf. Die ökonomische Entwicklung verläuft nicht glatt, vielmehr treten Schwankungen auf, also eine Folge von Aufwärts- und Abwärtsentwicklungen. Bis zu seiner Lebensmitte muss jeder von uns mit drei oder vier solchen volkswirtschaftlichen Abwärtsentwicklungen rechnen, die als Rezessionen bezeichnet werden. (Die US-amerikanische Wirtschaft durchlebte schwerwiegende Rezessionen in den Jahren 1973, 1981, 1990, 2001 und 2007.) Während einer schweren Rezession gehen Hunderttausende von Arbeitsplätzen verloren.
Als Makroökonomik bezeichnet man den Zweig der Wirtschaftswissenschaften, der sich mit der Gesamtwirtschaft beschäftigt, und zwar insbesondere mit den zu beobachtenden Auf- und Abschwungphasen.
Wie das oben beschriebene Marktversagen scheinen Rezessionen eine letztlich vielleicht nicht völlig vermeidbare Eigenschaft von Marktwirtschaften zu sein. Genau wie beim Marktversagen liefert die ökonomische Analyse für dieses Problem aber doch zumindest einige Lösungsvorschläge, die zu einer Verbesserung beitragen können. Die Untersuchung von Rezessionen gehört zu den Hauptaufgaben eines Teilgebietes der Volkswirtschaftslehre, das als Makroökonomik bezeichnet wird. Befasst man sich mit der Makroökonomik näher, dann kann man sehen, wie Ökonomen Rezessionen erklären und wie Wirtschaftspolitik eingesetzt werden kann, um die Schäden zu minimieren, die aus den gesamtwirtschaftlichen Schwankungen resultieren.[19]
Trotz der gelegentlich auftretenden Rezessionen verzeichnen fast alle entwickelten Volkswirtschaften vergleichsweise deutlich längere Phasen, in denen es aufwärts geht.
Vorwärts und aufwärts
Zu Beginn des 20. Jahrhunderts lebten in den Industrieländern die meisten Menschen unter Bedingungen, die wir heute als extreme Armut bezeichnen würden. Weniger als zehn Prozent der Haushalte verfügten über Toiletten mit Wasserspülung, weniger als acht Prozent hatten eine Zentralheizung und kaum zwei Prozent verfügten über Elektrizität. So gut wie niemand besaß ein Auto, von Waschmaschine oder Kühlschrank ganz zu schweigen.
Unter Wirtschaftswachstum versteht man die im Laufe der Zeit zunehmende Fähigkeit der Wirtschaft, Waren und Dienstleistungen zu produzieren.
Diese Vergleiche zeigen, wie stark sich unser Leben durch das Wirtschaftswachstum, die Zunahme der Produktionsmöglichkeiten also, verändert hat. Warum wachsen Volkswirtschaften im Zeitverlauf? Und warum ist in bestimmten Volkswirtschaften und zu bestimmten Zeiten stärkeres Wachstum zu verzeichnen als sonst? Dies sind für Wirtschaftswissenschaftler ganz zentrale Fragen, weil die meisten von uns Wirtschaftswachstum als positiv einschätzen und wir gerne ein höheres Wachstum hätten.
Eine Maschine für Entdeckungen
Wir hoffen, wir haben Sie davon überzeugt, dass das „ganz gewöhnliche Geschäftsleben“ in Wirklichkeit ziemlich außergewöhnlich ist und dass uns das Nachdenken hierüber zu sehr interessanten und wichtigen Fragen führen kann. In diesem Buch wollen wir die Antworten erläutern, die Ökonomen auf diese Fragen geben. Sie sollten von diesem Buch aber nicht eine Auflistung von Antworten erwarten. Es erhebt vielmehr den Anspruch, eine Einführung in die Disziplin der Wirtschaftswissenschaften zu sein und Ihnen zu zeigen, wie man mit den Fragen umgehen kann, die wir gerade besprochen haben. Um mit Alfred Marshall zu sprechen, der die Wirtschaftswissenschaften als Untersuchung des „gewöhnlichen Geschäftslebens“ beschrieben hat: „Wirtschaftswissenschaften … sind nicht eine Ansammlung konkreter Wahrheiten, sondern vielmehr eine Maschine zur Entdeckung konkreter Wahrheiten.“[20]
Starten wir also die Maschine.
Schlüsselbegriffe
Wirtschaft
Wirtschaftswissenschaften
Marktwirtschaft
unsichtbare Hand
Mikroökonomik
Marktversagen
Rezession
Makroökonomik
Wirtschaftswachstum
I Was ist Volkswirtschaftslehre?
1 Grundprinzipien
Lernziele
Eine Reihe von Prinzipien, die zeigen, wie Individuen ökonomische Entscheidungen treffen.
Eine Reihe von Prinzipien, die zeigen, wie individuelle Entscheidungen wechselseitig voneinander abhängen.
Eine Reihe von Prinzipien, die zeigen, wie gesamtwirtschaftliche Interaktionen entstehen.
Die gemeinsame Basis
Das jährliche Treffen der American Economic Association lockt Tausende von Ökonomen an – junge und alte, berühmte und unbekannte. Es gibt dort Büchertische, Geschäftstreffen und jede Menge Vorstellungsgespräche. Hauptsächlich treffen sich die Wirtschaftswissenschaftler jedoch, um zu reden und zuzuhören. Wenn es besonders emsig zugeht, kann es sein, dass mehr als 60 Vorträge gleichzeitig stattfinden. Diese Vorträge beschäftigen sich mit Fragen über die Zukunft der Aktienmärkte bis hin zu dem Problem, wer in einem Haushalt mit zwei Berufstätigen das Kochen erledigt.[21]
Was haben all diese Wissenschaftler gemeinsam? Ein Experte für Aktienmärkte versteht vermutlich nur sehr wenig von der ökonomischen Theorie der Familie und umgekehrt. Dennoch wird ein Ökonom, der aus Versehen in den falschen Vortrag geht und sich auf einmal der Präsentation eines ihm nicht vertrauten Themas gegenübersieht, mit großer Wahrscheinlichkeit etliches hören, das ihm vertraut ist. Die Ursache hierfür liegt darin, dass jede ökonomische Analyse auf einer Menge von gemeinsamen Prinzipien basiert, die sich auf sehr unterschiedliche Themenbereiche anwenden lassen.
Einige dieser Prinzipien beziehen sich auf das Entscheidungsverhalten der Individuen,denn in den Wirtschaftswissenschaften geht es zuallererst um die Entscheidungen, die Individuen treffen. Ziehen Sie es vor, Ihr Geld zu sparen und mit dem Bus zu fahren oder kaufen Sie sich ein Auto? Behalten Sie Ihr altes Smartphone oder legen Sie sich ein neues zu? Diese Entscheidungen implizieren eine Auswahl zwischen einer begrenzten Anzahl von Alternativen – begrenzt deswegen, weil niemand all das haben kann, was er sich wünscht. Geht man auf das elementarste Fundament zurück, berührt jede ökonomische Fragestellung letztlich das Entscheidungsverhalten von Individuen.
Um zu verstehen, wie eine Wirtschaft funktioniert, bedarf es natürlich mehr als nur des Verständnisses dafür, wie Individuen ihre Entscheidungen treffen. Schließlich ist keiner von uns Robinson Crusoe, der allein auf seiner Insel lebt. Vielmehr müssen wir unsere Entscheidungen in einem Umfeld treffen, das durch die Entscheidungen anderer geprägt ist. In einer modernen, arbeitsteiligen Wirtschaft werden selbst die einfachsten Entscheidungen, die man treffen kann, etwa die Frage, was man zum Frühstück isst, durch die Entscheidungen Tausend anderer Leute beeinflusst – etwa vom Apfelanbauer in Südtirol, der eine Zutat für Ihr Müsli liefert, oder vom Bäcker um die Ecke, bei dem Sie die Brötchen kaufen. Weil jeder von uns in einer Marktwirtschaft von so vielen anderen abhängt, die ihrerseits von uns abhängen, beeinflussen sich unsere Entscheidungen wechselseitig. Obwohl es bei den Wirtschaftswissenschaften grundsätzlich immer um die individuelle Entscheidung geht, müssen wir auch das Zusammenwirken[22] dieser Entscheidungen verstehen, um das Verhalten der Marktwirtschaft insgesamt begreifen zu können. Ganz zentral ist es also auch zu wissen, wie meine Entscheidungen Ihre Entscheidungen beeinflussen und umgekehrt. Aus der Betrachtung der Märkte einzelner Güter, wie beispielsweise des Marktes für Weizen, lässt sich ableiten, wie viele wichtige ökonomische Interaktionen entstehen. Aber die Wirtschaft als Ganzes erlebt Höhen und Tiefen, weshalb wir sowohl die gesamtwirtschaftlichen Interaktionen als auch die weniger weitreichenden Interaktionen auf einzelnen Märkten verstehen müssen.[23]
Im weiteren Verlauf dieses Kapitels wollen wir uns daher mit zwölf grundlegenden ökonomischen Prinzipien beschäftigen. Vier von diesen Prinzipien beziehen sich auf die individuelle Entscheidung, fünf beziehen sich auf die Art und Weise, wie individuelle Entscheidungen miteinander interagieren, und drei weitere beziehen sich auf gesamtwirtschaftliche Interaktionen.
1.1 Individuelle Entscheidung: Der Kern der Wirtschaftswissenschaften
Die individuelle Entscheidung ist die Entscheidung eines Individuums darüber, was es tun will und deswegen auch, was es nicht tun will.
Jeder ökonomische Sachverhalt umfasst im Kern eine individuelle Entscheidung, die Entscheidung eines Individuums darüber, was es tun will und was es nicht tun will. Man könnte sogar noch weiter gehen und sagen, dass es sich nicht um eine ökonomische Frage handelt, wenn es nicht um Entscheidungsfindung geht.
Stellen Sie sich vor, Sie betreten ein großes Einkaufszentrum. Dort gibt es Abertausende von verschiedenen Produkten und es ist extrem unwahrscheinlich, dass Sie oder irgendjemand sonst es sich leisten könnte, alles zu kaufen, was man gerne hätte. Ganz abgesehen davon ist vermutlich auch der Raum in Ihrem Zimmer oder Ihrer Wohnung begrenzt. Kaufen Sie sich also ein weiteres Bücherregal oder einen kleinen Kühlschrank? Vor dem Hintergrund der Begrenzungen, die sich aus Ihrem Budget und dem verfügbaren Wohnraum ergeben, müssen Sie sich entscheiden, welches Produkt Sie kaufen und welches Sie im Geschäft lassen.[24]
Auch der Umstand, dass diese beiden Produkte überhaupt im Geschäft vorhanden sind, impliziert Entscheidungen: Der verantwortliche Manager des Einkaufscenters hat sich entschieden, den Artikel in sein Programm aufzunehmen und der Hersteller des Produktes hat sich entschieden, es zu produzieren. Jede ökonomische Aktivität umfasst daher das Treffen von individuellen Entscheidungen.
Die ökonomische Theorie der individuellen Entscheidung basiert auf vier Prinzipien, die in Tabelle 1–1 zusammengefasst sind. Wir wollen im Folgenden diese Prinzipien etwas genauer betrachten.
Tab. 1–1 Prinzipien, die den ökonomischen Entscheidungen von Individuen zugrunde liegen
Prinzip 1: Ressourcen sind knapp
Man kann nicht immer alles bekommen, was man sich wünscht. Jeder wünscht sich ein schönes Haus in bester Lage (und am besten gleich die Hilfe, die einem das Haus sauber hält), zwei oder drei Luxusautos, dann noch recht häufig Ferien in noblen Hotels. Aber selbst in reichen Ländern, wie den Vereinigten Staaten, Deutschland oder Schweden, können sich nur wenige Familien die Erfüllung all dieser Wünsche leisten. Daher müssen wir fast immer Wahlentscheidungen treffen: Leisten wir uns einen Urlaub in Übersee oder kaufen wir uns ein neues Auto? Geben wir uns mit einem kleinen Grundstück für unser Haus zufrieden oder nehmen wir eine längere Fahrt zum Arbeitsplatz in Kauf, um in einem Vorort zu leben, in dem das Grundstück billiger ist?[25]
Ein begrenztes Einkommen ist nicht das Einzige, was die Leute darin beschränkt, alles zu haben, was sie sich wünschen. Auch Zeit ist knapp: Jeder Tag hat nur 24 Stunden. Und weil die Zeit, die wir haben, begrenzt ist, impliziert die Entscheidung, Zeit für eine Aktivität zu verwenden, gleichzeitig die Entscheidung, diese Zeit nicht für eine andere Aktivität zu nutzen: Entscheiden Sie sich dafür, den Abend mit Prüfungsvorbereitungen zu verbringen, dann verzichten Sie gleichzeitig auf eine alternative Aktivität, beispielsweise einen Abend im Kino. Es ist sogar so, dass viele Leute sich so durch die Zeitknappheit beschränkt sehen, dass sie bereit sind, Geld gegen Zeit zu tauschen. So ist es beispielsweise teurer, sich eine Fertigmahlzeit zu kaufen, als sich die entsprechenden Zutaten zu besorgen und das Essen selbst zu kochen. Die Kunden sind aber bereit, den höheren Preis zu bezahlen, weil sie damit Zeit einsparen können. (Vielleicht haben sie aber auch keine Lust zu kochen.)
Dies bringt uns zu unserem ersten Prinzip individueller Entscheidungen:
Individuen müssen Entscheidungen treffen, weil die Ressourcen knapp sind.
Als Ressource bezeichnet man alles, was genutzt werden kann, um irgendetwas anderes zu produzieren.
[26]Ressourcen sind knapp – die verfügbare Menge ist nicht groß genug, um alle produktiven Verwendungen realisieren zu können.
Als Ressource bezeichnen wir alles, was zur Produktion von irgendetwas anderem verwendet werden kann. Zu den Ressourcen einer Volkswirtschaft gehören etwa Land, Arbeit (die verfügbare Zeit der Arbeitnehmer), Kapital (Maschinen, Gebäude und andere produzierte Vermögenswerte) und Humankapital (das Ausbildungsniveau und die Fähigkeiten der Erwerbstätigen). Eine Ressource ist knapp, wenn die Menge der verfügbaren Ressourcen nicht groß genug ist, um alles produzieren zu können, was gewünscht wird. Die meisten Ressourcen sind knapp. Zu den knappen Ressourcen gehören etwa die sogenannten natürlichen Ressourcen, also Ressourcen der natürlichen physischen Umwelt wie beispielsweise Mineralien, Holz und Erdöl. Auch die sogenannten Humanressourcen (Arbeit, Fähigkeiten und Intelligenz) sind in der Regel knapp. Darüber hinaus sind in einer wachsenden Weltwirtschaft mit schnell zunehmender Bevölkerung mittlerweile sogar saubere Luft und sauberes Wasser knapp geworden.
Genau wie Individuen Wahlentscheidungen treffen müssen, zwingt die Knappheit der Ressourcen auch die Gesellschaft insgesamt zu solchen Entscheidungen. Eine Möglichkeit für eine Gesellschaft, solche Entscheidungen zu treffen, ist ganz einfach, sie aus vielen individuellen Entscheidungen resultieren zu lassen. Diese Art von gesellschaftlicher Entscheidungsfindung spielt gewöhnlich in Marktwirtschaften eine zentrale Rolle. Betrachtet man beispielsweise Deutschland, so steht den Deutschen insgesamt nur eine bestimmte Zahl von Stunden pro Woche zur Verfügung. Wie viele dieser Stunden werden sie damit verbringen, im Supermarkt nach günstigen Zutaten für ihr Essen zu suchen, statt sich mit Fertiggerichten zu begnügen oder ins Restaurant zu gehen? Die Antwort auf diese Frage ergibt sich aus der Summe der Einzelentscheidungen: Jedes einzelne der Millionen Individuen unserer Volkswirtschaft trifft diese Entscheidung für sich und die Gesamtentscheidung ergibt sich ganz einfach als Summe dieser individuellen Entscheidungen.[27]
Aus verschiedenen Gründen gibt es jedoch eine Reihe von Entscheidungen, die eine Gesellschaft besser nicht den Individuen allein überlässt. So leben beispielsweise die Autoren dieses Buches in einer Gegend, die bis vor kurzem ländlich geprägt war und hauptsächlich aus Ackerland, Wiesen und Weiden bestand. In jüngster Zeit entwickelt sich diese Gegend aber sehr schnell. Die meisten Anwohner sind der Meinung, dass es für die Gemeinde besser wäre, wenn nicht das gesamte Land bebaut werden würde und stattdessen Grünzonen erhalten würden. Ein einzelnes Individuum hat aber keinen Anreiz, das eigene Land in seiner ursprünglichen Form zu bewahren und es nicht an einen Bauträger zu verkaufen. In den Vereinigten Staaten kaufen daher viele Kommunalregierungen Land auf, um es als unbesiedelten Bereich zu bewahren. In Deutschland erfolgt ähnliches durch Restriktionen in der Verwendung von Land. Wir werden in späteren Kapiteln sehen, warum die Entscheidung über die Verwendung von knappen Ressourcen in den meisten Fällen am besten die Individuen treffen, manchmal aber auch von einer höheren Ebene, beispielsweise einer Gemeinde, getroffen werden sollte.[28]
Prinzip 2: Opportunitätskosten: Die realen Kosten einer Sache ergeben sich aus dem, was man dafür aufgeben muss
Nehmen wir einmal an, Sie verbringen ein Auslandssemester an einer Universität in den Vereinigten Staaten. Nehmen wir weiter an, dass Sie neben dem Pflichtprogramm noch die Möglichkeit haben, ein Wahlfach zu belegen. Von den infrage kommenden Fächern sind Sie an zweien besonders interessiert: Geschichte der amerikanischen Volkswirtschaft und Außenwirtschaftsbeziehungen der Vereinigten Staaten. Zwischen diesen beiden Fächern müssen Sie sich entscheiden.
Die realen Kosten eines Gutes bestehen in seinen Opportunitätskosten – dem, worauf man verzichten muss, um das Gut zu bekommen.
Nehmen wir an, Sie entscheiden sich für Geschichte der amerikanischen Volkswirtschaft. Was sind die Kosten dieser Entscheidung? Die Kosten ergeben sich aus dem Umstand, dass Sie nun die Außenwirtschaftsveranstaltung nicht belegen können. Wirtschaftswissenschaftler bezeichnen diese Art von Kosten – dass Sie auf etwas verzichten müssen, um das zu erhalten, was Sie sich wünschen – als Opportunitätskosten oder Verzichtskosten dieser Sache. Dies bringt uns zu unserem zweiten Prinzip individueller Entscheidungen:[29]
Die realen Kosten einer Sache entsprechen den Opportunitätskosten dieser Sache, also dem, worauf Sie verzichten müssen, um diese Sache zu erhalten.
Die Verzichtskosten der Wirtschaftsgeschichtsveranstaltung bestehen also aus dem entgangenen Vergnügen, das Sie an der Außenwirtschaftsveranstaltung gehabt hätten.
Das Konzept der Opportunitätskosten ist zentral für das Verständnis der individuellen Entscheidungshandlung, weil letztlich alle Kosten Opportunitätskosten sind. Kritiker behaupten manchmal, dass sich Ökonomen nur mit Kosten und Nutzen beschäftigen, die in Euro und Cent gemessen werden können. Das stimmt aber nicht. Die ökonomische Analyse beschäftigt sich häufig mit Fällen, wie in unserem Beispiel mit den Vorlesungsveranstaltungen, wo für das Belegen eines Wahlfaches keine gesonderten Studiengebühren erhoben werden – wo es also keine direkten monetären Kosten gibt. Gleichwohl ist das Wahlfach, das man belegt, mit Opportunitätskosten verbunden, weil man auf das Belegen des anderen Kurses verzichten muss.
Vielleicht glauben Sie jetzt, dass Opportunitätskosten Zusatzkosten sind, also Kosten, die zusätzlich zu den monetären Kosten einer Sache entstehen. Nehmen wir einmal an, das Belegen einer zusätzlichen Veranstaltung würde an Ihrer Gastuniversität 750 Dollar kosten. Nun gibt es also monetäre Kosten für das Belegen des Kurses in Wirtschaftsgeschichte. Sind die Opportunitätskosten für das Belegen dieses Kurses etwas anderes als diese monetären Kosten?[30]
Um diese Frage zu beantworten, wollen wir zwei Fälle betrachten. Nehmen wir zunächst einmal an, dass die Außenwirtschaftsveranstaltung ebenfalls mit Gebühren in Höhe von 750 Dollar verbunden wäre. In diesem Fall müssten Sie die 750 Dollar bezahlen, ganz gleich, welche Veranstaltung Sie belegen. Das, was Sie aufgeben, um Wirtschaftsgeschichte hören zu können, ist also immer noch die Außenwirtschaftsveranstaltung – und sonst nichts. Die 750 Dollar müssten Sie ja in jedem Fall bezahlen. Nehmen wir jetzt aber einmal an, für die Außenwirtschaftsveranstaltung würden keine Studiengebühren erhoben. In diesem Fall ergibt sich das, was Sie für das Belegen der Wirtschaftsgeschichtsveranstaltung aufgeben würden, aus Ihrem Verzicht auf die Außenwirtschaftsveranstaltung plus dem, was Sie sich sonst für die 750 Dollar gekauft hätten.
Wie immer man es betrachtet: Die realen Kosten der Veranstaltung, die Sie vorziehen, ergeben sich aus dem, was Sie dafür aufgeben müssen. Wenn Sie die Menge der Wahlmöglichkeiten erweitern – ob Sie ein Wahlfach belegen oder nicht, ob sie dieses Semester abschließen oder nicht, ob Sie ihr Studium aufgeben oder nicht –, werden Sie feststellen, dass letztlich alle Kosten Opportunitätskosten sind.
Manchmal ist der Geldbetrag, den man für irgendetwas bezahlen muss, ein guter Indikator für die Opportunitätskosten dieser Sache. Häufig ist das aber auch nicht so. Ein für Sie vermutlich sehr wichtiges Beispiel, wie schlecht monetäre Kosten die Opportunitätskosten beschreiben, sind die Kosten Ihres Studiums. Die Wohnheimmiete und Studiengebühren gehören für die meisten Studierenden zu den größeren Geldausgaben, die sie haben. Aber selbst dann, wenn Sie im Wohnheim umsonst wohnen könnten und keine Studiengebühren bezahlen müssten, ist das Studium für Sie eine teure Angelegenheit. Warum? Die meisten Studierenden würden, wären sie nicht an der Universität, einer Erwerbsarbeit nachgehen. Mit dem Besuch der Hochschule verzichten Studierende folglich auf das Einkommen, das sie mit der Erwerbsarbeit erzielt hätten. Die Opportunitätskosten eines Studiums ergeben sich also aus Wohnheimmiete und Studiengebühren zuzüglich[31] des entgangenen Einkommens aus der Erwerbsarbeit, der man aufgrund des Studiums nicht nachgehen kann.
Es ist leicht einzusehen, dass die Opportunitätskosten eines Hochschulstudiums für Menschen besonders hoch sind, die in ihrer Studienzeit ein sehr hohes Erwerbseinkommen hätten erzielen können. Das erklärt, warum prominente Sportler, Medienstars, aber auch Studierende, die bereits während ihres Studiums ein Unternehmen aufbauen, häufig die Hochschule verlassen, bevor sie einen Abschluss gemacht haben.
Prinzip 3: „Wie viel“ ist eine Entscheidung, die sich durch eine Grenzbetrachtung ergibt
Einige wichtige Entscheidungen implizieren eine „Entweder-oder“-Wahl. Dies gilt etwa für die Entscheidung, ob man nach dem Abitur ein Hochschulstudium aufnehmen möchte oder sich gleich eine Arbeit sucht. Analoges gilt, wenn man sich entscheidet, entweder Wirtschaftswissenschaften oder irgendein anderes Fach zu studieren. Andere wichtige Entscheidungen implizieren dagegen eine „Wie viel“-Wahl. Nehmen wir einmal an, Sie haben in diesem Semester sowohl eine Vorlesung zur Unternehmensbesteuerung als auch eine Vorlesung zur Empirischen Wirtschaftsforschung belegt. Die Prüfungen stehen bevor und Sie müssen sich entscheiden, wie viel Zeit Sie für die Klausurvorbereitung in beiden Fächern verwenden wollen. Geht es um das Verstehen von „Wie viel“-Entscheidungen, können die Wirtschaftswissenschaften eine wichtige Einsicht liefern: „Wie viel“ ist eine Entscheidung, die aus einer Grenzbetrachtung[32] resultiert.
Nehmen wir an, Sie haben sowohl Unternehmensbesteuerung als auch Empirische Wirtschaftsforschung belegt. Nehmen wir weiter an, dass Sie später Steuerberater werden möchten. In diesem Fall zählt die Note, die Sie im Fach Steuern erzielen, mehr als die Note in Empirischer Wirtschaftsforschung. Folgt daraus, dass Sie Ihre gesamte Vorbereitungszeit für Steuern verwenden und völlig unvorbereitet in die Wirtschaftsforschungsklausur gehen sollten? Vermutlich nicht. Auch wenn Ihnen die Note der Steuerklausur viel wichtiger erscheint, wäre es wohl sinnvoll, das Fach Empirische Wirtschaftsforschung nicht völlig zu vernachlässigen.
Mit dem englischen Begriff Trade-off bezeichnet man eine Austauschbeziehung, also zum Beispiel die Abwägung der Kosten und Nutzen einer Entscheidung.
Ein größerer Zeitaufwand für Empirische Wirtschaftsforschung impliziert einen Nutzen (eine bessere erwartete Note in diesem Fach), sie impliziert aber auch Kosten. (Sie hätten die Zeit für irgendetwas anderes verwenden können – etwa für die Vorbereitung der Steuerklausur, um dort eine bessere Note zu erzielen.) Folglich ist Ihre Entscheidung mit einer Abwägung verbunden, einem Trade-off[33] (Zielkonflikt), dem Vergleich von Kosten und Nutzen.
Wie entscheidet man diese Art von „Wie viel“-Fragen? Die nächstliegende Antwort ist die, dass man diese Entscheidungen im Zeitverlauf Schritt für Schritt trifft, indem man sich die Frage stellt, wie man die nächste Stunde nutzen sollte. Nehmen wir an, dass beide Prüfungen am selben Tag sind und dass Sie den Vorabend damit verbringen, noch einmal Ihre Vorlesungsunterlagen für beide Veranstaltungen durchzugehen. Um 18.00 Uhr entscheiden Sie, dass es vernünftig ist, für jede der beiden Veranstaltungen wenigstens eine Stunde Vorbereitungszeit zu verwenden. Um 20.00 Uhr entscheiden Sie, dass Sie für beide Kurse jeweils eine weitere Stunde zum Lernen brauchen. Um 22.00 Uhr werden Sie allmählich müde und sagen sich, dass es vernünftig ist, nur noch eine Stunde zu lernen, damit Sie am nächsten Tag ausgeschlafen sind. Für welche Vorlesung wollen Sie diese Stunde verwenden – Steuern oder Empirische Wirtschaftsforschung? Wenn Sie später Steuerberater werden wollen, wird es vermutlich Steuern sein, wenn Sie später bei einem Wirtschaftsforschungsinstitut arbeiten wollen, wird es wahrscheinlich Empirische Wirtschaftsforschung sein.[34]
Beachten Sie, wie Sie Ihre Entscheidung bezüglich der Aufteilung Ihrer Zeit getroffen haben: Zu jedem Zeitpunkt ist die Frage, ob Sie für das jeweilige Fach eine zusätzliche Stunde verwenden sollten oder nicht. Bei der Entscheidung, ob Sie eine zusätzliche Stunde für Steuern verwenden sollen, wägen Sie die damit verbundenen Kosten (eine Stunde weniger Zeit für die Vorbereitung der Wirtschaftsforschungsklausur oder eine Stunde weniger Schlaf) gegen den Nutzen ab (eine wahrscheinlich bessere Note in der Steuerklausur). Solange der Vorteil einer zusätzlichen Stunde für die Vorbereitung der Steuerklausur die Kosten überwiegt, sollten Sie sich für diese zusätzliche Stunde entscheiden.
Entscheidungen darüber, ob man eine bestimmte Aktivität noch ein bisschen ausdehnt oder sie etwas einschränkt, bezeichnet man als Marginalentscheidungen. Die Untersuchung solcher Entscheidungssituationen bezeichnet man als Marginalanalyse.
Entscheidungen dieser Art – wie verwende ich meine nächste Stunde, wie verwende ich meinen nächsten Euro usw. – sind Marginalentscheidungen. Dies bringt uns zu unserem dritten Prinzip individueller Entscheidungen:
„Wie viel“-Entscheidungen müssen durch eine Abwägung (Trade-off) an der Grenze getroffen werden – durch den Vergleich von Kosten und Nutzen von ein klein bisschen mehr oder ein klein bisschen weniger.
Sie implizieren ein Abwägen am Rande: den Vergleich von Kosten und Nutzen, die sich aus der geringfügigen Ausdehnung einer bestimmten Aktivität ergeben. Die Analyse solcher Arten von Entscheidungen bezeichnet man als Marginalanalyse[35].
Viele Fragen, denen wir uns in den Wirtschaftswissenschaften gegenübersehen, aber auch viele Fragen, auf die wir im realen Leben stoßen, haben mit Marginalanalyse zu tun: Wie viele Arbeiter sollte ich in meinem Betrieb einstellen? Bei welchem Kilometerstand sollte ich bei meinem Auto einen Ölwechsel machen? Wie groß ist die akzeptable Rate von Nebenwirkungen bei einem neuen Medikament? Die Marginalanalyse spielt in den Wirtschaftswissenschaften deswegen eine zentrale Rolle, weil sie der Schlüssel bei der Entscheidung ist, „wie viel“ man von einer bestimmten Aktivität tun sollte.
Prinzip 4: Üblicherweise nutzen Menschen Möglichkeiten, um sich zu verbessern
Eines Tages hörten die Autoren dieses Buches morgens im Radio einen heißen Tipp, wie man billig in Manhattan parken kann. Die Parkhäuser in der Gegend um Wall Street verlangen bis zu 30 Dollar pro Tag. Dem Nachrichtensprecher zufolge hatten einige Leute aber eine günstigere Möglichkeit gefunden: Anstatt ihr Auto im Parkhaus abzustellen, ließen sie sich bei der Firma Jiffy Lube, einem Autoservice, einen Ölwechsel machen, der nur 19,95 Dollar kostete. Das Auto konnte den ganzen Tag in der Werkstatt bleiben.
Das ist eine tolle Geschichte, die sich aber leider als falsch herausstellte – tatsächlich gibt es überhaupt keine Filiale von Jiffy Lube in Manhattan. Würde es aber eine geben, wäre die Geschichte wahr, dann würde diese Filiale jede Menge Ölwechsel durchführen. Warum? Wenn Menschen Gelegenheiten geboten werden, sich besser zu stellen, dann werden sie diese Gelegenheit normalerweise auch nutzen. Wenn sie die Gelegenheit hätten, ihr Auto den ganzen Tag für 19,95 Dollar zu parken statt für 30 Dollar, dann würden sie das tun.[36]
Als Anreiz bezeichnet man einen Vorteil, den Menschen realisieren können, wenn sie ihr Verhalten ändern.
In diesem Beispiel würden Ökonomen davon sprechen, dass Menschen auf Anreize reagieren – einer Möglichkeit, sich besser zu stellen. Wir können nun das vierte Prinzip individueller Entscheidungen formulieren:
Normalerweise reagieren Menschen auf Anreize, um die Möglichkeiten zu nutzen, die sie haben, um sich besser zu stellen.
Versucht man zu prognostizieren, wie Individuen sich in bestimmten wirtschaftlichen Situationen verhalten, kann man getrost darauf wetten, dass sie Möglichkeiten nutzen werden, bei denen sie sich besser stellen. Darüber hinaus werden die Akteure ihr Verhalten immer weiter fortsetzen, bis die Möglichkeiten vollständig ausgeschöpft sind.
Wenn es also in Manhattan tatsächlich eine Jiffy-Lube-Werkstatt gäbe und der Ölwechsel dort tatsächlich eine billige Möglichkeit wäre, das Auto zu parken, können wir mit großer Sicherheit vorhersagen, dass es für Ölwechsel innerhalb kürzester Zeit eine lange Warteliste geben würde.
Wir können noch einen Schritt weitergehen: Das Prinzip, dass Menschen Gelegenheiten nutzen, um sich zu verbessern, ist die Basis für jede[37] ökonomische Vorhersage des individuellen Verhaltens. Wenn die Einkommen von Betriebswirten in die Höhe schießen, während die Einkommen von Juristen sinken, dann werden mehr Studierende Betriebswirtschaftslehre belegen und weniger sich für Jura einschreiben. Steigen die Treibstoffpreise und verharren für längere Zeit auf hohem Niveau, dann werden die Menschen kleinere Autos mit geringerem Benzinverbrauch kaufen, um so ihre eigene Situation vor dem Hintergrund der hohen Benzinpreise zu verbessern.
Ein letzter in diesem Zusammenhang wichtiger Punkt: Ökonomen stehen jedem Versuch skeptisch gegenüber, das Verhalten von Menschen zu ändern, ohne ihre Anreize zu ändern. So wäre beispielsweise der Versuch, Unternehmen freiwillig zur Reduktion von Umweltbelastungen zu veranlassen, wenig effektiv. Würde man den Unternehmen dagegen finanzielle Anreize zur Reduktionsverringerung geben, wäre der Erfolg wahrscheinlicher.
Individuelle Entscheidung: Zusammenfassung
Wie wir in den vorangegangenen Abschnitten gesehen haben, gibt es vier grundlegende Prinzipien für die individuelle Entscheidung:
Ressourcen sind knapp. Es ist immer notwendig, zwischen verschiedenen Möglichkeiten Entscheidungen zu treffen.
Die realen Kosten einer Sache bestehen aus dem, was man für sie aufgeben muss. Alle Kosten sind Opportunitätskosten.
„Wie viel“ ist eine Entscheidung, die durch eine Grenzbetrachtung getroffen wird. Normalerweise lautet die Frage nicht „ob“, sondern „wie viel“. Dabei handelt es sich um eine Frage, deren Antwort von den Kosten und Nutzen einer geringfügigen Ausdehnung der infrage stehenden Aktivität abhängt.[38]
Menschen nutzen normalerweise Möglichkeiten, um sich besser zu stellen. Daraus folgt, dass Menschen auf Anreize reagieren.
Haben wir damit alle Grundlagen für unsere wirtschaftswissenschaftlichen Überlegungen zusammen? Noch nicht ganz, weil die wirklich interessanten Dinge in der Wirtschaft nicht das Ergebnis rein individueller Entscheidungen sind, sondern sich vielmehr erst aus dem Zusammenwirken der individuellen Entscheidungen ergeben.
Vertiefung
Gehalt für gute Noten?
Die wahre Belohnung für das Lernen ist, natürlich, das Gelernte selbst. Viele Schüler tun sich jedoch schwer damit, genügend Motivation zu finden, um fleißig zu lernen und zu arbeiten. Dabei ist es für Lehrer und politische Entscheidungsträger eine besondere Herausforderung, benachteiligten Schülern zu helfen, die seltener in der Schule erscheinen, öfter die Schule abbrechen und häufiger niedrige Punktzahlen in standardisierten Tests erreichen.
Zwei Studien, verfasst von Harvard-Ökonom Roland Freyer Jr. (2011) bzw. vom Ökonomen Steven Levitt (University of Chicago) und Koautoren (2012), zeigen, dass monetäre Anreize in Form von Geldprämien die Leistungen von Schülern an Schulen in ökonomisch benachteiligten Gegenden verbessern können. Wie genau die Geldanreize funktionieren, ist gleichzeitig überraschend und vorhersehbar.
Die Studie von Freyer wurde in vier verschiedenen Schulbezirken mit jeweils unterschiedlichen Anreizsystemen und Messgrößen durchgeführt. In New York wurden die Schüler anhand ihres Abschneidens bei standardisierten Tests ausbezahlt; in Chicago erfolgte die Bezahlung entsprechend ihrer Schulnoten; in Washington (D.C.) erhielten die Schüler Geld für Anwesenheit, gutes Verhalten und Schulnoten; und in Dallas wurden Zweitklässler immer dann entlohnt, wenn sie ein Buch lasen.[39]
Freyer wertete die Ergebnisse aus, indem er die Leistungen von Schülern, die an dem Anreizprogramm teilnahmen, mit denen verglich, die zwar die gleiche Schule besuchten, aber nicht an dem Programm teilnahmen.
In New York hatte das Programm keinen erkennbaren Effekt auf die Testergebnisse. In Chicago erlangten die an dem Programm teilnehmenden Schüler bessere Noten und waren öfter im Unterricht anwesend. In Washington verbesserte das Programm die Testergebnisse von denjenigen Schülern, die normalerweise am schwersten erreichbar sind, nämlich denen, die schwerwiegende Verhaltensprobleme zeigen. Die Testergebnisse verbesserten sich genauso, als ob die Schüler weitere fünf Monate zur Schule gegangen wären.
Der stärkste Effekt konnte in Dallas beobachtet werden: Die Schüler konnten ihre Testergebnisse im Leseverstehen erheblich steigern, was auch noch im Folgeschuljahr bemerkbar war, als die Geldprämien bereits nicht mehr ausgezahlt wurden.
Was also erklärt diese unterschiedlichen Ergebnisse?
Freyer fand heraus, dass Schüler – um sie durch Geldprämien motivieren zu können – davon überzeugt sein müssen, einen signifikanten Einfluss auf die Messgröße für Leistungen ausüben zu können. Demzufolge hatte das Programm in Chicago, Washington und Dallas eine signifikante Wirkung, da die Schüler einen großen Einfluss auf Noten, Anwesenheit, Verhalten oder die Anzahl der gelesenen Bücher ausüben konnten.[40]
Da die Schüler in New York jedoch wenig Vorstellung davon hatten, wie sie ihre Ergebnisse bei einer standardisierten Prüfung beeinflussen konnten, hatte die Aussicht auf eine Belohnung einen geringen Einfluss auf ihr Verhalten. Auch der Zeitpunkt der Belohnung spielt eine Rolle: Eine Belohnung von einem Dollar hat einen stärkeren Einfluss auf das Verhalten der Schüler, wenn die Leistungen in kürzeren Intervallen überprüft werden und die Belohnung mit nur geringer zeitlicher Verzögerung ausgezahlt wird.
Diese Ergebnisse wurden von der Levitt-Studie bestätigt, die mit 7.000 Schülern im Raum Chicago durchgeführt wurde: Monetäre Anreize verbesserten die Ergebnisse in standardisierten Tests genauso, als wenn die Schüler fünf oder sechs Monate für den Test gelernt hätten. Die Untersuchung von Levitt zeigte auch, dass größere monetäre Anreize (20 Dollar) zu deutlich besseren Testergebnissen führten als kleinere monetäre Anreize (10 Dollar). Wie Freyer fanden auch Levitt und Koautoren heraus, dass eine zeitliche Verschiebung der Auszahlung auf einen Monat nach dem Test keine Auswirkung auf die Testergebnisse hatte.
Diese beiden Experimente geben wesentliche Einblicke, wie Verhalten durch Anreize motiviert werden kann. Es ist wichtig, wie die Anreize gestaltet sind: Sowohl der Zusammenhang zwischen Aufwand und Ergebnis als auch die Schnelligkeit der Auszahlung spielen eine entscheidende Rolle. Die Ausgestaltung der Anreize könnte darüber hinaus stark von den Eigenschaften derjenigen Personen abhängen, die motiviert werden sollen: Maßnahmen, die einen Schüler aus wirtschaftlich privilegierten Verhältnissen motivieren, müssen nicht zwangsläufig den gleichen Effekt auf einen Schüler aus wirtschaftlich benachteiligen Verhältnissen haben.[41]