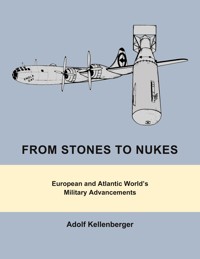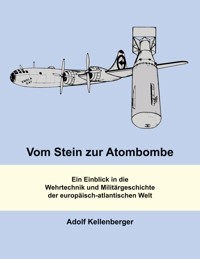
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Der hier angebotene Einblick in die Waffen- und Kriegsgeschichte Europas und der atlantischen Welt soll für Interessierte Versuch und Ansporn sein, sich der Basis zu erinnern, auf die sich die allgemeine Waffentechnik und das Wehrwesen der Gegenwart bis kurz vor der Jahrtausendwende abstützten. Die Probleme unserer Zeit sind global geworden, niemand kann sich ihnen mehr entziehen. Die Rückbesinnung auf ursprüngliche Gemeinsamkeiten und das Wissen um den eigenen Weg werden immer wichtiger. In unserer Zeit mit ihren politischen, sozialen, wirtschaftlichen und technischen Umwälzungen vollzieht sich der Wandel mit zunehmender Geschwindigkeit - im Frieden wie im Kriege.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 376
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Prolog
Einleitung
Ursprung
Vom Stein zum Eisen: Die Anfänge der Bewaffnung
Die Griechen (800–30 v. Chr.)
Die römische Militärmacht (753 v. Chr.–476 n. Chr.)
Völkerwanderung, Mittelalter (410–1500)
Renaissance und Reformation (1350–1600), erstes Aufkommen der Feuerwaffen
Absolutismus und Aufklärung (1600–1762)
Revolutionen, die die Welt veränderten (1763–1870)
Die Entstehung der modernen Welt (seit 1870)
Das zwanzigste Jahrhundert von Tsushima bis Hiroshima und Nagasaki
Der Weg in die Gegenwart
Epilog
Chronologie europäisch-atlantischer Schlachten und Kriege
Glossar der Seemannssprache
Literaturnachweis
Prolog
Die Natur hat dem Menschen den Reißzahn des Affen, die Pranken des Löwen und die Schnelligkeit des Pferdes versagt. Dafür gab sie uns die Zweischneidigkeit der Intelligenz. Werkzeuge und Waffen, die sich im Laufe der Jahrtausende vom Steinsplitter zum bearbeiteten Feuerstein entwickelten, sind erste Zeugen einer aggressiven Evolution, die bis heute nicht abgeschlossen ist.
Vom steinbewehrten Speer oder Pfeil zu den tief in ihren Silos drohenden Atomwaffen der Gegenwart war nochmals ein langer Weg.
Die Waffe, ursprünglich der Jagd und der Selbstverteidigung dienend, hat heute eine Eigendynamik entwickelt, die sich gegen die ursprüngliche Aufgabe richtet.
Einleitung
Die Probleme unserer Zeit sind global geworden. Niemand kann sich ihnen mehr entziehen. Die Rückbesinnung auf ursprüngliche Gemeinsamkeiten und das Wissen um den eigenen Weg werden immer wichtiger. In unserer Zeit mit ihren politischen, sozialen, wirtschaftlichen und technischen Umwälzungen vollzieht sich der Wandel (im Frieden wie im Kriege) mit zunehmender Geschwindigkeit. Der Druck nach immer mehr Leistung in immer kürzer werdenden Zeitintervallen lässt sich in allen Bereichen feststellen. Parallel zu diesem Leistungsdruck sind Trends zu immer komplexeren Organisationen, Produkten und Systemen feststellbar. Diese Vorgänge, die auch die Innovationszeit laufend verkürzen, führten zu einer hochgradigen Arbeitsteilung, die ihren sprachlichen Ausdruck im Begriff „Spezialist“ fand. Diese Entwicklung können wir nicht aufhalten, aber das Bewusstsein für das Wesentliche, das Ganze, sollte erhalten bleiben. Die Kriegs- und Militärgeschichte, ja das gesamte Wehrwesen an sich, ist wiederum nur ein kleiner Teil in unserem menschlichen Dasein. Nicht zu klein, im Guten wie im Bösen, ist der Anteil der europäisch-atlantischen Waffen- und Kriegsgeschichte.
Der vorliegende Einblick in die Waffen- und Kriegsgeschichte Europas und der atlantischen Welt soll für an diesem Gebiet Interessierte Versuch und Ansporn sein, sich der Basis zu erinnern, auf die sich die allgemeine Waffentechnik und das Wehrwesen der Gegenwart bis kurz vor der Jahrtausendwende abstützten. Aus verständlichen Gründen konnte im Rahmen dieser Arbeit nur auf die großen, und für die Thematik wesentlichen Ereignisse eingegangen werden.
Ursprung
Seit über fünf Millionen Jahren leben Menschen auf der Erde, ein kurzer Augenblick, verglichen mit dem Alter unseres Planeten von ca. 4,6 Milliarden Jahren. Die frühesten Spuren menschenähnlicher Wesen wurden in Afrika gefunden. Um diese Zeit hatten die Ozeane und Kontinente mehr oder weniger ihre heutige Form angenommen.
Das 170 Millionen Jahre dauernde Zeitalter der Dinosaurier war längst vorüber; die Säugetiere hatten ihr Erbe angetreten. Die Vorfahren des Löwen, Elefanten und Nashorns waren um diese Zeit schon vorhanden, wie auch die kleinen Ahnen von Pferd, Wolf, Rind Schwein und Hirsch. Eine spezielle, affenähnliche Spezies ging um diese Zeit bereits aufrecht, bewohnte offene Flächen am Rande von Wäldern und lebte von Pflanzen, Früchten und kleinen Tieren. Aber im Gegensatz zu den übrigen Tieren zerlegten und zerkleinerten diese Wesen ihre Nahrung nicht mehr mit ihren natürlichen Werkzeugen, den Zähnen und Klauen, sondern mit den Kanten bearbeiteter Steine. Auf eine für uns immer noch nicht erfassbare Art hatten diese Wesen begonnen, sich aus dem millionenalten, komplizierten Kampf zwischen Fressen und Gefressen werden herauszulösen und die Grenze ihrer körperlichen Leistungsfähigkeit durch geistige Leistungen immer weiter hinauszuschieben.
Vor 15 000 bis 10 000 Jahren hatten die Nachkommen dieser Geschöpfe die Kontinente der Erde fast ganz besiedelt. Der erste Mensch (Homo erectus), der das Feuer beherrschen lernte und sich über Afrika hinaus verbreitete, lebte vor über 500 000 Jahren. In einer Zeitspanne von mehr als 200 000 Jahren drang er über die Ostküsten des Mittelmeeres nach Europa und Asien vor bis hin nach Java und Peking. Ihm folgte der Neandertaler vor ca. 70 000 Jahren. Überreste dieses Menschentyps finden sich von Südfrankreich bis Nordchina. Etwa von 50 000 bis 12 000 Jahren lebte der „Cro-Magnon“-Mensch in Europa, Nordafrika und den Kanaren. Mit ihm begann die Aufspaltung in die Großrassen der Gegenwart. Die verschiedenen Klimazonen, in denen der Mensch sich heimisch machte, sind einer der Gründe für die Herausbildung der drei wichtigsten Menschenrassen, die mit vielen Unterrassen heute noch bestehen. Die Ausbreitung des Menschen über die Erde wurde vor ca. 30 000 Jahren abgeschlossen als über die damalige Landbrücke, an der Stelle, wo heute die Beringstraße Asien von Amerika trennt, Nord- und Südamerika besiedelt wurden. Um diese Zeit drang der Mensch auch nach Australien vor, als dieser Kontinent von Asien aus leicht zu erreichen war. Die Ureinwohner Australiens stammen vermutlich von einer frühen Form der Europiden ab, die sich in Asien isoliert entwickelten, wie übrigens auch die Ainu Nord-japans und die Wedda Südindiens.
Zu den am meisten verbreiteten Rassegruppen gehören Negride, Mongolide und Europide. Zur letzteren Gruppe zählen außer den Europäern die Hamiten Nordafrikas, die Semiten und die vorderasiatischen Völker bis Indien. Der Europäer war Jahrtausende lang auf das Mittelmeer fixiert. Er war eine Rasse unter Rassen. Das Weltbild des Europäers war noch bis vor 500 Jahren sehr klein. Nord- und Südamerika, Australien, Ozeanien, Afrika südlich der Sahara und die riesige Landmasse Nordasiens waren völlig oder nahezu unbekannt.
Bis zu dieser Zeit war der Europäer den anderen Rassen wenig voraus. Das änderte sich erst mit dem gezielten Einsatz der Wehrtechnik auf dem Gebiet der Feuerwaffen, der Entwicklung des hochseegängigen Rahseglers im Zuge der allgemeinen Förderung des Seewesens, der Erfindung des Buchdruckes und dem Aufschwung und der Ausbreitung der europäischen Weltwirtschaft. Gerade letzterer Aspekt wird oft verkannt, denn obwohl die wirtschaftliche Macht Europas im Spätmittelalter unbedeutend war, konnte sie sich dennoch durchsetzen und wurde zum Zentrum eines weltumspannenden Wirtschaftssystems, das bis zum Ende des ersten Kolonialzeitalters bis zu den amerikanischen Unabhängigkeitskriegen klare Konturen gewann. Es scheint, dass dieser Aufschwung gerade wegen der politischen Zersplitterung Europas begünstigt wurde. Denn das Europa des späten Mittelalters, am Vorabend der Expansion nach Übersee, war die erste Weltwirtschaft, die nicht zugleich wie China oder das vergangene Imperium Roms auch ein Weltreich war, sondern ein in zum Teil sehr kleine politische Einheiten von Stadt- und Territorialstaaten zersplittertes Konglomerat. Aus diesem Grunde gerieten die Kaufleute Europas nicht unter die Kontrolle einer allmächtigen und nicht vorrangig an eine an wirtschaftlichen Überlegungen interessierte und ausgerichtete Bürokratie, sondern sie konnten in ihren Entscheidungen mehrheitlich kaufmännischen und nicht politischen Erwägungen folgen. Die Wirtschaft in Europa blieb nie statisch, wie etwa in China auf die Hauptstadt ausgerichtet, sondern es kam immer wieder zu Verschiebungen und Brüchen, in deren Gefolge die eine Region auf-, die andere abstieg. Heute dominiert der Europäer auch in Amerika, Australien und vielen anderen Plätzen der Erde. Dies ging in den wenigsten Fällen friedlich vor sich. Handelsinteressen, Aggressionstrieb, Bevölkerungsdruck und zum Teil reine Abenteuerlust erschlossen auf Kosten der ursprünglichen Einwohner neue Räume für den Europäer. Weniger kriegerische Gewalt (wie zumeist angenommen) als mitgebrachte Krankheiten führten vielfach zur Ausrottung der ansässigen Bevölkerung, vor allem auf dem südamerikanischen Kontinent. Die industrielle Revolution im 19. Jahrhundert hat die europäisch-atlantische Welt zur absoluten Dominanz auf diesem Planeten gebracht. Die großen Kolonialreiche dieses Zeitalters sind inzwischen verschwunden. Was blieb, ist ihr materielles Vermächtnis im Bereich der industrialisierten westlichen Kultur.
Vom Stein zum Eisen: Die Anfänge der Bewaffnung
Im natürlichen Bestreben, sich seine Feinde auf Distanz zu halten, waren die ersten Waffen des Menschen vermutlich hölzerne Knüppel und Stangen sowie geworfene Steine.
Die allmähliche Beherrschung verschiedenartiger Bearbeitungsmethoden für den Stein führte zu einem großen Anwendungsbereich dieses überall vorkommenden Materials. Der Mensch lernte, zusammengesetzte Geräte herzustellen wie zum Beispiel Beile oder Spieße mit steinernen Klingen und Spitzen. Man darf sich um diese Zeit die Jagd aber nicht nur um einen mit Waffen ausgetragenen „technischen“ Vorgang denken. Am Anfang der Menschheitsgeschichte verschaffte zum Beispiel die Kunst des Fährtenlesens den Jägern einen wesentlichen Vorteil gegenüber den Tieren, das Aufspüren und Stellen war ebenso wichtig wie das Erlegen des Wildes. In dieser ursprünglichen Form wird diese archaische Kunst heute kaum mehr gepflegt. Zu ihren Meistern zählen in der Gegenwart noch die Buschmänner der Kalahari, die Aborigines Australiens und die Inuit der Arktis. Die Jäger dieser Völker wissen nicht nur die Zeichen in der Erde zu deuten, sondern können sich noch immer in das Wesen des verfolgten Wildes versetzen.
Eine wichtige Erfindung, die die Jagd vereinfachte, war der Pfeilbogen. Diese wirksame und zielsichere Fernwaffe ermöglichte die Erlegung von Tierarten, die sich dem Menschen bis anhin durch Flucht leicht entziehen konnten. Bereits um diese Zeit (vor 15 000–10 000 Jahren) stand der Mensch schon nicht mehr im Einklang mit der Natur. Mangels geeigneter Fernwaffen griffen die steinzeitlichen Jäger oft ganze Herden an, versetzten sie in panische Angst und trieben sie so über Steilhänge in den Tod. Bei Solutré in Frankreich sind Überreste von über 100 000 Wildpferden am Fuße einer Steilwand entdeckt worden. Die Knochenschicht umfasst ein Gebiet von 3800 m2und ist bis zu zwei Meter stark!
Urzeittechnik
Die Menschen der Urzeit formten sich ihre Waffen durch Schleifen, Schaben oder Behauen (Abschlagen) des Feuersteinkerns mit einem harten Stein. Angeschrägte Feuerstein-Pfeilspitzen wurden z. B. in einem Schlitz am vorderen Ende eines Pfeilschaftes eingesetzt, mit Harz geklebt und mit Tierdärmen oder Sehnen fixiert.
Das Vorhandensein weittragender Bogen sowie die Abrichtung des Hundes zur Jagd haben sicher ihren Teil zu einer Änderung der Wirtschaftsweise beigetragen. Der Mensch brauchte nicht mehr soviel Zeit für die Jagd aufzubringen. Er konnte sich nun mehr anderen Aufgaben zuwenden. Die Zähmung und Zucht weiterer Tiere, darunter auch des Pferdes, taten ein Übriges in dieser Richtung. Viehzucht folgte der Jagd und Landwirtschaft der Viehzucht. Kupfer und Bronze traten neben den Stein und verdrängten ihn mit der Zeit. Der nomadisierende Stamm wurde zur Dorfgemeinschaft und aus dieser die Stadt und daraus wiederum der Stadtstaat. Im Zuge dieser Entwicklung passte sich auch die Waffenentwicklung den neuen Gegebenheiten an: Die Waffe begann sich aufzuspalten in Jagd- und Kriegswaffe. Denn mit der Zeit führten Bevölkerungswachstum, Wohlstand und damit auch Wohlstandsgefälle zu sozialen Ungerechtigkeiten. Es brachen organisierte Kämpfe um Besitz, Grenzen und Handelswege aus. Die ersten Heere stellten die Sumerer auf, die vor mehr als 5000 Jahren zwischen Euphrat und Tigris lebten. Das sumerische Fußvolk, ausgerüstet mit Speer und Bogen, Lederhelm und einfachem Brustpanzer, focht bereits in dicht geschlossener Formation unter dem Schutz von ledergepanzerten Schilden. Eine wichtige Truppe waren auch Streitwagenformationen, bestehend aus klobigen vierrädrigen Esel-Karren, die von einem Lenker und einem mit Speeren bewaffneten Krieger besetzt wurden.
Die Kämpfer, bei denen es sich in der Anfangszeit wohl nur um Bürger-wehren handelte, begannen sich passiv zu schützen mit widerstandsfähiger Kleidung, wie zum Beispiel Brustpanzer, Kopfschutz und Schild. Verbesserungen im Bronzegussverfahren führten zur Entwicklung einer eigentlichen Kriegswaffe, dem langen Stichschwert. Mit dieser Waffe, die zu einer neuen Kampfweise führte, dem Fechten, begann sich der Schritt vom Jäger zum Krieger abzuzeichnen. Der Mensch der Bronzezeit trieb die Entwicklung in der Waffentechnik soweit, dass sie später lange Zeit in ihren Grundzügen nur noch in Details weiterverbessert werden konnte.
Bewaffnung der Spätbronzezeit
Links: Mitteleuropäische Bewaffnung der Spätbronzezeit (etwa 12. Jahrhundert v. Chr.)
Rechts: Griechische Bewaffnung der Spätbronzezeit (etwa 15. Jahrhundert v. Chr.)
Einer allgemeinen Durchsetzung des Schwertes und der damit verbundenen Fechtkunst, wie auch der weiteren metallischen Ausrüstung stand jedoch entgegen, dass Bronze wohl von großer Festigkeit und Haltbarkeit ist, seine Legierungsbestandteile jedoch immer Mangelware blieben.
Kupfer ist das älteste metallische Gebrauchsmaterial. Man nimmt an, dass es bereits vor rund 7000 Jahren verwendet wurde. Neben den Edelmetallen kommt nur das Kupfer (und zwar in recht seltenen Fällen) in metallischer Form vor. Im Allgemeinen sind die Metalle an Schwefel, Sauerstoff oder Kohlenstoff gebunden. In speziellen Verhüttungsprozessen, die sich mit der Zeit entwickelten, wurde das Metall von den anderen Elementen getrennt. Kupfer kann aber auch legiert werden. Durch Zusatz von bis zu 10 % Zinn entstehen die Zinn-Bronzen mit ihren braungelben Farbtönungen, die vor allem im Altertum weitverbreitet waren dank ihrer guten Eignung für den Formguss, ihrer hohen Korrosionsfestigkeit und ihren günstigen Festigkeitseigenschaften. Im Eisen aber hat der Mensch den vielseitigsten metallischen Werkstoff gefunden. Die eisernen Waffen wurden zudem rasch erschwinglicher als Bronzewaffen. In der Festigkeit waren sie der Kupfer-Zinnlegierung zudem stark überlegen. Probleme gab allerdings der Rostbefall, der jedoch mit verschiedenen Techniken gemeistert wurde: So zum Beispiel mit Verzinnen, Bemalen, Polieren usw. Anfänglich wurden nur kostbare Waffen und kleinformatige Schmuckstücke aus Eisen gefertigt. Erst um etwa 1000 v. Chr. wurde es im nachmykenischen Griechenland üblich, Schwerter, Lanzenspitzen, Äxte, Beile usw. sowie Wagenbeschläge und Pferdegeschirrteile aus dem neuen Material herzustellen. In Westeuropa findet sich das Eisen erstmals in Hallstatt (Österreich) um etwa 900 v. Chr. und in der La-Tène-Kultur (am Nordufer des Neuenburgersees) in der Schweiz um ca. 500 v. Chr.
Das Eisen wurde ursprünglich in Rennöfen oder im Rennfeuer aus Eisenerzen und Holzkohle gewonnen. Auf ein Holzkohlenfeuer wurde Erz und Kohle schichtweise solange aufgegeben, bis sich eine teigige, mit Schlacken durchsetzte Luppe bildete. Diese Luppe wurde anschließend ausgehämmert und zu Gegenständen verarbeitet. Erst viel später wurden Blasebälge eingesetzt, um mehr Zug in das Feuer zu bringen. Der Ofenschacht wurde immer höher gebaut. Der Stückofen war entstanden. Aber erst im Mittelalter konnte die Temperatur im Innern des Ofens dank wasserbetriebener Gebläse so weit gesteigert werden, dass das Eisen auch flüssig auslief. Dies ist die eigentliche Geburtsstunde des Hochofens. Das so erschmolzene Eisen war nicht mehr schmiedbar und konnte nicht mehr direkt verarbeitet werden. Es war spröde und roh und wurde deshalb Roheisen genannt. Um es in Stahl zu verwandeln, musste es gefrischt werden. Dies wurde durch die Einwirkung eines mit überschüssigem Wind betriebenen Holzkohlenfeuers möglich, dem sogenannten Frischfeuer. Bis weit ins 18. Jahrhundert hinein wurde so gearbeitet.
In der Frühgeschichte der Schweiz wurden die ersten Eisenbergwerke im Waadtland und im Rhonetal betrieben. Mit der Zeit wurde im ganzen Alpengebiet Eisen gewonnen. In der Schweiz vor allem im Berner Oberland, in Obwalden, Graubünden und am Gonzen. Auch im Jura wimmelte es eine Zeit lang von kleinen und kleinsten Hütten, in denen Erz zu Eisen verarbeitet wurde, bis im 15. Jahrhundert größere und leistungsfähigere Öfen gebaut wurden. Bassecourt, Matzendorf und Klus waren Orte mit bedeutender Eisenindustrie. Erst gegen Ende des 18. Jahrhunderts gelang der damaligen Eisenindustrie ein weiterer Fortschritt, als es möglich wurde, die Holzkohle durch Steinkohle und Koks zu ersetzen. Dies wurde erst möglich dank dem Hochofenbetreiber Abraham Darby, der 1713 in Coalbrookdale mit einem Meiler brauchbaren Koks erzeugen konnte durch Abschwefeln gut backender Kohle. Doch erst die Einführung eines besseren Frischverfahrens, des Puddelverfahrens, ebenfalls mit Kohle betrieben, gestattete zu Beginn des 19. Jahrhunderts, größere Luppen zusammenzuschweißen, so dass die Stücke nachher gewalzt werden konnten. Flüssiger Stahl wurde in Europa zum ersten Mal 1740 von Benjamin Huntsman in England und 1806 von Johann Conrad Fischer in Schaffhausen geschmolzen.
Zur modernen Entwicklung in der Stahlindustrie kam es aber erst nach den Erfindungen der Engländer Henry Bessemer und Sidney Gilchrist Thomas, denen es 1855 und 1879 gelang, flüssiges Roheisen mit Luft in Konvertern in kürzester Zeit zu frischen und in Stahl zu verwandeln. Mit der Einführung des Siemens-Martin Verfahrens durch Wilhelm und Friedrich Siemens (1856) sowie Pierre Martin (1864) in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts waren die notwendigen Voraussetzungen zur heutigen modernen Stahlgewinnung geschaffen. Im 20. Jahrhundert kam noch das Elektro-Stahlerzeugungsverfahren dazu, welches Ländern ohne Kohlevorkommen ebenfalls den Aufbau einer Stahlindustrie ermöglichte. Veränderungen in der Technik der Kriegsmittel hingen im Verlauf ihrer Geschichte unter anderem mit Neuerungen in der Eisen- und Stahlerzeugung zusammen.
Die Griechen (800–30 v. Chr.)
Den Griechen gelang es, ein inneres Gleichgewicht zwischen dem praktischen Verhalten des Nordländers und der oft überschäumenden Vitalität des Südländers zu entwickeln. Sie entwickelten eine Kraft, der wir die Grundlage unserer europäischen Kultur verdanken.
Neben geistigen und technischen Fortschritten gab es auch Entwicklungen im Kriegswesen. Bereits im 7. Jahrhundert v. Chr. formierten sich in Griechenland Elitekrieger zu einer Linie von meist acht Gliedern Tiefe. Im Angriff wurden sie unterstützt durch Bogenschützen und Schleuderer. Für den Kampf benötigte diese Formation, Phalanx genannt, ein ebenes und offenes Gelände, da die Schlachtreihen auf keinen Fall auseinanderreißen durften. Brach die geschlossene Reihe auseinander oder wurde sie in der Flanke gefasst, war die Schlacht verloren. Die Phalanx gab ihrem Führer nur wenige Möglichkeiten zur Lenkung und Beeinflussung vor und während der Schlacht. Ausnutzung des Geländes, Moral, Disziplin und zahlenmäßige Stärke im entscheidenden Augenblick waren die ausschlaggebenden Kriterien, die zum Sieg führten.
Trotz dieser offenkundigen Mängel siegten die Griechen in den Perser-kriegen (492–480 v. Chr.). Ihre Führung war zudem in der Lage, den Krieg auf verschiedenen Kriegsschauplätzen, zu Lande und zur See, durchzuführen. Unter dem Druck der Ereignisse schufen sie eine bedeutende und siegreiche Kriegsflotte, deren wichtigster Kriegsschiffstyp, die Triere, sich in Abarten über Jahrhunderte hinweg im Mittelmeer halten sollte. Zu Kämpfen, wie später zur Zeit der Römer, kam es aber nicht, denn die Ruderschiffe wurden vornehmlich dazu benutzt, das gegnerische Schiff zu rammen, ihm die Planken einzudrücken. Die Methoden des Landkrieges wurden in der Folge weiterentwickelt. Die schwerbewaffneten Krieger (Hopliten) bekamen in verstärktem und organisiertem Maße Hilfe von Unterstützungstruppen. Auch Kriegsmaschinen, die sich vor allem für Belagerungen eigneten, wurden eingesetzt. Aber am Ablauf einer Schlacht änderte sich im Grunde nichts. Das blieb so, bis im Jahre 371 v. Chr. der Thebaner Epaminondas in einer Schlacht seine Gegner mit einer neuen Taktik überraschte.
Die Schlacht bei Leuktra
Epaminondas verstärkte den linken Flügel seiner Phalanx auf Kosten des rechten derart, dass die Hopliten fünfzig Glieder tief standen und erst noch ein ansteigendes Gelände hinter sich hatten. Seinem rechten Flügel befahl er, nur langsam vorzugehen. Die Hopliten zur linken aber trieb er kraftvoll auf den Gegner zu. Unterstützt wurde dieses Vorgehen durch Reiterei, die der gegnerischen Phalanx in den Rücken fiel.
Links die Thebaner mit Epaminondas, rechts die Spartaner in der Schlacht bei Leuktra. Zur Ausrüstung des Hopliten gehörten ein leichter Rundschild, ein Helm, Brustpanzer und Beinschienen. Die Bewaffnung bestand aus einem Schwert und einer Stoßlanze.
Der Gedanke des Epaminondas ist als die erste Flügelschlacht und zugleich als Keimzelle aller Vernichtungsschlachten in die Kriegsgeschichte eingegangen. Es währe jedoch falsch zu glauben, der Erfolg sei lediglich auf eine theoretische Überlegung hin eingetroffen. Die Idee funktionierte, weil sie in der Praxis geübt wurde. Auch die Reiterei wurde aufgewertet. Sie half von nun an mit, Schlachten als operatives Element zu entscheiden. Hopliten, Leichtbewaffnete und Reiter verschmolzen zu einer organischen Einheit. Die Starre der Phalangenschlacht wurde so gemildert. Zur Zeit Alexanders des Großen stand die Phalanx meist sechzehn Glieder tief. Die ersten beiden Glieder führten den griechischen Hoplitenspieß. Die übrigen eine makedonische Waffe, die vier Meter lange Sarisse. Auf diese Weise konnten die weiter hinten stehenden Hopliten beim ersten Zusammenprall mit dem Gegner ihre Waffen entscheidend einsetzen. Im Belagerungstross wurden auch Torsionsschleudergeschütze mitgeführt. Im Gegensatz zum vorher benutzten Prinzip der Armbrust konnte beim Torsionsgeschütz die Spannkraft der Sehnenbündel erheblich gesteigert werden. Diese antike Artillerie verschoss Pfeile oder Steinkugeln. Der Aufbau dieser Geschütze war aber zu langwierig. Sie konnten daher in einer offenen Feldschlacht nicht mit Erfolg eingesetzt werden. Die Verbesserungen, die das griechische Heerwesen nach dem Tode Alexanders in der nachfolgenden Diadochenzeit im Einzelnen noch erfuhr, waren im Grunde nicht mehr wesentlich. Erwähnenswert ist noch, dass die „Panzerwagen“ der Antike, die Elefanten, von den Persern erstmals eingesetzt, nun auch bei griechischen Heeren zu finden waren.
Unter den Diadochenstaaten herrschte ein Gleichgewicht der Kräfte. Kriegsgelüste einzelner Fürsten und Staaten wurden gebremst durch sofortige Allianzbildung der übrigen hellenistischen Königreiche. Der kultivierte Osten war daher für Eroberungs- und Kriegsabenteuer versperrt, dagegen war im „barbarischen“ Westen noch alles offen. Pyrrhus, König von Epiros, war ein solcher Abenteurer. Ehrgeizig wie Alexander, verfügte er über einen perfekten militärischen Apparat, dem nur eines fehlte, die Möglichkeit loszuschlagen. Als er von Tarras, dem heutigen Tarent in Süditalien, um Hilfe angegangen wurde, weil sich das griechische Kulturzentrum in Italien von barbarischen Stämmen bedroht fühlte, sah er seine Stunde für gekommen.
Die römische Militärmacht (753 v. Chr.–476 n. Chr.)
Als die Römer das antike Griechenland überwanden, machten sie sich das für sie Beste der griechischen Kultur zu Eigen und gaben nach fast 500 Jahren das Erbe, bereichert um römisches Recht, Kriegs- und Zweckbaukunst, an das Abendland weiter.
Im Frühjahr 280 v. Chr. landete bei Tarent eine Vorausabteilung von 3000 Mann unter dem Befehl von Kineas, einem thessalischen Offizier, während Pyrrhus das Gros seiner Truppen versammelte. Nachdem er seine gesamte Streitmacht vereinigt hatte, die aus 20 000 Mann Fußtruppen, 3000 Reitern, 2000 Bogenschützen, 500 Schleuderern und 20 Kriegselefanten, aber ohne zugesagte Hilfstruppen bestand, rückte er gegen die „Barbaren“ vor, als er erfahren hatte, dass eine große römische Armee plündernd heranzog. Pyrrhus beobachtete von seinem Lager bei Heraclea aus, wie die Römer den Fluss Siris überquerten. Die dabei gezeigte Disziplin beeindruckte Pyrrhus tief und er erkannte, dass er sofort die Initiative an sich reißen musste. In der bewährten Taktik Alexanders des Großen sollte seine Phalanx den Feind halten, während er selbst mit 3000 Reitern den Angriffsstoß führen würde. Doch sein Gegner, der römische Fußsoldat, der Legionär, war für Pyrrhus und sein Heer etwas völlig Neues. Die Römer trugen große Schilde, die sie in der Abwehr zusammenfügten, kurze Wurfspeere und schwere Kurzschwerter. Die Legionäre gliederten sich in kleinen Blocks (Manipel) und diese wiederum im übergeordneten Verband, der Legion. Die hohe Beweglichkeit dieser Verbände machte Pyrrhus zu schaffen. Auch die durch Verbündete verstärkte Reiterei der Römer gab ihm große Probleme auf, so dass er seine Phalanx angreifen lassen musste.
Die Schlacht bei Heraclea wurde zu einer der mörderischsten in der antiken Kriegsgeschichte. Die flexiblere römische Aufstellung riss die Phalanx des Pyrrhus auseinander. Die Legionäre stießen in jede Lücke, schlugen mit ihren Kurzschwertern zu, nachdem sie die geschlossenen gegnerischen Schlachtreihen mit Speerwürfen erschüttert hatten. Die Phalanx des Pyrrhus begann zu zerbröckeln, als es endlich gelang, die Kriegselefanten gegen die Reiterei des rechten römischen Flügels einzusetzen. Die Reiterei floh und brachte im Zurückweichen die Formation der Römer durcheinander. So konnte das Heer von Pyrrhus noch einmal zum Angriff antreten, um ihn diesmal erfolgreich abzuschließen. Dieser Sieg war noch kein typischer „Pyrrhussieg“.
Doch auf Dauer bewährte sich die römische Zucht und Taktik. Selbst in den drei Niederlagen gegen Pyrrhus mit seinen Elefanten und riesigen Gewalthaufen, bewaffnet mit überlangen Spießen, bewiesen die Römer eine bisher unbekannte Festigkeit, die letztlich dem thessalischen Heer einen zu großen Blutzoll abforderte. Der Kampf der Römer gegen die Griechen war in erster Linie ein Kampf des Spießes gegen den Wurfspeer. In der ersten Phase des Kampfes rückte die griechische Phalanx, zumeist 16 Reihen tief, mit erhobenem Langspieß vor. Die römischen Manipel griffen in offener Schlachtordnung, gewöhnlich 12 Reihen tief, an. In 32 Meter Entfernung wurden leichte Wurfspieße (Pila) in großen Mengen geschleudert. Diese bohrten sich in den Rüstungen fest oder rissen Schilde zu Boden. In der Halbdistanz wurden schwerere Spieße geworfen, die Legionäre zogen das Schwert und formierten sich zur dichten Schlachtordnung. Der Einsatz der Wurfspieße hat ihren Tribut gefordert, die gegnerische Phalanx durch Tote und herumliegende Schilde in Unordnung gebracht. Dies war der entscheidende Moment zum Einbruch der Römer. Beim Aufprall fingen die Legionäre den Stoß der Langspieße mit ihren Schilden ab. In ihrem aggressiven Vorgehen nutzten die Legionäre die kleinsten Lücken in der Phalanx zum Einbruch aus. In den Zweikämpfen mit dem Schwert blieben meistens die Römer Sieger, da die Griechen ungeübte Schwertkämpfer waren und auch kleinere Schilde als die Römer mit sich trugen.
Nach dem Abzug der Griechen, Tarent zeigte noch hartnäckigen Widerstand bis ins Jahr 272 v. Chr., beherrschte Rom jetzt unumschränkt Süd-und Mittelitalien mit Etrurien und den griechischen Städten. Rom war aber nicht von heute auf morgen zur späteren Großmacht aufgestiegen. Dieser Prozess hatte fünf Jahrhunderte gedauert, in denen die Stadt selbst zweimal von fremden Heeren besetzt worden war.
Römische Heere waren nach den Kämpfen gegen den glücklosen Pyrrhus nur noch zu schlagen, wenn der Gegner weit überlegen war, sich auf eine noch überlegenere Taktik stützte oder wenn sie aus irgendwelchen Gründen von ihrer gewohnten Schlachtordnung abwichen. Das letztere war 216 v. Chr. der Fall in der Schlacht bei Cannae gegen den karthagischen Heerführer Hannibal. Auf ihre zahlenmäßige Überlegenheit bauend, griffen die Römer unter Terentius Varro nach alter Phalangentaktik an.
Cannae, die klassische Umfassungsschlacht der Antike
Im Vordergrund die Römer. Einfache Blocks: Fußvolk. Gemusterte Blocks: Reiterei. 80 000 Römer wähnen sich in der Überzahl und in günstiger Position gegen 50 000 Karthager, die zudem mit dem Rücken zum Meer stehen.
Die geschickt aufgestellten Truppen Hannibals umfassten die Römer und schlugen sie vernichtend.
Cannae, die erste Vernichtungsschlacht, erhielt unheilvolle Bedeutung in der Kriegsgeschichte. Immer wieder versuchten Feldherren es Hannibal gleichzutun und Vernichtungssiege zu erringen. Vor allem in Deutschlands jüngster militärischer Vergangenheit war ein Cannae das große, einzig erstrebenswerte Kriegsziel. So geschehen 1870 bei Sedan, 1914 bei Tannenberg und in vielen großen Schlachten des Zweiten Weltkrieges. Dabei wurde verdrängt, dass Hannibal wohl Schlachten gewinnen konnte, aber nicht den Krieg. Die Konzentration auf die große, endgültige Entscheidungsschlacht beeinflusste somit strategisches Denken. Bis Cannae hatten sich die ins Gefecht geführten Truppen (Treffen) in der Gliederung der Legionen abgezeichnet. Die hinteren Treffen dienten bei längeren Gefechten aber mehr einer Ablösung der vorderen. Unter Publius Cornelius Scipio wurden die hinteren Treffen für selbständige Aufgaben eingesetzt. Erst damit erhielten sie einen wahren Treffencharakter. Die Schlacht bei Zama auf afrikanischem Boden 202 v. Chr., die mit einem Sieg der Römer über Hannibal endete, tilgte den Erzfeind Karthago aus der Geschichte. Obwohl wirtschaftlich schwer angeschlagen, ging Roms Militärmacht gestärkt aus den „Punischen Kriegen“ hervor. Lagertaktik und Technik wurden weiter ausgebaut. Die römischen Legionäre schleppten ihr Schanzzeug, ihre Lagerpfähle usw. mit sich, um jederzeit ein festes Lager aufschlagen zu können. Der Manneszucht wurde größte Bedeutung zugemessen. In ihr lag die Stärke des römischen Militärwesens begründet.
In den Punischen Kriegen gegen Karthago war der römische Legionär mit einer hemdartigen ärmellosen Tunika bekleidet, über die der lederne, in der Herzgegend mit Metall verstärkte Lederpanzer geschnallt war. Vereinzelt wurden zudem Kettenpanzer getragen. Das Schuhzeug bestand aus einer benagelten Ledersohle, die durch ein Bändersystem am Fuß festgehalten wurde. Ein Kriegsmantel diente als Kälteschutz und als Lagerdecke. Den Kopf schützte ein Helm aus Bronzeblech, er wurde auf dem Marsch über die Schulter gehängt. Als passiven, beweglichen Schutz trug der Legionär einen leichtgewölbten rechteckigen Schild aus geleimten Brettern, die mit Kalbfell bezogen waren. Neben einem Dolch führte der Legionär nach Cannae ein neues Schwert. Es war dies ein Nachbau des spanischen Kurzschwertes, das die karthagischen Elitetruppen benutzten. Die Römer machten daraus eine der vollkommensten Blankwaffen. Einzig die Tatsache, dass zu ihrer Handhabung hohe Fechtkunst Voraussetzung war, ließ diese Waffe nach dem Untergang der römischen Militärmacht aussterben. Das Schwert, Gladius genannt, besaß eine Klingenlänge von etwa 60–70 cm, war breit ausgeschmiedet, beidseitig geschärft und besaß eine oft verstärkte scharfe Spitze. Das Heft des Schwertes war lang und kräftig und besaß keine Parierstange. Die Klinge steckte in einer hölzernen, mit Leder überzogenen Scheide und hing an einem Wehrgehänge dem Legionär von der linken Schulter zur rechten Hüfte herab. Der Spieß war im ganzen römischen Heer durch den Wurfspieß, „Pilum“ genannt, ersetzt worden. Das Pilum bestand in seiner vollendeten Form aus einem etwa 1,30 Meter langen Holzschaft, auf dem eine gleichlange Eisenspitze mit Zusatzgewicht bis zu ihrer halben Länge eingefügt und mittels Klammern am Schafte befestigt war. Die Gesamtlänge des gut ausgewogenen Pilum betrug etwa 2 Meter.
Römische „Artillerie“
Links Katapult mit senkrecht schwingendem Arm, rechts eine Balliste zum Schleudern schwerer Bolzen oder Steinkugeln.
Obwohl traditionell eine Landmacht, schufen sich die Römer in den punischen Kriegen eine Kriegsflotte, bei der sie eine neue Einrichtung einführten. Die Schiffe, es waren Galeeren mit durchgehendem Deck und aufgesetztem Kampfturm, wurden mit Enterbrücken ausgerüstet, die vom eigenen Schiff auf das feindliche herabgelassen werden konnten. Über sie hinweg stürmte der, der karthagischen Besatzung überlegene, römische Legionär und eroberte das gegnerische Schiff im Nahkampf. Diese Erfindung konnte sich aber nicht lange halten, da bei schlechtem Wetter viele Schiffe infolge der Ausmaße der hochgezogenen Brücken verloren gingen.
Römische Gefechtsgliederung
Die Legion ist in drei Treffen aufgeteilt. In der Darstellung stehen zwei Legionen vor dem Feind im Hintergrund.
In der langen Kriegsgeschichte Roms gab es naturgemäß immer wieder Reformen im Heerwesen, auch wurden unentwegt Verbesserungen in der Waffentechnik durchgeführt. Gajus Marius, ein großer Reformator des römischen Wehrwesens, organisierte die Legionen neu, verbesserte und vereinheitlichte die Ausrüstung. Im Heer wurden nun auch leichte Wurfmaschinen mitgeführt. Verwendung fand diese „Artillerie“ im Stellungskrieg, in der Lagerverteidigung und (bei Cäsar) gelegentlich auch in der offenen Feldschlacht.
Unter Gajus Julius Cäsar wurde auch der Wurfspieß (Pilum) weiter verbessert. Man verkürzte ihn und gab ihm eine Klinge aus Weicheisen mit gehärteter Spitze. Beim Einschlag in den feindlichen Schild bog sich nun die Pilumklinge nach unten und behinderte nun durch den durchhängenden Speerschaft den Schildträger erheblich in seiner Beweglichkeit. Im Übrigen wurde das Pilum immer noch im Salvenwurf geschleudert, um den Gegner zu erschüttern. Bei der Gliederung in drei Treffen brach das erste nach dem Pilumwurf in den Gegner ein, das zweite ersetzte die entstandenen Verluste und löste abgekämpfte Einheiten ab. Mit dem dritten Treffen wurde der Durchbruch herbeigeführt. Cäsar schied erstmals Reserven aus und behielt sie auch bis zur Entscheidung zurück.
Zur Zeit von Gajus Julius Cäsar hatte das römische Heer in Gliederung, Ausrüstung und Führung seine höchste Vollendung erreicht und kurz darauf auch überschritten. Soziale Missstände, eine allgemeine Kriegsmüdigkeit, das allmähliche Auseinanderfallen der römischen Geldwirtschaft sowie die Aufnahme fremder Söldner in das Heer waren erste Anzeichen des beginnenden Niederganges. Beim Bau des Limes, einem großen Grenzwerk, wurde es offensichtlich. Rom hatte seine dynamische Angriffskraft aufgebraucht. Germanische Angreifer jenseits der Grenze mussten bei Übergriffen nicht mehr mit sofortigen Gegenschlägen rechnen. Es kam soweit, dass sich Feldherren im Kampf gegen Jugurtha, König von Numidien (um 160 bis 104 v. Chr.) bestechen ließen und so einen jahrelangen Krieg gegen diesen nur sehr lässig führten. Die Dekadenz des römischen Imperiums kennzeichneten aber auch Plünderung und Bettel, Lieferantenbetrug und Spekulationsschwindel sowie Zins- und Kornwucher.
Das römische Heer, einstmals der Schrecken des Altertums, wurde durch Völker aus dem Norden überwunden. Die Auflösung Roms fiel mit der Völkerwanderung zusammen. Von überall her drängten neue Völker ans Licht der Geschichte. 378 n. Chr. besiegten die Goten ein oströmisches Heer. Es war ein Sieg der Reiterei über die Fußtruppen, die ihre Bedeutung verloren. Die nächsten tausend Jahre beherrschte der Berittene das Schlachtfeld. Im Westen wurde der Reiter der germanischen Völkerwanderungsheere zum Elitekrieger, der besonders bei den Franken eine große Entwicklung durchmachte.
Römischer Legionär aus der Zeit um 100 v. Chr. Er ist bewaffnet mit zwei Wurfspießen, einem Schwert und einem Dolch. Über einer kurzen Tunika, unter der halblange Hosen getragen wurden, ist ein aus Eisenbändern zusammengenieteter Kürass geschnallt.
Renaissance und Reformation (1350–1600), erstes Aufkommen der Feuerwaffen
Die Renaissance nahm ihren Anfang in Italien um die Mitte des 14. Jahrhunderts mit einem wiedererwachten Interesse an der Antike. Geendet hat sie nach über zwei Jahrhunderten, in denen fremde Länder entdeckt, und die Reformation die Autorität des Papstes in Frage stellte.
Feuertopf – Der Beginn des Pulvergeschützes
Die erste bildliche Darstellung einer Pfeilbüchse findet sich in einer Handschrift von Walter de Milemete (1326). Das pfeilartige Projektil ist im Begriffe, das Rohr des vasenförmigen Geschützes zu verlassen.
Ein wesentlicher Grund des nun kommenden Niederganges der Ritterzeit war das Aufkommen der Feuerwaffen. Ihre Entwicklung nahm nicht nur Einfluss auf den Fortschritt der Taktik und Technik, sondern bewirkte auch Veränderungen im sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Leben. Die Feudalherren verließen ihre unsicher gewordenen Burgen und wurden Höflinge von Kaisern und Königen. Die Städte gewannen an Macht und Einfluss, während der Ritterstand zunehmend verarmte.
Es ist sicher unnötig, an dieser Stelle das alte Thema „wer hat nun zuerst Feuerwaffen ...“, ebenfalls aufzugreifen. Es sei nur kurz bemerkt, dass mit großer Wahrscheinlichkeit chinesische Alchimisten im Verlaufe ihrer Forschungsarbeit im 10. Jahrhundert n. Chr. Pulver herstellten. Die Chinesen kannten bald einfache Bomben, Granaten und Raketen und benutzten vermutlich um 1120 bereits ein einfaches Geschütz im Kriege. Die Geschichte hat aber bewiesen, dass europäische Waffenbauer die Probleme um das Geschützwesen am besten meisterten. Die Erfindung des Schießpulvers war für sich allein nutzlos, es musste erst noch die Zusatzerfindung des schussfesten und entsprechend lafettierten Geschützrohres gemacht werden, um die freigesetzte zerstörerische Energie zu nutzen. Aufgezeichnet wurde das erste Pulverrezept in Europa vom Franziskanermönch Roger Bacon aus Ilchester (1214–1294), doch erst etwa 60 Jahre später tauchten die ersten Pulvergeschütze auf.
Kriegsführung und Mentalität der Krieger wurden durch die Feuerwaffe, insbesondere der Artillerie, mit der Zeit von Grund auf verändert. Der Krieger hatte sich schnell daran gewöhnt, dass zu einer Schlacht das Dröhnen der Kanonen gehörte, ja er weigerte sich bald, ohne Artillerievorbereitung zum Sturm anzutreten.