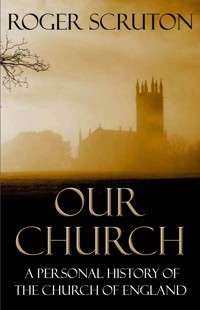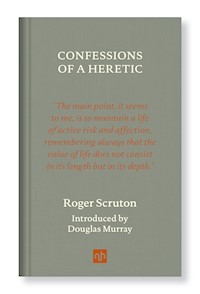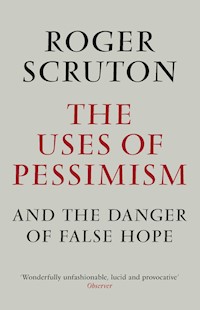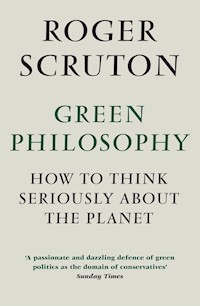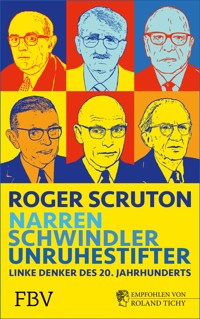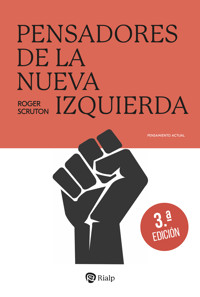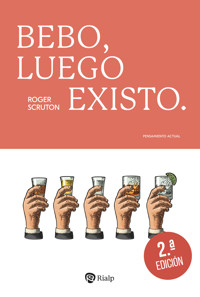19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FinanzBuch Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Wir leben in einer Zeit, in der es als Makel angesehen wird, konservativ zu sein. Bestenfalls wird der Konservatismus als eine angestaubte Nostalgie belächelt. Die Bannerträger des Zeitgeistes verstehen unter Freiheit die Zerstörung aller in der Geschichte gewachsenen Gemeinschaften, aller kulturellen und institutionellen Bindungen. Konservative jedoch halten dagegen. Sie glauben daran, dass es viel Gutes in unseren Gesellschaften gibt und das zu bewahren sich lohnen würde. Denn es ist zwar einfach etwas zu zerstören, aber ist das, was an die Stelle des Zerstörten tritt, tatsächlich immer auch das Bessere? Roger Scruton, Philosoph und einer der einflussreichsten konservativen Intellektuellen der Gegenwart, führt in diesem faktenreichen, dennoch persönlichen und humorvollen Buch aus, wie man auch gegen die herrschenden Auffassungen der modernen Gesellschaft konservativ denken und handeln kann. Seine eigenen Erfahrungen mit der kommunistischen Herrschaft in Osteuropa und der linken Gedankenhoheit an den Universitäten und im öffentlichen Leben bilden den Hintergrund für seine unerschrockenen und mutigen Folgerungen für einen Konservatismus der Gegenwart. Scruton zeigt, dass es durchaus möglich ist, das »gewachsene Gewebe« der Gemeinschaften zu schützen, und wo es dabei ist, verloren zu gehen, wieder herzustellen. Statt dem Verlorenen hinterherzutrauern, hat er ein durch und durch optimistisches Buch geschrieben. »Während viele die konservativen Ideen bestenfalls als politische Nostalgie verbuchen, beweist Scruton etwas anderes. Etwas, was für deutschsprachige Leser ganz besonders nützlich sein dürfte. Denn die konservative Philosophie, für die er eintritt, ist keine Philosophie, die in eine Glasvitrine gestellt wie in einem Museum betrachtet und nur von Kennern geschätzt wird. Sie ist eine tiefgreifende Philosophie, die hier und heute nützlich ist. Das zu erkennen ist insbesondere für junge Leser wichtig. Die von Scruton entfaltete Philosophie sucht keine Zuflucht in der Vergangenheit, sie blickt auf die Vergangenheit, um nach Anleitung für die Gegenwart zu suchen.« Douglas Murray
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 402
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Roger Scruton
Von der Idee, konservativ zu sein
Roger Scruton
Von der Idee, konservativ zu sein
Eine Anleitung für Gegenwart und Zukunft
Aus dem Englischen von Krisztina Koenen
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://d-nb.de abrufbar.
Für Fragen und Anregungen:
EDITION TICHYS EINBLICK
3. Auflage 2021
© 2019 by FinanzBuch Verlag, ein Imprint der Münchner Verlagsgruppe GmbH
Türkenstraße 89
80799 München
Tel.: 089 651285-0
Fax: 089 652096
Copyright der Originalausgabe © Roger Scruton, 2014. Die englische Originalausgabe erschien unter dem Titel How to be a Conservative bei Bloomsbury Continuum.
Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung, vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme gespeichert, verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Übersetzung: Krisztina Koenen
Redaktion: Ulrike Kroneck
Korrektorat: Silvia Kinkel
Umschlaggestaltung: Pamela Machleidt
Umschlagabbildung: istockphoto/DNY59
Satz: Helmut Schaffer, Hofheim a. Ts.
Druck: GGP Media GmbH, Pößneck
eBook: ePubMATIC.com
ISBN Print 978-3-95972-272-8
ISBN E-Book (PDF) 978-3-96092-499-9
ISBN E-Book (EPUB, Mobi) 978-3-96092-500-2
Weitere Informationen zum Verlag finden Sie unter
www.finanzbuchverlag.de
Beachten Sie auch unsere weiteren Verlage unter www.m-vg.de.
Inhalt
Vorwort zur deutschen Ausgabe
Vorwort
1. Meine Reise
2. Zu Hause ist aller Anfang
3. Die Wahrheit im Nationalismus
4. Die Wahrheit im Sozialismus
5. Die Wahrheit im Kapitalismus
6. Die Wahrheit im Liberalismus
7. Die Wahrheit im Multikulturalismus
8. Die Wahrheit im Umweltschutz
9. Die Wahrheit im Internationalismus
10. Die Wahrheit im Konservativismus
11. Der Bereich der Werte
12. Praktisches
13. Eine Abschiedsrede, die Verluste einräumt, ohne ihnen nachzutrauern
Vorwort zur deutschen Ausgabe
von Douglas Murray
Roger Scrutons Schaffen umfasst eine außerordentliche Vielfalt an Themen. Er schrieb über Musik, Architektur, Ästhetik und Philosophie, und die Werke in jedem einzelnen dieser Bereiche würden schon ausreichen, um ein Lebenswerk für vollendet zu erklären und ihm zu gönnen, dass er sich der Muße hingibt. Hinzu kommen Romane, Erzählungen, mehrere Opern, unzählige Kolumnen und noch einiges mehr.
Doch es ist das Thema des Konservativismus, zu dem Scruton immer wieder zurückkehrte und zu dem er von seinen Lesern auch immer wieder zurückgerufen wurde. Die Gründe dafür sind in gewisser Weise offenkundig. Obwohl es vielen nicht bewusst sein mag: Unsere Zeit braucht Denker, und ganz besonders Denker von konservativer Gesinnung. Wie Scruton in seinem 1985 veröffentlichten Buch Thinkers of the New Left (das 2015 unter dem Titel Fools, Frauds, Firebrands in einer aktualisierten Ausgabe erschienen ist) zeigte, herrscht in der modernen Welt kein Mangel an linksradikalen Denkern. Diese Philosophen der Dekonstruktion (die sich im Gegenzug von Scruton dekonstruieren lassen mussten) wurden während der letzten Generationen vom Rückenwind der Kultur und der akademischen Welt getragen. Zu ihnen gehört auch die Generation, in der Scruton aufgewachsen ist, und in der er zur politischen und intellektuellen Reife gelangte. Die oben erwähnten Denker – Deleuze, Derrida, Foucault und andere – luden ihre Leser in ihr intellektuelles Revier ein, und sehr viele folgten ihnen dorthin. Sie sogen die Ideen dieser Denker auf und eigneten sie sich an, selbst wenn sie gar nicht versucht hatten, sich mit ihnen auseinanderzusetzen. So lief diese Kultur allmählich auf Grund, und sie war nicht nur abstoßend, sie lieferte auch eine widernatürliche Interpretation von uns selbst.
Doch es reicht nicht aus, solche Denker zu dekonstruieren. Es reicht auch nicht aus, sie zu kritisieren und zu zeigen, wo sie im Unrecht sind. Die wirkliche Aufgabe ist es – und dieser Aufgabe widmete sich Scruton während seines ganzen Arbeitslebens –, eine alternative Vorstellung von einem intellektuellen und auch einem einfachen Leben aufzuzeigen. Eine Vorstellung zu bieten, die verwirklichbar und auch wahr ist.
Nur wenige zeitgenössische Denker können so über die Bedeutung der Dinge nachdenken wie Scruton, und keiner kann es mit einer solchen Vielfalt an philosophischen und kulturellen Bezügen. Nur wenige, wenn überhaupt, sind imstande, eine Schneise durch das alles verschlingende Dickicht der üblen Ideen zu schlagen, die unsere Kultur überwuchert haben. Genau das ist der Grund, warum Leser in aller Welt Scruton schätzen.
Doch warum fühlte sich Scruton immer wieder von diesem Thema angezogen? Der Grund dafür zeigte sich schon in seinem Buch The Meaning of Conservativism (1980) und wird offensichtlich in dem Werk, das Sie gerade in der Hand halten. Sein Vorhaben bestand im Wesentlichen darin, den Lesern kulturelle und intellektuelle Begründungen zu liefern – man könnte auch von »Rüstzeug« sprechen –, um sie zu befähigen, für die Wahrheit streiten zu können. Und dies ist eine wichtigere und kompliziertere Aufgabe, als es zunächst erscheinen mag.
Sie ist kompliziert, weil die intellektuelle Kultur – mit ihren verheerenden Auswirkungen sowohl auf Intellektuelle als auch Nicht-Intellektuelle – gegen die natürlichen Instinkte der Menschen argumentiert. Wenn Menschen aus einem natürlichen Instinkt heraus an der traditionellen Familie festhalten wollen, wird ihnen erklärt, dass diese Teil eines abscheulichen Netzes von naturwidriger Unterdrückung und Hierarchie sei. Wenn sie Loyalität gegenüber einer Nation empfinden, wird ihnen erklärt, dass diese Loyalität nur in eine Richtung führe, nämlich in die Hölle. Wenn sie an einer Kultur festhalten wollen, die ihre Vorfahren als Bereicherung empfanden und von der sie deshalb annehmen, auch sie könnten durch diese bereichert werden, dann sagt man ihnen, dass diese Kultur nicht nur bedeutungslos, sondern auch beispiellos bösartig und aus der Sünde geboren sei.
Derart ist die Denkkultur, in der die letzten Generationen erzogen wurden. Es ist – wie Scruton sie bezeichnet hat – die »Kultur der Selbst-Zurückweisung«. Und diese Kultur ist es, die Menschen ermutigt hat, auf der Suche nach Sinn bis ans Ende der Welt zu gehen, ihm aber zu entsagen und ihn anzugreifen, wenn sie ihm vor ihrer eigenen Haustür begegnen.
Das Problem dabei ist – und das weiß Scruton besser als alle anderen –, dass dieses Denken die Menschen allein in der Welt zurücklässt. Sie haben keinen Anker mehr und keine Beziehung zu einem Ort, und sie werden so zum Opfer von jeder Schwärmerei und jeder vorübergehenden Mode, egal wie krank oder gutartig diese auch sein mögen. Unter diesen Umständen ist es nicht weiter überraschend, wenn Menschen infolge solcher Schwärmereien in den wütenden Tonfall verfallen, der die Auseinandersetzungen unserer Zeit in besonderem Maße prägt. Die Raserei entsteht nicht allein durch die jeweils aktuelle Wut, sondern durch ein tiefes Gefühl des nirgendwo Hingehörens, durch das Empfinden, dass die Welt, in der man sich befindet, nicht so ist, wie es einen gelehrt wurde.
Warum ist es so schwer, über den Konservativismus zu schreiben? Der Grund besteht darin, dass Dinge gesagt werden müssen, die man früher nicht sagen musste, weil sie selbstverständlich waren. Philosophen und Denker gehen oft bis an die äußersten Grenzen, und dies führt dazu, dass die Auseinandersetzung mit Ideen, die bereits bekannt sind, auf der Liste der Prioritäten immer weiter zurückfällt. So lange, bis das, was einmal bekannt war, in Vergessenheit gerät und deshalb von Neuem erklärt, verteidigt und unterstützt werden muss.
Manche glauben, dass der Konservativismus eine politische Idee sei, die von den weniger Klugen und den weniger Kultivierten verfolgt wird. Wahr an dieser Behauptung ist, dass viele Menschen neue Ideen mit einem instinktiven Argwohn verfolgen, nicht, weil sie diese prinzipiell ablehnen, sondern weil sie die Gefahr spüren, zu der diese neuen Ideen – insbesondere die revolutionären unter ihnen – führen können. Während viele Intellektuelle daran arbeiten, Ideen zu erschaffen, die zu einer perfekten Gesellschaft führen sollen, erinnern sich viele daran, wohin utopische Ideen im Laufe der Geschichte tatsächlich geführt haben. Sie versuchen lieber, ein gutes Leben in einer guten Gesellschaft zu führen, statt sich so schlecht zu benehmen, wie es anscheinend notwendig ist, um die perfekte Gesellschaft zu errichten. Diesen Instinkt haben die meisten Menschen, möglicherweise hat ihn die Mehrheit der Gesellschaft. Doch er wird kaum von den Denkern an den Universitäten oder außerhalb unterstützt.
Konservativismus bedeutet vieles, und viele dieser Themen werden in diesem Buch erklärt. Unter ihnen sind die Tugenden der Anerkennung und der Vergebung, wie Scruton seit vier Jahrzehnten nicht aufgehört hat, seinen Lesern nahezubringen. Seine Philosophie ist auch eine der Dankbarkeit für die Güter, die unseren Vorfahren gut gedient haben und uns ebenso gut dienen könnten.
Denker gehören sowohl zu einem Ort als auch in eine Zeit, und dementsprechend wurde Scruton oft als ein ausgesprochen englischer Philosoph eingeordnet. Das liegt in gewisser Weise auf der Hand. Nicht nur ist England der Ort, an dem er geboren wurde. Auch hat sich Scruton während seines ganzen Lebens begeistert mit den intellektuellen und kulturellen Fragen Englands auseinandergesetzt und rief damit oft die Wut seiner Zeitgenossen hervor. Seine Schriften über die Fuchsjagd gehören für jene, die Lust auf Ketzerjagd haben, zu den ketzerischsten überhaupt. Doch er zeigte in seinen Essays zum Thema (insbesondere in dem Kleinod von Memoire mit dem Titel On Hunting, 1998), dass die Erörterung eines solchen Gegenstandes eine Sicht ermöglicht, die weit über das eigentliche Thema hinausreicht. So handelt die Jagd nicht vom Jagen allein, sondern von den Landschaften und den Menschen, die sie betreiben, den Dingen, die Menschen dabei anstellen und letztlich von der Bedeutung des Ortes, den sie bewohnen. Die Leser dieses Buches werden wissen, dass darin nicht allein Fragen über Engländer, sondern auch über Heidegger beantwortet werden.
Englisch zu sein gehört untrennbar zum persönlichen Charakter Scrutons. Doch obwohl dies die Verwurzelung an einem Ort bedeutet, weist es auch darüber hinaus. Es hat mich in den vergangenen Jahren auf meinen Reisen durch unseren Kontinent immer wieder überrascht, wie viele Menschen – egal welchen Alters und welcher Klassenzugehörigkeit – Roger Scruton zitierten. Wann immer ich mich über den Zustand des Denkens in Großbritannien beklagte oder ihn negativ mit der intellektuellen Kultur anderer Länder verglich, kam das Gegenargument auf: »Aber ihr habt doch Roger Scruton!« Einerseits ist es rührend, dass Menschen einem einzigen Individuum zutrauen, fähig zu sein, den vorherrschenden Strömungen standzuhalten – oder sie gar zur Umkehr zu zwingen. Vielleicht ist es tatsächlich eine zu große Erwartung an einen Einzelnen. Und doch haben diese Menschen Recht. Eine einzige Person, Mann oder Frau, kann eine Umkehr zum Besseren erzwingen, im Bereich der Ideen ebenso wie in der Politik. Ich erhebe nur einen einzigen Einwand gegen diesen Satz, wenn ich ihn höre. Ich sage nicht, dass der Satz falsch ist (egal in welchem Land er geäußert wurde), nur dass man erkennen sollte, dass »wir« Roger Scruton haben.
Wie seine Leser und Zuhörer in ganz Europa und in Amerika bezeugen können: Seine Schriften und sein Denken gehören zu keinem bestimmten Land, sondern zu den Menschen jeder Provenienz, die daran interessiert sind, das Gute in der Kultur zu bewahren, und die, wie er, die Anerkennung der Dinge, die in Vergessenheit geraten sind, fördern wollen. Dinge wie die Schönheit. Aber das war zu erwarten. Denn es gibt keinen Grund, warum die Wahrheiten eines Philosophen, die in einem Land so klar klingen, in einem anderen Land nicht ebenso klar klingen sollten.
Das bringt mich zu einem Dilemma, das den konservativen Positionen innewohnt. Während Linke dazu neigen, in allen Ländern der Welt die gleichen Forderungen zu erheben und die gleichen Prioritäten zu setzen, können sich Konservative diesen Luxus nicht immer erlauben. Ein französischer Konservativer wird etwas andere Dinge bewahren wollen als der englische oder deutsche Konservative. Und die spanischen und italienischen Konservativen werden noch mal etwas anderes bewahren wollen. Doch die Empfindungen und die Wahrheiten, die hinter diesem Wunsch des Bewahrens stehen, kennen keine kulturellen oder nationalen Grenzen. Es sind diese tiefen Unterströmungen, die Scruton häufig anspricht. Und dies ist der Grund dafür, dass er ein so breites und internationales Publikum ansprechen konnte und weiterhin anspricht.
Eine der Gründe für meine Begeisterung über die deutsche Ausgabe dieses Buches ist, dass es mir aufgrund meiner – freilich beschränkten – Erfahrungen so vorkommt, als würde Deutschland die Philosophie Roger Scrutons ganz besonders brauchen. Mir scheint es, dass es in Deutschland nur ganz wenige Denker gibt (es gibt sie natürlich), die seine Positionen vertreten. Und noch weniger an der Zahl sind jene, die diese Position so leichtfüßig und geistreich vortragen können. Deutschland und die anderen Länder unseres Kontinents brauchen Übersetzungen von Scrutons Werk.
Während viele die konservativen Ideen bestenfalls als politische Nostalgie verbuchen, beweist Scruton etwas anderes. Etwas, was für deutschsprachige Leser ganz besonders nützlich sein dürfte. Denn die konservative Philosophie, für die er eintritt, ist keine Philosophie, die zur Betrachtung in einer Glasvitrine ausgestellt und nur von Kennern geschätzt wird. Sie ist eine tiefgreifende Philosophie, die hier und heute nützlich ist. Das zu erkennen ist insbesondere für junge Leser wichtig. Die von Scruton entfaltete Philosophie sucht keine Zuflucht in der Vergangenheit, sie blickt auf die Vergangenheit, um nach Anleitung für die Gegenwart zu suchen. Mit seiner Philosophie sucht er die Wunden zu heilen und jene Gräben wieder zu schließen, die die Vertreter der Postmoderne aufgerissen haben und die heute die Gesellschaft teilen und fragmentieren.
Im Mittelpunkt dieser Vision steht der Versuch, etwas in uns selbst zu heilen, und unseren tiefsten Intuitionen wieder zu vertrauen. Denn intuitiv wissen wir, dass wir mehr sind als das, wie wir zur Zeit beschrieben werden: mehr als bloße Konsumenten oder Umweltverschmutzer, mehr als Rädchen in echten oder eingebildeten Hierarchien, die wir nicht kontrollieren können, für die wir trotzdem verantwortlich gemacht werden. Scruton spricht an, was wir wirklich sind, wo unser Platz in der Welt wirklich ist, und wie unser Verhältnis zu den heiligen Dingen sein sollte. Auf diesem Wege zeigt er den Menschen, wie sie in Frieden leben können – nicht nur mit den anderen, sondern auch mit sich selbst. Wenn unsere Gegenwart eine Philosophie braucht, dann diese.
Vorwort
Die konservative Geisteshaltung ist anerkanntes Merkmal jeder menschlichen Gesellschaft. Aber hauptsächlich in der englischsprachigen Welt bezeichnen sich politische Parteien und Bewegungen als konservativ. Diese merkwürdige Tatsache erinnert uns an die gewaltige und uneingestandene Kluft, die zwischen den Erben der englischen Common-law-Tradition1 und allen anderen besteht. Großbritannien und die Vereinigten Staaten waren sich an der Schwelle der Moderne ihrer gemeinsamen Geschichte durchaus bewusst. Später, im Laufe der traumatischen Ereignisse des 20. Jahrhunderts, verteidigten beide Länder gemeinsam die sie einende Zivilisation. Und selbst heute, nachdem Großbritannien zur allgemeinen Unzufriedenheit seiner Bürger Mitglied der Europäischen Union geworden ist, genießt die atlantische Allianz weiterhin die Zuneigung des Volkes, was beweist, dass wir für etwas Höheres zusammenstehen als es unsere menschliche Bequemlichkeit begründen könnte. Aber was könnte das sein? Zu Zeiten von Margaret Thatcher und Ronald Reagan war die Antwort ein einziges Wort: Freiheit. Doch dieses Wort verlangt nach einer Erklärung. Wessen Freiheit? Wie ausgeübt? Wie beschrieben und definiert?
In Amerika ist vor einiger Zeit ein Buch erschienen, das dem mittelalterlichen Habeas Corpus gewidmet ist. Habeas Corpus wird ein Schriftstück genannt, das im Namen des Königs verfasst wurde und befiehlt, dass wer auch immer einen seiner Untertanen festhält, ihn unverzüglich freilassen oder aber vor einem königlichen Gericht anklagen soll. Die ungebrochene Gültigkeit dieses Befehls, schreibt der Autor, untermauere die Freiheit in Amerika, weil er die Regierung zum Diener und nicht zum Herren der Bürger mache.2 Nirgendwo außerhalb der Anglosphäre gebe es etwas, was dem Habeas Corpus gleichkomme, und unter den englischsprachigen Bürgern riefen bisher alle Versuche Widerstand hervor, die seine Bedeutung und Auswirkung einzuschränken trachteten. Das Recht auf unverzügliche Haftprüfung bringt auf einfachste Weise die einmalige Beziehung zwischen Regierung und Regierten zum Ausdruck, so wie es dem englischen common law entwachsen ist. Diese Beziehung ist ein Teil dessen, was Konservative im Namen der Freiheit hochhalten.
Meine Erklärung und Verteidigung des Konservativismus richten sich deshalb in erster Linie an die englischsprachige Welt. Ich baue auf eine Leserschaft, für die die Common-law-Gerichtsbarkeit, die parlamentarische Demokratie, die private Wohltätigkeit, der Gemeinsinn und die von Edmund Burke und George Orwell gelobten »kleinen Einheiten«3 der Eigeninitiative zu den Grundpositionen der bürgerlichen Gesellschaft gehören und denke an Leser, die sich an die herablassende Autorität des modernen Sozialstaats und noch viel mehr an die transnationalen Bürokratien, die sie zu verschlingen drohen, noch gewöhnen müssen.
Es gibt zwei Sorten von Konservativismus: einen metaphysischen und einen empirischen. Der metaphysische Konservativismus beruht auf dem Glauben an heilige Dinge und auf dem Wunsch, sie vor der Entweihung zu schützen. Diesen Glauben gab es fortwährend in der Geschichte, und er wird auch weiterhin einen machtvollen Einfluss auf die menschlichen Angelegenheiten haben. Ich werde deshalb im Weiteren darauf zurückkommen. Doch auf den meisten der folgenden Seiten werde ich mich eher bodenständigen Dingen widmen. In seiner empirischen Manifestation ist der Konservativismus eindeutig ein modernes Phänomen, eine Reaktion auf die gewaltigen Veränderungen, die von der Reformation und der Aufklärung ausgelöst wurden.
Der Konservativismus, den ich verteidige, lehrt uns, dass zu unserem gemeinschaftlichen Erbe viel Gutes gehört, das wir erhalten sollten. Wir, die Erben sowohl der westlichen Zivilisation als auch des englischsprachigen Teils davon, sind uns sehr wohl dessen bewusst, was dieses Gute bedeutet: die Möglichkeit, unser Leben zu führen, wie wir es wollen; die Sicherheit, die das unparteiische Gesetz bedeutet, wodurch unsere Klagen erhört und unsere Verletzungen wiedergutgemacht werden; den Schutz unserer Umwelt als eines gemeinsamen Vermögens, das nicht nach Gutdünken und im Interesse von Mächtigen enteignet oder zerstört werden darf; die offene und neugierige Kultur, die unsere Schulen und Universitäten geprägt hat; die demokratischen Prozeduren, die ermöglichen, unsere Vertreter zu wählen und unsere eigenen Gesetze zu verabschieden – all das und viele andere Dinge mehr, die uns vertraut sind und als selbstverständlich erachtet werden. Sie alle sind bedroht. Vielleicht setzt der Konservativismus mehr Einsichten voraus, als ein normaler Mensch aufzubringen bereit ist. Doch er ist die einzige Antwort auf die neuen Realitäten, und ich versuche in diesem Buch so kurz wie nur möglich zu erklären, warum es unvernünftig wäre, einen anderen Standpunkt einzunehmen.
Konservativismus beginnt mit einem Gefühl, das alle reifen Menschen bereitwillig teilen: das Gefühl, dass das, was gut ist, leicht zu zerstören, aber nur schwer zu erschaffen ist. Das gilt insbesondere für die Güter, die uns als gemeinschaftlicher Besitz entgegentreten: Frieden, Freiheit, Recht, Anstand, Gemeinsinn, Besitzsicherheit und Familienleben sind Güter, bei denen wir auf die Zusammenarbeit mit anderen angewiesen sind, und die wir als Einzelne nicht erwerben können. Die Zerstörung gerade dieser Güter ist schnell, einfach und aufregend, die Arbeit der Erschaffung dagegen langsam, mühsam und langweilig. Dies ist eine der Lehren des 20. Jahrhunderts. Hierin liegt auch der Grund dafür, warum Konservative in der öffentlichen Meinung so benachteiligt sind. Ihr Standpunkt mag zwar richtig sein, ist aber langweilig, der ihrer Gegner dagegen aufregend, aber falsch.
Wegen dieses rhetorischen Nachteils neigen Konservative dazu, ihren Standpunkt als Grabrede vorzutragen. Das Gejammer kann, wie die Klagen des Jeremia, alles auslöschen, ebenso wie die revolutionäre Literatur die zerbrechlichen Errungenschaften unserer Welt auslöschen kann. Die Trauer kann manchmal begründet sein; denn ohne die »Trauerarbeit«, wie sie Freud beschrieben hat, kann sich das Herz nicht vom Verlorenen trennen und sich weiterbewegen zum Neuen, das es ersetzt.4 Nichtsdestotrotz muss die Sache des Konservativismus nicht in elegischem Ton präsentiert werden. Es geht nicht darum, was wir verloren haben, sondern darum, was wir bewahrt haben, und wie wir daran festhalten können. Darum wird es in diesem Buch gehen. Deswegen schließe ich dieses Buch mit einer sehr persönlichen Stellungnahme, mit einem Abschied ohne Trauer.
Von den Kommentaren von Bob Grant, Alicja Gescinska und Sam Hughes habe ich außerordentlich profitiert. Ohne die Anregungen, die Zweifel und die gelegentlichen ironischen Bemerkungen meiner Frau Sophie wäre es mir nicht gelungen, meine Gedanken zu Papier zu bringen. Ihr und unseren Kindern widme ich das Ergebnis.
Malmesbury, im Januar 2014
1. Meine Reise
Es ist nichts Besonderes daran, konservativ zu sein. Aber es ist etwas Besonderes, ein intellektueller Konservativer zu sein. Sowohl in Großbritannien als auch in den Vereinigten Staaten bezeichnen sich etwa 70 Prozent der Akademiker als Linke, während die uns umgebende Kultur immer feindseliger auf traditionelle Werte und auf jedes Lob der Errungenschaften der westlichen Zivilisation reagiert.5 Normale Konservative – und zu dieser Kategorie gehören vermutlich die meisten Menschen – bekommen dauernd erklärt, dass ihre Ideen und Empfindungen reaktionär, vorurteilsbehaftet, sexistisch oder rassistisch seien. Allein schon dadurch, was sie sind, verstoßen sie gegen die neuen Normen der Inklusion und der Nicht-Diskriminierung. Ihre aufrichtigen Bemühungen, ihren Überzeugungen entsprechend zu leben, Familien zu gründen, Gemeinschaften zu pflegen, ihre Götter zu verehren und sich eine beständige und positive Kultur anzueignen, werden von der Guardian-Klasse zornig kritisiert und der Lächerlichkeit preisgegeben. In Intellektuellenkreisen bewegen sich die Konservativen deshalb ruhig und unaufdringlich, verständigen sich im Raum mit Blicken, wie einst die Homosexuellen bei Proust, die der große Dichter mit den Göttern Homers verglich, weil sie nur einander bekannt waren, während sie sich getarnt durch die Welt der Sterblichen bewegten.
Deshalb stehen wir, angebliche Ausgrenzer, unter Druck und müssen verbergen, was wir sind, aus Angst, selbst ausgegrenzt zu werden. Ich habe diesem Druck widerstanden, und deshalb ist mein Leben viel interessanter geworden, als ich es jemals gewollt habe.
Ich bin gegen Ende des Zweiten Weltkrieges geboren und wuchs in einer Familie der unteren Mittelschicht auf. Mein Vater war Mitglied der Gewerkschaft und der Labour-Partei und dachte dauernd darüber nach, ob er die Arbeiterklasse verraten habe, weil er Grundschullehrer geworden ist. Denn in den Augen von Jack Scruton war Politik die Fortsetzung des Klassenkampfes mit anderen Mitteln. Dank der Gewerkschaften und der Labour-Partei, meinte er, könnten die oberen Klassen immer stärker in die Ecke gedrängt werden, wo man sie zwingen würde, ihre gestohlenen Besitztümer abzuliefern. Das größte Hindernis auf dem Wege zu diesem langersehnten Ergebnis war die Konservative Partei, eine Einrichtung der Konzerne, der Immobilienentwickler und der landbesitzenden Aristokratie, die darauf hoffte, das Erbe der britischen Bürger an den Höchstbietenden verkaufen zu können und dann auf die Bahamas zu ziehen. Jack befand sich in einem lebenslangen Kampf mit diesem Establishment im Namen der angelsächsischen Bauernschaft, deren Geburtsrecht von den normannischen Rittern vor tausend Jahren entwendet wurde.
Für diese Geschichte fand er die Bestätigung im Geschichtsunterricht an den Schulen, in den sozialistischen Traktaten von William Morris und H. J. Massingham und in seinen eigenen Erfahrungen als Kind in den Slums von Manchester, von wo er in eines der übriggebliebenen Teile des alten England in der Nähe des Themse-Flusses floh. Dort wurde er dank eines Schnellkurses für Lehrer sesshaft, zusammen mit meiner Mutter, die er während des Krieges beim gemeinsamen Dienst beim Oberkommando der Bomberflotte der Royal Air Force kennengelernt hatte. Seine Liebe zum alten England wuchs in ihm Seite an Seite mit der Feindseligkeit gegenüber der Aristokratie, die dieses gestohlen hatte. Er glaubte an Sozialismus nicht als ökonomische Doktrin, sondern als Zurückerstattung des Landes an die einfachen Menschen, denen es rechtmäßig gehörte.
Es war schwierig, mit einem solchen Menschen zusammenzuleben, insbesondere als ich anfing, die lokale grammar school6 zu besuchen und mich auf den Weg nach Cambridge machte – wo ich vom Klassenfeind rekrutiert werden sollte. Ich habe von meinem Vater nichtsdestotrotz gelernt, wie tief sich das Gefühl der Klassenzugehörigkeit in die Erfahrungen seiner Generation und in die der nordenglischen Industriegemeinden, woher er kam, eingeprägt hatte. Ich habe auch von klein auf gelernt, wie diese tiefen Erfahrungen mit einer Reihe von aufregenden Ausschmückungen angereichert wurden. Die Klasse war für meinen Vater das wahre Nationalepos, das den Hintergrund für sein Leben bildete, so wie der Trojanische Krieg der Hintergrund der griechischen Literatur war. Ich habe die ökonomischen Theorien des Sozialismus, die ich aus George Bernard Shaws Wegweiser für die intelligente Frau zum Sozialismus und Kapitalismus kennengelernt hatte, nicht verstanden. Aber ich wusste damals schon, dass die Theorien nur wenig wirkliche Bedeutung hatten. Dichtungen waren viel anziehender als Fakten, und noch viel anziehender als beide zusammen war die Sehnsucht nach dem Aufgehen in einer Massenbewegung der Solidarität, die am Ende die Emanzipation versprach. Die Klagen meines Vaters waren real. Aber seine Lösungen waren Träume.
Doch der Charakter meines Vaters hatte auch noch eine andere Seite, und die beeinflusste mich ebenfalls stark. Robert Conquest sprach einmal über die drei Gesetze der Politik, von denen das erste lautete, dass jeder in den Dingen, die er kennt, rechts sei.7 Mein Vater war der perfekte Beweis für dieses Gesetz. Er kannte den ländlichen Raum, die lokale Geschichte, die althergebrachten Lebens-, Arbeitsund Bauweisen. Er untersuchte die Geschichte und die Architektur seines Wohnortes High Wycombe und die Siedlungen um den Ort herum. Und indem er über diese Dinge Bescheid wusste, wurde er, was sie betraf, zu einem leidenschaftlichen Konservativen. Hier fand er das Gute, das er bewahren wollte. Er drängte andere, sich seiner Bewegung anzuschließen, mit der er High Wycombe und die umliegenden Gemeinden vor der Zerstörung bewahren wollte, die ihnen durch die hemmungslose Vorgehensweise der Entwickler und Autobahnfanatiker drohte. Er gründete die »High-Wycombe-Gesellschaft«, sammelte Unterschriften unter Petitionen und stärkte so allmählich das Bewusstsein unserer Stadt, bis sie endlich anfing, ernsthafte und dauerhafte Anstrengungen zu unternehmen, sich selbst zu bewahren. Ich teilte seine Liebe zum ländlichen Raum und die alte Art zu bauen. Ich war wie er der Meinung, dass die modernistische Architektur, die unsere Stadt entweiht, auch ihr soziales Gewebe zerstört; und ich erkannte zum ersten Mal in meinem Leben, dass es immer richtig ist, Dinge zu bewahren, wenn Schlechteres an ihre Stelle treten soll. Dieses a priori bestehende Gesetz der praktischen Vernunft ist auch die Wahrheit des Konservativismus.
Deshalb war der Kern der sozialistischen Überzeugungen meines Vaters in Wirklichkeit ein tiefempfundener konservativer Instinkt. Und mit der Zeit habe ich verstanden, dass ihm der Klassenkampf, der seine politische Sicht bestimmte, viel weniger wichtig war als die Liebe, die sich darunter verbarg. Mein Vater liebte innig sein Land – nicht das Vereinigte Königreich der offiziellen Dokumente, sondern das England seiner Spaziergänge und Betrachtungen. Wie viele andere seiner Generation hatte er erlebt, wie England in Gefahr geriet, und wurde zu seiner Verteidigung gerufen. Ihn hatten die Sendungen über den Landbau von A. G. Street8 im nationalen Programm der BBC, Paul Nashs9 bewegende Malereien englischer Landschaften, H. J. Massinghams10 Artikel in The Countryman und die Dichtung von John Clare11 inspiriert. Er hegte eine tiefe Liebe zur englischen Freiheit: Er glaubte daran, dass wir Engländer über Jahrhunderte jene Freiheit verteidigten, die uns erlaubte, zu sagen, was wir denken, zu leben, wie wir wollen, und dass dies etwas sei, was uns im Kampf gegen die Tyrannei immer vereinen würde. Habeas Corpus war in sein Herz eingeprägt. Er war das Musterbeispiel für die englische Arbeiterklasse, wie sie George Orwell in seinem Buch The Lion and the Unicorn beschrieben hatte. Wenn es darauf ankommt – erklärte Orwell – würden die Arbeiter nicht ihre Klasse, sondern ihr Land verteidigen. Sie würden ihr Land gedanklich mit jener sanften Lebensart verbinden, in der ungewöhnliche und exzentrische Angewohnheiten – wie zum Beispiel die, einander nicht umzubringen – allgemein als der Gang der Dinge akzeptiert werden. Orwell war auch der Meinung, dass linke Intellektuelle die Arbeiter, die den hochnäsigen Verrat, den sich nur Intellektuelle leisten können, ablehnten, immer falsch verstehen würden.
Doch ich selbst war auch ein Intellektueller, oder zumindest war ich dabei, einer zu werden. In der Schule und an der Universität rebellierte ich gegen die Autoritäten. Institutionen waren dazu da, um untergraben zu werden, dachte ich, und es dürfe keine Vorschriften und Normen geben, die die Phantasie begrenzen. Aber ebenso wie mein Vater war ich ein Beispiel für Conquests Gesetz. Aber es war die Kultur, die mich am meisten interessierte und die ich mir anzueignen entschlossen war. Darunter verstand ich die Philosophie ebenso wie die Kunst, die Literatur und die Musik. Und in Sachen Kultur war ich »rechts«: Das bedeutete Respekt gegenüber Ordnung und Disziplin und Anerkennung dessen, dass man Wertungen braucht; das umfasst den Wunsch, die große Tradition der Meister zu erhalten und für ihr Weiterleben zu arbeiten. Diesen kulturellen Konservativismus lernte ich von den Literaturkritiken von F. R. Leavis, von T. S. Eliot, dessen Vier Quartette12 und literarische Essays in der Schule unsere Herzen bewegten, und von der klassischen Musik. Ich war erschüttert von Schönbergs Behauptung, dass seine atonalen Experimente die große Tradition der deutschen Musik nicht ersetzen, sondern fortsetzen sollten. Die tonale Sprache sei zu Klischees und Kitsch verkommen, und deshalb sei es notwendig, »den Dialekt des Stammes zu reinigen«, wie Eliot in den Four Quartets in Anlehnung an Mallarmé sagte. Die Idee, dass wir modern sein müssen, um die Vergangenheit zu bewahren, kreativ sein müssen, um die Tradition zu verteidigen, hatte eine tiefgründige Wirkung auf mich, und prägte zu gegebener Zeit meine politischen Neigungen.
Nachdem ich Cambridge verlassen hatte, verbrachte ich ein Jahr als lecteur an einem französischen collège universitaire und verliebte mich – wie einst Eliot – in Frankreich. Und das führte zur entscheidenden Veränderung des Zentrums meines Denkens, weg von der Kultur und hin zur Politik. Der Mai 1968 ließ mich begreifen, was ich an den Traditionen, Institutionen und der Kultur Europas so schätzte. Während ich mich in Paris aufhielt, las ich die Angriffe auf die bourgeoise Gesellschaft mit der wachsenden Erkenntnis, dass – wenn es in der großartigsten Stadt der Welt eine Lebensweise gibt, die man als einigermaßen akzeptabel bezeichnen kann –, »bourgeois« die richtige Bezeichnung dafür ist. Die Achtundsechziger waren Erben dieser bourgeoisen Lebensweise und genossen die Freiheit, die Sicherheit und die vielfältige Kultur, die der französische Staat seinen Bürgern sicherte. Sie hätten jeden Grund gehabt, dieses Frankreich zu schätzen, das unter der Führung General de Gaulles entstanden war, der die Kommunistische Partei Frankreichs in den Augen des Volkes so lächerlich gemacht hatte, wie sie es auch in den Augen der Intellektuellen hätte sein müssen.
Zu meiner Verwunderung jedoch waren die Achtundsechziger emsig dabei, das alte marxistische Versprechen einer radikalen Freiheit wieder aufzuwärmen, die kommen würde, wenn man nur das Privateigentum und die »bourgeoise« Rechtsstaatlichkeit abschaffte. Die unvollendete Freiheit, ermöglicht durch Eigentum und Rechtsstaat, der die Achtundsechziger ihre Annehmlichkeiten und Exaltiertheiten zu verdanken hatten, reichte ihnen nicht aus. Die echte, aber relative Freiheit musste ihres illusorischen, aber absoluten Schattens zuliebe zerstört werden. Die neuen »Theorien«, die aus den Federn der Pariser Intellektuellen im Kampf gegen die »Strukturen« der bourgeoisen Gesellschaft quollen, waren überhaupt keine Theorien, sondern nur ein Haufen Paradoxien, entworfen, um die studentischen Revolutionäre darin zu bestätigen, dass Recht, Ordnung, Wissenschaft und Wahrheit nur Masken der bourgeoisen Vorherrschaft waren. Deshalb sei es nicht mehr von Bedeutung, was man denke, entscheidend sei, auf der Seite des Kampfes der Arbeiterklasse zu stehen. Die von diesem Kampf inspirierten Genozide kamen in den Schriften von Althusser, Deleuze, Foucault und Lacan nicht vor, obwohl gerade zu der Zeit so ein Genozid in Kambodscha seinen Anfang nahm, unter der Führung von Pol Pot, eines in Paris ausgebildeten Mitglieds der Französischen Kommunistischen Partei.
Sicherlich konnte nur jemand, der in der Anglosphäre aufgewachsen ist, daran glauben – wie ich es in den Folgejahren von 1968 tat –, dass die politische Alternative zum revolutionären Sozialismus der Konservativismus sei. Doch als ich an der Londoner Universität zu lehren begann, musste ich feststellen, dass meine Kollegen das, was sie unter dem Wort Konservativismus verstanden, ausnahmslos ablehnten. Der Konservativismus sei, so erklärten sie mir, nicht nur der Feind der Intellektuellen, sondern auch aller, die für einen fairen Anteil am Sozialprodukt arbeiteten und »für den Frieden« und gegen den US-Imperialismus kämpften. Meine Kollegen sympathisierten mit der Sowjetunion, deren Schwierigkeiten – wie sie behaupteten – eine Folge der Politik der »kapitalistischen Einkreisung« waren, die trotz der notwendigen Liquidierung der konterrevolutionären Elemente immer noch nicht überwunden werden konnten. Sie glaubten daran, dass es eine Alternative zum revolutionären Sozialismus Lenins gebe, die frei von den Mängeln des sowjetischen Modells war, und diese Alternative war der marxistische Humanismus des New Left Review13.
Das Birkbeck College, wo ich unterrichtete, hatte seine Ursprünge im frühen 19. Jahrhundert im Institut für Mechanik. Das College folgt bis zum heutigen Tag dem Wunsch seines Gründers, George Birkbeck, Abendkurse für Leute anzubieten, die einer Ganztagsbeschäftigung nachgehen. So hatte ich tagsüber frei und widmete die Zeit dem Jurastudium, da ich davon ausging, dass ich irgendwann demnächst eine zweite Karriere würde beginnen müssen. Birkbeck war eine feste Bastion des linken Establishments. Sein oberster Guru war der Kommunist Eric Hobsbawm, dessen Geschichten über die industrielle Revolution immer noch die Standardkost in unseren Schulen sind. Das Ethos des Instituts war der »lange Marsch durch die Institutionen«, womit der Umbau Großbritanniens nach dem sozialistischen Modell gemeint war.
Während meines Studiums des Rechts und des englischen Rechts, so wie es damals war, bevor es durch die europäischen Gerichtshöfe vergiftet wurde und bevor Tony Blair willkürliche verfassungsmäßige Änderungen einführte, bekam ich eine vollkommen andere Idee von unserer Gesellschaft. Das Common-law-Recht erzählte mir die Geschichte von einer von unten gewachsenen Gemeinschaft, ermöglicht durch die Garantien, die die Gerichtshöfe all jenen boten, die mit weißer Weste vor ihnen erschienen. Diese Idee blieb für mich fortan gleichbedeutend mit Heimat. Im englischen Recht gibt es heute noch gültige, aus dem 13. Jahrhundert stammende Gesetze und Präzedenzfälle, was Progressive wahrscheinlich für absurd halten. Für mich war das ein Beweis dafür, dass das englische Recht immer schon das Eigentum des englischen Volkes war und keine Waffe seiner Herrscher. Diesen Gedanken wird man in den Geschichtsbüchern Hobsbawms nicht finden.
Tagesaktuelle politische Realitäten hatten kaum Bezug zu dem beständigen Gemeinwesen, das durch die Präzedenzfälle des Richters Lord Denning14 durchscheint und ebenso klar in unserem Boden- und Erb- und Treuhandrecht sichtbar wird. Ich kann mich noch lebhaft an meine Überraschung erinnern, als ich erfuhr, dass das Unternehmensrecht Unternehmen verpflichtet, Gewinne zu machen. Wie kam es, dass im »Ingsoc«15 der 1970er-Jahre Profit gerade so erlaubt, aber gewiss keine Pflicht war? Damals schien die ganze Verwaltung des Landes darauf konzentriert zu sein, den gleichmäßigen Verfall von Kultur und Wirtschaft aufrechtzuerhalten, in der Hoffnung auf die neue und auf Gleichheit gegründete Gesellschaft, in der jeder das Gleiche besaß, nämlich gar nichts.
Tatsächlich glaubten viele konservativ Gesinnte in den späten 1970er-Jahren, dass Großbritannien bereit war, zu kapitulieren und alles aufzugeben, wofür es einst gestanden hatte: seinen Stolz, seine Unternehmen, die Ideale der Freiheit und der bürgerlichen Gesellschaft, ja sogar seine Grenzen und seine Landesverteidigung. Das war die Zeit des CND16, der Bewegung für nukleare Abrüstung, und der sowjetischen »Friedensoffensive«, die zum Ziel hatte, die westliche Allianz mit Hilfe der »nützlichen Idioten« zu entwaffnen, wie Lenin sie in einem berühmten Spruch bezeichnet hatte. Das Land schien sich in den Gefühlen der Kollektivschuld zu suhlen, die noch gefördert wurden durch die immer stärker werdende Kultur der Abhängigkeit. Für linke Politiker wurde »Patriotismus« zu einem schmutzigen Wort. Den rechten Politikern war alles egal, außer dem Streben, Teil des neuen Europa zu werden, dessen Märkte uns vor den schlimmsten Auswirkungen der Nachkriegsstagnation retten sollten. Die nationalen Interessen wurden durch Interessen von Gruppen ersetzt: durch die der Gewerkschaften, des Establishments und der Industriekapitäne.
Die Lage war für Konservative ganz besonders entmutigend. Edward Heath, ihr angeblicher Führer, glaubte, dass Regieren gleichbedeutend mit Kapitulation sei: Die Wirtschaft sollten wir den Managern überlassen, das Bildungssystem den Sozialisten und unsere Souveränität Europa. Die alte Garde der Tory-Partei war mit ihm überwiegend einverstanden und schloss sich der Hexenjagd auf Enoch Powell17 an, dem Einzigen unter ihnen, der dem Nachkriegskonsens öffentlich widersprach. In den dunklen Jahren der 1970er, als die Kultur der Ausgrenzung an den Universitäten und unter den meinungsbildenden Eliten immer mehr um sich griff, sah es so aus, als gebe es keinen Weg mehr zurück zu dem großartigen Land, das unsere Zivilisation in zwei Weltkriegen erfolgreich verteidigt hatte.
Doch dann, als wir in Entmutigung versanken, ist Margaret Thatcher wie durch ein Wunder an der Spitze der Konservativen Partei erschienen. Ich kann mich noch gut an die Freude erinnern, die an der Londoner Universität aufbrandete. Endlich war jemand da, den man hassen konnte! Nach all den trostlosen Jahren des sozialistischen Konsenses, als man in den braunen Ecken der britischen Gesellschaft herumstochern musste, um irgendwelche schäbigen Faschisten aufzustöbern, die noch am ehesten als Feinde herhalten konnten, war nun endlich ein echter Dämon aufgetaucht: nichts weniger als eine Führerin der Tory-Partei, die die Unverschämtheit besaß, ein Bekenntnis zur Marktwirtschaft, zu privatem Unternehmertum, zur Freiheit des Individuums, zur nationalen Souveränität und zur Rechtsstaatlichkeit abzulegen, kurzum zu allem, was Marx als »bourgeoise Ideologie« abgelehnt hatte. Es überraschte, dass es ihr gar nichts ausmachte, von den Linken gehasst zu werden, sie zahlte ihnen mit der gleichen Münze heim und konnte dabei die Menschen mitreißen.
Ich habe die Freie-Markt-Rhetorik der Thatcher-Anhänger nie ganz akzeptiert. Aber ich sympathisierte zutiefst mit den Beweggründen Thatchers. Sie wollte, dass die Wählerschaft begreift, dass das Individuum Besitzer seines eigenen Lebens ist, und dass die Verantwortung für das eigene Leben kein anderer übernehmen kann, am allerwenigsten der Staat. Sie hoffte, Talente und Unternehmungsgeist zu entfesseln, von denen sie – trotz des jahrzehntelangen egalitären Geschwätzes – annahm, dass sie in der britischen Gesellschaft weiterhin vorhanden seien. Typisch für die ererbte Lage war der unter einer gelähmten konservativen Regierung 1962 gegründete National Economic Development Council, der den wirtschaftlichen Niedergang des Landes verwalten sollte. Seine Mitglieder waren hohe Tiere aus der Industrie und dem öffentlichen Dienst. »Neddy«, wie er damals genannt wurde, befasste sich mit der Aufrechterhaltung der Illusion, dass sich das Land in »sicheren Händen« befinde, dass es einen Plan gebe und dass Manager, Politiker und Gewerkschaftsführer in dem Forum zusammenkämen, um für das Gemeinwohl zu arbeiten. Neddy verkörperte das britische Establishment der Nachkriegszeit, das die Probleme der Nation zu lösen versuchte, indem es Komitees ernannte, die aus Leuten bestanden, die die Probleme selbst verursacht hatten.
Neddys Leitidee war, dass das Wirtschaftsleben aus der Verwaltung der vorhandenen Industrien statt aus der Gründung von neuen bestand. Harold Wilson, Edward Heath und James Callaghan stützten sich auf Neddy in ihrem gemeinsamen Glauben, dass man nur lange genug durchhalten müsse, damit alles gut werde, und die ganze Schuld würde erst die Nachfolger treffen. Margaret Thatcher glaubte daran, dass die Verantwortung sowohl in der Wirtschaft als auch in der Politik bei einem selbst liege. Die wichtige Person in der freien Wirtschaft ist nicht der Manager, sondern der Unternehmer – derjenige, der die Risiken auf sich nimmt und den Preis dafür bezahlt. Es darf freilich bezweifelt werden, ob Thatcher die Ökonomie des Managements und der Interessengruppen erfolgreich durch die des Unternehmertums und der Übernahme der Risiken ersetzen konnte. Indem sie den Arbeitsmarkt liberalisierte, verhalf sie der Wirtschaft zum Aufschwung. Aber als die multinationalen Konzerne mit ihren Unternehmensübernahmen ins Land strömten, mit ihren rechtlichen Privilegien und ihren transnationalen Lobbyisten, die den Kleinunternehmen und kleinen Unternehmern feindlich gegenüberstanden, zeigte sich die langfristige Folge ihrer Politik: das Aufkommen einer neuen Klasse von Managern. Gegner dieses neuen »Managerismus« (zu denen auch ich gehöre) sollten dennoch erkennen, dass das Schlechte darin genau mit dem identisch ist, was in der alten, korporatistischen Wirtschaft schlecht war, die zu zerstören sich Thatcher aufgemacht hatte. Wenn sie behauptete, dass es die Unternehmer seien, die Dinge erschufen, während die Manager sie beerdigten, war es sofort offensichtlich, dass sie Recht hatte, denn die Ergebnisse der Managementkultur lagen offen zu Tage.
Ich sage hier, dass es sofort offensichtlich war, doch für die intellektuelle Klasse war es nicht offensichtlich, sie blieb dem Nachkriegskonsens im Großen und Ganzen bis zum heutigen Tage treu. Die Idee vom Staat als einer gutmütigen Vaterfigur, die die gemeinschaftlichen Güter der Gesellschaft dorthin lenkt, wo sie gebraucht werden, und die immer da ist, um uns vor Armut, Krankheit und Arbeitslosigkeit zu beschützen, blieb die zentrale Idee der akademischen Politikwissenschaft in Großbritannien. Am Tag, als Margaret Thatcher starb, war ich gerade dabei, eine Vorlesung in politischer Philosophie an der Universität von St. Andrews vorzubereiten. Ich stellte mit Staunen fest, dass der dafür vorgegebene Text das Phänomen »Neue Rechte« entdeckt hatte. Diese brachte der Autor des Textes mit Thatcher und Ronald Reagan in Verbindung, und behauptete, sie stünde hinter dem radikalen Angriff auf die verletzlichsten Mitglieder der Gesellschaft. Der Autor nahm an, dass die Hauptaufgabe der Regierung darin bestehe, die gemeinschaftlichen Güter der Gesellschaft an deren Mitglieder zu verteilen, und dass in Sachen Verteilung die Regierung ganz besonders kompetent sei. Die Tatsache, dass Vermögen nur verteilt werden kann, wenn es zuerst erzeugt worden ist, schien seiner Aufmerksamkeit entgangen zu sein.
Natürlich war Thatcher keine Intellektuelle, sie war mehr durch Instinkte als durch eine vollständig ausgearbeitete Philosophie geleitet. Wenn sie Argumente suchte, verließ sie sich nur allzu bereitwillig auf die Marktwirtschaft und ignorierte die tieferen Wurzeln des Konservativismus in Theorie und Praxis der bürgerlichen Gesellschaft. Ihre flüchtige Bemerkung »so etwas wie Gesellschaft gibt es nicht« wurde von meinen Universitätskollegen schadenfroh zitiert, als Beweis für ihren groben Individualismus, ihre Unkenntnis der Sozialphilosophie und ihre Untertanentreue gegenüber der neuen Generation von Geschäftsleuten, die in drei Worten zusammengefasst werden kann: Geld, Geld, Geld.
Dabei war das, was Thatcher bei dieser Gelegenheit meinte, ziemlich richtig, nur war es das genaue Gegenteil von dem, was sie wörtlich sagte. Sie meinte durchaus, dass es so etwas wie Gesellschaft gebe, aber diese sei nicht identisch mit dem Staat. Die Gesellschaft besteht aus Menschen, die sich frei zusammentun und Gemeinschaften mit gemeinsamen Interessen hervorbringen, die die Sozialisten nicht das Recht haben zu kontrollieren und die Obrigkeit nicht das Recht hat zu verbieten. Aber es war nicht Thatchers Art, sich in dieser Weise auszudrücken, und es war auch nicht das, was ihre Anhänger von ihr erwarteten. Was die britische Öffentlichkeit wollte und bekam, war eine instinktive Politikerin, bei der sie sofort erkannten, dass sie für die Nation sprach, egal ob sie die richtigen abstrakten Argumente fand oder nicht.
Natürlich spürte sie den Wind der intellektuellen Verachtung, der um sie herum wehte und verschanzte sich hinter der Prätorianergarde ihrer Wirtschaftsberater, die gekonnt über »marktwirtschaftliche Lösungen«, »angebotsorientierte Wirtschaftslehre«, »die Unabhängigkeit der Konsumenten« und alles andere sprachen. Aber diese modischen Slogans beherrschten nicht ihre Kernüberzeugungen. Ihre wichtigsten Reden ebenso wie ihre bleibenden politischen Entscheidungen entstammten dem Bewusstsein der Treue zur Nation. Sie glaubte an unser Land und seine Institutionen und sah sie als die Verkörperung über Jahrhunderte gehegter und bewahrter sozialer Zuneigung. Die Familie, die bürgerlichen Zusammenschlüsse, die christliche Religion und die Common-law-Gerichtsbarkeit gehörten alle zusammen zu ihrem Ideal der Freiheit in Gesetzlichkeit. Es war sehr bedauerlich, dass sie keine Philosophie hatte, mit der sie ihr Ideal hätte artikulieren können, und so wurde der »Thatcherismus« zu einer Karikatur des konservativen Denkens, erfunden von den Linken, um die Rechten lächerlich zu machen.
Dabei hatte Thatcher durchaus eine Wirkung auf ihre linken Kritiker. Die von ihr eingeleiteten Veränderungen waren so groß, dass die Labour-Partei fortan ihre viktorianischen Spinnweben abstreifen musste: Die Labour-Partei ließ Absatz IV ihres Grundsatzprogramms (das Bekenntnis zur sozialistischen Wirtschaft) fallen, und eine Partei der neuen Mittelschicht wurde geboren, die nichts mehr von der alten Agenda behielt, außer den Wunsch, die Oberschicht zu bestrafen, und die Überzeugung, dass der beste Weg dies zu tun, das Verbot der Fuchsjagd sei. Dieser Sache wurden unter der Regierung Tony Blairs insgesamt 220 Stunden parlamentarischer Arbeit gewidmet, während er nur eine Debatte von 18 Stunden zuließ, bevor das Land in den Irakkrieg zog.
Damals allerdings stand nicht so sehr Thatchers innenpolitische Wirkung im Zentrum des Interesses, sondern ihre Präsenz auf der internationalen Bühne. Ihr Bekenntnis zur Atlantischen Allianz und ihre Bereitschaft, Seite an Seite mit Präsident Reagan der sowjetischen Bedrohung zu trotzen, hatte die Atmosphäre in Osteuropa grundlegend verändert. Plötzlich erfuhren die bis dahin vom totalitären Alltag gebrochenen und unterworfenen Menschen, dass es westliche Führer gab, die auf ihre Befreiung drängten. John O’Sullivan hat in seinem Buch gewichtige Argumente dafür vorgebracht, dass die gleichzeitige Führerschaft von Reagan, Thatcher und Johannes Paul II. der Grund für den Zusammenbruch der Sowjetunion war.18 Meine eigenen Erfahrungen unterstützen diese Annahme.
Denn um diese Zeit erlebte ich einen neuen politischen Aufbruch. Während der 1970er-Jahre arbeitete ich mit einigen Freunden daran, die Conservative Philosophy Group aufzubauen. Das Ziel war, Parlamentarier, konservative Journalisten und Akademiker zusammenzubringen, um die Grundlagen der von ihnen geteilten Weltanschauung zu diskutieren. Und dann, 1979 schrieb ich das Buch The Meaning of Conservativism, was ein energischer Versuch war, der marktliberalen Ideologie der Thatcher-Think-tanks zu widersprechen. Ich wollte die Konservativen daran erinnern, dass es sehr wohl etwas wie Gesellschaft gab, und es gerade die Gesellschaft sei, um die sich im Konservativismus alles drehe. Ich war davon überzeugt, dass »Freiheit« keine klare oder ausreichende Antwort auf die Frage ist, woran Konservative glaubten. Wie Matthew Arnold19 bin ich der Meinung, »dass Freiheit ein sehr gutes Pferd ist, aber nur, um darauf irgendwohin zu reiten«.
Während des Aufstiegs von Margaret Thatcher konnte ich mir gar nicht vorstellen, was mit unserer immer noch sicheren und behaglichen Welt passieren würde, wenn man uns alle grundlegenden Freiheiten nehmen würde. Ich wog mich in falscher Sicherheit auf einer beschaulichen Insel und hatte keine Ahnung vom Regime der Angst und des Nihilismus, das die Kommunisten unweit von uns im Osten errichtet hatten. Besuche in Polen und der Tschechoslowakei 1979 führten mir die Realität vor Augen. Ich erlebte selbst, was Orwell beobachtete, als er an der Seite der Kommunisten im Spanischen Bürgerkrieg gekämpft und danach so ausdrucksvoll in seinem Buch 1984 beschrieben hatte. Ich sah nun in der Realität die Fiktionen, die in den Hirnen meiner marxistischen Kollegen herumschwammen. Ich betrat das Reich Hobsbawmia und spürte den kranken Zauber einer vollständig entzauberten Welt.
Ich wurde eingeladen, im Rahmen eines Privatseminars in Prag zu sprechen. Das Seminar wurde von Julius Tomin veranstaltet, einem Prager Philosophen, der versucht hatte, die Helsinki-Vereinbarungen von 1975 für sich zu nutzen, denen die tschechoslowakische Regierung angeblich Folge leistete, indem sie die Informationsfreiheit und Grundrechte achtete, wie sie in der UN Charta niedergelegt worden waren. Die Helsinki-Vereinbarungen waren eine Farce, die die Kommunisten dazu nutzten, potenzielle Unruhestifter zu identifizieren, während sie leichtgläubigen westlichen Intellektuellen gegenüber vorgaben, zivilisierte Regierungen zu sein. Dr. Tomins Seminar trat trotzdem regelmäßig zusammen, man versicherte mir, dass ich willkommen sei und freudig erwartet werde.
Ich erreichte das Haus, nachdem ich durch stille und verlassene Straßen gegangen war, in denen die wenigen Herumstehenden anscheinend dunkle dienstliche Geschäfte erledigten, und in denen jedes Gebäude durch Parteilosungen und -symbole entstellt war. Auch das Treppenhaus des Wohnhauses war völlig verlassen. Überall lag eine erwartungsvolle Stille in der Luft, als sei ein Luftangriff angekündigt worden, als sei die Stadt vor ihrer unmittelbar bevorstehenden Zerstörung in Deckung gegangen. Vor der Wohnung allerdings begegnete ich zwei Polizisten, die mich ergriffen, als ich die Klingel drückte, und nach meinen Papieren verlangten. Dr. Tomin kam heraus, ein Wortwechsel folgte, woraufhin ich die Treppen heruntergestoßen wurde. Aber die Auseinandersetzung hielt an, und ich bahnte mir wieder einen Weg nach oben, vorbei an den Polizisten, hinein in die Wohnung. Ich fand ein Zimmer voller Menschen und die gleiche erwartungsvolle Stille vor. Ich erkannte, dass es tatsächlich einen Luftangriff geben würde, und dieser war ich.
In jenem Zimmer hatte sich der arg mitgenommene Rest der Prager Intelligenzia eingefunden: alte Professoren in abgenutzten Westen, langhaarige Poeten, Studenten mit frischen Gesichtern, die man wegen der »politischen Verbrechen« ihrer Eltern nicht zum Studium zugelassen hatte, Priester in ziviler Kleidung und Gläubige, Romanautoren und Theologen, ein angehender Rabbiner und sogar ein Psychoanalytiker. Auf allen sah ich die durch Hoffnung gemäßigten Zeichen des Leids und die gleiche sehnliche Erwartung, dass es jemandem wichtig sein könnte, ihnen zu helfen. Auch hatte ich entdeckt, dass sie alle den gleichen Beruf hatten: Sie waren Heizer. Manche heizten Kessel in Krankenhäusern, andere in Wohnhäusern, einer war Heizer auf einem Bahnhof, ein anderer in einer Schule. Manche waren sogar Heizer, wo es gar keine Kessel gab, und diese imaginären Kessel waren für mich ein passendes Symbol für die kommunistische Wirtschaft.
Das war mein erstes Zusammentreffen mit »Dissidenten«: mit Menschen, die zu meinem späteren Erstaunen die ersten demokratisch gewählten Führer der postkommunistischen Tschechoslowakei werden sollten. Ich verspürte sofort eine Wesensverwandtschaft mit ihnen. Nichts war ihnen wichtiger als das Überleben ihrer nationalen Kultur. Da sie vom materiellen und beruflichen Fortschritt ausgeschlossen waren, verbrachten sie ihre Tage erzwungenermaßen mit Nachdenken über ihr Land, dessen Vergangenheit und die großen Fragen der tschechischen Geschichte, die die Tschechen seit dem nationalen Erwachen im 19. Jahrhundert in einem fort beschäftigt hatten. Sie durften nicht publizieren, die Behörden verheimlichten vor der Welt, dass sie überhaupt existierten und beschlossen, ihre Spuren im Buch der Geschichte auszulöschen. Deshalb waren sich die Dissidenten des Wertes der Erinnerung so überaus bewusst. Ihr Leben war eine Übung darin, was Platon als anamnesis bezeichnete: vergessene Dinge wieder ins Bewusstsein holen. Etwas in mir wurde durch diese rührende Bestrebung wach, und ich war sofort begierig, mich ihnen anzuschließen und ihre Lage der Welt bekanntzumachen. Und ich begriff, dass anamnesis auch der Sinn meines Lebens war.