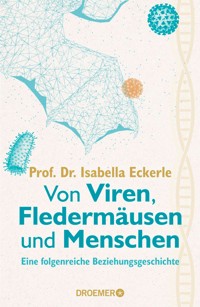
18,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Droemer eBook
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Die weltweit renommierte Virologin Isabella Eckerle über die Sprengkraft von Virus-Infektionen - ein hochaktuelles Wissenschafts-Sachbuch über Zoonosen, Pandemien und die globale Gesundheit. Tollwut, Ebola- und Marburg-Fieber, Affenpocken, Vogelgrippe, Covid-19 – allesamt gefährliche Virus-Erkrankungen. Und jedes Mal wurde das Virus von Tieren auf Menschen übertragen, um dort sein zerstörerisches Werk zu beginnen. Isabella Eckerle erforscht seit vielen Jahren die Beziehung zwischen Viren, Wildtieren und Menschen. In ihrem Buch gewährt die Expertin für neuartige Krankheitserreger erstmals faszinierende Einblicke in ihre wissenschaftliche Arbeit im Labor und im afrikanischen Urwald. In ihrem Buch gibt sie Antworten auf drängende Fragen: Wo kommen eigentlich neue Krankheitserreger her? Was sind Zoonosen und wie erforscht man sie? Werden wir nun immer häufiger Pandemien erleben? Und wieso kommen dabei eigentlich so oft Fledermäuse vor? Welche Rolle spielt unser Immunsystem bei der Bekämpfung neuer Viren? Waren unsere endemischen Viren früher auch einmal Zoonosen? Handelt es sich bei neuen Krankheitsausbrüchen um Natur-Ereignisse, oder haben wir die Möglichkeit, aktiv etwas dagegen zu tun? Die Virologin schlägt dabei einen weiten Bogen vom Ursprung und der Verbreitung zoonotischer Viren über Einblicke in die aktuelle Erforschung zoonotischer Ereignisse bis hin zur gesellschaftspolitischen Aufgabe der Gesundheitsvorsorge in Zeiten der Globalisierung. Im Mittelpunkt steht hier die brisante Frage, welche Rolle Virus-Infektionen in Zukunft für die globale Gesundheit spielen. Isabella Eckerles Resümee macht Hoffnung: Der Mensch hat es in der Hand, ob aus einer Virus-Infektion eine Pandemie wird.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 414
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Isabella Eckerle
Von Viren, Fledermäusen und Menschen
Eine folgenreiche Beziehungsgeschichte
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
AIDS, Ebola-Fieber, Vogelgrippe, Affenpocken, SARS-CoV-2 – allesamt gefährliche Virus-Erkrankungen. Und jedes Mal wurde das Virus von wild lebenden Tieren wie Fledermäusen auf Menschen übertragen, um dort sein zerstörerisches Werk zu beginnen. Isabella Eckerle erforscht seit vielen Jahren die Beziehung zwischen Viren, Wildtieren und Menschen. In ihrem Buch gewährt die Expertin für neuartige Krankheitserreger erstmals faszinierende Einblicke in ihre wissenschaftliche Arbeit im Labor und im afrikanischen Urwald.
In ihrem Buch gibt sie Antworten auf drängende Fragen: Was sind Zoonosen und wie erforscht man sie? Und warum kommen dabei eigentlich so oft Fledermäuse vor? Welche Rolle spielen einheimische Viren beim Thema Zoonosen? Und was hat das alles mit der Globalisierung, dem Klimawandel und der weltweiten Bedrohung von Ökosystemen zu tun? Isabella Eckerles Resümee macht Hoffnung: Der Mensch hat es letztlich selbst in der Hand, ob aus einer Virus-Infektion eine Pandemie wird.
Inhaltsübersicht
Widmung
Warum ein Buch über Zoonosen?
Zoonosen, was sind das eigentlich?
Exkurs: Neue und verstärkt wiederauftauchende Viren
1967 – Marburg-Virus
1976 – Ebola-Virus
1994 – Hendra-Virus
1998 – Nipah-Virus
2001 – Nipah-Virus
2002/2003 – SARS-Corona-Virus-1
2012 – MERS-Corona-Virus
2019 – SARS-Corona-Virus-2
Das Zeitalter der Epidemien
Warum immer wieder Fledermäuse?
Exkurs: Warum die Ausrottung von Fledermäusen keine Lösung ist
Der Ursprung endemischer humaner Viren
Exkurs: Wie man Krankheitserreger zurückdrängen oder verschwinden lassen kann
Einheimische zoonotische Viren
Exkurs: Wie kann man sich vor Zoonosen und neuartigen Viren schützen?
Vermeidung von Zoonosen im eigenen Umfeld und im Alltag
Vermeidung von Zoonosen auf Reisen und im Ausland
Bildteil
Auf welchen Wegen springen neue Viren über?
Von der Feldarbeit zum Labor – wie Zoonosen erforscht werden
Zoonosen – unausweichliche Naturereignisse?
Dank
Quellen und weiterführende Informationen
Für J. und L.
Warum ein Buch über Zoonosen?
Die Fledermaus veräppelt uns. Seit einer gefühlten Ewigkeit schauen wir dabei zu, wie der schwarze Schatten lautlos über unseren Köpfen gaukelt, über und unter dem Netz durch, im Slalom um die Seitenstangen des Netzes herum, wenige Zentimeter an unseren Stirnlampen vorbei, sodass man in der schweren, feuchtwarmen Nachtluft bisweilen sogar den Windhauch ihrer Flügel auf dem verschwitzten Gesicht spürt. Aus dem Lichtkegel heraus verschwindet sie wieder im Pechschwarz, um nach einigen Kreiseln zurückzukommen und das Flugmanöver noch mal zu vollführen. Auch meine Kollegin, eine gestandene Fledermausbiologin, ist überrascht über die Fähigkeit, unser aufgespanntes Netz so klar zu erkennen und es mit einer solchen Präzision zu umfliegen. Eigentlich sollte die Fledermaus das gar nicht können, denn die feinen Fäden sind zu dünn, um vom Echolot der Fledermaus erkannt zu werden. Tja. Die Fledermaus denkt nicht daran, das Netz zu streifen oder gar blind hineinzufliegen und sich in den feinen Maschen zu verheddern, sodass wir sie vorsichtig entwirren und beproben können. Beproben, das heißt, mit einem winzigen Tupfer je einen Rachen- und Rektalabstrich zu nehmen und einige Mikroliter Blut, um darin nach neuen Krankheitserregern zu forschen. Im Moment frage ich mich aber, wer hier eigentlich wen erforscht. Nach ein paar weiteren Runden verliert sie das Interesse an uns Eindringlingen und flattert endgültig davon. Wir bleiben arbeitslos an unserem Campingtisch sitzen und starren in den nachtschwarzen Regenwald. Wie wir so dasitzen, frage ich mich, wie viele Erreger da draußen in dieser Dunkelheit sind, die uns bisher so knapp verpasst haben wie wir gerade die neugierige Fledermaus.
Es ist Juni 2015, und ich bin als Virologin mit einem Team von Wissenschaftler*innen im Wakka-Nationalpark in Gabun in Zentralafrika unterwegs, um neuartige Krankheitserreger in Fledermäusen zu erforschen. Wie so oft, wenn man wissenschaftliche Forschung betreibt, läuft es nicht ganz so wie geplant, und die logistisch sehr aufwendige Expedition in den unberührten Regenwald, von dem wir uns eine Fülle an Fledermaus-Proben erhofft hatten, hat uns bisher nur eine mickrige Handvoll Proben beschert, während wir in der Woche zuvor in den Feldern und Dörfern sehr schnell Hunderte von Proben sammeln konnten.
Wie bin ich zu dieser Arbeit gekommen? Ich habe Medizin studiert und habe mich nach einer kurzen klinischen Tätigkeit dem Thema gewidmet, für das mein Herz schlägt und das mich wie kein anderes fasziniert: neuartige Viren an der Schnittstelle zwischen Tier und Mensch zu erforschen. Früher war es oft eine holprige Unternehmung, jemandem zu erklären, warum man sich als Humanmedizinerin für dieses Thema interessiert. »Du bist doch eigentlich Ärztin, warum beschäftigst du dich mit diesen komischen Fledermaus-Viren?«
»Aber diese ganzen exotischen Viren, das betrifft doch nur so wenige Menschen, im Ernst, das ist doch nicht wirklich von Bedeutung.« An diese beiden Aussagen habe ich während der Corona-Virus-Pandemie oft gedacht. Heute braucht es keine Erklärung mehr, was Virolog*innen machen und warum neuartige Viren ein wichtiges Forschungsfeld sind.
Zoonosen gibt es aber nicht erst seit der Covid-19-Pandemie, und viele Viren, die wir heute als typische »Menschenviren« kennen, sind vor langer, langer Zeit – wir wissen nicht, wie lange – aus einem Tier in den Menschen übergesprungen. Und immer wieder spielen Fledermäuse – genauer gesagt: die Fledertiere, zu denen neben den Fledermäusen auch die Flughunde gehören – beim Ursprung von neuen und alten menschlichen Viren eine Rolle (Fledertiere haben allerdings von den Virolog*innen für lange Zeit auch mehr Aufmerksamkeit bekommen als andere Säugetiergruppen, und auch in diesem Buch stehen sie im Vordergrund, denn sie sind einfach faszinierende Tiere. Dennoch soll nicht unerwähnt bleiben, dass es auch andere, ebenfalls zoonotisch wichtige Säugetiergruppen gibt, auf die ich stellenweise eingehen werde).
Seit über zwanzig Jahren beschäftigt man sich in der Wissenschaft intensiv mit zoonotischen Viren, und eine Fülle an Wissen liegt mittlerweile vor. Darunter viele, viele Fallstudien von anderen Erregern, die near misses waren, also »Beinahe-Pandemien«, Infektionsereignisse, die es gerade so nicht geschafft haben, sich weltweit auszubreiten. Entweder, weil diese Viren noch nicht die richtige Kombination ihrer Gene für die Vermehrung im Menschen gefunden haben oder die Übertragung noch nicht effizient genug war. Entweder, weil das Immunsystem des neuen Wirts es geschafft hat, den Eindringling sofort zu überlisten, oder aber, weil es zu stark, oder überhaupt nicht reagiert hat, und der neu eroberte Wirt zu schnell gestorben ist, bevor er das Virus weitergeben konnte. Vielleicht auch, weil das Flugzeug, das überfüllte Sammeltaxi oder der nächste Tiertransport verpasst wurde.
Viele dieser zoonotischen Übergänge hätten Hinweise liefern und uns als eine unvollständige, aber doch hilfreiche Blaupause dienen können, um die Covid-19-Pandemie vielleicht nicht zu verhindern, aber doch dafür zu sorgen, dass die Welt nicht ganz so unvorbereitet in diese Geschichte hineinstolpert. Dennoch stehen wir mit der Erforschung dieser Viren erst am Anfang. Das elektrisiert mich und deprimiert mich zugleich: Es gibt noch so viel zu verstehen, viel mehr, als in ein einzelnes Forscherleben hineinpasst. Denn da draußen ist noch eine unvorstellbar große Anzahl an Viren, über die wir nichts wissen. Man schätzt ihre Zahl auf etwa 1,6 Millionen, von denen knapp die Hälfte die Fähigkeit haben könnte, auch Menschen zu infizieren. Jeden Tag versuchen einige davon an irgendeinem Ort der Welt gerade den Übergang in einen neuen Wirt. Vielleicht auf einem gut versteckten, illegalen Wildtiermarkt in Asien, vielleicht in einem kleinen, entlegenen Dorf in Zentralafrika, vielleicht auf einer schlammigen Ackerfläche frisch gerodeten Regenwalds in Südamerika. Oder in einer Massentierhaltung in einem Industrieland. Und wir haben sogar schon einen Namen dafür reserviert: »Krankheit X«. Niemand weiß, wie diese Krankheit genau aussehen und wann sie kommen wird, aber wir können mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit sagen, dass sie kommen wird.
Dieses Buch wirft einen Blick auf neue, alte und künftige Viruskrankheiten und beschreibt, wie Viren und ihre Wirte, Wildtiere und Nutztiere, Ökosysteme und der Mensch interagieren: wo die Vielzahl der heutigen »Menschenviren« ihren Ursprung hat, wodurch zukünftige Krankheitsausbrüche wahrscheinlich begünstigt werden und was das für unsere und für die Gesundheit unserer Kinder bedeutet. Es geht aber auch um die Erkenntnis, dass der Übersprung der allermeisten zoonotischen Viren auf den Menschen überhaupt nichts Schicksalhaftes an sich hat. Denn die Ökosysteme, in denen Wildtiere und ihre Erreger eine Jahrtausende bis Jahrmillionen lange Koevolution durchlaufen haben und eine fein ausbalancierte, friedliche Koexistenz entwickelt haben, werden immer mehr aus ihrem Gleichgewicht gebracht – durch menschliche Eingriffe. Wissenschaftler*innen bezeichnen unser heutiges Zeitalter auch als das Anthropozän, das Zeitalter, in dem menschengemachte Veränderungen zu den wichtigsten Stellschrauben für das Leben auf der Erde geworden sind. In wenigen Hundert Jahren hat der Mensch das Gesicht der Erde unwiderruflich verändert, ihre Oberfläche an seine Bedürfnisse angepasst, mit weitreichenden Konsequenzen. Dazu gehört, dass die letzten unberührten Nischen, in denen Erreger und ihre Wirte koexistieren, erschlossen und geplündert werden. Wildtiere werden gejagt, gehäutet, gegessen, mit fremden Arten in viel zu engen Kontakt gebracht, lebend oder tot und in Stücke zerlegt per Flugzeug rund um die Welt transportiert, landen als Delikatesse auf unseren Tellern, als Pelzkragen in unseren Kleiderschränken, als exotische Haustiere in unseren Wohnzimmern – mit all den Risiken neuer, unbekannter Viren. Domestizierte Nutztiere, genetisch hochgradig homogen und damit eine riesige gleichförmige Wirtspopulation, werden in tausend- und zehntausendfacher Zahl unter unnatürlichen, krank machenden Bedingungen gehalten, um den zunehmenden globalen Hunger nach Fleisch zu decken. Millionen Tonnen von Fleisch werden rund um die Welt transportiert – und vielleicht mit an Bord: der nächste unbekannte Krankheitserreger.
Der Klimawandel verändert Ökosysteme und zwingt Arten, sich anzupassen. Die Vielzahl an Spezialisten, die höchst komplexe und fein ausgewählte Ansprüche an ihre Lebensgrundlagen haben, verlieren ihren Lebensraum und verschwinden. Ein paar wenige, flexiblere Generalisten, die sich besser an eine veränderte Umwelt anpassen können, folgen dem menschengemachten Wandel – und mit ihnen auch ihre Viren. Alle diese Faktoren lassen es sehr wahrscheinlich erscheinen, dass die meisten von uns in ihrer Lebenszeit noch eine oder sogar mehrere weitere Pandemien erleben werden.
Aber was können wir tun, wenn wir diese Entwicklung nicht einfach hinnehmen wollen? Es gibt keinen Grund zu verzweifeln: Wie häufig und wie folgenreich künftige Ausbrüche werden und ob wir lokale Epidemien zu Pandemien heranwachsen lassen, liegt zu einem guten Teil in unserer Hand. Weil Pandemien kein Naturereignis sind, sondern überwiegend von Menschen und ihrem Verhalten verursacht sind.
Dabei triumphiert im Fall der Infektionskrankheiten wie in keinem anderen Bereich die Wissenschaft über die Natur. Neben der Sicherstellung von sauberem Trinkwasser gibt es keine wirkungsvollere Maßnahme als das Impfen, um Krankheiten und Todesfälle zu verhindern, vor allem im Kindesalter. Auch diesem Triumph ist es zu verdanken, dass ein humaner und ein tierischer Krankheitserreger komplett ausgerottet werden konnten. Das heißt, wir haben es geschafft, diese beiden Viren vollständig aus der Natur verschwinden zu lassen! Es geht um die echten Pocken (ausgerottet 1980) und die Rinderpest (ausgerottet 2011). Diese Erfolge sind eine enorme Errungenschaft! Bei den Masern und bei der Kinderlähmung (Polio) wäre es möglich und wird versucht, mit einigen Rückschlägen zwar, aber wir könnten es schaffen, wenn wir uns anstrengen. Ein einziges neu übergesprungenes Virus konnte man sogar ohne Impfung wieder aus der Zirkulation im Menschen verbannen: das SARS-Corona-Virus (was im Nachhinein als SARS-Corona-Virus-1 bezeichnet wird), das 2002/2003 genau jenen Pfad in die Menschheit gefunden hat wie 17 Jahre später das SARS-Corona-Virus-2. Gelungen ist die Verbannung des SARS-Corona-Virus-1 allein mit einer konsequenten Umsetzung von Infektionsschutzmaßnahmen wie Isolation, Quarantäne und Kontakt-Nachverfolgung.
Infektionskrankheiten haben bei allem Leid, was sie verursacht haben und noch verursachen werden, auch einen entscheidenden Beitrag zur Weiterentwicklung der Medizin geleistet, vor allem die Viren, die Meister darin sind, zelluläre Prozesse für ihren eigenen Vorteil zu nutzen. Viren sind in der Lage, eine Körperzelle so umzuprogrammieren, dass diese alle ihre verfügbaren Ressourcen in den Dienst der Virusvermehrung stellt, auch, wenn dies zwangsläufig die vollkommene Erschöpfung und den sicheren Tod des Betroffenen zur Folge hat. Diese Mechanismen aber, mit denen Viren sich eine Wirtszelle untertan machen, haben zur Identifizierung vieler wichtiger zellulärer Prozesse geführt. Die Entdeckungen durch primär virologisch orientierte Forschung haben einen enormen Beitrag geleistet, molekulare Prozesse auch bei anderen Erkrankungen wie Krebs oder Autoimmunerkrankungen zu verstehen, bis hin zur Entwicklung von Medikamenten. Man könnte also sogar sagen: Viren sind die besseren Zellbiolog*innen. Vor diesem Hintergrund sei es uns Virolog*innen verziehen, wenn wir manchmal vielleicht zu sehr von unserem Forschungsfeld schwärmen, mit dem doch viele Menschen vor allem Ängste, Krankheit und Tod verbinden. Es fehlt uns keineswegs an Empathie, sondern wir staunen über ein schier unerschöpfliches Repertoire an Strategien, in einem vergleichsweise winzigen Erbgut hinterlegt, mit dem sich Viren so viel komplexere Organismen zum Untertan machen können.
Die Verhinderung der nächsten Pandemie und die bessere Kontrolle bereits endemischer Viren geht jedoch über den Fachbereich der Medizin hinaus. Wie in der Corona-Virus-Pandemie leidlich erfahren, bleiben die Auswirkungen eines neuen Virus nicht auf den Bereich der individuellen, physischen Gesundheit beschränkt. Genauso wie die Bewältigung einer Pandemie nicht nur medizinische Aspekte umfasst, sind zur Vermeidung der nächsten Pandemie auch die Gesellschaft und die Politik gefragt. Ob »Krankheit X« unsere Welt noch einmal so durcheinanderwirbelt, wie SARS-CoV-2 es getan hat, liegt zuallererst in unserer Hand.
Auf der Suche nach dem Ursprung von Pandemien haben die Laborarbeiten von Virolog*innen viel Aufmerksamkeit bekommen, weil ein möglicher Ursprung von SARS-CoV-2 aus einem Forschungsumfeld heraus diskutiert wurde. Auch wenn es keine wissenschaftlich belastbaren Hinweise gibt, dass SARS-CoV-2 aus einem Labor heraus seinen Weg in die Menschheit gefunden hat, so liegt es dennoch im Aufgabenbereich der Wissenschaft, solche Befürchtungen zu adressieren. Auch Forschende, die sich wie ich seit vielen Jahren mit Pandemierisiken beschäftigen, konnten sich nicht in Gänze ausmalen, was für ein gesamtgesellschaftliches Erdbeben eine Pandemie auslöst und welche bitteren Konsequenzen ein neues humanes Virus im globalen Maßstab mit sich bringt. Die Erfahrung mit der Covid-19-Pandemie sollte auch den Forschungsbereich für mögliche Risiken sensibilisieren, die die konkrete Erforschung solcher Viren mit sich bringt. Gleichzeitig hat uns diese Pandemie klargemacht, wie enorm wichtig wissenschaftliche Forschung an potenziell zonotischen Viren ist. Die schnelle Entwicklung von Nachweisverfahren und Medikamenten zu SARS-CoV-2 war nur deshalb möglich, weil man bereits um diese Gruppe von Viren wusste, weil es bereits erste (wenn auch viel zu wenig) Forschung zu Medikamenten und Impfstoffen gegen Corona-Viren gab. Deshalb ist es wichtig, dass die Wissenschaft das Vertrauen in ihre Forschung erhalten kann, denn wir brauchen diese Forschung dringend. Wir Forschenden müssen erklären, warum wir weiterhin mit Viren arbeiten wollen, die ein Risiko für den Menschen darstellen, und warum dies unverzichtbar ist. Warum wir eben genau diese Orte gezielt aufsuchen, an denen wir den Erreger der »Krankheit X« erwarten, und warum wir diesen Erreger mit in unsere Sicherheitslabore nehmen – und warum wir all dies unter hohen Sicherheitsauflagen verantworten können. Ein Kooperationspartner hat dies einmal sehr schön auf den Punkt gebracht: »Wir sollten den Erreger zu Krankheit X finden, bevor er uns findet.«
Die Diskussionen in der Öffentlichkeit, die die Forschung an Viren während der Pandemie erstmals in den Blick genommen hat, sind eine Herausforderung für die Virologie, die bis dahin meist wie in einem Elfenbeinturm zurückgezogen gearbeitet und sich nur mit ihresgleichen ausgetauscht hat. Die Erfahrungen mit Covid-19 bieten aber auch die Chance, darüber zu reden, welche Konsequenzen Entscheidungsträger aus unseren wissenschaftlichen Erkenntnissen ziehen sollten. Denn auch das ist ein Teil der Wahrheit: Wissenschaftliche Forschung wird zum größten Teil aus Steuergeldern finanziert, weil wir uns als Gesellschaft einen Erkenntnisgewinn, letztlich direkt oder indirekt auch eine Verbesserung unserer Lebensbedingungen erhoffen. Umgekehrt bedeutet dies aber auch, dass wissenschaftliche Erkenntnisse gesehen und gehört werden und am Ende zu politischem Handeln führen. Dass Wissenschaftler*innen mit ihren Erkenntnissen nicht immer nur willkommen sind, haben die Kolleg*innen aus dem Bereich der Klimaforschung schon lange vor uns erfahren, wir Virolog*innen haben diese Erfahrung nun auch gemacht.
Unsere Gegenwart ist vor eine Reihe großer Herausforderungen gestellt, die unsere nächste und weitere Zukunft wesentlich bestimmen werden: die Klimakrise, der Verlust von Biodiversität, die steigende Nachfrage nach Ressourcen durch eine weiterhin zunehmende Bevölkerung und das damit verbundene Risiko weiterer Pandemien betreffen uns alle. Aber auch die Lösung dieser Probleme kann nur in der Zusammenarbeit von Wissenschaft, Politik und Gesellschaft gelingen. Wenn ich eine Botschaft mit diesem Buch vermitteln möchte, dann diese: Die Verhinderung von Pandemien und die Kontrolle von Krankheitserregern geht Hand in Hand mit den anderen Herausforderungen, die die Zukunft an uns stellt. Wenn wir weitere Pandemierisiken minimieren wollen, müssen wir die Distanz zwischen uns und dem »wilden Leben« vergrößern. Wir müssen jedem Lebewesen seinen eigenen, ausreichenden Platz einräumen, an dem eine würdevolle Existenz möglich ist. Denn auch wenn es in anderen Arten noch eine immense Fülle an unbekannten Viren gibt: Solange der Kontakt nur ein vorsichtiges Beäugen bleibt, solange wir oder unsere Nutztiere der Vielzahl an unbekannten Viren nicht als neue Wirtsspezies »ins Netz« gehen – so wie unsere kluge Fledermaus damals im Wakka-Nationalpark –, so lange stellen weder Wildtiere noch ihre Viren eine Gefahr für uns dar.
Zoonosen, was sind das eigentlich?
Die erste Infektionswelle begann im Februar und zog sich bis in den März hinein. Plötzlich hörte man überall ein Husten und Niesen, und über die Hälfte der Erkrankten war durch ein schweres Krankheitsbild gezeichnet.
Am stärksten hatte es die kleine Betty erwischt, die erst zwei Jahre alt war, als der Ausbruch begann. Was zunächst als Erkältung anfing, hatte sich bei ihr nach kurzer Zeit lebensbedrohlich bis in die Lunge ausgebreitet. Bald schon schaffte es ihr kleiner Körper nicht länger, dagegen anzukämpfen. Am Ende hat sie den Kampf gegen den Erreger verloren und verstarb.
In der Autopsie zeigte sich das ganze Ausmaß der Infektion: Die Oberfläche ihrer Lunge wies fleckenhafte Einblutungen auf, und zwei Drittel ihrer beiden Lungenflügel hatten sich so stark verdichtet, dass kaum noch ein Gasaustausch möglich gewesen war. Die eingeatmete Luft kam allerdings auch kaum noch in der Tiefe der Lunge an, denn ihre Bronchien waren vollständig mit Schleim ausgefüllt. Auch ihre Leber war bereits in Mitleidenschaft gezogen, sie war unter der Infektion angeschwollen, und das Blut darin hatte sich bereits aufgestaut. Todesursache: schwere akute Lungenentzündung. Und nicht nur Betty, sondern auch noch vier weitere Familienmitglieder im Alter zwischen 24 und 58 Jahren starben während des Infektionsausbruchs.
Um zu verstehen, um welchen Erreger es sich hier handelt, wurde bei der Autopsie mit einem dünnen Plastikstäbchen, an dessen Spitze sich feinste Polyesterfäden befinden, direkt nach Bettys Tod Abstriche aus ihrem Rachen, ihrer Luftröhre und ihrer Lunge genommen. Mithilfe dieser Abstriche wollte man die genaue Todesursache erforschen, und man fand ein Rhinovirus. Diese Viren sind die mit am häufigsten auftretenden Infektionen beim Menschen, und man schätzt, dass über die Hälfte der winterlichen Erkältungskrankheiten – banal: der Schnupfen – ihnen zuzuschreiben sind. Aber warum hat ein Schnupfenvirus die kleine Betty und ihre erwachsenen Familienmitglieder getötet?
Weil es sich bei Betty nicht um einen Menschen, sondern um ein Schimpansenmädchen gehandelt hat. Betty und ihre Familienmitglieder sind an einer Zoonose gestorben.
Der Ausbruch im Jahr 2013 im Kibale-Nationalpark in Uganda war der erste, bei dem ein menschliches Rhinovirus als Auslöser einer Zoonose bei Schimpansen festgestellt wurde.
Eingetragen wurde das Virus, das Betty getötet hat, wohl durch einen infizierten Menschen – vielleicht durch Tourist*innen, die dort Menschenaffen aus nächster Nähe beobachten wollten, durch Parkwärter*innen oder Forschende, von denen einer zum Zeitpunkt des Besuchs eine laufende Nase oder etwas Halskratzen hatte, sich gerade in die Hand geniest oder gehustet und über eine Schmierinfektion das Virus in das Umfeld der Affen gebracht hatte. Vielleicht hatten sich die Schimpansen auch bei einem ihrer gelegentlichen Ausflüge aus dem Park heraus angesteckt, bei dem sie sich auf den angrenzenden Feldern an den Feldfrüchten der dort heimischen Bauern gelabt hatten, und so in die Nähe von Menschen gekommen waren. Die meisten Leserinnen und Leser werden bei Zoonosen oder neuen gefährlichen Viren wohl bisher an Erreger gedacht haben, die unsere eigene, menschliche Gesundheit bedrohen. Und es mag an dieser Stelle erstaunen, dass ein für uns Menschen harmloses Virus für den Tod einer anderen Spezies verantwortlich sein kann – in der Welt der zoonotischen Viren ist dies allerdings nicht die Ausnahme, sondern die Regel.
Das Wort Zoonose ist griechischen Ursprungs: »zōon« für »Tier« und »nósos« für »Krankheit«. Nach der Definition der Weltgesundheitsorganisation von 1959 umfassen Zoonosen alle Infektionskrankheiten, die auf natürliche Weise zwischen dem Menschen und anderen Wirbeltieren übertragen werden können – durch Viren, Bakterien, Parasiten, Pilze und Prionen. In diesem Buch geht es um die viralen, also durch Viren ausgelöste Zoonosen. Von allen genannten Erregern haben Viren das größte Potenzial für eine Epidemie oder Pandemie – das verdanken sie einer Reihe an biologischen Eigenschaften, die später noch näher erläutert werden. Da diese Definition nur Wirbeltiere umfasst, gehören Krankheiten, wie sie beispielsweise durch blutsaugende Moskitos oder Zecken übertragen werden, im strengen Sinne also nicht dazu, da es sich um wirbellose »Wirte« handelt – auch wenn die genannten Krankheiten oft zusammen mit den Zoonosen genannt werden (Mensch und Tier, die von einem Virus befallen werden, bezeichnet man als Wirte).
Die Liste an alten und neuen viralen Zoonosen ist lang, und selbst wenn man nur die Erreger listet, die vom Tier aus ihren Weg in den Menschen gefunden haben, liest sie sich erschreckend: Dazu gehören das humane Immundefizienz-Virus (HIV), Tollwut-Viren, Ebola-, Marburg- und Lassa-Viren, die Erreger der Vogelgrippe und der Schweinegrippe, das MERS-Corona-Virus, SARS-Corona-Virus 1 und 2, das Affenpocken-Virus, Hanta- und Borna-Viren, Hendra- und Nipah-Viren und noch viele andere mehr, zum Teil mit seltsam anmutenden Namen und oft plötzlich unerwartetem Auftreten.
Im April 2023, da ich diese Zeilen schreibe, zirkuliert eine ganze Wolke an neuen SARS-CoV-2-Unterlinien der Omikron-Variante, ihre Bedeutung für den weiteren Verlauf der Covid-19-Pandemie ist noch unklar. Im Jahr zuvor gab es einen weltweiten Ausbruch mit dem Affenpocken-Virus mit anhaltender Mensch-zu-Mensch-Übertragung. Ob es einfach begünstigende Umstände zu dieser Übertragung waren oder aber Veränderungen in der Ökologie oder Biologie des Virus, die zu diesem Ausbruch geführt haben, ist bislang nur wenig verstanden. Ein besorgniserregender Ausbruch mit dem Sudan-Ebola-Virus, jetzt schon einer der größten, trat 2022 in Uganda auf – er konnte zum Glück zum Erliegen gebracht werden. Gleich zwei neue Ausbrüche mit dem Marburg-Virus wurden in Äquatorialguinea und Tansania in der ersten Jahreshälfte von 2023 verzeichnet. Kürzlich wurde ein weiteres neues Corona-Virus, rekombiniert aus einem Hunde- und Katzen-Corona-Virus bei Kindern mit Lungenentzündung in Malaysia entdeckt und zeitgleich, am anderen Ende der Welt, eine fast identische Virussequenz bei einem erkrankten Gesundheitsmitarbeiter gefunden nach Rückkehr aus einem Einsatz in Haiti. In Ost-China wurde bei fieberhaft erkrankten Bauern ein neues Virus entdeckt: ein weiteres Mitglied der Henipa-Viren, zu denen auch die beiden hochpathogenen Hendra- und Nipah-Viren gehören, die schwerste Gehirnentzündungen im Menschen auslösen können. Und dies sind nur ein paar Beispiele aus dem Zeitraum, in dem dieses Buch entstanden ist – die Liste ließe sich noch lange fortführen.
Virale Zoonosen scheinen plötzlich überall zu sein, in immer größerer Geschwindigkeit aufzutauchen, und seit der Covid-19-Pandemie werden solche Berichte weltweit mit größter Aufmerksamkeit wahrgenommen.
Aber selbst Viren, die heute nur noch im Menschen zirkulieren und deren Herkunft wir gar nicht hinterfragen, haben vor langer Zeit ihren Weg als Zoonose in den Menschen gefunden: Dazu gehören zum Beispiel die Masern, die vier endemischen Corona-Viren, die etwa für ein Viertel aller Erkältungen verantwortlich sind, sowie einige menschliche Hepatitisviren. Bei einigen mehr vermutet man einen zoonotischen Ursprung, kann aber die Übergangsschritte nicht mehr zuverlässig rekonstruieren. Zoonosen gibt es schon sehr lange. Das Hin und Her von Viren zwischen Mensch und Tier ist ein Teil unserer Geschichte – und dennoch wird eine echte Zunahme von zoonotischen Ereignissen in den vergangenen Jahrzehnten verzeichnet. Immer mehr von diesen Ereignissen finden statt, breiten sich immer schneller aus, betreffen mehr Menschen, als dies vor Jahrzehnten noch der Fall war. Bei der Suche nach den zoonotischen Ursprüngen von humanpathogenen Viren entdeckte man darüber hinaus eine gigantische Vielfalt an Viren in den verschiedensten Tierarten: Zuvor unbekannte, für uns gänzlich neue Virus-Spezies, ja sogar ganze Virusfamilien treten in Erscheinung. Besonders häufig spielen dabei Fledertiere – also Fledermäuse und Flughunde – eine Rolle, die zweitgrößte Gruppe aller Säugetiere und die Einzigen, die fliegen können (siehe Abb. 1 im Bildtafelteil). Besonders viele, für den Menschen gefährliche Viren oder zumindest deren nahe Verwandte hat man in den vergangenen Jahren in dieser Säugetier-Ordnung nachgewiesen.
Gleichzeitig zeigt uns diese enorme Anzahl an neu entdeckten Viren aber auch, dass die allermeisten dieser Viren kein Risiko für den Menschen darstellen, sie werden sehr wahrscheinlich immer Tierviren bleiben. Nur ein winziger Bruchteil von ihnen trägt ein gewisses Potenzial in sich, neue Epidemien oder gar Pandemien auszulösen, wenn diesen Viren die Gelegenheit für einen Wirtswechsel gegeben wird.
Zu den neuartigen Viren gesellen sich aber vermehrt auch bereits altbekannte Viren, die man in den meisten Regionen der Welt weitgehend unter Kontrolle geglaubt hatte, z.B. die Polio oder Masern. Und auch Viren, die man über Jahrzehnte für unkritisch hielt, die kaum Ausbrüche verursacht hatten und denen man deshalb bisher kaum Aufmerksamkeit geschenkt hatte, überraschen uns plötzlich – so wie beispielsweise das von Moskitos übertragene Zika-Virus. Manche Viren sind bereits seit langer Zeit in bestimmten geografischen Regionen der Welt als problematisch erkannt, da die Krankheiten, die mit diesen Viren einhergehen, aber nicht die westliche Welt betreffen, wurden sie vernachlässigt. Das beste Beispiel hierfür ist das Affenpocken-Virus, das seit Jahrzehnten jedes Jahr für schwere Krankheitsfälle vor allem bei kleinen Kindern und schwangeren Frauen in Subsahara-Afrika verantwortlich ist. Eine Zunahme der Fälle dort wurde ebenfalls seit einiger Zeit beobachtet – globale Aufmerksamkeit sowie umfangreiche Investition in die Forschung an Medikamenten und Impfstoffen gibt es aber erst seit dem ersten weltweiten Ausbruch im Jahr 2022.
Dank Weiterentwicklungen in der molekularbiologischen Technik sind Wissenschaftler*innen besser und sehr viel schneller darin geworden, neue Viren zu entdecken. Dennoch ist dies keine ausreichende Erklärung allein für den Anstieg dieser Ereignisse: Neue und verstärkt wieder auftretende Zoonosen werden zunehmend zu einer Bedrohung und in Zukunft sehr wahrscheinlich in noch höherer Frequenz auftreten.
Die Übertragung einer Zoonose kann in zwei Richtungen gehen: vom Wirbeltier auf den Menschen oder umgekehrt, vom Menschen auf ein Wirbeltier. Meistens ist beim Begriff Zoonose aber die Infektionsrichtung vom Tier zum Menschen gemeint.
Und hier genau beginnt das Dilemma: Die Geschichte der Medizin und die Forschung an Krankheitserregern hat zunächst den Menschen im Blick und hat sich für sehr lange Zeit in erster Linie für die Erreger interessiert, die den Menschen krank machen. Und darüber hinaus für jene Erreger, die unsere Nutz- und Haustiere befallen. Daraus sind die beiden großen medizinischen Disziplinen entstanden, die wesentliche Grundlagen für die Virologie und die Zoonosenforschung geliefert haben: die Humanmedizin und die Tiermedizin. In einem solchen menschzentrierten Verständnis von Gesundheit und Krankheit wundert es also nicht, dass die Definition einer Zoonose zwischen uns (eine Art) und den anderen Wirbeltieren (mehr als 70000 Arten) unterscheidet. Aus einer menschlichen Perspektive erscheint es logisch, Infektionskrankheiten danach einzuteilen, ob sie uns direkt betreffen – dann erscheinen sie uns besonders wichtig und Forschung wert – oder ob sie »nur« in der Tierwelt eine Rolle spielen, zu der wir uns ja in der Regel nicht zählen. Betrifft es domestizierte Arten, vor allem solche, die wir gern essen oder mit denen wir gern kuscheln, dann sind solche Erreger ebenfalls von großem Interesse – sie gefährden nicht nur unsere Nahrungsversorgung oder machen unsere Haustiere krank, sondern sie können enorm hohe wirtschaftliche Schäden verursachen, beispielsweise durch Einschränkungen im Handel oder durch die Vernichtung von tierischen Produkten in großem Maßstab.
Betrifft ein neues Krankheitsgeschehen Wildtiere, so bleibt die Aufmerksamkeit begrenzt – wenn es denn überhaupt registriert wird. Die Geschichte von Betty hat es bei der Veröffentlichung der wissenschaftlichen Studie zwar in einige Zeitungen geschafft, sicher auch, weil Menschenaffen viel Sympathie und Interesse in uns hervorrufen, mehr als viele andere Tierarten. Aber meist scheinen Krankheitsausbrüche bei Wildtieren sehr weit weg von uns und unserem Alltag. Es mag auf den ersten Blick unwichtig für unsere eigene Gesundheit sein, dass auch Wildtiere von neuen Krankheitserregern befallen werden, daran erkranken oder gar sterben. Aber neuartige Krankheitsausbrüche mit teils verheerenden Ausmaßen sind nichts, was ausschließlich den Menschen betrifft – auch Wildtiere bleiben davon nicht verschont. Und sehr häufig findet sich ein immer wiederkehrendes Muster: Ein Erreger, der in einer bestimmten Tierart oder Region örtlich begrenzt, also endemisch auftritt, wird plötzlich in eine andere Art, eine andere Population oder Region eingetragen, und ein neues Infektionsgeschehen nimmt seinen tragischen Lauf – manchmal bis hin zur kompletten Auslöschung einer Tierart.
Prominente Beispiele der letzten Jahrzehnte sind zwei Pilzerkrankungen, die eine hat durch das Weißnasen-Syndrom mit dem Pilz Pseudogymnoascus destructans zum millionenfachen Tod von Fledermäusen in Nordamerika geführt, die andere durch den Chytridpilz, Batrachochytrium dendrobatidis, zu einem Massensterben bei Amphibien. Bei beiden Krankheiten vermutet man einen menschengemachten Ursprung: Der Pilz, der das Weißnasen-Syndrom auslöst, wurde wahrscheinlich von Höhlenforschenden mit kontaminierter Kleidung oder Ausrüstung von einer Höhle zur nächsten getragen. Und: Nachdem man sich auf die Suche nach ihm gemacht hat, hat man ihn auch in Europa und China entdeckt – ohne dass er hier Fledermäuse krank macht. Eine mögliche Ursache dafür ist, dass die Fledermäuse in der Alten Welt an den Pilz angepasst sind. Da es natürlicherweise keinen Kontakt zwischen Fledermäusen der Alten und Neuen Welt gibt, liegt auch hier nahe, dass es Menschen waren, die den Pilz aus der Alten Welt in die amerikanischen Fledermaushöhlen eingetragen haben.
Der Chytridpilz der Amphibien hingegen stammt ursprünglich aus Afrika, wo man ihn auf der Haut der afrikanischen Krallenfrösche findet. Diese sind gegen die krank machende Wirkung des Pilzes immun. In den 1940er-Jahren gab es zu medizinischen Zwecken plötzlich großes Interesse an diesen Fröschen – sie wurden weltweit gehandelt, und mit ihnen verbreitete sich auch ihr Hautpilz. Mit verheerenden Folgen, denn die neu befallenen Amphibienarten erkranken schwer daran. Auch heute spielt der Handel mit Amphibien immer noch eine Rolle bei der Ausbreitung des Erregers. Der Handel dient allerdings nicht mehr medizinischen Zwecken, sondern verkauft sie als exotische Haustiere. Für die globale Amphibienpopulation ist er zur Tragödie geworden – etwa 500 Arten wurden massiv durch den Pilz dezimiert und 90 davon komplett ausgerottet.
Natürlich gibt es in der Welt der Viren auch eine ganze Reihe weiterer Beispiele, die gerade in diesem Moment mit höchster Aufmerksamkeit beobachtet werden: Die Afrikanische Schweinepest, eigentlich heimisch in afrikanischen Warzenschweinen, breitet sich über immer größere geografische Räume in Wildschweinen aus. Einmal infiziert, sterben über 90 Prozent der infizierten Tiere innerhalb weniger Tage elendig daran, und auch Hausschweine sind zunehmend davon betroffen. Das Virus ist außerdem extrem umweltstabil und kann selbst in verarbeiteten Fleischprodukten infektiös bleiben – ein achtlos weggeworfenes Salamibrötchen, das von einem Wildschwein gefressen wird, kann in Windeseile einen Ausbruch in einer bislang unbetroffenen Region auslösen. Für den Menschen stellt das Virus keine gesundheitliche Gefahr dar – wohl aber bedroht es Tierbestände, führt zu drastischen Eindämmungsmaßnahmen, Handelsbeschränkungen und großen finanziellen Verlusten.
Auch die Vogelgrippe ist hier zu nennen. Seit 2021 zeigt sie eine sehr hohe Infektionsaktivität von bisher nicht gekanntem Ausmaß, mit verheerender Auslöschung von Wildvogel-Populationen und dem Befall von domestiziertem Geflügel und sogar zunehmend von Säugetieren. Menschengemachte Veränderungen wie Massentierhaltung oder der internationale Handel von Tieren und Tierprodukten sind häufig die Treiber sowohl für neue Virusübergänge als auch für deren Ausbreitung bis hin zu Ausbrüchen auf globaler Ebene. In die Schlagzeilen schaffen es solche Ausbrüche jedoch selten – das Interesse und das allgemeine Bewusstsein für die Risiken, die solche Ausbrüche mit sich bringen, ist eher gering.
In unserer Selbstwahrnehmung grenzen wir uns nämlich in der Regel eindeutig von den Tieren ab, doch unsere Biologie zeichnet ein wesentlich weniger einzigartiges Bild von uns. Eine eindrückliche bildliche Darstellung aus Sicht eines Virus ist der Säugetier-Supertree, also ein kompletter (deshalb »super«) Stammbaum aller Säugetierarten – am Rande dieser Abbildung stehen die lateinischen Einzelnamen aller Säugetierspezies; aufgrund des Artenreichtums der Säuger so klein geschrieben, dass man sie in der Gesamtansicht nicht mehr lesen kann, sondern nur feine kleine Striche erkennt, wo Tausende von Artennamen stehen, die sich zu einem Kreis formen (siehe Abb. 2). Es gibt auch eine elektronische Version, in die man hineinzoomen kann und die die Dimensionen besser darstellt als die gedruckte Abbildung. Von einem einzigen der 4510 kleinen Striche in dieser Abbildung, von denen jeder eine eigene Spezies darstellt, geht ein kleiner roter Strich ab mit einer Beschriftung: »you are here« – »Du bist hier«. Eine Abbildung, die demütig macht, zeigt sie doch, dass sich der Mensch nur als eine von vielen Arten in den Stammbaum einreiht und gleichzeitig als die invasivste Spezies sich den Lebensraum und die Existenz aller anderen Arten untertan macht. Ich selbst habe in der Vergangenheit viele Stunden damit verbracht, über diesen Stammbaum zu sinnieren – denn er hing als riesiges Wandbild im Büro meines früheren Chefs Christian Drosten, in dessen Institut in Bonn ich den Grundstein für meinen Weg in die Virologie legen konnte.
Wer wie ich Humanmedizin studiert hat, der hat Viren erst mal nur aus dem Blickwinkel einer Ärztin zu betrachten gelernt, als häufige, lästige und im Gegensatz zu den Bakterien oft nur schlecht behandelbare Krankheitserreger, die den Menschen wohl schon immer geplagt haben. Zoonosen oder neuartige Virusübergänge mit Übertragungspotenzial in den Menschen spielten in meinem Studium der Humanmedizin kaum eine Rolle und werden bis heute höchstens als kuriose Randnotiz gelehrt. Als ich mich später der Forschung an Zoonosen gewidmet habe, hat sich mein humanmedizinischer Horizont aber sehr schnell erweitert! Veterinärmedizinische Kolleginnen und Kollegen, mit denen man in der Zoonosenforschung oft zu tun hat, lassen es sich meist nicht nehmen, ihre humanmedizinischen Kolleginnen und Kollegen mit einem Spruch aufzuziehen: »Wir können mehr als nur eine Spezies!« Damit haben sie auch recht. Deshalb ist die Tiermedizin einer der Studiengänge, der für eine Laufbahn in der Zoonosenforschung geradezu prädestiniert, und in dem viel mehr Wissen zu Zoonosen vermittelt wird als in der Humanmedizin.
Noch etwas prägnanter hat es Prof. Thomas Mettenleiter, der frühere Präsident des Friedrich-Loeffler-Instituts und Bundesforschungsinstituts für Tiergesundheit mir gegenüber mit einem Augenzwinkern ausgedrückt: »Humanmediziner sind eigentlich Fachtierärzte für Menschen!« Ich habe es ihm nicht übel genommen, ganz im Gegenteil: Denn je länger ich in diesem Bereich forsche, desto klarer wird mir, dass das Mensch-zentrierte Bild der Humanmedizin, ja fast der gesamten Lebenswissenschaften, uns eher im Weg steht, wenn wir den Übersprung neuartiger Viren besser verstehen wollen.
Aber wie schafft es ein Virus, eine Artengrenze zu überspringen und sich eine neue Wirtsspezies zu erobern? Zunächst muss ich einmal klarstellen: Aus der Sicht eines Virus ist die Unterteilung in Mensch und Tier beliebig, ja unbedeutend! Wenn ein Virus die Gelegenheit dazu bekommt und einen passenden Rezeptor an der Zelloberfläche vorfindet, dann ist es egal, welche Spezies sich aus diesen Zellen am Ende zusammensetzt. Einfach ausgedrückt ist ein Rezeptor die Eintrittspforte in die Zelle, also ein bestimmtes Molekül auf der Zelloberseite, zu dem das Oberflächenprotein des Virus passt wie ein Schlüssel in das Schloss. Durch die Bindung an einen Rezeptor kann das Virus an die Zelle andocken und ins Zellinnere eintreten. Das bekannteste Beispiel ist das humane Angiotensin-Converting Enzyme II, auch ACE-2 genannt, das SARS-CoV-2 als Rezeptor dient und an welches das Stachelprotein (eng. Spike) des Virus bindet.
Besonders günstig ist es für ein neues Virus, wenn eine solche Begegnung einen neuen Wirt unvorbereitet trifft und es noch keine Immunität gegenüber diesem oder einem verwandten Virus gibt – denn dann gibt es keine Antikörper und keine spezifischen Immunzellen, die sich dem Virus in den Weg stellen könnten. Genau solch eine Situation hat SARS-CoV-2 im Jahr 2020 vorgefunden: eine Population, in der kein Mitglied dem Virus eine Immunität entgegenbringen konnte, was man auch als »immun-naiv« bezeichnet. Für ein neues Virus waren das perfekte Bedingungen – so gut, dass es erst mal keine Notwendigkeit für das Virus gab, sich anpassen zu müssen. Das erklärt vermutlich auch, warum man im ersten Jahr der Pandemie nur sehr wenige Veränderungen im Erbgut des Virus fand.
Wenn es dann auf Anhieb auch noch gut klappt, die angeborene, zelleigene Alarmanlage außer Kraft zu setzen, bevor der Erreger erkannt wird, dann hat das Virus schon einen großen Teil des Weges in eine neue Spezies geschafft. Wird die Zelle dann erfolgreich manipuliert, sodass alle Ressourcen nur noch der Virusvermehrung dienen, dann kann das eindringende Viruspartikel bei seinem Vermehrungszyklus pro Zelle tausend- bis zehntausendfach Nachkommen freigeben, die wiederum bereit sind, die nächste Zelle zu infizieren. Nimmt man alle Zellen eines Zellverbandes zusammen, dann summiert sich diese Zahl schnell auf eine nur noch schwer vorstellbare Anzahl an Virus-Nachkommen.
Für SARS-CoV-2 haben Wissenschaftler*innen Berechnungen angestellt, wie viele Virionen, also vollständige Viruspartikel, am Höhepunkt der Infektion in einem 70 Kilogramm schweren Erwachsenen im Durchschnitt produziert werden. Sie sind bei der unglaublichen Anzahl von 109 bis 1011 gelandet, das sind bis zu 100 Milliarden Viruspartikel! Zählt man die Virusmenge in allen Menschen zusammen, die zu einem Zeitpunkt gerade infiziert sind, kommen die Wissenschaftler*innen auf ein Gesamtgewicht aller Virionen zwischen 100 Gramm bis 10 Kilogramm SARS-CoV-2 – es ist bemerkenswert, wie viel Ärger »nur« 10 Kilogramm Virus weltweit anrichten können.
Da es bei der Virusproduktion häufig zu Fehlern kommt, sind nicht alle Viruspartikel funktionsfähig, also infektiös, aber (im Fall von SARS-CoV-2) 105 bis 107 wahrscheinlich schon. Das heißt, 100 000 bis 10 000 000 Nachkommen sind bereit und auf der Suche nach dem nächsten Wirt. Findet nur eine kleine Anzahl davon rechtzeitig den nächsten Vertreter der gleichen Spezies und schafft es in deren Zelle zur Vermehrung, dann ist das Überleben einer weiteren Generation des Virus gesichert. Klappt auch der letzte notwendige Schritt reibungslos, und begegnen sich empfängliche Wirte häufig genug zur rechten Zeit, dann stehen die Chancen für das Virus gut, dauerhaft erfolgreiche Infektionsketten aufzubauen. Alle ehemaligen Tierviren, die heute endemisch im Menschen zirkulieren, haben diese Hürden erfolgreich genommen. Das letzte, das dies erfolgreich getan hat, ist SARS-CoV-2.
Jedoch nicht bei jedem Virus klappt es so gut: Besonders beim ersten Wechsel in eine neue Art kann jeder einzelne dieser Schritte noch leicht scheitern, die Situation für das Virus ist sehr fragil – entweder bricht die Reise bei irgendeinem der Schritte ab, und es kommt gar nicht erst zum Überschreiten einer Speziesgrenze. Oder, wenn das Eintreten in die Zelle klappt, dann klappt vielleicht die Weitervermehrung doch nur unzureichend, die Zell-Maschinerie passt nicht richtig, und die Infektionskette bricht ab. Oder aber das Virus kann sich zwar gut vermehren, tut dies aber an einem Ort, von dem man nicht so leicht zum nächsten Wirt kommt – wie zum Beispiel in den tiefen Abschnitten der Lunge. Manchmal klappt zwar die Übertragung, aber sie ist nicht sehr effizient, die Infektionsketten laufen sich dann nach wenigen Generationen aus. Ausnahmen von dieser Regel gibt es jedoch, und auch Viren, die nur schwach übertragbar sind – wie zum Beispiel das MERS-Corona-Virus – können unter bestimmten Bedingungen dennoch bedrohliche Ausbrüche auslösen, mehr dazu später.
Und manche, die wir als »neuartige« Viren bezeichnen, sind gar nicht neu – sondern wurden einfach lange Zeit übersehen. Zum Beispiel das MERS-Corona-Virus, das mindestens seit den 1980er-Jahren in Dromedaren zirkuliert (wahrscheinlich sogar schon viel länger). Den ersten Infektionsfall beim Menschen hat man jedoch erst im Jahr 2012 entdeckt. Ob vorherige Infektionen im Menschen nur nicht bemerkt wurden oder das Virus aus noch unbekannten Gründen erst später entweder die Fähigkeiten oder aber die Gelegenheit dazu bekommen hat – wir wissen es nicht. Noch weniger wissen wir über die near misses, die Beinahe-Ereignisse von Viren, die auf dem Weg in den Menschen gescheitert sind – die (noch?) nicht erfolgten Wirtsübergänge. Kommt ein Virus bei seinem Sprung in einen neuen Wirt an einer Stelle nicht weiter, bleibt es meist unter unserem Radar, der neue Zoonosen aufspüren könnte. Selbst dann, wenn es einen beachtlichen Teil von einer zur anderen Spezies sogar schon geschafft hat. Diese Beinah-Zoonosen finden wahrscheinlich sehr viel häufiger statt als die von uns wahrgenommenen Ausbrüche oder neuen Erkrankungen, die von Ärzt*innen oder Labormitarbeiter*innen herausgefischt oder in Überwachungssystemen entdeckt werden.
Dabei sind es gerade diese Ereignisse, die von besonderem Interesse für die Forschung sind – denn hier zeigen sich genau die kritischen Schritte, die zusammenkommen müssen, damit es zu einem Ausbruch, einer Epidemie oder gar Pandemie kommt. Denn: Ein einmaliges Scheitern heißt eben nicht, dass der Versuch beim nächsten Mal wieder scheitert. Die Viren, die bereits in einem Übergangsbereich ihren nächsten Wirt austesten, sind bereit, sie bringen schon einiges mit, um in der geeigneten Konstellation einen neuen Wirt für sich zu erobern. Vielleicht noch nicht perfekte, aber doch schon ganz gute Voraussetzungen. In manchen Fällen ist die biologische Ausstattung des Virus zwar nicht optimal, aber sie reicht vielleicht gerade aus, wenn der Wirt nur ein klein wenig sein bisheriges Verhalten ändert. Diese feine, noch wenig vorhersagbare und häufig überraschende Interaktion zwischen Viren und ihren Wirten fasziniert mich als Virologin bis heute stets aufs Neue. Dieser Aspekt macht das Fach so reich an Herausforderungen und erfordert eine interdisziplinäre Zusammenarbeit mit vielen anderen Forschungsfeldern.
Zoonosen, Epidemien und Pandemien werden aber nicht nur durch Viren allein ausgelöst. Sie entstehen durch die Gesamtheit der Interaktionen zwischen Umwelt, Tieren und Menschen, und das Verhalten von Letzteren spielt, direkt oder indirekt, eine besondere Rolle (siehe Abb. 4). Die Grundidee, dass die Gesundheit von Tieren, Menschen und ihrer Umwelt untrennbar zusammenhängt, ist heute bedeutsamer denn je – in der Forschung an neuen Viren und sogar über die Infektionskrankheiten hinaus. Man bezeichnet dieses Konzept auch als One Health, also eine einzige, gesamtheitliche Gesundheit – es ist eine Definition von Gesundheit, die alle drei genannten Bereiche Mensch-Tier-Umwelt umfasst.
Neu ist dieser ganzheitliche Ansatz jedoch nicht. Bereits Hippokrates (460–370 v.Chr.) hatte erkannt, dass menschliche Gesundheit von der Umwelt beeinflusst wird. Das gedankliche Grundkonzept von One Health hat Rudolf Virchow 1873 gelegt: »Zwischen Tier- und Menschenarzneikunde ist oder sollte wissenschaftlich keine Scheidegrenze sein.« Und der Ausdruck »Eine Medizin«, aus dem der Begriff One Health entstand, wurde erstmals von dem amerikanischen Tiermediziner Calvin Schwabe verwendet, einer der Begründer des heutigen One Health-Konzeptes. Von ihm stammt auch ein inspirierendes Zitat aus dem Jahr 1984: »Zu den kritischen Bedürfnissen des Menschen gehören die Bekämpfung von Krankheiten, die Sicherstellung einer ausreichenden Ernährung, eine angemessene Umweltqualität und eine Gesellschaft, in der humane Werte vorherrschen.« Worte, die aktueller denn je klingen in einer Welt, die von Epidemien und Pandemien, Klimakrise, Krieg und globaler Ungleichheit gezeichnet ist. Das One Health-Konzept erfährt international momentan große Aufmerksamkeit, und ich persönlich glaube, dass es in seiner Bedeutung gar nicht überschätzt werden kann – denn es ist genau der Ansatz, den wir umsetzen müssen, wenn es uns wirklich ernst damit ist, die nächste Pandemie zu verhindern.
Veränderte Umweltbedingungen führen zu einer Anpassung von Organismen, und eine bestimmte Gruppe von Viren bringt eine biologische Ausstattung mit, die es besonders gut ermöglicht, sich schnell an neue Bedingungen anzupassen. Diese Eigenschaft ist ihr Schlüssel zum Erfolg und der Grund, warum gerade diese Viren bei den Zoonosen eine so große Rolle spielen: Es sind die RNA-Viren, deren Erbgut nicht wie bei uns und allen anderen Lebewesen aus DNA (Desoxyribonukleinsäure) besteht, sondern aus RNA (Ribonukleinsäure).
Gerade neuartige Viruserkrankungen bei Menschen oder Tieren mit epidemischem oder pandemischem Potenzial gehen am häufigsten auf RNA-Viren zurück: HIV, SARS-Corona-Virus 1 und 2, das MERS-Corona-Virus, Ebola-, Marburg-, Influenza-, Hanta- und Borna-Virus, und alle Beispiele aus Abbildung 3. Auch DNA-Viren können Zoonosen auslösen, das aktuellste Beispiel dafür ist das Affenpocken-Virus. Dennoch sind es sehr viel seltener DNA-Viren, die neue Zoonosen auslösen.
Wie bei jedem Erbgut muss auch bei der Vermehrung von Viren das Genom kopiert werden. Das machen jeweils Enzyme, die entweder die DNA beziehungsweise RNA ablesen (je nachdem, woraus das Genom des jeweiligen Virus besteht) und nach dieser Vorlage neue Kopien anfertigen. Man kann sich das in etwa so vorstellen wie eine Schulklasse, die einen Text von der Tafel in ihre Hefte abschreiben muss. Manche Schüler und Schülerinnen machen das sehr gewissenhaft. So in etwa geschieht das bei den meisten DNA-Viren – Fehler entstehen hier nicht so schnell, und Vorlage und Abschrift sind bis auf sehr seltene Fehler identisch. Einige Schüler und Schülerinnen lesen das Geschriebene am Ende noch mal genau durch und vergleichen mit dem Originaltext – hat sich auch wirklich kein Fehler beim Abschreiben eingeschlichen? Falls doch, wird er gleich korrigiert, und der Originaltext und die Abschrift sind gleich. Genauso macht es die DNA-Polymerase in den meisten Fällen: Sie arbeitet nicht nur zuverlässig, sondern die entstandenen Kopien werden bei den meisten DNA-Viren danach sogar noch mal mittels einer Korrekturfunktion überprüft, um Fehler auszuschließen. Alle Lebewesen und auch ein Teil der DNA-Viren fertigen bei ihrer Vermehrung also vergleichsweise exakte Kopien ihres Erbgutes an, während die RNA-Viren Kopien erstellen, die eine ganze Bandbreite an kleinen Variationen aufweisen.
Das Enzym, das die RNA-Viren kopiert, die sogenannte RNA-abhängige RNA-Polymerase, arbeitet nämlich wesentlich ungenauer als das Enzym, das DNA abliest. Diese Schüler und Schülerinnen schlampen ein bisschen, immer wieder weichen die Buchstaben im Heft von denen auf der Tafel ab, dadurch verändern sich einzelne Wörter und ab und zu auch der Sinn eines Satzes. So ist es auch bei den RNA-Viren, sie mutieren stärker als die DNA-Viren: Nachkommen weichen ein klein wenig von ihren Vorgängern ab, jeder ein wenig anders als der andere. Die RNA-Viren gehören damit zu der Gruppe an Viren, die sich sehr schnell verändern können – ihre Mutationsrate ist etwa eine Million Mal höher als die unserer eigenen Zellen (siehe Abb. 5)! Und diese Wandlungsfähigkeit ist auch ein Schlüssel zum Erfolg dieser Viren: Unter veränderten Umweltbedingungen ist es unter Umständen genau eine dieser kleinen Abweichungen, die dem Virus eine Anpassung an einen neuen Wirt ermöglicht, und damit einen Überlebensvorteil verschafft!
Aber auch zwischen den RNA-Viren gibt es Unterschiede. Es mag zunächst nicht eingängig erscheinen, dass gerade die Corona-Viren, die so mühelos über Artengrenzen springen und in der Vergangenheit so eine extreme Wandlungsfähigkeit gezeigt haben, als einzige Gruppe der RNA-Viren auch eine Korrekturfunktion haben. Sie haben aber auch ein sehr großes Genom, mit etwa 30000 Nukleotiden sind sie die größten aller RNA-Viren, und zu viele Fehler bei der Vermehrung würden dazu führen, dass kaum noch funktionsfähige Viren gebildet werden. Genügend Spielraum für Mutationen, um sich schnell an einen neuen Wirt anzupassen, gibt es bei den Corona-Viren aber trotzdem ausreichend, wie man an der Ausbildung von SARS-CoV-2-Varianten gesehen hat. Noch mehr genetische Plastizität gewinnen Corona-Viren außerdem noch durch eine andere Strategie: die Rekombination – sozusagen der Sex bei Viren, bei dem ganze Stücke des Genoms zwischen Viren ausgetauscht werden.
Bei manchen Viren ist die beschriebene Variation durch Mutation so groß, dass man auch von »Quasispezies« spricht. Ein Meister darin ist das Hepatitis-C-Virus, ein RNA-Virus und Auslöser einer chronischen Leberentzündung beim Menschen. Durch seine hohe Mutationsrate, eventuell auch durch mehrere Eintragungen in den Menschen weist das Hepatitis-C-Virus eine sehr hohe genetische Vielfalt auf. Diese große Diversität ist auch ein Grund, warum es bis heute noch keine Impfung gegen dieses Virus gibt. Und obwohl Hepatitis C eine der ganz großen, medizinisch bedeutsamen viralen Erkrankungen des Menschen ist, kennt man bis heute nicht den Ursprung des Virus. Vermutet wird aber, genau, ein zoonotischer Übersprung, allerdings einer, der wahrscheinlich mehrere Tausende Jahre zurückliegt. Direkte Vorfahren des menschlichen Hepatitis-C-Virus sind nicht bekannt, aber vermutlich stehen Viren aus Kleinsäugern wie z.B. Nagetieren ganz am Ursprung aller Hepatitis-C-verwandten Viren von Menschen und anderen Säugetieren.
Dass man die Übergänge von Viren oft nicht mehr eindeutig nachvollziehen kann, liegt an einer großen Schwierigkeit, mit der man als Virolog*in konfrontiert ist: In die länger zurückliegende Vergangenheit zurückzuschauen, ist in der Virologie leider sehr schwierig. Denn RNA ist höchst fragil und anfällig für Umwelteinflüsse und zerfällt deshalb schnell. Fossilien im eigentlichen Sinne, wie wir sie von Pflanzen oder Tieren kennen, gibt es bei den Viren nicht. Allerdings hat ein Teil der RNA-Viren zumindest in Bruchstücken faszinierende Spuren aus der Vergangenheit hinterlassen. Man findet sie allerdings nicht tief in der Erde oder irgendwo im Gestein. Umgeschrieben in DNA findet man sie an einem höchst ungewöhnlichen Ort: nämlich in unserem eigenen Erbgut. Etwa 8 Prozent des menschlichen Erbguts besteht aus ehemals viraler DNA – zu einem kleinen Teil bestehen wir selbst also sogar aus viralem Material!
Bis auf dieses ungewöhnliche Überbleibsel erscheinen trotz vieler technischer Fortschritte in der Molekularbiologie die Möglichkeiten begrenzt, virale RNA aus länger zurückliegender Zeit zu finden, geschweige denn zu lesen. Das älteste sequenzierte Pflanzen-RNA-Virus ist zwar etwa 1000 Jahre alt, die ältesten Nachweise humanpathogener RNA-Viren sind jedoch deutlich jünger. Sie stammen aus Museumspräparaten, wie zum Beispiel ein Masernvirus von 1912, oder aus dem Permafrost, wo man aus einem Opfer der Spanischen Grippe das ursprüngliche Virus von 1918 rekonstruieren konnte. Ein bisschen besser haben es da die DNA-Virolog*innen: Immerhin konnte kürzlich ein Hepatitis-B-Virus sequenziert werden, welches aus einem etwa 7000 Jahre alten Zahn stammte. Ob man eines Tages auch bei den RNA-Viren so weit oder noch weiter in die Vergangenheit schauen kann, bleibt offen. Ein besonders aufregendes Forschungsgebiet, die Paläo-Virologie, hat sich genau das zur Aufgabe gemacht – ich bin mir sicher, dass wir in den kommenden Jahren noch viele überraschende Erkenntnisse zur Evolution noch aktiver und vielleicht auch ausgestorbener Viren aus alten Präparaten gewinnen werden.
Aber auch wenn der Blick in die Vergangenheit (noch?) getrübt ist, so hat die Forschung an schnell mutierenden Viren andere Vorteile. Sie erlaubt etwas, was den allermeisten Wissenschaftler*innen, die nicht-virale Lebensformen untersuchen, verwehrt bleibt: nämlich der Evolution bei der Arbeit zuzusehen. In Echtzeit, in Zeiteinheiten, die in ein einzelnes Forscherleben passen. Manchmal ist die Evolution, die man hier beobachten kann, sogar schneller, als einem lieb ist: Sie vollzieht sich innerhalb von wenigen Wochen und Monaten, wie man am Beispiel von SARS-CoV-2 und der konstanten Ausbildung an neuen Varianten beobachten kann.
Warum aber spielen gerade die Viren so eine große Rolle bei den Zoonosen, und warum geht es meist um Viren und viel weniger um Bakterien oder Parasiten, wenn wir über bedrohliche Krankheitsausbrüche, über Epidemien oder Pandemien sprechen?
Der Nobelpreisträger Peter Medawar hat Viren einmal recht flapsig beschrieben als »bad news wrapped in protein«





























