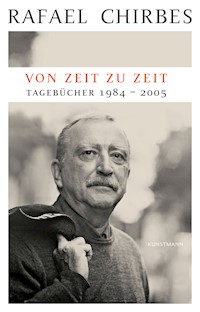
27,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kunstmann, A
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Zeit seines Lebens hat Rafael Chirbes nicht viel Aufhebens um sich gemacht. Der Literaturbetrieb war ihm fremd, die Literatur aber bedeutete ihm alles. Sie war sein Zugang zur Welt. In den Tagebuch-Aufzeichnungen, die von Chirbes' Anfängen als Schriftsteller bis kurz vor Veröffentlichung von »Krematorium« reichen, zeigt sich ein sensibler und scharf beobachtender Geist, dessen Werk in der Weltliteratur einen festen Platz hat. Rafael Chirbes erzählt von seinen Lieben, von schlaflosen Nächten, in Gesellschaft oder allein, oft mit Alkohol oder Drogen; von den Schmerzen des Alterns, den körperlichen, den seelischen, davon, was es bedeutete, homosexuell zu sein in einem bigotten Land. Seinen Lebensunterhalt verdient er sich mit Reportagen für eine Gourmet-Zeitschrift, die ihn durch ganz Europa schickt. Jede freie Minute arbeitet er an seinen Romanen, immer zweifelnd an dem eigenen literarischen Schreiben, auch dann noch, als die öffentliche Anerkennung längst da ist und er mit Literaturpreisen ausgezeichnet wird. In diesen schonungslos offenen Aufzeichnungen, die von seinen Anfängen als Schriftsteller bis kurz vor Veröffntlichung von »Krematorium« reichen, zeigt sich ein sensibler, verletzlicher und scharf beobachtender Geist und ein großartiger Stilist.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 638
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
RAFAEL CHIRBES
VON ZEIT ZU ZEIT
Tagebücher 1984 – 2005
Vorwort vonHeinrich von Berenberg
Aus dem Spanischenvon Dagmar Ploetz und Carsten Regling
Verlag Antje Kunstmann
INHALT
VORWORT: LEBENSROMANE. RAFAEL CHIRBES IN SEINEN TAGEBÜCHERN
(Heinrich von Berenberg)
VON ZEIT ZU ZEIT 1 (1984 – 1992): EIN ZIMMER IN PARIS
ÜBERBLEIBSEL AUS DEM GROSSEN HEFT
(April 1984 – 21. März 1985)
DAS SCHWARZE HEFT MIT DEN FLECHTORNAMENTEN
(21. März 1985 – 14. April 1986)
DAS BORDEAUXROTE HEFT
(14. April 1986 – 20. August 1992)
VON ZEIT ZU ZEIT 2 (August 1995 – März 2005)
1995
1997
1998
2000
DAS SCHWARZE NOTIZBUCH MIT SPIRALBINDUNG
(23. November 2003 – 26. August 2003)
DER GRAUE BAND
(5. September 2003 – 21. Juli 2004)
DAS NOTIZBUCH MIT DEN BLAUEN SEITEN
(24. Juli 2004 – 11. September 2004)
RIVADAVIA-NOTIZBUCH
(Deutschlandreise)
RÜCKKEHR ZUM NOTIZBUCH MIT DEN BLAUEN SEITEN
(6. Oktober – 24. Oktober 2004)
NOTIZBUCH MAX AUB
(26. Oktober 2004 – 1. März 2005)
Quellennachweise
Namensregister
LEBENSROMANE
Rafael Chirbes in seinen Tagebüchern
»Es gibt kein Heilmittel gegen die Klassenherkunft« (S. 398)
1.
Ob literarische Tagebücher für ein großes Publikum bestimmt sind oder nicht, bleibt ein interessantes Feld der Literaturgeschichte. Rafael Chirbes jedenfalls hat seine privaten Aufzeichnungen nicht den Zufällen des posthumen Geschehens überlassen. Er hat sie sorgfältig bearbeitet, gekürzt, in zwei große Abschnitte aufgeteilt und als einen von ihm selbst abgesegneten Teil seines Gesamtwerks der öffentlichen Leserschaft hinterlassen. Eine ordentliche Chronik des Lebens also? Keineswegs! Wenn man dieses letzte Buch von Rafael Chirbes liest, hat man nicht den Eindruck, als werde man, wie häufig bei Tagebüchern der Fall, in ein diffuses, Jahr für Jahr immer weiter flutendes, unübersehbares Meer aus Lebenssplittern und unkontrollierten Ausbrüchen eines kommentierten Innen- und Außenlebens hineingezogen. Das Werk geht weit über eine Chronik hinaus, in der Leben, Meinungen und Gedanken des Rafael Chirbes nebeneinanderstehen. Im Ergebnis ist dieses sorgfältige Konstrukt eine Art kommentierter Lebensroman, in dem die Innenwelt eines der ganz großen spanischen Autoren der Nach-Franco-Zeit mit manchmal fast schmerzhafter Helligkeit ausgeleuchtet ist.
Rafael Chirbes, 1949 in der Kleinstadt Tabernes de Valdigna in der Nähe von Valencia als Sohn eines Eisenbahnarbeiters geboren und 2015 auch dort gestorben, hat Romane geschrieben, die für das Verständnis der Geschichte Spaniens und seiner sozialpsychologischen Entwicklung während der Franco-Zeit und danach mehr aussagen als fast alles, was darüber literarisch, politisch oder historisch geschrieben worden ist. Das gilt nicht nur für die Trilogie der Romane Der lange Marsch, Der Fall von Madrid und Alte Freunde, es gilt vor allem auch für die letzten zu Lebzeiten des Autors erschienenen Romane, Krematorium und Am Ufer, beide gewidmet den das zeitgenössische Spanien bedrohenden Kräften der gesellschaftlichen und geografischen Selbstzerstörung, von denen auch in diesem Tagebuch immer wieder die Rede ist. Erst mit diesen letzten Romanen konnte Chirbes in der spanischen Öffentlichkeit und in dem von ihm stets mit argwöhnischer Scheu betrachteten Literaturbetrieb das Ansehen, den Ruhm und die Preise erringen, die er längst verdient hatte.
Neben den Romanen hat Rafael Chirbes drei eindrucksvolle Essaysammlungen veröffentlicht: El novelista perplejo (2002) und Por cuenta propia. Leer y escribir (2010), außerdem eine Sammlung Städteporträts, die 2004 unter dem Titel El viajero sedentario (Der sesshafte Reisende, 2006) erschienen sind. Schon sie bezeugen, was für ein skrupulöser Schriftsteller Chirbes war, einer, der sich ständig selbst hinterfragte, der, nachdem er nicht nur in Spanien, sondern über die zahlreichen Übersetzungen seiner Werke auch im Ausland zu Ruhm gekommen war, nicht aufhörte, die Legitimität und Qualität der eigenen schriftstellerischen Produktion in Zweifel zu ziehen. Die Seiten seines Tagebuchs bezeugen, wie sehr ihm Selbstzweifel und, damit zusammenhängend, bisweilen tiefe Depressionen zu schaffen machten.
Die so sorgfältig für die Veröffentlichung vorbereiteten Tagebücher lassen sich im Grunde wie Romane lesen, und zwar als mehrere zugleich, denn sie spiegeln die Veränderungen der lebensgeschichtlichen Konturen wie auch die Vielschichtigkeit und die Wandlungen von Rafael Chirbes’ literarischen Leidenschaften und Präferenzen. Obwohl ein eminent politischer Schriftsteller, marxistisch in der Jugend gebildet und, wie er selbst einmal schreibt, »gelernter Materialist«, hat Chirbes es vermieden, in den Tagebüchern den Ablauf des politischen Geschehens in Spanien zu kommentieren oder nachzuverfolgen. Das alles spielt keine große Rolle, nicht einmal als Hintergrundrauschen. Ganz im Gegensatz zum Thema seiner sozialen Herkunft aus einem republikanisch-proletarischen Milieu. Darauf, auch auf die damit einhergehenden Prägungen, die es ihm nicht leichter machten, sich als Schriftsteller durchzusetzen, kommt er immer wieder zurück. Von daher auch sein tiefes, bis zum Schluss nie gewichenes Misstrauen gegenüber dem Literaturbetrieb in der Ära nach Francos Tod 1975. Bei flüchtigem Hinsehen wirkt es manchmal fast unvereinbar – der unbedingte Wunsch nach Anerkennung durch ein intellektuelles und geistiges Milieu, zu dem er nicht gehören mag. Aber das ist es nicht. Die scheinbar widersprüchlichen Stimmungen und Gedankenreihen in den Aufzeichnungen erklären sich aus dem zutiefst unbürgerlichen Selbstverständnis von Rafael Chirbes, der zugleich nichts mehr ersehnte, als ein im bürgerlichen Ambiente der spanischen Kultur der Nach-Franco-Zeit anerkannter Schriftsteller zu werden, weil ihm, um Erfolg und Anerkennung zu erlangen, letztlich gar nichts anderes übrig blieb. Er selbst hat diese Widersprüche nur mit Mühe ausgehalten. Für mich, der ich das Glück hatte, ihm zu begegnen, sind die Tagebücher nicht zuletzt deshalb eines seiner erschütterndsten Bücher, denn man begegnet darin manchmal fast erschrocken einem Mann, den die widerstreitenden Leidenschaften und Selbstzweifel fast zerrissen hätten. Gerettet hat ihn allein die Literatur, die selbst geschriebene und die gelesene, besser noch: die in ständiger, als segensreiche Arbeit empfundener Anstrengung erlesene.
Die zwei Teile des Tagebuchs – der erste reicht von 1984 bis 1992, der zweite endet 2005 – strukturieren zwei große Abschnitte in Rafael Chirbes’ Leben: Während der zweite Teil dem gewidmet ist, was man als den Lauf der Karriere des Schriftstellers nach Erscheinen seiner ersten beiden Romane nennen könnte (etwas irreführend, denn Chirbes hat sich für Karrieren, auch sein eigene, wenig interessiert), enthält der erste das Porträt des Autors als junger Mann, besser gesagt, das Porträt des jungen Autors als lesender und schreibender Homosexueller. Chirbes betrachtete sich nie als Teil der berühmt gewordenen movida, aber er hat das so bezeichnete ausschweifende Nachtleben im Madrid der Achtzigerjahre ausgekostet bis zur Neige. Roter Faden ist die alles andere als glückliche Liebesgeschichte, die ihn mit seinem Freund François verband, einem Franzosen aus einer Vorstadt von Paris, der von Chirbes geliebten und zeitlebens immer wieder aufgesuchten französischen Hauptstadt. François war Proletarier wie Chirbes, aber im Unterschied zu seinem spanischen Lover keiner, dem Literatur viel bedeutete. 1992 starb François an Aids. Da lässt Chirbes den ersten Teil des Tagebuchs enden.
2.
Sex, so viel ist klar, war für den Chirbes der Achtzigerjahre eine homosexuelle Kampfzone, und zwar eine, in der nur selten gute Laune herrschte. Liebe und Sex hat er nicht streng voneinander geschieden. Aber dass es für ihn verschiedene Dinge sind, wird schon in diesem ersten Teil der Tagebücher klar. Nicht von ungefähr schreibt er später, Ende der Neunzigerjahre, in einem Halbsatz, wie lächerlich er Sex in der Ehe findet.
Viel wird gevögelt in diesem ersten Teil, Alkohol und bisweilen auch härtere Drogen sind stets mit von der Partie. Bereits zur Zeit der problematischen, ungleichen Fernbeziehung mit François, der eifersüchtig in Paris auf ihn wartet, besucht Chirbes daheim in Madrid fast Nacht für Nacht, so hat es den Anschein, ausgesucht schäbige, manchmal ziemlich gefährliche Madrider Schwulenkneipen, auf der Suche nach sexuellen Abenteuern und Selbstverwirklichung. Als Leser hat man den Eindruck, dass er zu diesem Zeitpunkt seines Lebens zwar bereits unbedingt Schriftsteller werden will, aber noch kein Thema hat, das dem überaus leidenschaftlichen Impetus seiner Suche danach die Waage halten könnte. Man liest von One-Night-Stands, gelungenen und danebengegangenen, oder aber, wenn der viele Alkohol der Kondition zusetzt, ziemlich desperat wirkenden, manchmal geradezu filmisch nacherzählten Exzessen, bei denen ordentlich masturbiert und geblasen wird und zuweilen unterhaltsam exhibitionistisches Gehabe zum Zuge kommt. Es kommt auch vor, dass er sich abschleppen lässt und nach durchzechter und durchvögelter Nacht ausgeraubt aufwacht. Dass ihm das Schicksal seines Freundes erspart blieb, dass er sich nicht mit dem zu jener Zeit noch absolut tödlichen Virus infizierte, obwohl er das Spektrum der sexuellen Variationen bis zur Neige auskostete und, wie er einmal selbst schreibt, »nie gedacht hätte, dass man so viel vögeln kann«, darüber hat der spätere Chirbes schaudernd nachgedacht.
Es ist faszinierend, sich als Leser über die zumeist schlecht beleuchteten, manchmal durchaus furchterregenden Stätten dieses Kampfplatzes führen zu lassen. Aber wie alles, was Rafael Chirbes im Laufe seines Lebens für würdig befand, in seinen Tagebüchern der Nachwelt zu hinterlassen, wird selbst dieses Pandämonium immer durch ein reichhaltiges, vielfarbiges, ständig erweitertes und sich veränderndes Prisma gesehen. Gemeint sind die Bücher, die er liest, die darauf warten, gelesen zu werden, Literatur also, aber auch jede Menge Kunst, Musik, Film, Architektur, vor allem aber Literatur. Es ist beeindruckend, wie fleißig Chirbes zu diesem noch unentschiedenen Zeitpunkt seines Lebens ist. Er liest, ob mit schwerem oder freiem Kopf, bestrebt, noch jede seiner Gesten und Haltungen, seiner Stimmungen und Gedankenreihen vor dem Hintergrund seiner ständig fortschreitenden literarischen und ästhetischen Fortbildung – Lektüre, Kino, Museumsbesuche – zu kommentieren und zu interpretieren. Fast ist es eine Art ästhetischer Selbstkontrolle, der er sich in der Nachbetrachtung unterwirft.
An einem Sonntag im Mai 1984 unternimmt er einen Spaziergang in Madrid. Er ist nicht allein, sondern in Begleitung eines Bekannten, von dem er nur die Initialen verrät. Jedenfalls nicht François, mit dem es schon zu diesem Zeitpunkt nicht mehr ganz rundläuft. Aber tut es das irgendwann, irgendwo im Leben dieses schon hier sehnsüchtig nach Erfolg suchenden Autors, mit Unruhe, Unzufriedenheit, Unsicherheit als ständigen Begleitern? Ein typischer Sonntag jedenfalls. Nicht nur, weil die beiden Männer, wie es sich gehört, zunächst in den Prado gehen, neben dem Pariser Louvre zu dieser Zeit einer der kulturellen Arbeitsplätze von Rafael Chirbes, wo er wieder und wieder mit großer Aufmerksamkeit, großem Ernst, fast mit Besessenheit den Kanon der europäischen Kunst studiert und sich einprägt.
Danach begeben sie sich, wie Tausende Madrilenen an jedem Sonntag nach dem Besuch im Prado, auf einen Bummel durch den Retiro, Madrids Stadtpark. Dort hält sein Freund für Rafael eine Überraschung bereit: Er führt ihn in ein kunstvoll angelegtes Labyrinth, und hier, nur wenige Meter entfernt von der sonntäglichen Promenade von Eltern und Großmüttern, die ihre Enkel und Kinder spazieren führen, erblickt Chirbes eine Szene, zu der ihm, trotz der an Bestürzung grenzenden Überraschung, sofort die ästhetische Parallele einfällt. Es ist »Der Garten der Lüste«, ein berühmtes Gemälde von Hieronymus Bosch, das er eben noch im Prado betrachtet hat. Vor ihm im Gras liegen, stehen und hocken Männer, die zu Paaren und in Gruppen miteinander Sex haben, in den verschiedensten Formen und Stellungen, begleitet von lautem Stöhnen, Männer, die Bäume umarmen, während jemand in sie eindringt, drum herum Männer die nackt oder mit heruntergelassenen Hosen das Schauspiel betrachten und sich selbst oder einander masturbieren. Chirbes beschreibt das Geschehen als eines von Eingeweihten, von Stammesangehörigen, ein ebenso frenetisches wie exklusives Ritual, von dem die Tanten und Großmütter hinter der Hecke keine Ahnung haben.
Ganz klar ist es nicht, mit welchem Gemütszustand der Autor diesem Schauspiel zusieht. Fasziniert? Angeekelt? Sicher ein bisschen von beidem. Er ist definitiv ein Stammesangehöriger. Aber Rafael Chirbes ist auch bereits Schriftsteller, obwohl sein Erstling Mimoun noch nicht erschienen ist. Sein literarischer Ehrgeiz ist auf eine schriftstellerische Karriere gerichtet, und die Bedingungslosigkeit, mit der er diesen Lebensplan verfolgt, spiegelt sich in der literarischen, ästhetischen und beizeiten philosophischen Kommentierung, mit der er in sich hineinhorcht. Auch die Szene im Retiro-Park findet in den Seiten des Tagebuchs notwendig ihre Spiegelung in der Kunst – und der Literatur. Der junge Chirbes fühlt sich durch das, was er eben noch hinter den Hecken des Labyrinths im Retiro gesehen hat, zunächst reflexhaft an Gustave Dorés Zeichnungen zu Dantes »Inferno« erinnert. Da steht er bereits wieder neben den Großmüttern und ihren Enkeln auf der anderen Seite der Hecke. Er hört die Sonntagskapelle spielen, nennt mit Kennerschaft die Komponisten der Hits aus den Zarzuelas des 19. Jahrhunderts, er ordnet alles ein in einen Zusammenhang, den er, en passant und etwas musterschülerhaft – so hat er es während der Jahre der Marx-Lektüre an der Universität gelernt –, als provinziell kleinbürgerlich einstuft, aber gleich kehrt er wieder zurück zu dem sinnlichen Schauspiel und vergleicht es mit dem Gemälde, das er eine halbe Stunde vorher im Prado bestaunt hat. Dann zitiert er einen Vers von Jaime Gil de Biedma, einem der bedeutendsten (und schwulen) Lyriker der spanischen Literatur der Nachkriegszeit. Es gibt für den jungen Chirbes – und später auch für den reifen – keine Manifestation von Sinnlichkeit, weder der eigenen noch der fremden, keine Manifestation von Affekten, die nicht auf der Stelle in einen kulturellen und ästhetischen Kontext eingefügt wird. Das ist ein Schema, dem sich fast alles in seinem Leben unterordnet, und es hat ihm das Leben gerettet: Immer wieder, auch aus den manchmal erschreckend tiefen Tälern der Depression, die bereits der erste Teil ahnen lässt, wies ihm die Literatur einen Weg, einen Ausweg manchmal, vor allem aber einen Weg. Und wie beeindruckend ist die Fülle der Autoren, die er im Laufe seines Lebens las! Manche – Proust, Dostojewski, Musil, Hermann Broch – gleich mehrmals. Auch noch in jenen Zeiten, in denen sich die Schwindelanfälle zu häufen begannen, die Vorboten des Krebsleidens, dem Chirbes 2015 erlag.
Es sind auch solche scheinbar infernalischen Szenen, die das Leben dieses angehenden Schriftstellers wie ein manchmal fast heroisches Drama wirken lassen. 1995 hat er in der Rückschau eine wunderbare Passage geschrieben, in Erinnerung an die erwähnte movida de Madrid und Jesus Toledo, einen ihrer besonders schrägen Protagonisten und für den jungen Chirbes so etwas wie ein Cicerone durch Madrids Nächte und ihr manchmal gruseliges Theater der Lüste, in dem es von Transvestiten, Huren, Verzweifelten wimmelte: »schäbige Paradiese voller Junkies, armer Schwuchteln auf der Suche nach einem Zimmer für ein paar Stunden. Transvestiten, todkranke Nutten, miese Typen, Männer jeden Alters, die frisch aus dem Knast kamen und zu allem bereit waren für ein bisschen Essen oder Drogen. Möblierte Zimmer mit Waschbecken, in die Generationen von Männern gepisst hatten, gebrauchte Kondome unter dem Bett und in den Ecken, mit Sperma gestärkte Bettlaken, voll Scheißespuren.«
3.
Sosehr das Thema Homosexualität den ersten Teil des Tagebuchs bestimmt, so sporadisch taucht es im zweiten auf. Irgendwann zwischen 1998 und 2000 – er hat die einzelnen Abschnitte nicht durchgängig datiert – schreibt er: »Nichts davon interessiert mich als Literatur – Krankheit ist Thema der Mediziner, das mit der Jugend gibt sich mit der Zeit, Paare mit Problemen sollen sich trennen, und Schwule sollen heiraten (in Kürze wird das möglich sein) und öfter zum Baggern in die Sauna oder in Kneipen gehen, oder noch besser: Sie sollen nirgendwohin gehen und lieber versuchen, mit den Nachbarn zu vögeln, die ihnen gefallen, denn letzten Endes ist das die einzige wirklich wünschenswerte Normalität.« Die Normalität des Lebens von Rafael Chirbes nach 1992 ist es bestimmt nicht geworden. Aber mit seiner Homosexualität ist er fortan, zumindest in seinen Büchern, eher diskret verfahren. Außer in seinem 1988 erschienenen Erstling Mimoun, in dem sie noch eine tragende Rolle spielt, und seinem vierten, 1994 veröffentlichten Roman Der Schuss des Jägers – ein stilistisch und formal besonders vollendetes Buch –, spielt sie eine eher zweitrangige Rolle.
Nur zwanzig Jahre durchmessen diese Tagebücher, für ein ganzes Leben, auch für eines, das nur sechsundsechzig Jahre gedauert hat, beileibe nicht die Spanne, die eine Lebenszeit ausmacht. Und dennoch hat man beim Lesen den Eindruck, dass hier ein vollständiger, erwachsener Lebenslauf thematisiert und beschrieben ist. Dabei fehlen die Jugendjahre, die Chirbes als Student und Widerstandskämpfer gegen das Franco-Regime in Madrid verbrachte. Und es fehlen seine letzten zehn Lebensjahre, in denen mit den beiden letzten großen Romanen Krematorium und Am Ufer jener Ruhm kam, den er in den Tagebüchern so oft gleichzeitig herbeisehnt wie fürchtet.
Wenn es einen Protagonisten im zweiten Teil der Tagebücher gibt, so ist es eindeutig die Literatur. Vergegenwärtigt man sich, was Chirbes in dieser Zeit alles gelesen hat, so könnte man einen Vergleich zu den Medizinern ziehen, die sich ständig weiterbilden, um den Fortschritten ihres Fachs folgen zu können. Aber auch Roberto Bolaño fiel mir ein, wie Chirbes ein ungeheuer gefräßiger Leser, der in seinen Wilden Detektiven einen der beiden Protagonisten sogar unter der Dusche weiterlesen lässt. Dem jüngeren Kollegen stand Chirbes übrigens durchaus kritisch gegenüber. Gelegentlich sogar mit einer gewissen Eifersucht. Über Bolaño sprach um die Jahrtausendwende die gesamte hispanische Literaturwelt. Er war eine Berühmtheit, spätestens seit er für Die wilden Detektive den Premio Romulo Gallegos erhalten hatte. Die öffentliche Anerkennung für Chirbes hingegen bewegte sich zu jener Zeit noch auf eher bescheidenem Niveau, und das empfand er als ungerecht, als Irrtum der von ihm sowieso nicht mit viel Sympathie betrachteten Literaturkritik.
Für Chirbes dient die Lektüre der Vervollständigung des Lebens. Das Bild von der sich ständig weiterbildenden Ärzteschaft ist da schon passender. Er las, so scheint es, jeden Tag. Klassiker und Moderne. Mit großer Akribie verfolgte er auch die Neuerscheinungen, um sich ein Urteil über sein Umfeld zu bilden. Und es ist manchmal rührend nachzulesen, wie er selbst Autoren gegenüber fair zu bleiben versucht, die er nicht gut fand, und das sind fast die meisten: Autoren, über die heute, nur zwanzig Jahre später, auch in Spanien kein Mensch mehr spricht, die aber erschienen, in den Zeitungen besprochen wurden und deshalb von Chirbes gelesen werden mussten.
1998 zieht er irgendwann einen offensichtlich aus bitterer Erfahrung gewonnenen Vergleich. Die Kritiker verstünden sich selbst als die Garde der Architekten, als Anreger und Konstrukteure von Richtungen, Entwicklungen, Strömungen in der Literatur, als diejenigen, die wissen, wo es langgeht, während sie die dazu unverzichtbaren Schriftsteller als notwendiges Übel, als die Handwerkerklasse der Maurer verstünden und entsprechend behandelten. Ein durchaus selbstbewusst gemeinter Vergleich: der Klasse der mit den Händen arbeitenden Menschen, aus Kindheit und Jugend vertraut, fühlte Chirbes sich stets näher als denen, die er als herrschaftsbedürftige Ideologen verstand, und die Kritiker rechnete er, manchmal ungerecht, dazu. Verständlich immerhin, denn über seinen Erstling Mimoun – das Buch wurde noch im Jahr nach seinem Erscheinen ins Deutsche übersetzt und erschien danach in mehreren anderen Sprachen – hatte ein Kritiker geschrieben, es sei »eines der schlechtesten in letzter Zeit veröffentlichten Bücher«.
Chirbes hatte seine Favoriten, seine großen und mittelgroßen Favoriten, die er immer wieder las, mit Genuss, aber stets auch, um sich durch sie auf neue Gedanken bringen zu lassen oder – im Falle des Ozeans namens Balzac, unter seinen schriftstellerischen Vorbildern besonders hell leuchtend – um zu versuchen, alles zu lesen, was sie geschrieben hatten. Es scheint, dass er bei Balzac sehr weit gekommen ist. Der Autor der gigantischen Comédie Humaine, der gnadenlose Porträtist der französischen Bourgeoisie in ihrer besonders habgierigen und hässlichsten Ausformung Mitte des 19. Jahrhunderts, war eine ideale Ergänzung zu dem literarisch unergiebigen Marx, den Chirbes während seiner Zeit als Geschichtsstudent in den letzten Jahren unter Franco gelesen hatte. Balzac begegnet man in diesen Tagebüchern auf Schritt und Tritt.
Ein anderer, eher überraschender Favorit ist Dostojewski. Vielleicht ist es eine europäische Zeitverschiebung, die es mit sich brachte, dass der russische Autor, den meine eigene deutschsprachige Generation am Ende der Schulzeit mit gesträubten Haaren las, für den jungen Chirbes, eingesperrt im katholischen Käfig namens Franco-Spanien, erst am Ende des Studiums infrage kam. Und er liest ihn auch danach immer wieder. Das Schlusskapitel aus dem Idioten, in dem Fürst Myschkin mit seinem Freund Rogoschin an der Leiche von Nastassja Filippowna wacht, die dieser soeben umgebracht hat, wofür ihm Myschkin mit tiefem Mitgefühl die Hand auf die Schulter legt, schildert er ganz ergriffen. Statt Dostojewski hätte ich eher den nüchtern soziologischen Tolstoi zu seinen Vorbildern gerechnet. Aber Tolstois aristokratisches Personal kam für den aus proletarischem Elternhaus stammenden Rafael Chirbes, wenn wir von Identifikationsfiguren reden, weniger infrage als die verzweifelt suchenden und in die Irre gehenden, eher dem Bürgertum, der kleinen Beamtenklasse oder dem verarmten Adel entstammenden Protagonisten der Dämonen und der Brüder Karamasow.
Auch hier lässt Chirbes sich jedoch nicht festlegen. Das überaus aristokratische Personal in Prousts Recherche hat ihn nicht daran gehindert, dieses Werk, wenn ich richtig gezählt habe, allein bis 2005 dreimal gelesen zu haben. Schon 1973, als er in einer kleinen Buchhandlung in Madrid arbeitete, um sich sein Studium zu finanzieren, verstand er sich, wie er sich später erinnert, »als proustianischer Leninist«.
Fast auf jeder Seite der Tagebücher stehen Lektüreerlebnisse, hinzu kommen Überlegungen zu Filmen, die er gesehen hat, zur Kunst, die ihn immer wieder literarisch inspiriert hat. Der Maler Francis Bacon faszinierte ihn, aber ebenso die spanischen Klassiker, El Greco, Ribera, Goya, so wie er sie aus dem Prado und aus Toledo kannte. Ich kenne kein anderes Tagebuch, in dem der Lektüre, dem Lektüreerlebnis und der Reflexion über das Gelesene – und Gesehene – so viel Raum gegeben wird. Fast liest es sich wie ein persönlich akzentuiertes, erschöpfendes Verzeichnis europäischer, vor allem französischer und spanischer Literatur – vom 16. (Rabelais, Montaigne, Quevedo, Mateo Alemán) bis zum 19. Jahrhundert, mit dem von ihm geliebten, jenseits der Pyrenäen verständlicherweise eher wenig bekannten Benito Pérez Galdós, dem »spanischen Fontane«, aber auch den Romantikern, Larra und Espronceda, und den Lyrikern der Generation von 1927, von denen er besonders Rafael Cernuda liebt. Am 27. Juni 2004 schreibt er: »Du denkst, du kennst ihn besser als jeder andere, weil er stundenlang mit dir geredet hat, aber dann stellt sich heraus, jeder kennt ihn besser als du. Du weißt, was er dir ins Ohr flüstert, die anderen wissen, wer er ist.« Es gibt ein unvergleichlich schönes Gedicht von Rafael Cernuda, »La sombra«, das mir einfiel, als ich diese Zeilen las, die nebenbei auch resümieren, warum Rafael Chirbes später im Leben jenen Bindungen misstraute, denen er in früheren Jahren, auf der Suche nach Liebe und Anerkennung, manchmal so verzweifelt hinterhergelaufen war.
Warum aber las er Hermann Broch? Was findet er an Ernst Jünger, dessen Heliopolis ihn fasziniert, obwohl er es als pures Stück Ideologie bezeichnet? Pasenow, den ersten Teil von Brochs Schlafwandler-Trilogie, liest er dreimal! Zuerst als Student, in den Achtzigerjahren, zuletzt 2004. Die Frage beantwortet er ausführlich, und am Ende bringt er Broch und Robert Musil zusammen: »Broch ist, wie Ulrich aus Musils Roman, ein Mann ohne Eigenschaften, der Konzepte entwickelt, die ihn wie Barrieren vor dem eigenen Ich schützen sollen.« Das schreibt er, ausgerechnet auf einer Reise nach Florenz und in die Toskana. Aber an Italien haben ihn sowieso eher die Städte, ihre Architektur und die darin aufbewahrte Kunst interessiert. Caravaggio, seinem schwulen Bruder, in dessen Leben, vor allem aber in dessen Kunst die im Sex aufgehobene Gewalt eine so ungeheure, kaum sublimierte Präsenz beansprucht, hat er aus Anlass einer Reise nach Neapel ein paar beeindruckende Seiten gewidmet. Keine Spur indes von Lampedusa, von Manzoni, von Natalia Ginzburg, Moravia, Elsa Morante, Pavese, Calvino. Es war offenbar nicht die italienische, mediterrane Literatur, die ihm lag, sondern ausgerechnet die deutschsprachige. Warum?
Betrachtet man die Lebenszeit dieses Autors von hinten, von seinen letzten beiden großen Werken Krematorium und Am Ufer her, beides tief pessimistische Romane, die sich den Kräften der Selbstzerstörung in der spanischen Gesellschaft widmen – der inneren, also der Zersetzung des Wertekostüms der Individuen im Zeitalter der spanischen Nachwende-Demokratie, und der äußeren, dem unvorstellbaren Immobilien-Boom, der Spaniens einst schöne Mittelmeerküste entstellt und zerstört hat –, so muss man vielleicht sagen, dass Chirbes sein eigenes Leben als Spiegelbild eines Wegs nach unten betrachtete. Vom oberflächlichen Hurra, politisch wie alltäglich, im Spanien nach dem Ende der Franco-Zeit, ließ er sich nicht blenden. Hermann Brochs Soziologie des inneren Verfalls im wilhelminischen Deutschland, gegen den letztlich am besten die Uniform schützt, empfand er vielleicht als Leitfaden, auch wenn er eine Uniform nie getragen hat. Auch seine eigene Lebenszeit empfand Chirbes als Zeit des Verfalls, obwohl er gerne lebte, aß, trank und – sicher zunehmend mit Abstrichen – Sex hatte. Sein Eindruck, dass der immer hemmungslosere Kapitalismus der Neunziger- und frühen Nullerjahre bei sensiblen Zeitgenossen ein inneres Ruinenfeld hinterlassen musste, verließ ihn nie, und als hilfreiche Kommentare und Wegbegleiter empfand er da die großen deutschsprachigen Romanciers. Neben Broch las er immer wieder begeistert in Musils Mann ohne Eigenschaften, den er aber, wie so viele aus seiner eigenen kritischen, nicht nur dem hemmungslosen Neoliberalismus ringsum, sondern auch den einstigen linken Überzeugungen mit zunehmend melancholischer Skepsis begegnenden Generation, niemals bis ans – nicht vorhandene – Ende las. Der bittere letzte Teil seiner Spanien-Trilogie, Alte Freunde, thematisiert diesen Verfall mit besonderer Intensität.
Von Rafael Chirbes’ schwierigem Verhältnis zur Kritik war bereits die Rede. Deshalb mag es auf den ersten Blick verwundern, dass er dem deutschen Großkritiker Marcel Reich-Ranicki ein paar respektvolle und dankbare Passagen widmet. Aber Reich-Ranicki hatte seine Bücher im Literarischen Quartett ungewöhnlich begeistert gelobt, und beide verband die Neigung zu Thomas Mann, aber auch zu Alfred Döblins Berlin Alexanderplatz, den Chirbes der Manhattan-Trilogie von John Dos Passos an die Seite stellte. Von Döblin überliefert er die Sentenz, Thomas Mann fabriziere Literatur mit Bügelfalte. Von Reich-Ranicki den Satz, demzufolge das Schönste an Deutschland sei, dass man es jederzeit verlassen dürfe.
4.
Im September 2004 begibt sich Rafael Chirbes wieder einmal auf Lesereise nach Deutschland, und man kann hier nachlesen, was für eine Zumutung diese für einen zeitgenössischen Schriftsteller obligatorisch gewordene Werbetour schon zu jener Zeit war. Endlose Zugfahrten, schlechte Hotels oder – schlimmer noch – private Unterkünfte bei angeblich gleichgesinnten Gastgebern, die sich im Licht des bekannten Gastes sonnen, mit denen er sich aber nichts zu sagen hat und wo dem schon nicht mehr ganz fitten Autor der Lift in die Dachmansarde fehlt, der ihn sonst ins anonyme Hotelzimmer bringt, wo er aber wenigstens ungestört ist. Er begegnet Landsleuten, für die Literatur ein exotischer Zeitvertreib ist und die nicht glauben wollen, dass er ohne Frau unterwegs ist. Und immer wieder: schlechtes Essen, schlechte Weine. Und dabei reiste er doch so gerne, vom guten Essen und Trinken ganz zu schweigen. Im Radio wird er gefragt, was er zuletzt an deutschsprachiger Literatur gelesen hat, und wieder zeigt sich, wie fleißig Chirbes seine Hausaufgaben macht: Bernhard Schlink, Marcel Beyer, Ingo Schulze, Uwe Timm (von dem er gleich zwei Romane nennt), Tilman Spengler, der seine Lesung in Zürich moderiert.
Von den Depressionen, die Rafael Chirbes mit zunehmendem Alter immer wieder heimsuchten, zusammen mit jenen lästigen und zuzeiten alarmierenden Schwindelanfällen, war schon die Rede. Zum ersten Mal überfielen sie ihn bei einer solchen Lesereise in Deutschland. Es ist ihm oft schlecht ergangen. Als junger Mann hat er sich nicht geschont, als Fünfzigjähriger erlebt er wiederholt tiefe Täler. Ein resignierter Mensch ist Rafael Chirbes dennoch nie gewesen. Mut zum Überleben gab ihm – Cervantes, Galdós, Balzac, Proust, Broch, Musil, Thomas Mann beiseite – sein vollkommen unbürgerliches Lebensgefühl. Und im Gegensatz zu vielen anderen Intellektuellen seiner Zeit hatte er eine halbwegs sichere Einkommensquelle. Seinen früh feststehenden Lebensplan, Schriftsteller zu werden, konnte er, ebenfalls im Gegensatz zu vielen seiner schreibenden Zeitgenossen, mit einer Arbeit finanzieren, die nicht nur ein Job war, sondern eine zumal in den Achtzigerjahren durchaus ungewöhnliche Tätigkeit beinhaltete, die ihm die Welt jenseits der spanischen Grenzen erschloss und ihm ein stets aufs Neue mit tiefer Befriedigung empfundenes Sensorium für die guten Dinge des Lebens gab: Zusammen mit Freunden hatte Chirbes 1984, als er sich die Nächte von Madrid um die Ohren schlug und den aufschlussreichen Sonntagsspaziergang im Retiro unternahm, eine Zeitschrift gegründet, in der in erster Linie weder von Politik noch von Literatur die Rede war, sondern vom guten Essen und Trinken. Die Zeitschrift heißt bis heute Sobremesa (Nachtisch), widmet sich der Küche und dem guten Essen und ist auf ihrem Feld zu einer der angesehensten in Spanien geworden. Als Chirbes 2015 mit sechsundsechzig an einem Lungenkrebsleiden starb, widmeten seine Redaktionskollegen ihm als einem ihrer Gründungsdirektoren einen bewegenden Nachruf mit dem Titel: »Abschied von einem Genie mit gutem Geschmack«.
Dank der Arbeit für Sobremesa konnte Chirbes reisen, schon früh, immer wieder nach Frankreich, Paris, Bordeaux, um Restaurants zu prüfen und der Qualität angesagter Weingüter kritisch auf den Grund zu gehen. So kam er mit der Zeit weit über den iberischen Tellerrand hinaus. In seinem Tagebuch kann man nachempfinden, welche Befreiung für ihn in der Tatsache lag, die spanischen Grenzen hinter sich lassen zu können, und als welches Glück er es empfand, immer wieder nach Spanien, nach Madrid oder aber an die Mittelmeerküste bei Valencia, wo er herkam, heimzukehren. Besonders zeigt das jene Passage auf dem Rückflug von Istanbul nach Spanien, als er das Mittelmeer überfliegt, Neapel unter sich erblickt, Sardinien und Korsika, und fast ekstatisch das Glücksgefühl empfindet, als Bewohner des Mittelmeerraums geboren zu sein.
Im November 2004 ist er in Rom, fährt weiter nach Neapel und stellt fest, in wie ungewöhnlicher Weise sich die Stadt verwandelt, wenn die Sonne fehlt. Es ist eine schöne Passage, denn sofort hat er Vergleiche zur Stelle: Paris, das er im Regen und bei schlechtem Wetter manchmal als klarer und ehrlicher empfindet als unterm Sonnenschein. Santiago hingegen benötigt ihm zufolge den galicischen Nebel: »Im Nebel verwischen die Grenzen der Stadt, und wir haben das Gefühl, durch ein endloses Bühnenbild zu laufen. Der Besucher malt sich weitere Plätze hinter denen aus, die er sieht, und glaubt, verborgen hinter den Vorhängen aus Nebel, erwarteten ihn weitere Bühnendekorationen, weitere architektonische Perspektiven. Sonne und klare Luft zeigen das wahre Gesicht der Stadt. Es ist nur eine kleine Provinzstadt.«
2005 sammelte er seine Reiseberichte und veröffentlichte sie in einem Band mit dem Titel El viajero sedentario, ein literarisches Porträt der über den gesamten Planeten verstreuten Städte, die er kennenlernte. Ein eindrucksvolles Buch, vor allem, weil man mit ehrfürchtigem Erstaunen feststellt, dass Chirbes tatsächlich in der ganzen Welt unterwegs war, ohne dass er jemals viel Aufhebens davon machte. Als das Buch erscheint, nimmt er dennoch halb entrüstet, halb amüsiert zur Kenntnis, dass eine Rezension im Reiseteil erscheint. Wieder einmal fühlt er sich unter Wert, von oben herab behandelt.
5.
Als der 1949 geborene Rafael Chirbes vier Jahre alt war, starb sein Vater, ein republikanisch gesinnter Eisenbahner. Um dem Sohn das Überleben in den für die Familien republikanischer Arbeiter immer noch existenzbedrohenden Fünfzigerjahren zu erleichtern, schickte die Mutter den Achtjährigen auf ein für Waisenkinder von Eisenbahnern bestimmtes, von Priestern geleitetes Internat bei Ávila, weit weg von der Mittelmeerküste, in Kastilien. Der kleine Rafael, der bis dahin das valencianische Katalanisch seiner Kindheit gesprochen hatte, muss eine neue Sprache lernen, castellano, die Sprache der Polizisten, der Priester und der feinen Leute – »manu militari«, wie Chirbes in der Erinnerung grimmig anmerkt. Seinen Mitschülern begegnet er, eine besonders berührende und vielsagende Passage des Tagebuchs, fünfzig Jahre später wieder, im Oktober 2004, bei einem Klassentreffen. Einige sind gestorben, mit anderen hat er sich auch nach fünfzig Jahren nichts zu sagen. Der frühere Klassenbeste, den er immer bewundert hatte, ist ein bescheidener, nicht mehr gesunder alter Mann, von dem er erfährt, dass, im Gegensatz zu ihm selbst, sie alle damals schon wussten, dass aus dem Kind mit Namen Rafael Chirbes kein Eisenbahner werden würde, sondern »etwas Besseres«.
Etwas Besseres wurde er. Aber der Richtung, nach der sich auch seine eigene Lebensgeschichte mit Studium, Literatur und dem eigenen schriftstellerischen Erfolg ausrichtete, nach oben also, dieser Richtung hat er misstraut, und das Misstrauen blieb. »Es gibt kein Heilmittel gegen die Klassenherkunft«, schreibt er im Oktober 2004, als er das Treffen mit den alten Klassenkameraden resümiert. Und er fährt fort: »Das erstaunt mich nicht. Als Materialist weiß ich, dass die Seele ein Abbild der Umstände ist, ein komplexes Geflecht aus Formen, Tabus, Hoffnungen, Misstrauen und Groll, das sich in der frühen Kindheit herausbildet.«
Seine soziale Herkunft hat das Gesamtwerk von Rafael Chirbes auf besondere und, wie könnte es bei diesem Autor anders sein, ambivalente Weise beeinflusst. Der spanische Begriff clase obrera lässt sich wohl als »Arbeiterklasse« übersetzen, hat aber einen ganz anderen Resonanzraum. Die politische Tradition und Geschichte der spanischen Arbeiterschaft unterschieden sich von derjenigen der in den großen Gewerkschaften und politischen Parteien organisierten Arbeiterklasse im übrigen Europa. Nicht nur weil Anarchismus, vergleichsweise bescheidene Industrialisierung und die entsprechend fließende Grenze zwischen Arbeitern und Bauern in Spanien eine Rolle spielten. Rafael Chirbes beschreibt in den Seiten seines Tagebuchs die Generation seiner Großväter als Menschen, die lange darauf warten mussten, bis sich unter der kurzlebigen Republik Anfang der Dreißigerjahre endlich Träume von Freiheit und bescheidenem Wohlstand zu erfüllen schienen. Zuvor hatte man Diktaturen, morsche Monarchien erduldet, die Kinder wurden in sinnlose, in Katastrophen mündende Kriege gegen die letzten noch verbliebenden Kolonien in Nordafrika geschickt – im Gegensatz zu den Kindern aus wohlhabenden Familien, die sich davon freikaufen konnten. Als dann Freiheit und Wohlstand winkten, kam ein mörderischer, drei Jahre währender Bürgerkrieg, und er kostete wieder Tausende das Leben, ganz zu schweigen von den Hekatomben der noch lange nach dem Ende des Bürgerkriegs umgebrachten und versklavten Republikaner, die meisten Arbeiter und »einfache« Leute, deren sterbliche Überreste erst jetzt aus den über das ganze Land verstreuten Massengräbern geborgen werden.
Für die Generation dieser von der Geschichte so übel behandelten Großeltern, unter denen er aufwuchs, durchaus nicht nur umgeben von Trauer, sondern wie er sagt, von viel Gelächter, bescheidenem, aber gutem Essen, einem selbstverständlichen Gefühl der Solidarität und einer Achtung für die auf das Nützliche konzentrierte Handarbeit, hat er sich zeitlebens »eine grenzenlose Bewunderung« bewahrt. Eine Bewunderung, die sich auch nährt aus dem Respekt vor der Arbeit all jener, die nicht herrschen, nicht bestimmen wollen. Im Gegensatz zu jener anderen sozialen Schicht, einen Stock höher, die, wie ihm sein Vater erzählte, so jedenfalls meint er sich 1998 zu erinnern, es gewohnt ist, Hilfe und Solidarität für einen käuflichen Artikel zu halten und nicht, wie für Menschen proletarischer Herkunft, für eine aktive, moralische Selbstverständlichkeit.
Die Idolatrie der einfachen Menschen trägt bei Chirbes bisweilen durchaus Züge einer Nostalgie nach den kargen, verarmten, aber in der Orientierung stabilen sozialen Verhältnissen der spanischen Vergangenheit, etwas, das er im Übrigen freimütig zugibt. Auch dafür hat er seine literarischen Zeugen: Benito Pérez Galdós, eine, freilich unverwechselbar spanisch-madrilenische, Mischung aus Maupassant und Fontane, wenn man einen etwas gewagten Vergleich anstellt. Nicht zu vergessen den republikanischen Journalisten Corpus Barga, dessen dreibändige Memoiren vom Leben in Madrid und Umgebung einer definitiv verschwundenen Epoche angehören, einer, die mit der Ankunft des neoliberalen Kapitalismus, der rasanten Modernisierung und im Zuge der hemmungslosen Immobilienspekulation von der Bildfläche verschwand. Los pasos contados. Una vida española a caballo en dos siglos (1887–1957) (Gezählte Schritte. Ein spanisches Leben in zwei Jahrhunderten), geschrieben im peruanischen Exil, ist eines jener Werke, die Chirbes immer wieder las, und eines, das er als vorbildlich empfand: Der Titel, den er seinen eigenen Tagebüchern gab, »A ratos perdidos«, klingt, auf Spanisch, wie eine bittere Hommage.
6.
Ich hatte das Glück und das Privileg, Rafael Chirbes mehrfach persönlich zu begegnen. In Madrid, aber auch auf einer der manchmal so mühsamen Lesereisen in Deutschland, von denen schon die Rede war. Nicht auf jener, von der das Tagebuch 2004 eine wunderbare, sehr burleske Chronik enthält, sondern gut zehn Jahre früher, als seine Bücher im Verlag Antje Kunstmann mit immer größerem Erfolg zu erscheinen begannen. Ich erinnere mich an sein stark idiomatisches Spanisch, dem ich manchmal Mühe hatte zu folgen. Von Rafael konnte man viel lernen über die umgangssprachlichen und im Wortsinn populären Reichtümer dieser wunderbaren Sprache. Bei den Lesungen in den Buchhandlungen fürchtete ich das Ende, wenn die Fragen aus dem Publikum kamen und ich seine Antworten übersetzen musste. Nie, so meine ich mich zu erinnern, habe ich mich so konzentrieren müssen. Kopfschmerztabletten waren obligatorische Reisebegleiter.
Ich betreute ihn als Lektor, und mir ist ein, wie ich finde, für das Persönlichkeitsbild dieses Autors wichtiges Detail in Erinnerung geblieben. Schon in seinem Erstling Mimoun, dessen Übersetzung 1990 noch bei Klaus Wagenbach in Berlin erschien, hatte ich den einen oder anderen Satz gestrichen. Aber nur wenig. Als ich die spanische Version des ersten großen Teils seiner Madrider Trilogie, Der lange Marsch, las, fand ich, dass dieses im spanischen Original 400 Seiten lange Buch ein paar Eingriffe nötig hatte. Nehme ich mein Exemplar von damals zur Hand, erschrecke ich noch im Nachhinein. Ganze Seiten habe ich gestrichen, um Ergänzungen gebeten, lange Kommentare, kritische Anmerkungen, Bitten um Ergänzungen und Erklärungen für meine Streichungen an den Rand geschrieben. Das Buch erschien dann in einer im Vergleich zum spanischen Original stark lektorierten Fassung. Erwähnen möchte ich das hier, weil ich mich heute noch mit großer Dankbarkeit an die Reaktion des Autors erinnere. Er war von der Nachricht, dass da jemand für die deutschsprachige Ausgabe eines schon in Spanien gedruckten Buchs Veränderungen und Streichungen vorschlug, zunächst nicht begeistert. Aber vielleicht auch wegen der ungewöhnlich konstruktiven Kritik von Ignacio Echevarría in der Tageszeitung El Pais, der das Buch – kritisch, aber durchaus zutreffend – als novela mural bezeichnet hatte, als einen Roman in der Tradition der großen mexikanischen Wandbilder von Rivera, Siqueiros und Tamayo, war Rafael bereit, sich das Ergebnis des Lektorats anzuschauen. Danach rief er mich an, jagte mir zunächst einen Schreck ein, als er sagte, er habe so etwas noch nie erlebt. Dann – ich glaube, er hatte meinen Schrecken bemerkt und sich darüber gefreut – sagte er, er sei mit allem einverstanden und dankbar, dass ein Verlag so viel intensive und konstruktive Arbeit auf einen Text verwandt hatte, den er selbst als auf diese Weise noch einmal verbessert empfand.
Ich habe andere spanischsprachige Schriftsteller kennengelernt. Wer auf der iberischen Halbinsel als Autor zu Ruhm kam, durfte sich lange als etwas Besonderes fühlen, in Lateinamerika waren mitunter sogar diplomatische Karrieren oder gar Präsidentschaftskandidaturen damit verbunden. Roberto Bolaño, dem ich als Übersetzer für den letzten Teil seines großen Romans Die wilden Detektive ein paar Änderungen vorgeschlagen hatte, verbot mir in einer frostigen Mail kategorisch, auch nur ein Komma zu streichen oder zu verändern. Solche fürstlichen Attitüden waren Rafael Chirbes vollkommen fremd. Seine Herkunft stand auch hier, und durchaus segensreich, im Wege. Die Achtung, mit der dieser Autor jeder ernsthaften Arbeit, körperlicher wie geistiger, auch und natürlich gerade der Arbeit an und mit der Literatur, begegnete, wäre mit einer wie auch immer gearteten hoheitsvollen Attitüde gegenüber der Arbeit eines Verlagslektors am Text – etwas, das sich viele Verlage im Spanien der Neunzigerjahre immer noch nicht leisten konnten – nicht vereinbar gewesen. Auch die für ihn sicherlich mit zusammengebissenen Zähnen akzeptierten Vorschläge für Veränderungen, Streichungen in seinem ersten großen Roman waren das Ergebnis langer, konzentrierter, vor allem aber solidarischer Arbeit, und das wusste dieser Autor zu schätzen. In den folgenden beiden Romanen, Der Fall von Madrid und Alte Freunde, gab es nichts mehr zu meckern. Rafael hatte selbst gearbeitet, aufgeräumt. Am Ende dieser Tagebücher hadert er mit den sich noch nicht zusammenfügenden Arbeiten zu seinem nächsten Roman, den er noch nicht nennt, möglicherweise auch noch nicht als Ganzes im Kopf hat. Es handelt sich um Crematorio, mit dem ihm der Durchbruch gelang und der 2007, zwei Jahre nach dem chronologischen Ende dieses Tagebuchs, erscheinen wird. Er fühlt sich, wieder einmal, konfus, weiß nicht, wo es hingeht, sein Leben ist durcheinander, er sehnt sich nach einem Kompass, der ihn irgendwo hinbringt. Und dann ist er wieder da, und wieder ist es die Literatur. Sie arbeitet in ihm, und sie wird ihn, immer wieder und auch dieses Mal, retten: Der letzte Satz des Tagebuchs lautet: »Die Literatur als Putzfrau, die das Haus aufräumt.«
Heinrich von Berenberg
VON ZEIT ZU ZEIT 1
(1984 – 1992)
Ein Zimmer in Paris
ÜBERBLEIBSEL AUS DEM GROSSEN HEFT
(APRIL 1984 – 21. MÄRZ 1985)
1984
April 1984
Ein Gefühl der Vorläufigkeit. Ich setze mich auf die Stuhlkante, statt mich richtig hinzusetzen, mich bequem auf meinem Gesäß niederzulassen: eine nervöse Art des Daseins. Unfähig, mich auf ein Sofa zu fläzen, den Kopf zu leeren und dabei in einer bequemen, entspannten Stellung liegen zu bleiben. Ich komme spät und müde von der Arbeit heim. Es gelingt mir nicht, mir Räume zu erobern. Obwohl ich schon fast zwei Jahre in dieser Wohnung lebe, habe ich mich noch nicht daran gewöhnt, sie als die meinige anzusehen, sie ist weiterhin nicht meine Wohnung, mein Ort. Ich fühle mich nicht einmal wohl, wenn ich mich in das Zimmer zurückziehe, das ich mir nach meinen Bedürfnissen und meinem Geschmack hergerichtet habe, ein stilles, sonniges Zimmer, vom Grün der Pflanzen belebt. Alles kommt mir provisorisch vor, unordentlich, durcheinander. Nichts passt an seinen Ort, die Dinge machen sich dort breit, wo sie nichts zu suchen haben. Der Schreibtisch ist besetzt von Papierhaufen und Büchern, die gelesen werden wollen. Die Wochen fliegen mir davon, keine Zeit, etwas Ordnung in diesem Chaos zu schaffen, nachzudenken, mich zu konzentrieren, mir die häusliche Geografie anzueignen, ganz zu schweigen von der anderen Geografie, meiner eigenen, der intimen Geografie, was auch immer das sein mag: Ich bin nicht in der Lage, mich selbst zu kolonisieren, ein plurales Wesen in der Abdrift, und jedes seiner Teile scheint sich in eine andere Richtung davonzumachen. Wie soll man da schreiben, wenn alles in der Schwebe ist, in Erwartung irgendeiner Form von Normalität?
Bemerkenswert, wie eilig man es in der Liebe damit hat, sich gemeinsame Erinnerungen aufzubürden: Bücher, Platten, Orte, mots de famille: Als wäre es nicht eben dieser ganze Krimskrams, für den du am Tag der Trennung einen hohen Preis zahlen musst. Wenn die Liebesgeschichte erst einmal vorbei ist, sind es diese Gegenstände, Klänge, Orte oder Gesichter, die du mit der anderen Person gesehen oder gehört hast, das, was du gerochen oder ertastet hast, die dich überallhin verfolgen, dich belauern und dich daran hindern, den Kopf wieder hoch zu tragen. Du gehst in die Buchhandlung, willst ein Buch aus dem Regal ziehen, und da steht jenes, das die andere Person mochte. Du machst den Kühlschrank auf, und die Erdbeeren oder das Kalbsfilet, was immer du da siehst, stellen den Kontakt her, über eine Geste, einen an dich gerichteten Satz: Das holt die Person herbei, stellt sie vor dich hin, da steht sie zwischen dir und dem Rest der Welt.
Nicht zu vergessen das schmerzhafte Gewicht der Gerüche – das Erinnern der Gerüche – bei jeder Trennung und beim Aufbau einer neuen Liebesgeschichte. Der Körper, den du jetzt umarmst, riecht nicht wie der andere, keiner riecht genau so wie ein anderer. Und jener Anblick, der dich so erregte und dessen Genuss der Anfang deiner Heilung zu sein schien, wird plötzlich unangenehm, abstoßend, geradezu bedrohlich, weil beim Umarmen dieser Geruch auftaucht, der nicht im Geringsten dem gleicht, den du erwartest, dem jenes anderen Körpers, der dich vor Kurzem verlassen hat und nach dem du suchst.
Nachdenken gilt als eine Tätigkeit, die in jedweder Angelegenheit des Lebens geboten ist, nicht jedoch beim Scheitern einer Liebe, da erweist es sich als nutzlos, gar gefährlich: Nicht nachzudenken ist eine Form der Heilung. Eine ganze Stunde lang nicht vom Bild des anderen überfallen zu werden und nicht alles zu drehen und zu wenden, was man gemeinsam gelebt habt, ist schon ein beachtlicher Erfolg.
Ein anderer Tag im April
Zwei Uhr nachts. Zeit, ins Bett zu gehen, weil ich morgen früh rausmuss. Aber ich bin in bester Verfassung, klar und ruhig, habe soeben die Englischübungen, die ich mir auferlegt habe – Conrad mit Wörterbuch lesen –, beendet und einen Brief an einen Freund geschrieben. Wenn ich nicht morgen auf dem Posten sein müsste, bliebe ich noch ein paar Stunden sitzen. Als ob der Körper darauf aus wäre, mir Paroli zu bieten. Er ist rebellisch. Er hasst die Zeitpläne und fühlt sich immer dann wohl, wenn er erschöpft sein sollte, und umgekehrt, denn in der Arbeitszeit bin ich müde, unruhig, habe Magenschmerzen, fühle mich träge oder einfach nicht gut. Ich boykottiere mich selbst. Als könnte ich nicht leben ohne meine tägliche Ration an Unsicherheit, Angst und Leid. Ständig muss ich mich von etwas erholen, das mich verletzt hat.
2. Mai 1984
Stille im Haus. Nachts, spätnachts. Ich bin im Zentrum von Madrid und man hört nichts: nur ein Summen in den Ohren, wenn ich die Feder hebe und zu schreiben aufhöre, wie am Grund eines Brunnens. Ich lese Penúltimos castigos (Vorletzte Strafen), die Autobiografie von Barral. Ich fühle mich entspannt, ruhig, wie ich es seit einem Jahr nicht mehr war, obwohl sich, und das seit Tagen, ein physischer Schmerz dazwischendrängt, der mich von dem anderen, dem Trennungsschmerz, ablenkt.
7. Mai
Wieder die Schlaflosigkeit. Heute aber setzt sich der physische Schmerz durch. Ich hänge an einem Faden. Mit einem Schnippen der Schere könnte ihn jeder durchtrennen. Ich schaue mir das an, was ich vor ein paar Tagen geschrieben habe – dass ich ruhig und entspannt bin –, und muss über mich selbst lachen.
8. Mai
Ungemütliche Tage und Nächte der Verzweiflung. Eine Fistel, die sich dann – nach Auskunft des Arztes – als Schrunde erweist, setzt mir unsäglich zu. Seit fünf Nächten mache ich kein Auge zu. Vorgestern endlich habe ich beschlossen, einen Arzt aufzusuchen. Nach einer gewissenhaften Untersuchung diagnostizierte er die Fissur und sagte, da bliebe nichts anderes übrig, als zu operieren. Er verschrieb mir noch eine Salbe und Ampullen mit einem Analgesikum, um die Schmerzen zu lindern. Er sagte auch, dass die Salbe, die ich bis dahin benutzt hatte, völlig nutzlos ist. Und er gab mir eine Überweisung für den Facharzt (Proktologe, hat er ihn, glaube ich, genannt). Die Nacht wird trotz Salbe und Schmerzmittel die übelste bisher. Zu Hause allein kann ich nicht stillhalten, ich wimmere, knie mich hin, nehme den Kopf in die Hände und drücke fest zu, um zu sehen, ob der eine Schmerz vom anderen ablenkt. Alles zwecklos. Es ist dieses Gefühl, von dem ich in einem Buch gelesen habe: Ein wütendes Tier kratzt dich von innen auf. Mir fällt das Buch von Hernán Valdés über Pinochets Putsch in Chile ein, Auch wenn es nur einer wäre: Ich glaube in diesem Buch gelesen zu haben, dass eine der Foltermethoden der Militärs darin bestand, ihren Opfern in die Scheide oder den After ein Gefäß einzuführen, in das sie eine Ratte gesteckt hatten, damit das Nagetier sich dann seinen Weg bahnte und in den Körper eindrang. Wenn es nicht dieses Buch war, dann eins der anderen, die ich damals über die verschiedenen Foltermethoden der Putschisten las. Der liebe Gott, mein ganz persönlicher Putschist.
Draußen ist es kalt und regnerisch. Aber auch in der Wohnung habe ich ständig Schüttelfrost. Ich stehe auf, der Boden ist eisig, ich setze mich aufs Bidet, um mich zu waschen, es ist eisig, das kalte Wasser beißt in mein Gesäß, in meine Schenkel, ich zittere und weiß nicht, wie ich mich halten soll. Jede eingenommene Stellung ist unangenehm, wenn nicht gar extrem schmerzhaft. Die Schmerzen gehen von der Spitze des Schwanzes bis zum After, und von da ziehen sie im Inneren bis in den Bereich der Leber, aber auch in die Schenkel, von wo sie sich zum Bauch hin ausbreiten. Merkwürdigerweise fühle ich mich morgens, trotz Schlafmangel und Schmerzen, munter und von großer Vitalität, ganz im Gegensatz zu der Erschöpfung durch den Schmerz im Morgengrauen. Ich gehe ganz normal ins Büro, halte die Zeiten ein, erledige meine Arbeit und nehme sogar an einigen Essen teil, um den Verpflichtungen der Zeitschrift Sobremesa zu genügen. Nicht dass ich dabei eine gute Zeit hätte, aber es gelingt mir, den Schmerz zu verbergen, und keiner merkt etwas.
Heute begebe ich mich in die zuständige Klinik, die mir die Krankenkasse angegeben hat: Es handelt sich um ein kleineres Gebäude, gelegen in einem eleganten Viertel der Stadt, das Ambiente sehr kalifornisch. Ich sitze auf einem der Sofas im Warteraum, der an das Wohnzimmer einer Mittelklassefamilie erinnert, an den Wänden triviale Bildchen: Blumen, Landschaften, und eine große Glasfront zu einem prächtigen Garten hin, der heute funkelt von den Glanzlichtern, die der Regen vorhin auf die Pflanzen gesetzt hat, Rosen in verschiedenen Farben, eine japanische Kirsche mit auffallenden Blüten – alles atmet eine angenehme Sorglosigkeit, von den Klinikbesitzern sicher gewollt, um die Ängste der Patienten zu vertreiben. Es gilt, die Krankheit und ihre möglichen Folgen in das heimische Wohnzimmer zu bringen. Diese Sorglosigkeit hat etwas Unheimliches, so scheint es mir zumindest. Jedes Ding sollte ausdrücken, was es ist, und die Einrichtung dieser Klinik erweist sich als so falsch wie Judas, man kommt nicht her, um Tee zu trinken oder zu stricken: Du kommst her, um abgehört, um gepikst, um aufgeschnitten zu werden. Fünf Minuten später, im Behandlungszimmer, ich auf allen vieren auf einem Untersuchungsbett, Hintern in die Höh, und der Arzt sagt, es muss operiert werden, aber davor sind einige Punktionen nötig, und die sind sehr schmerzhaft. Er nennt das Infiltrationen. Er setzt an zum ersten Stich. Ich jaule auf.
12. Mai
Wenn in den Büchern, die uns die Pfarrer in der Schule zu lesen gaben, jemand dem Teufel begegnete (der Wanderer, der inmitten tiefer Waldesnacht entdeckt, dass sein Gefährte nach Schwefel riecht), stellte er am nächsten Morgen fest, dass sein Haar von dem Schrecken weiß geworden war. Etwas muss dran sein. Ich weiß nicht, ob ich schon die Bocksfüße unter dem Mantel jenes Wesens, das mich in meinen Albträumen begleitet, gesehen habe oder ob ich mich dem Höllentor nähere, aber dieser Tage streune ich durch Nachbarschaften, die den unverwechselbaren Duft des Schwefels ausströmen. Der Spiegel zeigt mir, dass meine grauen Haare sich in etwas mehr als einem Monat rasch vermehrt haben. Mit der Erscheinung eines Playboys und eines Mannes, der gewohnheitsmäßig Whiskey in Nuttenklubs trinkt, ist Dr. D. ein kühler Galicier (und, wie ich entdecke, grausam), er verabreicht mir die Infiltrationen, die, um es einfach auszudrücken, monströse, in den Anus gesetzte Spritzen sind, die mir, logischerweise, grauenhaft wehtun, ihn hingegen zu amüsieren scheinen, als wäre er nicht dabei, ein Leiden zu behandeln, sondern ein von ihm verachtetes Laster zu bestrafen. Es wirkt so, als habe er den Beruf aus Hass auf das Milieu gewählt, mit dem er es zu tun hat. Er senkt das Ohr auf die Höhe, wo ich meinen Kopf in der Liege vergraben habe (nicht zu vergessen, ich hocke auf allen vieren), und schreit: Nicht kauern! Hoch mit dem Hintern! Es wird dir so oder so wehtun. Ich jaule auf wie ein Hund, als er die Nadel hineinsticht. Warum duzt er mich? Ist das etwa keine Privatklinik (auch wenn ich von der Sozialversicherung hierher überwiesen wurde), in der ein Patient gewisse Privilegien genießt? Ich bin drauf und dran, nachzufragen. Auch, warum er Proktologe geworden ist, wenn er diesen Teil des Körpers, den ich ihm zu meinem Leidwesen zeige, so sehr ablehnt. Oder regiert bei den Ärzten, wie beim Rest der Sterblichen, die Maxime, dass Hass und Liebe dicht beieinanderliegen?
Obwohl, wie Karl Marx uns lehrt, ist es, will man Dinge begreifen, am besten, auf Fragen des Geldes und des Klassenkampfs zurückzukommen: Was ihm auf den Sack geht, ist wohl, dass er einen armen Schlucker behandelt, den die Sozialversicherung in diese angesehene Privatklinik geschickt hat, er behandelt mich, wie in Herrenhäusern der Stallbursche behandelt wird, dessen Krankheiten nicht der Hausarzt heilt, der vielmehr seine Rezepte und Spritzen vom Tierarzt bekommt, wenn der gerade den Reitstall besucht.
14. Mai
Wieder eine Nacht (die wievielte?) wälze ich mich schlaflos im Bett. Unfähig zu lesen, zu schreiben. Ich bin allein zu Hause, wie ein kleiner, von seinem Herrchen verlassener Köter. Ich könnte heulen. In der ganzen Zeit habe ich nichts von J.T. gehört. Das mit der Liebe ist eine höchst unbeständige Angelegenheit. Jemand, der eine Zeit lang alles für dich ist, verschwindet und ist nichts mehr. Ein eher masochistisches Spielchen. Als ich ihn einmal zufällig traf, sah er eiligst weg. Ich grüßte ihn im Vorbeigehen, und er wirkte sehr nervös: »Wir können jetzt nicht reden. Ich bin mit meinem neuen Liebhaber hier«, zischelte er, bewegte die Lippen dabei so wenig wie möglich. Monatelang hatte ich nicht gewusst, wie ich Schluss machen sollte, ertrug stoisch eine eingeschlafene Beziehung, um ihn nicht mit leeren Händen auf die Straße zu schicken, und jetzt, wo er eine neue Sicherheit gefunden hat, bin ich ihm lästig. Ich verstehe, für ihn ist es wichtig, nicht zu verlieren, was er hat, es nicht zu gefährden. Und ich spreche da nicht von Liebe oder Lieblosigkeit, sondern von Ökonomie, oder, besser, vom Überleben: Es gilt, die errungenen Subsistenzmittel nicht zu verlieren. Brot und Bett. Das verstehe ich, aber es tut weh.
Obgleich es schon Mitte Mai ist, halten Kälte und Regen an. Welch seltsames Jahr. Das ist Madrid, widersprüchlich und nicht eben gastfreundlich. Neun Monate Winter, drei Monate Hölle, sagt das Sprichwort über die Stadt. Ein anderes Sprichwort, das sich auch auf die Härte und Tücke des Klimas bezieht: Die Luft von Madrid löscht keine Kerze, aber tötet eine alte Frau. Jedes Mal, wenn ich vom Bett aufstehe (wie oft jede Nacht?), denke ich daran, dass ich mich auf das kalte Bidet setzen muss, und an den Schmerz, wenn ich mich beim Auftragen der Salbe berühren muss, denke an die Kälte des Steinguts: Schmerz und Kälte, eine Paarung, die dieser grauen Stadt entspricht. Wo versteckt Madrid seine Sinnlichkeit, seine Lebensfreude? Nicht einmal in der Architektur erlaubt es sich allzu viele Schnörkel. Madrid hat Machtcontainer hochgezogen, eine Reihe von Großbauten, denen es zumeist an Anmut mangelt, die aber im Inneren Reichtümer und Geheimnisse bergen (meine ersten Eindrücke von der Stadt: interessant nur der Prado und der Retiro, nicht einmal den Königspalast fand ich schön). Barcelona hat Schaufenster für den Handel errichtet, hat sich herausgeputzt, putzt sich noch immer für den Besucher heraus; in Barcelona drängt der Reichtum auf die Straße, stellt sich aus. In Madrid zieht die Macht es vor zu überwältigen, statt zu verführen: Bauten wie ein Schlag mit der Faust auf den Tisch.
Ob Madrid nun freundlich ist oder nicht, die Spülungen des Afters, die Kälte der Bidetschüssel bleiben; und danach die unangenehme Begegnung der schmerzenden Stelle mit dem Handtuch. Alles wird schwierig, abweisend, hoffnungslos in dieser leeren Wohnung, die, als ich sie vor ein paar Jahren kaufte, wie geschaffen schien, mir Frieden zu gewähren, ein wohltuendes Gleichgewicht.
Wenn der Schmerz es erlaubt, lese ich den Quijote. Cervantes gönnt dem Leser keine Ruhepause: Während der Hirte die Geschichte von Marcela wieder aufnimmt, verbessert Don Quijote ihn ständig. Es gibt eine Handlung im Vordergrund und eine zeitlich verschobene. Die Leichtigkeit dabei erinnert an das Drehbuch zu einer Komödie, von Billy Wilder etwa, oder an einen Hollywood-Krimi aus den Vierzigerjahren.
Zum ersten Mal in meinem Leben verbringe ich einen ganzen Nachmittag beim Bügeln; genau, richtig gehört, beim Bügeln. Ich, der ich ein absoluter Versager bei dieser Art von halb mechanischen, halb häuslichen Arbeiten (Bügeln, Waschen, Nähen) bin, bügle eingehüllt in Hintergrundmusik: Arriaga, Smetanas Moldau, Die Zauberflöte. Ich wähle die Musik wie für eine dieser Radiosendungen mit dem Titel »Unvergessliche Momente« oder »Melodien zum Träumen«. Die Fissur schmerzt so sehr, dass allein Bügeln mir als Möglichkeit einfiel, um länger zu stehen – die Stellung, in der ich mich am besten fühle – und zugleich quälende Gedanken zu vermeiden: die ganze Aufmerksamkeit auf etwas konzentrieren, das für mich schwierig ist und das ich in mehreren Anläufen angehen muss. Mit dem Dunst aus der angefeuchteten, heißen Wäsche steigen Kindheitserinnerungen auf: das Haus der Familie, meine Großmutter, meine Mutter, die Gespräche in der Küche, das Geräusch der Löffel, wenn sie beim Essen über die Glasur der Teller schaben, der pflanzliche Geruch aus den Schränken, die nach aromatischen Kräutern oder Seife duften; oder der Geruch des Backofens in der Bäckerei, wohin man außer den Brotlaiben auch Reisgerichte, Teigtaschen, Mandelkuchen, Kürbisse, Erdnüsse oder Süßkartoffeln zum Aufbacken brachte. Die Kindheit wie eine Küche bei Andersen oder den Gebrüdern Grimm, alles warm und friedlich, es riecht nach einem eben aus dem Ofen geholten Kuchen, und plötzlich die Ahnung, dass sich irgendwo etwas Entsetzliches verbirgt. Klopf, klopf, wer bist du? Zeig deine Pfote. Ich bin deine Fissur. Wie bei den sadistischen Erzählern, die für Kinder schrieben.
15. Mai
Feiertag in Madrid. Um nicht den ganzen Tag zu Hause herumzusitzen, beschließe ich, mir die Edvard-Munch-Ausstellung anzusehen. Ich gehe früh los und treffe wenige Schritte von meiner Haustür entfernt einen Verkäufer vom Rastro, mit dem ich einen freundschaftlichen Umgang habe. Wir gehen einen Kaffee trinken. Eine Stunde Ablenkung, vergessen die physischen und seelischen Schmerzen. Immerhin etwas. Jede Zeit, in der ich den Schmerz vergesse, ist für mich gewonnene Zeit. Bei der Nationalbibliothek angekommen, stehe ich vor verschlossenem Gitter. Auch der Prado ist geschlossen, wo es eine Ausstellung von Claude Lorrain und den Landschaftsmalern des 18. Jahrhunderts gibt. Tatsächlich sind heute, am Tag des heiligen Isidro, Patron von Madrid, alle Museen der Stadt geschlossen. Ich spaziere über die Cuesta de Moyano mit ihren Antiquariaten; durch den Botanischen Garten, sehr schön nach all diesen Regentagen, die Madrid zu einer Erweiterung Galiciens gemacht haben. Müde und frustriert komme ich nach Hause. Ich lege mich ohne Essen hin. Der Schmerz schwindet. Abends gehe ich mit M. C. I. ins Kino. Wir sehen Fanny und Alexander. Später trinken wir ein Glas in einem Schwulenlokal. Ich fühle mich besser, als ich heimkomme, entspannter, doch sobald ich mich hinlege, bin ich wieder hellwach und spüre diesen Drillbohrer, der mich durchlöchert. Ich sage mir, dass die Frauen wohl etwas Ähnliches spüren, wenn es ans Gebären geht, ein Tier, das in dir wohnt und ganz egoistisch nach draußen drängt, um das Sonnenlicht zu genießen.
16. Mai
Treffen mit J., nach vielen Jahren. Wir gehen noch mal die Anekdoten aus unserer Kindheit im Internat durch. Er war ein sehr guter Freund.
17. Mai
Wieder eine schlaflose Nacht. Ich hatte mit Martínez Llopis gegessen, mit dem mich eine von Tag zu Tag engere Freundschaft und ein wachsendes Vertrauen verbinden. Zu Hause dann akuter Schmerz. Viel Blut im Stuhl. Die Schmerzen hören trotz der Salbe nicht auf. Als ich den Beipackzettel lese, sehe ich, dass die Salbe bei Blutungen nicht angewendet werden soll. Das heißt, ich mache etwas falsch. Ich lege mich ins Bett, schließe die Augen und versuche in eher düsterer Stimmung an all die Menschen zu denken, die ich geliebt habe, in die ich auf die eine oder andere Weise verliebt gewesen bin, körperliche Lieben, aber auch platonische Lieben. Lauter Versuche, jenen Zustand zu erreichen oder zu streifen, den wir Liebe nennen und als Fülle zu erleben trachten, während er doch seiner Natur nach nichts als Selbstauflösung ist. In vielen Fällen waren es frustrierende Erfahrungen, Bekannte, die mit meiner Sexualität kokettierten; oder die sich kurzfristig von ihr angezogen fühlten. Einer, an den ich mich mit besonderer Zärtlichkeit erinnere, ist ganz jung gestorben. T., er war so stark und voller Leben. Das letzte Mal sah ich ihn im Krankenhaus: Ich habe ihn kaum wiedererkannt. Ein Skelett. Er starb, eine Woche nachdem sein zweites Kind geboren war.
An einem anderen Tag
Morgendlicher Spaziergang mit M. C. I., Besuch des Prado. Danach nimmt er mich mit zum Retiro, führt mich in ein Pflanzenlabyrinth, das die Homosexuellen frequentieren. Am helllichten Tag, wenige Meter entfernt von den mit ihren Enkeln spazierenden Großeltern, ficken die Paare auf dem Gras liegend oder stehend; Typen, die lutschend auf dem Boden knien oder hocken; Typen, die einander penetrieren: der Passive gebückt, stützt sich gegen einen Baumstamm, der andere bewegt sich schnell, ein Karnickel, er ruft: Uff, ahh, geil, mein Gott, wie geil. Ich glaube, er übertreibt mit Blick auf die Galerie (ich genieße mehr als ihr, lässt er den Kreis derer wissen, die dem Zentauren – wie Gil de Biedma sagen würde – zuschauen). Es herrscht reichlich Gruppensex, da finden welche zusammen und laufen schnell wieder auseinander, Typen, die einander mit heruntergelassenen Hosen oder ganz nackt penetrieren, beobachtet von anderen, die masturbieren. Eine eigene Welt, wenige Schritte entfernt von der erkennbaren, der beichtbaren Welt; so etwas wie ein schwarzes Loch, das sich an diesem lichten Sonntag weitet, ein Spiel der Zauberei, das nur derjenige sieht, der zum Stamm gehört. Wer nicht um das Geheimnis weiß, wird nicht in diesen abgekapselten Ort eindringen und auch keine der schlüpfrigen Szenen sehen, die hier aufgeführt werden. Auf dem Boden, im Schlamm oder zwischen dem Gestrüpp Papiertaschentücher, zum Säubern benutzt, ausgespuckter Samen. Im Park ist alles sehr grün wegen der langen Regensaison. Wir verlassen das Labyrinth, das mich an die Illustrationen von Doré zu Dantes Inferno erinnert (ich mit einer gewissen Beklommenheit, aber auch mit einer dunklen Erregung), und gehen hinüber zu dem Pavillon, wo die städtische Kapelle in Endlosschleife die Ouvertüre zu »La Dolores«, »El baile de Luis Alonso« und »Los Nardos« spielt. Der Musik hört eine stattliche Menschengruppe zu, ein provinzielles Ambiente, wie beim Kleinbürgertum aus der Belle Époque, das Berlanga in Novio a la vista





























