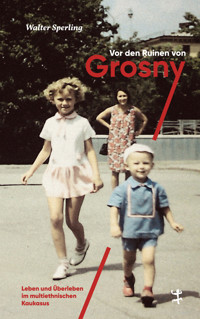
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Matthes & Seitz Berlin Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
»Was war der Vielvölkerstaat Sowjetunion, der immerhin sieben Jahrzehnte lang das Leben von über zweihundert Millionen Menschen bestimmte? Wie funktionierte das Miteinander der multiethnischen Gemeinschaften, die in einer Vielzahl von sowjetischen Städten über Jahrzehnte bestanden? Anders gefragt, wie gelang es den Menschen, nach den Exzessen der Gewalt – Revolution, Bürgerkrieg, Terror, Zweiter Weltkrieg – einander wieder in die Augen zu schauen und neues Vertrauen zu fassen? Oder waren die gemeinsam verlebten Jahrzehnte nach Stalins Tod nichts weiter als ein Ausharren, ein Warten auf das ›Ende der Geschichte‹?« Die Suche nach Antworten auf diese Fragen führte Walter Sperling in dieser mitreißend erzählten Alltagsgeschichte an den Rand der ehemaligen Sowjetunion, nach Grosny. Dort bündelt sich wie in einem Brennglas das Kräftespiel von Widerstand und Integration, im Ringen des russischen Imperiums und der Peripherie, der Kolonisatoren und Kolonisierten. Erst Garnisonsort, dann Boomtown des Erdöls, nach der Oktoberrevolution Baustelle des Sozialismus, wenig später Frontstadt im Visier der deutschen Wehrmacht. Nach der Deportation der Tschetschenen und Inguschen 1944 und deren Rückkehr 1957 hörte man lange nichts mehr von dem beschaulichen Städtchen im Kaukasus, das beharrlich um seinen sozialen Frieden rang. Bis zum ersten russischen Tschetschenienkrieg, als Grosny erneut in Ruinen endete. Die Eskalation und die Radikalisierung zeichnet Walter Sperling nach. Vor allem aber macht er die Bemühungen sichtbar, Brücken zu schlagen und zu vermitteln, weil die Eliten der multiethnischen und multireligiösen Peripherie wussten, was der Preis von Entfesselung ist.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 1173
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Einleitung
Die Mythen der Völkerfreundschaft
Eine Stadt an der imperialen Peripherie
Die Spuren und Quellen einer Geschichte
Alltag und Zivilisation: Fragen an Grosny
Kapitel 1
Vom Vorposten des Imperiums zur Boomtown des Öls
Die Festung an der Sunscha
Hinter dem Fluss: das Land der Tschetschenen
Der Kolonialkrieg, die Verheißung des Islam und die Zwänge des Dschihad-Staates
Von Widerstand zu Eigensinn: Plädoyer für postkoloniale Perspektiven
Boomtown des Öls im Zeichen der Verbürgerlichung
Kapitel 2
Brennende Ölfelder 1917: Revolution, Bürgerkrieg, Terror
Streik, Revolution und Pogrom: Grosny 1905
Wut und Angst: Gewaltgemeinschaften der Revolution
Inmitten des Bürgerkrieges: Grosny 1917–1920
Fragiler Frieden: die Schwäche des bolschewistischen Staates
Kapitel 3
Der Kampf ums Öl, um den Plan und um eine sowjetische Nation
Grosneft – ein Ölkonzern entsteht
»Russische« Stadt, »tschetschenisches« Land
Hauptstadt einer sowjetischen Nation
Baustelle und Brückenkopf der sowjetischen Zivilisation
Produktionserfolge nach Plan: Druck, Terror, Angst
Stalinismus als Zivilisation: die Stadt und die Versprechen der Heterotopie
Kapitel 4
Brennende Ölfelder 1942: Hitlers Krieg, Stalins Deportation
Der Kaukasus, das Öl und die Wehrmacht am Terek
Freund und Feind in den Bergen
Die Suche nach Eindeutigkeit hinter der Front
Die Deportation: »sowjetische« Nation, »feindliche« Nation
Im Niemandsland
Kapitel 5
Nachkriegsidyll aus dem Geist des Stalinismus
Erdöl für den Kalten Krieg
Jenseits der Repression: zur Signatur der Nachkriegszeit
»Gezähmte Helden« und das kleinbürgerliche Glück
Ordnung, Fleiß, Familiensinn: Konturen einer Nachkriegsgesellschaft
Grosny – ein Nachkriegsidyll
Kapitel 6
Im Tauwetter der Völkerfreundschaft: Die Rückkehr der Deportierten nach Grosny
Die Rehabilitierung der Deportierten in Moskau
Die Ablehnung der Nordkaukasier in Grosny
»Banditen«: Drohgebärden und die Gewalt der Rückkehrer
Der August-Aufstand 1958 in Grosny und seine Folgen
Völkerfreundschaft: die Sowjetunion als imagined community
Der Platz der Völkerfreundschaft: 1973 in Grosny
Kapitel 7
Auf den Straßen von Grosny: Alltag einer multiethnischen Zivilisation
Jenseits von Geschichte
Die Anderen der Stadt und die Mythen des Alltags
Der kultivierte Einwohner der kultivierten Stadt
Zwischen sowjetischer Moderne und kaukasischer Tradition
Das Kopftuch: Variationen sowjetischer Zivilisation
Der Herrenhut: moderne Form lokaler Tradition
Hörsaal, Boxring, Werkstatt: das Individuum, seine Räume und Kollektive
Die »goldenen« Siebziger: Segen und Fluch der industriellen Moderne
Kapitel 8
Die Kritik der Perestroika und die »Krise des Föderalstaates« im Kaukasus
Die Sehnsucht nach Tradition und die ›Neuerfindung‹ der Nation
Sexappeal der Perestroika, Miss Grosny und die Provokation der Tradition
Die Rede vom Untergang der Nation: Kritik und Krise im Kaukasus
»Heimat von Männern, nicht Sklaven«. Der Kongress der Inguschen in Grosny 1989
Kapitel 9
Revolution und Revanche: Die Auflösung der multiethnischen Gemeinschaft
Kriminalität, Gewalt und die Enthemmung der Straße
Die »Anarchie der Freiheit« oder: Im Schatten der nationalen Revolution
Der »zivilisierte Weg« und der Abgrund des Bürgerkrieges
Moskaus »verfassungsmäßige Ordnung« und das Ende von Grosny
Epilog
»Die tote Stadt« und der Schmerz der Erinnerung
Gemeinschaft der Trauer, Gemeinschaft der Nostalgie
Trennendes und Verbindendes: postkoloniale Geschichte(n)
Dank
Anmerkungen
Abbildungsverzeichnis
Literatur - und Quellenverzeichnis
Personenregister
EINLEITUNG
Die Mythen der Völkerfreundschaft
Eine Stadt an der imperialen Peripherie
Die Spuren und Quellen einer Geschichte
Alltag und Zivilisation: Fragen an Grosny
»If history creates complexities, let us not try to simplify them.«
Salman Rushdie, Imaginary Homelands1
»Es wäre an der Zeit, die Sache in all ihren Verstrickungen zu studieren.«
Sultan Jaschurkaew, Auf Splittern gekratzt. Grosny 19952
Das Ende der Sowjetunion haben Millionen gefeiert. Im Osten wie im Westen haben sich Menschen über das Ableben des Regimes gefreut. Doch genauso gab es Millionen, die dem sowjetischen Staat nachgetrauert haben, die idyllischen Bilder der sozialistischen Gesellschaft vor Augen, den Geruch und Geschmack der sowjetischen Kindheit und Jugend im Sinn. Es ist diese Sehnsucht nach der zerfallenen Sowjetunion, die immer wieder auf Verwunderung stößt.3
Die Sowjetunion war ein Imperium, kann man bei Zeitzeugen und Historikern nachlesen, das letzte seiner Art.4 Nirgends tritt dies heute so deutlich zutage wie in Moskau, das mit seinen unter Stalin entworfenen Prospekten, Hochhauskathedralen und Blockbaufassaden immer noch den Anspruch einer Weltmacht vermittelt. Das Imperium hat sich vor Jahrzehnten aufgelöst, doch die Ambitionen, die Übermacht und die Abhängigkeiten sind geblieben. Menschen aus den ehemaligen Republiken der Sowjetunion strömen noch immer in Russlands Metropole, um dort ein Auskommen zu finden, weil die Wege sich historisch ergeben haben und weil die Wirtschaft im Kaukasus, in Zentralasien und im Fernen Osten sie nicht ernährt. So war es zumindest bis zu Russlands Einmarsch in die Ukraine.5
Bei einer Reise nach Moskau 2011 fallen mir am Flughafen unweigerlich junge Männer aus Tadschikistan auf. Dicht gedrängt stehen sie vor den Schaltern des Zolls. Eine Grenzbeamtin keift sie an, beschimpft sie lauthals als »Schafsköpfe« und »Horde Vieh«. »Sollen die ›Schwarzen‹ doch bleiben, wo sie sind«, zischt mir ein Bekannter wenige Jahre später in einem hippen Moskauer Café zu, als wir auf die Wanderarbeiter aus dem Kaukasus zu sprechen kommen. »Schauen Sie doch nach Europa«, gibt mir 2018 eine gebildete Dame nach einem Vortrag in der Moskauer Bibliothek für Ausländische Literatur zu bedenken, »das liberale Projekt des Multikulturalismus hat doch auch dort ein totales Fiasko erlebt.«
Fremdenfeindlichkeit, Rassismus, Orientalismus – unbefangen geäußert und öffentlich zur Schau gestellt. Als Historiker des Zarenreiches und der Sowjetunion überrascht mich das nicht. Doch aufgewachsen als Enkel von deutschen Deportierten in einer sowjetischen Industriestadt inmitten der kasachischen Steppe, umgeben von Nachbarn, die aus der Ukraine, dem Ural und dem Kaukasus stammten, kann ich nicht aufhören, Trauer darüber zu empfinden, dass die sowjetische »Völkerfreundschaft« heute lediglich in meiner Kindheitserinnerung existiert, dass der Zerfall der Sowjetunion auch etwas im Gesamtdiskurs des multiethnischen Miteinanders zerbrochen hat: die Sagbarkeit im öffentlichen Raum, das behördliche Regulativ, die sowjetische Form einer political correctness, die an den »Internationalismus«, an die Solidarität, an das »brüderliche« Miteinander der »Völker« appelliert.
Die Mythen der Völkerfreundschaft
Über diese Verlusterfahrung sprach ich immer wieder mit meiner Familie, meinen Freunden und Bekannten aus dem postsowjetischen Raum. Sie antworteten mir mit nostalgischen Erinnerungen an den Urlaub an der abchasischen Schwarzmeerküste, mit Reminiszenzen an die georgischen Filme und an den Jazz aus Baku. Da war von einer Nähe die Rede, vom gemeinsamen cultural space und von einem geteilten Schicksal. Doch immer wieder fiel auch das Wort »Mythos«. Während wir über die George-Washington-Brücke auf Manhattan zufahren, erzählt mir ein aus Leningrad stammender amerikanischer Kollege: Mitte der 1980er Jahre habe er in der sowjetischen Armee gedient und dort keine Anzeichen für eine wie auch immer geartete Völkerfreundschaft gesehen. Einen Schmelztiegel habe es da bestimmt nicht gegeben, denn die Wehrpflichtigen hätten sich spontan zu nationalen Gemeinschaften zusammengeschlossen. Als Nationen hätten sie dann miteinander darum gerungen, wer der Stärkere sei und welche Gruppe in der Kaserne jenseits der Offiziere das Sagen habe.
Abbildung 1: »Völkerfreundschaft der UdSSR – eine große Errungenschaft der Lenin’schen Nationalitätenpolitik«. Eine Amateuraufnahme fügt die Behauptung des Regimes ein in die Poetik des Alltags. Die Banalität des Parteislogans an der Hausfassade verbindet sich mit einem romantischen Sujet der Stadtfotografie, das Private und das Politische im multiethnischen Grosny auf eigentümliche Weise verquickend. Im Lermontow-Garten an den Ufern der Sunscha. (um 1980)
Von einem Mythos spricht auch die wissenschaftliche Literatur. Sie handelt die sowjetische Völkerfreundschaft als Propaganda ab und als ein Herrschaftsmittel des Regimes.6 Keine Frage, auch die Nation ist ein Mythos – von Intellektuellen im 18. Jahrhundert erfunden, von den Institutionen des europäischen Nationalstaates im 19. Jahrhundert durchgesetzt. Dass die Nationsbildung in Europa ein langer Vorgang der Disziplinierung war, hat etwa der Historiker Eugen Weber in den 1970er Jahren anschaulich beschrieben. Sein Buch Peasants into Frenchmen gehört zu den Grundlagenwerken der europäischen Geschichte, steht auf der Literaturliste eines jeden Nationalismus-Seminars.7 Und obwohl Kritik am Nationalismus heute selbstverständlich ist, wird der Mythos der Nation akzeptiert, nicht zuletzt, weil er sich mit völkerrechtlicher Souveränität, mit territorialer Staatlichkeit und mit politischer Repräsentation verbindet. Die Projektion des Multiethnischen und Multinationalen in der Sowjetunion steht dagegen grundsätzlich im Verdacht, Moskaus Hegemonie zu verschleiern.
Dabei hat der Zerfall der Sowjetunion 1991 ein Konvolut an Forschungsarbeiten hervorgebracht, die zeigen, dass die Oktoberrevolution 1917 in ihrem Anspruch eine antiimperiale Veranstaltung war, dass das Selbstbestimmungsrecht der Nationen für die Bolschewiken nicht Floskel, sondern Glaubenssatz war und dass sie danach strebten, Nationen zu schaffen, wo noch keine existierten. Um den Gang der evolutionär gedachten Geschichte zu beschleunigen, haben sie »bourgeoisen Nationalismus« bekämpft und sozialistische Nationen und deren Kulturen gefördert, haben nationale Schriftstellerunionen gegründet und Unsummen in die Schaffung, Übersetzung und Verbreitung der nationalen Literaturen ins Russische gesteckt.8
Was war also der Vielvölkerstaat Sowjetunion, der immerhin sieben Jahrzehnte lang das Leben von über 200 Millionen Menschen bestimmte? Wie funktionierte die Sowjetunion als multinationale Gesellschaft? Und wie gestaltete sich das Miteinander der multiethnischen Gemeinschaften, die in einer Vielzahl von sowjetischen Städten über Jahrzehnte bestanden? Anders gefragt, wie gelang es den Menschen, nach den Exzessen der Gewalt – Revolution, Bürgerkrieg, Terror, Zweiter Weltkrieg – einander wieder in die Augen zu schauen und neues Vertrauen zu fassen? Oder waren die gemeinsam verlebten Jahrzehnte nach Stalins Tod nichts weiter als ein Ausharren, ein Warten auf das »Ende der Geschichte«, das der Politologe Francis Fukuyama mit dem Zerfall der Sowjetunion anbrechen sah?
Eine Stadt an der imperialen Peripherie
Um Antworten auf diese Fragen zu bekommen, begab ich mich an die ehemalige sowjetische Peripherie. Nicht nach Zentralasien, das mir aus der Kindheit vertraut war, sondern in den Nordkaukasus, wo die Spuren von Moskaus Gewalt nicht zu übersehen sind und ebenso wenig die Geldmittel, die Russland aufbringt, um die Eigenständigkeitsbestrebungen im Keim zu ersticken. Meine Fragen verlangten nach einem konkreten Ort und einem städtischen Milieu, in dem sich die Jahrzehnte der sowjetischen Geschichte wie in einem Brennglas spiegelten. Kein anderer Ort schien mir dafür besser geeignet als Grosny: Die Stadt verdankt ihre Geburt dem Zarenreich. Sie entstand als Festung des russischen Imperiums, das sich Ende des 18. Jahrhunderts den Kaukasus einzuverleiben begann. Als hundert Jahre später das Erdöl zum weltweit begehrten Rohstoff wurde, verwandelte sich das Garnisonsstädtchen in eine Boomtown. Am Vorabend des Ersten Weltkrieges war Grosny auf den europäischen Börsenparketts der Inbegriff von Rendite versprechender Investition. Unter den Bolschewiken wurde Grosny eine Industriestadt – ein regionales Zentrum der Ölförderung und -verarbeitung, das die deutsche Wehrmacht 1942 zu erobern versuchte. Nach der Deportation der Tschetschenen und Inguschen nach Zentralasien 1944 und ihrer Rückkehr 1957 im Zeichen von Chruschtschows Tauwetterpolitik verlor die Welt Grosny aus den Augen. Erst Russlands 1994 begonnener Krieg gegen die um internationale Anerkennung ringende Republik Tschetschenien brachte die Stadt auf die Bühne des Weltgeschehens zurück.9
Heute sind die einst sprudelnden Ölquellen von Grosny versiegt, die Raffinerieanlagen im Krieg zwischen Russland und Tschetschenien zerstört und abgetragen. Wie heute Mariupol lag Grosny nach seiner letzten Eroberung im Frühjahr 2000 in Schutt und Asche. Mit Russlands Mitteln und den Steuergeldern der tschetschenischen Gesellschaft wiederaufgebaut, ist Grosny nun Hauptstadt einer autonomen Republik der Russländischen Föderation und einer durch die Sowjetzeit geprägten Nation. Verloren hat Grosny dabei, wie viele andere Städte des Kaukasus und auch Zentralasiens, nicht zuletzt seine multiethnischen Milieus. Was in Taschkent ein eher schleichender Vorgang war, hat sich hier innerhalb einer kurzen Zeit vollzogen. Die russischen, ukrainischen, jüdischen und armenischen Einwohner haben die Stadt in den 1990er Jahren fluchtartig verlassen. Ethnisch ist Grosny heute, ganz ähnlich wie Baku, Tiflis oder Taschkent, nahezu homogen. Der Zerfall der Sowjetunion bedeutete auch hier den Triumph der einen Nation, den Siegeszug des politischen Nationalismus über den multiethnischen Gesellschaftsentwurf.
Die Spuren und Quellen einer Geschichte
Die multiethnischen Milieus hörten aber auch nach den beiden Tschetschenien-Kriegen nicht auf zu existieren – zumindest nicht in der nostalgischen Erinnerung der ehemaligen Einwohner, die es in die Metropole Moskau oder in die Städte des russischen Südens verschlagen hatte. Was sie zusammenhielt, waren nicht allein die alten Freundschafts- und Nachbarschaftsbeziehungen, die sich in der Fremde auszahlten. Es war ebenso der Verlust von Heimat, der geteilte Schicksalsschlag, was sie jenseits von ethnischer Zugehörigkeit verband. Als ich im Herbst 2011 in Moskau auf diese Gruppen stieß, beschloss ich, die Erinnerungen dieser Menschen zum Ausgangspunkt meiner Erkundungen zu machen. Mit Angehörigen der Gemeinschaften sprach ich am heimischen Küchentisch und im Café, im Stau der Großstadt und unter Baumkronen im Park. Mit vielen traf ich mich im Laufe der Jahre immer wieder. Ich sprach mit Russinnen und Tschetschenen, mit Ukrainerinnen und Tataren, mit Inguschinnen und Armeniern, mit Jüdinnen und Georgiern. Von vielen Gesprächspartnern wurde ich an Freunde, Verwandte und ehemalige Kollegen weitergereicht, an Menschen mit unterschiedlichen Bildungswegen und Berufen. Mit Namen und Telefonnummern ausgestattet, brach ich von Moskau auf nach St. Petersburg, dann in die Provinz, in den Süden, nach Krasnodar, und, schließlich, nach Grosny, wo Jugendfreunde meiner Moskauer Gesprächspartner mich am Flughafen empfingen.
Meine Interviewpartner teilten eine Sehnsucht nach Heimat, die die Medizin des 17. Jahrhunderts als Krankheit eingestuft hatte: Nostalgie. Selbst moderne Sozial- und Kulturwissenschaftler neigen dazu, der nostalgischen Erinnerung zu misstrauen, weil diese den Blick auf die Wirklichkeit verstelle.10 Aus der Erinnerungsforschung wissen wir jedoch, dass jede Erinnerung trügt, dass das »kommunikative Gedächtnis« einer permanenten Neuinterpretation unterliegt, dass selbst private Erinnerungen, angeordnet in so scheinbar neutralen, weil schablonenhaften Medien wie dem Familienfotoalbum, in einem Wechselverhältnis stehen zu politischen Großwetterlagen und gesellschaftlichen Trends.11 Daher fragte ich mich immer wieder, ob ich wohl einer postsowjetischen Erzählung aufsitze, die die Erinnerungen neu formatiert – einem nostalgischen Narrativ vom multinationalen städtischen Idyll am Rande des romantisierten Kaukasus.
Die Quellen gegen den Strich zu lesen und zugleich ihr Narrativ, gehört indessen zum Kerngeschäft von Historikern und Anthropologen. Mit einem Augenzwinkern hat dies Natalie Zemon Davis in ihrem Buch Fictions in the Archive betrieben, das anhand von Gnadengesuchen an den König die Gesellschaft der Renaissance-Zeit ausleuchtet.12 Der Vorteil von Interviews gegenüber anderen erzählenden Quellen wie Gnadengesuchen, Memoiren oder Beamtenberichten besteht darin, dass sie die Möglichkeit bieten, einzugreifen und nachzufragen: nach dem Schulweg und den Spielkameraden, nach den Freunden und den Nachbarn, nach dem Viertel, nach der Stadt und den Querverbindungen zu anderen Regionen der Sowjetunion, die sich in Akten eines Amtsarchivs nicht finden lassen. Ein Interview, so gründlich vorbereitet es auch sein mag, ist immer ein Zwiegespräch. In ihm treten die Widersprüche und Leerstellen deutlicher hervor als in der geschönten und geglätteten Erinnerungsliteratur.
Um meine Interviews zu konturieren, bedurfte es Gegenstimmen, die eine andere Wahrheit behaupteten. Deshalb suchte ich mithilfe der NGO Memorial und einer Aktivistin in Grosny weitere Gesprächspartner. Journalisten halfen mir, Kontakte zur tschetschenischen Diaspora im Ausland, in Wien, Paris und New York zu knüpfen, die einen tendenziell nationalistischen Standpunkt vertrat und somit einer Sowjetnostalgie fern schien. Interviews mit ehemaligen Grosny-Einwohnern in Berlin und Tel Aviv ergänzten den Kreis meiner Gesprächspartner, der in seiner sozialen und ethnischen Zusammensetzung die Vielfalt der Stadtbewohner Ende der 1980er Jahre spiegelt.13
Ob als Einzelpersonen oder als Kleingruppen, die Gesprächspartner ließen mich nicht nur an ihren Erinnerungen teilhaben. Oft gewährten sie mir auch Einblicke in ihr Privatarchiv: Urkunden und Zeugnisse, Fotos, Briefe, Postkarten, Zeitungsschnipsel und Broschüren, das wenige, was nach vielen Umzügen oder der Flucht übrig geblieben war. Die dort aufgenommene Spurensuche setzte ich in Bibliotheken und Archiven fort: Ich las Reisebeschreibungen europäischer Gelehrter des 18. Jahrhunderts, die die Vorstellung einer tabula rasa in den Osten des europäischen Kontinents geführt hatte; ich verschlang Briefe und Berichte der Offiziere des Zarenreiches, die oftmals unverhüllt die imperiale Gewalt beschrieben; ich studierte die Korrespondenz der Emire des Nordkaukasus, die ihre Herrschaft ebenfalls auf Gewalt gründeten; und ich quälte mich durch Erhebungsbögen der Volkszählungen und die Berichte über die Landnahme, die »Umsiedlung« und »Verdichtung« der nordkaukasischen Siedlungen in den Ebenen um Grosny im ausgehenden 19. Jahrhundert. Die Archivalien des russischen Imperiums bekräftigen die Muster der uns so vertrauten gewaltsamen Kolonialgeschichte, die ihren Schauplatz genauso in der Kabylei in Algerien oder in der Prärie in Nordamerika haben könnte.
Daher war ich erstaunt, als mir eine tschetschenische Geflüchtete in Wien erzählte, wie stolz ihr Großvater darauf gewesen sei, sich bereits in der Zarenzeit in Grosny niedergelassen zu haben. Er schöpfte sein Selbstbewusstsein daraus, ein Stadtbewohner gewesen zu sein, als seine Verwandten noch nichts anderes kannten als die kleine Welt ihres Dorfes. Der Blick in die Stadtführer und in die Zeitungen aus der Zeit vor 1917 veranlassten mich, diese Spur weiterzuverfolgen. Und so durchforstete ich die Berichterstattung und die Kurzmeldungen, die Feuilletons und die mit Jugendstilornamenten verzierten Anzeigen, um festzustellen, was eigentlich nahelag: dass am Vorabend der Oktoberrevolution die globale Welt auch die Kleinstadt Grosny erreicht hatte und dass auch die Bevölkerung des Nordkaukasus vom Umbruch und den Neuerungen der Moderne in den Bann gezogen war.
Alltag und Zivilisation: Fragen an Grosny
Die Beobachtungen in und Beschreibungen von der Stadt, ihre Spiegelung in den Erinnerungen und in der historischen Presse machten klar, dass der multiethnischen Peripherie mit der schlichten Erzählung von Unterwerfung und Kolonisierung allein nicht beizukommen war. Der hier sichtbar werdende Alltag ging nicht auf in einer Geschichte von Widerstand und Eigensinn, von den Taktiken und Strategien der Machtlosen, die übergestülpten Regeln und Gesetze des Imperiums zu unterlaufen. Vielmehr half mir der Blick in die scheinbar überholte Schrift des Soziologen Norbert Elias Über den Prozess der Zivilisation (1939). So kritikwürdig Elias’ These von der Verdrängung der Gewalt im Zuge der Moderne auch sein mag, so legt er doch überzeugend dar, dass es nicht allein der neuzeitliche Staat mit seinem Gewaltmonopol, sondern ebenso die Menschen selbst waren, die die Verflechtungsprozesse vorangetrieben haben. Sie waren es, die sich der Logik einer zivilen, auf Gewaltverzicht und -kontrolle ausgelegten sozialen Ordnung unterwarfen, weil ihnen dies auf lange Sicht Gewinn und Sicherheit zu versprechen schien.14 Aus diesem Blickwinkel betrachtet, leuchtet das Vorgehen der Eliten um Grosny, von den Mullahs bis zu den Ölmagnaten, umso mehr ein: Nach der Revolution von 1917 und den Jahren des Bürgerkrieges suchten sie auch mithilfe der Bolschewiken die Kontrolle über die Gewalt wiederzuerlangen, weil mit dem Zerfall des Zarenreiches der gesellschaftliche Frieden abhanden gekommen war. Aus den Pamphleten, Reden und Deklarationen, die ich mit Memoiren konfrontierte, tritt nicht nur die Eskalation deutlich hervor, die Radikalisierung im Zuge der Revolution oder der Reaktion. Sichtbar werden dort auch die Bemühungen, Brücken zu schlagen und zu vermitteln, weil die Eliten der multiethnischen und multireligiösen Peripherie wussten, was der Preis von Entfesselung ist.
In dieser Perspektive wird dann auch nachvollziehbar, warum die Eliten des Nordkaukasus nach den Wirren des Bürgerkrieges auf die Bolschewiken setzten. Denn ohne deren Hilfe waren sie nicht in der Lage, den konkurrierenden Warlords den Garaus zu machen. Und die Bolschewiken unterbreiteten mit dem Versprechen der nationalen Autonomie im multinationalen föderalen Staat ein Angebot, von dem die junge Nationalelite vor 1917 nicht zu träumen gewagt hätte. Überhaupt, die Lebensläufe der von den Bolschewiken geförderten nationalen Kader lassen darauf schließen, dass die lokalen Eliten sich mit dem neuen Regime arrangierten. Die Netzwerke der Familien und Clans mögen sich in den neuen sowjetischen Institutionen reproduziert haben und die Geheimpolizei in ihrem Verdacht bestärkt haben, dass die Sowjetisierung auch in dieser Randregion nur eine oberflächliche sei. Die Akten des Parteiapparats und sowjetischer Institutionen zeichnen hingegen ein anderes Bild. Der Verwaltungsstaat der Bolschewiken zog mehr Menschen an als das alte Regime des Zarenreiches. Und er machte die Stadt stärker zum Marktplatz einer sozialen Ordnung als das alte Imperium, das sich gegen die Urbanisierung und die Mobilisierung der Massen gesperrt hatte. Ob in Grosny, im benachbarten Wladikawkas oder eben in Moskau – Chancen auf Posten und Positionen wurden nicht in den Dörfern der Tschetschenen und Inguschen errungen, sondern in der Stadt: auf Schulungen und in Sitzungen, beim Jubeln auf Demonstrationen, beim Schwingen von Reden, beim Zitieren und Rezitieren der Parteidoktrin. Die neue Hegemonie entfaltete ihre Kraft als eine eigene Politökonomie.
Historiker:innen der Sowjetunion gehen gern der Frage nach, inwieweit es dem Regime gelang oder misslang, die Wahrnehmung seiner Bürger so zu verändern, dass sie Moskaus Hegemonie als Selbstverständlichkeit ansahen. Im Zentrum steht für sie vor allem die Frage nach der politischen Loyalität, gerade an der nationalen Peripherie. Ich hingegen interessierte mich für Lebenswege, Lebensstile, Lebensweisen und die materielle Welt, die sich die alteingesessenen Stadtbewohner und die Neuankömmlinge zu eigen gemacht haben. In meiner Geschichte von Grosny kommt es auf Erzählungen an. In den Erinnerungen, autobiografischen Skizzen und Privatarchiven stieß ich nicht nur auf die Überreste einer Vergangenheit, die eben deswegen sowjetisch war, weil die Menschen in der Sowjetunion kaum eine andere Wahl hatten, wie dies oft anhand von Quellen aus den staatlichen Archiven diskutiert wird. Vielmehr scheint in den Ego-Dokumenten derselbe spezifische sowjetische Begriff von Kultiviertheit (kul’turnost’) auf, den die Menschen in Grosny teilten – eine sowjetische und sozialistische Interpretation der Bürgerlichkeit, die nach Norbert Elias das Bindeglied der modernen Gesellschaften Europas darstellt. Die Konturen dieses Habitus, die Umrisse der ihn tragenden Gemeinschaft möchte ich nachzeichnen. Denn er legt nahe, dass die Sowjetunion nicht allein eine (post-)imperiale staatssozialistische Zwangsveranstaltung war, sondern zugleich eine eigene, multiethnische Zivilisation.
Von diesem Standpunkt aus ergeben sich für mich folgende Fragen: In welcher Weise ordnete das sowjetische Konzept von Kultiviertheit die multiethnische Gesellschaft neu? Auch wenn die Direktiven des Moskauer Zentralkomitees und die Leitartikel der hauptstädtischen Zeitungen den Ton vorgaben, so waren es doch die Menschen vor Ort, die mit den und trotz der ideologisch imprägnierten Losungen das Leben praktisch zu gestalten hatten. Wie arrangierten sie sich miteinander? Wie interpretierten und variierten sie die Hegemonie, wie stellten sie im alltäglichen Miteinander Gemeinschaft her und wann setzten sie Grenzen? Wie gingen sie vor dem Hintergrund der Gewalterfahrungen des Terrors, des Zweiten Weltkrieges und der Deportationen miteinander um? Wie vermittelten sie in Konflikten, die sich nun einmal ergeben, wenn Menschen unterschiedlicher Herkunft und Sozialisation in städtischen Räumen aufeinandertreffen, und was blieb die Achillesferse dieser multinationalen industriellen Gesellschaft?
Als historische Disziplin nimmt die Alltagsgeschichte ihre Subjekte ernst. Die Handlungsweisen ihrer Akteure im Blick, deren überschaubare Kontexte vor Augen, sucht sie die großen Fragen zu beantworten. Ausgehend von der multiethnischen Stadt Grosny will ich verstehen, was die multinationale Sowjetunion gewesen ist, und ebenso erklären, woran sie Ende der 1980er Jahre zerbrach und welche Rolle dabei der Kaukasus und Grosny spielten.15 Die Ruinen von Grosny vor Augen möchte ich zeigen, inwiefern das Ende der UdSSR als eine Tragödie aufzufassen ist. Die so erzählte Geschichte ist tragisch, weil sie von Aufbruch handelt und zugleich von Scheitern und von Gewalt; und weil durch den Zerfall der Sowjetunion die einen die Freiheit ihrer Nation erlangten, während die anderen alles verloren, was sie vorher besaßen. Der Preis der Desintegration der multiethnischen Gesellschaft, der Entflechtung und der Erosion ihrer Zivilisation war hoch und bleibt eine Hypothek, an der die postsowjetischen Gesellschaften zu tragen haben. Ob wir es wollen oder nicht, diese Hypothek tragen wir mit.
Lektürehinweis
Dieses Buch ist um Verstehen und Verständigung bemüht. Weil es eine historische Zeit beschreibt, die eine gendersensible Sprache nicht kannte, wird für die Vergangenheit das generische Maskulinum verwendet. Um die in die Sprache eingewobene Hegemonie nicht rückwirkend zu verschleiern, wird ebenso bei den Ortsnamen die jeweils historisch gängige Schreibweise verwendet. Das heutige Kyiv wird daher als Kiew benannt, das heutige Almaty als Alma-Ata betitelt. Bei den russischsprachigen Ortsangaben und Namen wird ferner aus Gründen der Lesbarkeit auf die Duden-Schreibweise zurückgegriffen, bei den Literatur- und Archivverweisen hingegen die wissenschaftliche Transliteration vorgezogen.
KAPITEL 1
Vom Vorposten des Imperiums zur Boomtown des Öls
Die Festung an der Sunscha
Hinter dem Fluss: das Land der Tschetschenen
Der Kolonialkrieg, die Verheißung des Islam und die Zwänge des Dschihad-Staates
Von Widerstand zu Eigensinn: Plädoyer für postkoloniale Perspektiven
Boomtown des Öls im Zeichen der Verbürgerlichung
Grosny ist keine alte Stadt des Kaukasus. Anders als Tiflis in Georgien oder Derbent in Dagestan hat es keine antiken Wurzeln. Bei der Eingliederung ins Zarenreich konnte die Stadt auf kein reiches Erbe zurückblicken. Grosny war ein Geschöpf des Imperiums, entstanden zu einem militärisch-strategischen Zweck. Nach dem Siegeszug gegen Napoleons »Grande Armée« 1813 wandte sich das russische Imperium wieder seiner Südflanke zu, um sich gegen das Osmanische Reich und Persien abzusichern. Im Kaukasus hatte Russland bereits vorher Fuß gefasst: 1784 war am Eingang in die Darjal-Schlucht die Festung Wladikawkas errichtet worden, die den Zugang zum »Tor des Kaukasus« bewachte. 1801 wurde Georgien ins Zarenreich eingegliedert, das im Hochmittelalter den Kaukasus beherrscht hatte. Dann wurden Teile des heutigen Aserbaidschans und Armeniens erobert. Doch die neuen Gebiete waren nicht sicher, solange der Nordkaukasus nicht unter der Kontrolle des russischen Staates war, solange die Bergvölker sich nicht dem Willen des Zaren fügten.16 Grosny entstand als eine der Festungen, die der neue Generalgouverneur der transkaukasischen Provinz und Oberbefehlshaber der dortigen Streitkräfte General Jermolow anlegen ließ, als er zum Vorstoß in den Nordkaukasus ansetzte.
Die Festung an der Sunscha
General Jermolow ließ Grosny 1818 in einer Schleife des Flusses Sunscha errichten (Abb. 1.1). Wie der Terek nimmt die Sunscha ihren Anfang in den Bergen. Doch anders als ihr Nebenfluss wird die Sunscha von einer Hügelkette, dem Sunscha-Bergrücken, daran gehindert, in den Norden zu fließen. Stattdessen führt der Fluss in den Osten, wo er, andere Bergflüsse aufnehmend, unweit von Grosny der Steppenebene entgegenstrebt, sich mit dem Terek vereint und schließlich sein Wasser ins Kaspische Meer trägt. Damit bildet die Sunscha im Vorgebirgsland eine natürliche Verteidigungslinie, die Jermolow nutzte, um eine Reihe von Festungen anzulegen. Grosny war damit nichts weiter als ein Vorposten des Imperiums, auch wenn dieser Vorposten auf einem Gebiet errichtet wurde, das seit Langem besiedelt war. Anstelle von verstreut liegenden Dörfern und Weilern entstand die Festung Grosnaja, »die Furchterregende«, die die Tschetschenen das Fürchten lehren sollte. »Ich habe hier eine Festung errichtet«, schrieb Jermolow seinem Freund, Graf Michail Woronzow, vom Feldlager an der Sunscha. »Sie wird eine Garnison von tausend Soldaten haben. Die Tschetschenen werden sie aber so fürchten, als seien dort fünftausend« Soldaten stationiert. Als Vorposten sollte Grosny die ältere Grenzlinie am Terek schützen, die seit Jahrzehnten immer wieder von Überfällen heimgesucht wurde, worüber die Terek-Kosaken klagten.17
Abbildung 1.1: Fragment der »Generalkarte des Kaukasus-Gebiets und des Landes der Bergvölker« von 1825, auf der die Verschiebung der »Kaukasus-Linie« gen Süden entlang der Sunscha verzeichnet ist.
18
Anders als in anderen Regionen des Kaukasus nahmen die hinter der Sunscha lebenden Stämme der Tschetschenen die Angebote der freiwilligen Integration nicht an. Die alte Strategie des Imperiums, die Kooptierung der Eliten, die etwa bei der Adelsgesellschaft Georgiens gefruchtet hatte, griff hier nicht, weil die Stämme keinen Erbadel kannten. Daher setzte der General auf die abschreckende Wirkung der Gewalt.
Vor Grosny liegt die damals noch von dichtem Wald umgebene Chankala-Schlucht, wo unter anderem die Truppen des Krim-Khans 1735 vernichtend geschlagen worden waren. Dahinter der Fluss Argun, der zum »Tor der Wölfe« führt – zur Schlucht, die den Weg frei macht ins Innere der Berge (Abb. 1.3). Dort siedelten die Stämme von Tschetschenen, die in der kargen Berglandschaft zu überleben suchten. Ihnen galten die Bastionen der als Hexagon angelegten Festung Grosnaja (Abb. 1.2). Die Festung bestand nicht aus Stein, sondern aus Holz, Erde und Lehm. Wie die gesamte Grenzlinie des Terek war Grosny ein Provisorium. Sie war Teil jenes Systems von russischen Forts und Militärsiedlungen, das seit Jahrhunderten durch die Steppe gen Süden kroch.19
Seine Aufgabe hat Grosny erfüllt. So schreckte die Festung 1825 aufständische Tschetschenen ab, die anfangs nicht daran geglaubt hatten, dass die Truppen des Zaren gekommen waren, um zu bleiben. Sie umgingen Grosny gezielt und griffen stattdessen eine andere Festung an. Doch ihr Erfolg war nicht von Dauer. Bald spielte Grosny eine wichtige Rolle beim Kampf der Armee gegen die rebellischen Bergbewohner. Von hier aus zogen die Regimenter los, um die Aufständischen zu unterwerfen. »An einem klaren Sonntagmorgen«, erinnerte sich Baron Tornau, der dem baltischen Adel entstammte, »brachen wir in der Festung Grosny auf zur Expedition nach Tschetschenien […]. Auf dem Weg zum Aul Gechi begannen wir Dörfer niederzubrennen und Felder zu zerstören, um die Tschetschenen dafür zu bestrafen«, dass sie Schamil, einem der bedeutendsten Anführer der Rebellion im Nordkaukasus, gefolgt waren.20
Es dauerte nicht lange, da büßte Grosny seinen Charakter als Vorposten ein. Nach und nach wurde die Verteidigungslinie in den Süden an den Rand der Berge verlegt. Von dort aus drang das Imperium immer weiter in die Schluchten vor. Grosny wurde mit seinen Garnisonen und Lazaretten Hinterland. Neben der Festung wurde 1844 eine Militärsiedlung angelegt, deren Einwohner nicht nur Dienst an der Waffe leisteten, sondern auch Felder bestellten. Einige Jahre später wurden die Siedler, ehemalige Soldaten und Unteroffiziere des Kuriner Regiments, in den Rechtsstatus der Kosaken überführt, was sie mit Privilegien ausstattete und in treue Diener des Zaren verwandelte.22 1869 bekam Grosny den Rechtstitel einer Stadt zugesprochen. Es wurde Verwaltungssitz des Grosny-Bezirks, der wiederum Teil des von Wladikawkas aus regierten Terek-Gebiets war. Damit wurden die Stadt und die Region rechtlich den übrigen Gouvernements des Zarenreiches gleichstellt. Die Bergbevölkerung im Umland von Grosny unterlag allerdings in der niederen Gerichtsbarkeit nicht den Reichsgesetzen, sondern dem eigenen Gewohnheitsrecht.23 1895 bekam die etwa 14 000 Einwohner zählende Stadt eine Duma. Fortan lenkten 40 nach dem Zensuswahlrecht gewählte Deputierte die Geschicke der Stadt.24
Abbildung 1.2: Fragment des Stadtplans von Grosny, 1886. Zu sehen ist noch der Grundriss der alten Festung. Die letzte Straße im Südwesten, »Granitschnaja«, markiert die Grenze der Stadt zur Staniza, der Kosakensiedlung Grosnenskaja. An der »Unteren Marktstraße«, auf der rechten Flussseite, begann das Basarviertel, wo sich u. a. tschetschenische Händler und Kaufleute ansiedelten. Die Festung war von Kirchen umringt, die auf dem Plan dunkel hervorgehoben sind: im Norden die katholische Kirche, im Süden am Fluss die armenische Kirche und, weiter oben, die orthodoxe Kathedrale. Die Moschee und die Synagoge, die sich auf der rechten Flussseite, an der Marktstraße befanden, liegen außerhalb des gewählten Ausschnitts.
21
Das Erscheinungsbild Grosnys hielt mit dieser politischen Entwicklung indessen nicht Schritt. Zwar hat sich Grosny in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts sehr verändert. Den Zeitgenossen fielen vor allem die neuen Häuser aus Ziegelstein auf, die hier und da sogar zwei Geschosse hatten. Sie überragten die alten Häuser, deren Dächer mit Rohrschilf gedeckt waren. Bei Sonne verstaubt, bei Regen verdreckt, war Grosny wie viele andere Kleinstädte des Zarenreiches dennoch weit davon entfernt, den modernen Vorstellungen einer Stadt zu entsprechen. Auf den Aufnahmen, die der Militärfotograf Alexander Berischwili um 1860 in Grosny gemacht hat, sind breite, leere Straßen zu sehen. Am Fluss eine Wassermühle. An den Ufern Gärten, die im Laub der Obstbäume ertrinken.25 Die Aufnahmen erinnern an Kleinstädte, die Anton Tschechow in seinen Stücken gern im Umland von Moskau platzierte, nicht aber in Russlands Süden, aus dem er stammte, und ganz gewiss nicht im Kaukasus, dessen Badeorte er gelegentlich aufgesucht hat. Im Kaukasus erwarteten die zeitgenössischen Leser Romantik und Abenteuer, nicht aber die gähnende Leere, wie sie auf den raren Fotografien und ebenso in zeitgenössischen Beschreibungen greifbar wird: »Und da ist auch schon Grosny«, spottete ein Zeitungskorrespondent 1892. »Links von der Straße – Kasernen, rechts Scheunen und in der Mitte ein Platz, auf dem Tierknochen verstreut sind. Ein Schwarm von Krähen und ein Rudel von Straßenkötern reißen sich darum, die Reinigung von Grosny zu übernehmen.«26 Ein anderer Reisender äußerte sich weniger abfällig, berichtete aber Ähnliches: »Dreckige ungepflasterte Straßen, ein schablonenhafter Boulevard, Aushänge mit Rechtschreibfehlern […], arme, niedrige Häuser – das ist das erste, was bei der Ankunft in Grosny ins Auge fällt.«27
Grosny war lange ein unbedeutendes Nest. In der Kaserne schob man Dienst. In den Hospitälern wurden Verwundete gepflegt. Der Krieg, der die Region über Jahrzehnte plagte, fand weit entfernt statt. In den Memoiren russischer Offiziere taucht Grosny nur als ein Ort auf, den man durchquerte oder verließ, um den Rebellen im Dickicht der Wälder nachzustellen. In der Festungsstadt gab es offenbar nichts Spannendes, wovon sich zu erzählen lohnte. Um Grosny rückwirkend Bedeutung einzuhauchen, berichteten sowjetische Heimatkundler gern über berühmte Schriftsteller wie Leo Tolstoi oder Dichter wie Michail Lermontow, die sich während des Kaukasuskrieges zeitweise in der Festung aufgehalten hatten. Mit den Großen der russischen Kultur fügte man die Stadt ein in den Diskurs von Russland als imperialer Nation.28 Wer der Vergangenheit der Region jenseits des russischen Narrativs nachspüren wollte, der suchte sie im Kampf gegen die Unterdrückung der tschetschenischen Nation. Die Helden der antikolonialen Erzählung sind jene »Freiheitskämpfer«, die die Festung Grosnaja anzugreifen strebten, um die Eindringlinge aus dem Norden fortzujagen.29
Über die Schicksale von gewöhnlichen Menschen gehen beide Erzählungen hinweg. Dabei lässt sich in ihnen Entscheidendes verfolgen: nicht allein die Konflikte, sondern ebenso die Nähe, die aus der kolonialen Situation am Rand des Imperiums entstand. Memoiren berichten etwa von den Minaretten der tschetschenischen Dörfer, die Grosny umgaben und die Stadt aus der Ferne als eine muslimische Stadt erscheinen ließen. Und auch Grosny selbst war nicht nur eine Stadt der Kosaken, Invaliden und Soldaten. Als Handelsplatz zog die Stadt viele Menschen aus ihrer Umgebung an. Bis zu 40 000 Bergbewohner sollen Jahr für Jahr nach Grosny gekommen sein, um hier Waren zu tauschen. In einer Eingabe der muslimischen Soldaten aus den sechziger Jahren des 19. Jahrhunderts heißt es, dass täglich um die 500 Muslime Grosny besuchten. In der Garnison selbst gab es an die 200 muslimische Soldaten und Unteroffiziere. Weil sie ihrer täglichen Pflicht zum Gebet nachkommen wollten, baten sie den Statthalter um Erlaubnis, in der Festung eine Moschee zu errichten. Im orthodoxen Russland beäugte man den Islam misstrauisch. Doch der Zar gab sich gottesfürchtig. Daher bekamen Grosnys Muslime ihre Moschee, wenn auch in respektabler Entfernung zu den christlichen Kirchen der Stadt (vgl. Abb. 1.2).30
Grosny bildete so etwas wie ein middle ground – ein Ort, an dem ungleiche Parteien und unterschiedliche Kulturen in Beziehung zueinander traten, nicht zuletzt deshalb, weil sie aufeinander angewiesen waren, wie Richard White dies für die Städte der Großen Seen in Nordamerika beschrieben hat.31 Zu einem dreitägigen Jahrmarkt sollen 1850 bis zu »500 Karren der ›renitenten‹ Tschetschenen« gekommen sein. Viele von ihnen reisten in Begleitung von Frauen und Kindern an. Die Bergbewohner brachten allerlei Lebensmittel, etwa Käse, Eier, Butter, Honig sowie Tierhäute, Stoffe und Teppiche mit, die sie bei den russischen Kaufleuten gegen Industriewaren eintauschten. Manche von ihnen blieben. Anfang der 1870er Jahre lebten in Grosny unter den 8 450 ständigen Einwohnern 712 Tschetschenen.32 Diese vielfältigen Kontakte der Einwohner der nahe gelegenen tschetschenischen Dörfer zu Grosny sind kein Gegenstand der Erzählungen vom russischen Imperium oder dem heldenhaften Kampf der Völker des Kaukasus.33 Dabei sind es gerade diese Begegnungen, die uns davon berichten könnten, wie Menschen unterschiedlichen Glaubens, mit unterschiedlichen ethnischen Selbstentwürfen und mit unterschiedlichen Erfahrungen in Beziehung traten und eine Kultur des Miteinanders prägten, die für die Peripherie des Imperiums ebenso charakteristisch ist wie die Kultur der Differenz und der Konfrontation.
Von Großvater Mussa erzählte mir seine Enkelin Taissja, die der Krieg zwischen Russland und Tschetschenien nach Wien verschlagen hatte. Großvater Mussa stammte aus Atagi, einem Aul, also einer Dorfsiedlung, am Fluss Argun, etwa 20 Kilometer von Grosny entfernt. Wie seine Enkelin war Großvater Mussa von Atagi nach Grosny gezogen. Wie Taissja ließ sich Großvater Mussa auf Grosny ein, brachte jedoch seine Erfahrungen vom tschetschenischen Land mit in die Stadt. Großvater Mussa hat wie die allermeisten Einwohner jener Region keine Tagebücher geführt oder Memoiren verfasst. Er hat nicht mehr hinterlassen, als das wenige, was in den Erinnerungen seiner Enkelkinder fortlebt. Die Fragmente seiner Erinnerung waren mir Anlass, der Geschichte des Hinterlandes von Grosny nachzugehen, denn sie gehört ebenso zu Grosny wie General Jermolow, Graf Tolstoi und die zarentreuen Kosaken. Und ebenso wie die Erfahrungen derjenigen, die es aus unterschiedlichen Regionen des Zarenreiches und der Sowjetunion nach Grosny verschlagen hatte.
Hinter dem Fluss: das Land der Tschetschenen
Das Dorf Atagi – genau genommen das Große oder das Alte Atagi (Jokkcha Atag-a), das sich im Unterschied zum gegenüber liegenden Dorf, dem Kleinen oder Neuen Atagi, auf dem linken Argun-Ufer befand – lag günstig an einer Nord-Süd-Achse des Nordkaukasus. Zudem kreuzte ein Weg von Ost nach West die Dorfsiedlung, die sich Ende des 18. Jahrhunderts auf einer Länge von etwa zwei Kilometern entlang des Flusses ausgebreitet hatte. Hier lebten unterschiedliche Stämme der Tschetschenen, die ihre ethnische Bezeichnung ihrem Nachbardorf im Norden zu verdanken hatten – dem Aul Tschetschen beziehungsweise Großer Tschetschen (vgl. Abb. 1.1). Dabei war Tschetschen wie Atagi nur einer der großen Aule der Region, deren Bewohner sich nochtschi, unsere Leute, nannten, weil sie eine Sprache sprachen, die sie alle verstanden.34
In »alter Zeit«, schreibt ein Ethnograf, sei Atagi ein Ort gewesen, an dem sich »einmal im Jahr Legendenerzähler, Sänger, Musiker, Tänzer und Seilakrobaten« trafen, wohl um ein Publikum zu unterhalten, das sich hier regelmäßig versammelt haben muss, um Waren zu tauschen.35 »In der alten Zeit«, so steht es in einer undatierten Handschrift, lebte man in Atagi »glücklich und ohne Sorgen: man liebte das Leben, brachte Kinder zur Welt, säte und erntete. Im Umland bogen sich die Äste unter der Last der Früchte. Auf den Ebenen weideten zahlreiche Herden Kühe und Schafe.« Die Eintracht des Pastorals wurde aber immer wieder von Überfällen getrübt, weil Atagi, ebenso wie die Nachbardörfer, exponiert war. »Einst rückten Nomaden mit schielenden Augen an«, berichtet die Handschrift. »Sie waren böse, kannten keine Gnade und brachten den Krieg […]. Sie zerstörten Dörfer und Felder, brannten Häuser nieder, töteten erbarmungslos Frauen und Kinder. Die Gefangenen wurden versklavt.«36
Eine Legende ist kein Tatsachenbericht. Doch diese Darstellung, die in einer handschriftlichen Textsammlung entdeckt wurde, bündelt die Erfahrungen einer Region, die seit Jahrhunderten unter den Überfällen der Nomadenvölker gelitten hatte. Ob es sich um die Khane der Goldenen Horde handelte oder um ihre Herausforderer wie Tamerlan – die fruchtbaren Ebenen des Nordkaukasus lockten die Steppenheere, deren Zusammenhalt nur so lange gesichert war, wie der Vormarsch die Reiter mit Nahrung und Beute versorgte. Zuletzt waren es die Horden der Nogai-Tataren und der Kalmyken, die auf ihrer Wanderung gen Westen die Region plünderten. Auch die Fürsten der Kabardiner überfielen die Gegend von Zeit zu Zeit. Sie taten dies nicht zuletzt, um Gefangene zu machen, die sich in den Häfen des Schwarzen Meeres versilbern ließen. Was den globalen Menschenhandel betraf, so war Osteuropa nach Westafrika der zweitgrößte Lieferant von Sklaven. Der Nordkaukasus war Teil dieses Menschenreservoirs, das angezapft wurde, um die Nachfrage des Persischen und des Osmanischen Reiches nach unfreien Männern und Frauen zu befriedigen.37
Bei Überfällen flohen die Bewohner der fruchtbaren Ebenen in die Berge. Sobald die Lage es wieder zuließ, kehrten sie zurück. Denn fremde Heere kamen nicht hierher, um zu bleiben. Dies änderte sich im 18. Jahrhundert mit der Ausdehnung des Zarenreiches und damit schon Jahrzehnte, bevor General Jermolow in den Kaukasus einrückte. Vor allem unter Katharina der Großen (1762–1796) begann Russland, auf der einen Seite das Osmanische Reich aus dem Schwarzmeergebiet hinauszudrängen und auf der anderen Seite das Persische Reich von den Küsten des Kaspischen Meeres zu vertreiben. Russland folgte dabei einer bestimmten Logik. Beflügelt vom Beifall der europäischen Aufklärung rückte es mit Vorstellungen vom modernen Staat vor. Anders als das Osmanische und das Persische Reich begnügte es sich nicht damit, im Kaukasus Einflusszonen zu etablieren. Vielmehr folgte es dem Prinzip des Territorialstaates, das der vagen frontier eindeutige Grenzen entgegensetzte. Für deren Sicherung brauchte es ein fest etabliertes System von Festungen und Garnisonen, von Magazinen und Straßen. Als das Zarenreich aber in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts entlang des Terek eine Verteidigungslinie aufbauen ließ, zu deren endgültiger Absicherung schließlich 1818 auch die Festung Grosny errichtet wurde, war die fruchtbare Ebene zwischen der Steppe und dem Gebirge relativ dicht besiedelt. Nicht zuletzt dank eines ausgeklügelten Bewässerungssystems und des Anbaus von Mais war die Region in der Lage, einen Überschuss an Nahrungsmitteln zu produzieren. Mit der Errichtung einer festen Grenze und der Ansiedlung von Kosaken versperrte Russland den Zugang zu den Weiden in der Steppe und griff damit grundlegend in die Ökonomie des Gebirgsvorlandes ein.38
Die Siedlungen der Kosaken waren aber nicht nur eine Provokation, sondern mit ihren Pferden und Viehherden ebenso eine Versuchung. Und so entwickelte sich der im Kaukasus etablierte und bestimmten Regeln unterworfene Kult des Raubes zu einem regelrechten »Gewerbe des Überfalls«.39 Dieses »Gewerbe« wurde meist von jungen Männern betrieben, die sich zu kleinen Gruppen zusammenschlossen, um bei Nacht und Nebel Beute zu machen. Der Raub von Vieh und auch von Menschen war gefährlich. Doch er zahlte sich aus, war zudem gemeinschaftsbildend, schweißte junge Männer fürs Leben zusammen, was wichtig gewesen sein muss, um in der fragmentierten, von keinem Gewaltmonopol eines Fürsten oder eines Staates durchsetzten Region zu bestehen. Wer sich bei Überfällen auszeichnete, erlangte Ansehen, wer kühn, dreist und erfolgreich war, der erntete Ruhm, wurde als Held gefeiert.40
Die Nordkaukasier waren zweifelsohne keine genuinen Räuber, als die sie die russischen und europäischen Autoren des 19. Jahrhunderts zeichneten.41 Denn vor Russlands Ankunft in der Region war das Ausmaß der Gewalt notwendigerweise begrenzt. Wer es mit den Überfällen übertrieb, lief Gefahr, Blutrache der Nachbarn heraufzubeschwören, die dann der ganze Stamm auszubaden hatte. Erst die Ansiedlung der Kosaken an der Terek-Linie verlieh der Gewalt eine eigene Dynamik. Die Stämme der Tschetschenen und Inguschen begannen, ihre neuen sesshaften Nachbarn zu überfallen, so wie sie es mit den Stämmen der Kabardiner und Kumyken getan hatten, die mit ihren Fürsten übrigens keine schlechteren Räuber gewesen waren. Nun zogen aber die Tschetschenen nicht nur den Zorn der Kosaken, sondern auch den der russischen Armee auf sich, die danach trachtete, es den Bergstämmen heimzuzahlen. Dies provozierte wiederum Gegenaktionen. Kleine Überfälle verwandelten sich in Feldzüge. An ihnen nahmen nun nicht mehr eine Handvoll junger Männer teil, sondern Hunderte von Bergbewohnern. Die neue Konstellation in der Region, in der sich auch die Einwohner von Atagi wiederfanden, begünstigte die Spirale der Gewalt.42
Als Kind des Aufklärungszeitalters war General Jermolow humanistisch gebildet, hatte sich von Cäsars De bello gallico inspirieren lassen, den er auf Latein gelesen hatte. Im Kaukasus studierte er die Bände des französischen Generals und Militärhistorikers Matt–hieu de Dumas, die von Napoleons glorreicher Expansion in Europa und in Nordafrika berichteten. Er glaubte daher zu wissen, wie man widerspenstige »Barbaren« zähmt.43 Dazu gehörte für ihn die Strategie der Überfälle (nabegi) – ein systematisches Niedermetzeln und Plündern der vermeintlich aufständischen Dörfer.44 Mit seinen Strafexpeditionen säte Jermolow Wind. Er erntete einen Sturm, denn die Stämme der Tschetschenen waren als Wehrgemeinschaften organisiert. Sie bauten auf Solidarität. Ein jeder Haushalt dieser Gemeinschaften war dazu verpflichtet, sich an der Verteidigung des eigenen Dorfes zu beteiligen. Dafür waren sie gut gerüstet, waren mit Gewehren bewaffnet, die seit dem 18. Jahrhundert in der Region hergestellt wurden. Einige der Büchsenmacher saßen in Atagi, dem Heimatdorf von Großvater Mussa, das wie die übrigen tschetschenischen Siedlungen keinem Feudalherrn unterstand.46
Abbildung 1.3: Ein Kaukasusidyll – Tschach-Keri, das Nachbardorf im Süden von Atagi am Eingang in die Argun-Schlucht, abgebildet in der populären Beschreibung »Vaterland Russland« des Geografen Pjotr Semjonow. (1883)
45
Die Ausbreitung der Gewehrproduktion im Nordkaukasus hat der Soziologe Georgi Derluguian mit einer technischen Revolution verglichen. Waren die Handfeuerwaffen zuvor teuer gewesen, weil sie von der Krim und aus dem Osmanischen Reich importiert werden mussten, so wurden sie nun erschwinglich. Dies half den Bergbewohnern, die Feudalherren, die Kumyken-Fürsten, zu vertreiben und stattdessen egalitäre Kriegergemeinschaften, eine Art »Sparta im Kaukasus«, zu etablieren. Im Unterschied zu den Waffen der russischen Armee waren diese Gewehre mit ihren gezogenen Läufen zwar umständlich zu laden.47 Doch sie schossen weiter und genauer, erlaubten es, den Kosaken, Infanteristen und Grenadieren aus der Deckung des Waldes erheblichen Schaden zuzufügen. Auf die Strategie des Guerilla-Krieges antworteten General Jermolow und seine Nachfolger mit »Strafaktionen«. Sie schlugen Schneisen in die Wälder hinein, brannten Dörfer nieder, töteten das Vieh, ermordeten Männer, Frauen und Kinder, um Angst und Schrecken zu verbreiten.48
Die Rache ereilte vor allem die Siedlungen in den Ebenen des Vorgebirges, wie Atagi, weil die Menschen dort einfacher zu greifen waren als in den schwer zugänglichen Bergdörfern. Für die Argun-Ebene hielt der Orientalist und Staatsbeamte Adolf Bersche fest, dass sich dort die Zahl der Einwohner allein im Zeitraum zwischen 1840 und 1850 auf ein Viertel reduziert habe. Was Atagi und die drei weiteren Dörfer am linken Argun-Ufer betraf, notierte der Beamte lakonisch: »Die einen Aule wurden bei der erstmaligen Eroberung Tschetscheniens unter General Jermolow niedergebrannt […], die anderen beim Durchmarsch unseres Korps beim Aufstand der Tschetschenen im Jahre 1841, und die dritten schließlich [wurden zerstört,] als wir die Festung Wosdwischenskaja angelegt haben.«49
Wie verheerend die Feldzüge für die Region gewesen sein müssen, lässt sich allein anhand der Beschreibungen Jermolows erahnen, der im Winter 1826 Atagi angreifen ließ. Persönlich bekam er den Landstrich nun zum ersten Mal zu Gesicht und freute sich darüber, dass die Wälder inzwischen abgeholzt und die Aule, die Dorfsiedlungen, nunmehr schutzlos waren. Dies war der Grund, warum er ohne Verluste in Atagi einrücken konnte. Nach Feuergefechten mit den Aufständischen, die sich auf der anderen Seite des Arguns, im Kleinen Atagi, verschanzt hatten, ging Jermolow zum Angriff über. Zuvor ließ er das flussaufwärts gelegene Nachbardorf Tschach-Keri (Abb. 1.3) niederbrennen, an das sich die Soldaten und Kosaken im Schutz der Nacht herangeschlichen hatten. An der Schlacht nahe Atagi sollen die Tschetschenen mit bis zu 3 000 Mann teilgenommen haben. Jermolows Expeditionskorps war allerdings noch größer und verfügte zudem über Artillerie, die Kartätschen, Schrotsalven, auf die Reihen der Nordkaukasier feuerte. Die Aufständischen verloren den Kampf im offenen Gelände und zogen sich zurück. Die nächsten drei Wochen war der General damit beschäftigt, von Dorf zu Dorf zu ziehen und mal den einen, mal den anderen Aul niederzubrennen.50
Die Häuser in jenem Landstrich »waren aus Flechtwerk gebaut, auf das dicke Lehmschichten aufgetragen« waren, erinnert sich Baron Tornau. Sie hatten Flachdächer und »bestanden aus zwei bis drei recht sauberen, weiß getünchten Zimmern«. Die Saklja, wie das Wohnhaus im Nordkaukasus genannt wurde, war meist »von Gärten umgeben, in denen die Tschetschenen verschiedenes Gemüse und Obst gepflanzt hatten. Auf den Lichtungen waren nicht geringe Saatflächen an Mais, Hirse, Weizen, Roggen und Gerste gesät. Die Wälder waren voll von Nussbäumen, Apfel-, Birnen-, Pflaumen- und Kirschbäumen.«51 Dass die Speicher in Atagi gut gefüllt und die Häuser »recht gut« waren, hatte auch Jermolow in seinem Bericht festgehalten.52 Gegen Ende des Kaukasuskrieges waren jedenfalls vom einst großen Aul mit etwa 700 Familien nur noch 430 Höfe übrig geblieben.53
Der Kolonialkrieg, die Verheißung des Islam und die Zwänge des Dschihad-Staates
Wenn Großvater Mussas Enkelin Taissja ausholt, um über die Geschichte der Region zu erzählen, so berichtet sie von der brutalen Gewalt der Zarenarmee auf der einen und vom heldenhaften Widerstand der Tschetschenen auf der anderen Seite. In ihrer Erzählung spiegeln sich die Geschichten wider, die die Alten berichtet hatten, als die Sowjetunion sich Ende der 1980er Jahre aufzulösen begann und die Völker an den Rändern des ehemaligen Reiches sich ihre Unterwerfung und Unterdrückung durch die »russischen« Machthaber vergegenwärtigten.54 Wie für die Alten, die unter Stalin nach Zentralasien deportiert worden waren, so scheint die Geschichte sich auch für Taissja zu wiederholen. Wie ihre Vorfahren haben auch Taissjas Brüder gegen die russische Armee gekämpft, wie ihre Vorfahren unterlagen sie Russlands Übermacht und bezahlten mit ihrem Leben. »Wir waren 11 Jungs in unserer Klasse«, erinnert sich ein Gesprächspartner aus Atagi. »Wir zogen alle in den Krieg. Nur drei von uns sind heute noch am Leben.«55 Der aus der Nähe von Atagi stammende und heute in Paris lebende Historiker Majrbek Watschagajew begreift diesen Widerstand als Teil eines antikolonialen Kampfes, der im späten 18. Jahrhundert begonnen hatte: »Je näher die russische Grenze rückte, desto erbitterter wurde der Kampf der Tschetschenen gegen die Kolonisatoren.«56
Die antikoloniale Rhetorik spiegelt gewiss den gegenwärtigen Blick auf die Geschichte des Kaukasus. Das antikoloniale Narrativ bestimmt nicht nur die westliche Berichterstattung über die Region, die immer dann eine höhere Dichte erreicht, wenn Russland einen Krieg vom Zaun bricht: Wie etwa 1994 und 1999, als Russlands Verbände in die abtrünnige Republik Tschetschenien einmarschierten. Oder 2008, als der Konflikt zwischen Georgien und Russland in einen Fünf-Tage-Krieg mündete. Dieser Blick wird auch von Historikern geteilt. So bringt Charles King die Geschichte des Kaukasus mit dem »Geist der Freiheit« in Verbindung, der den Widerstand gegen das Imperium befeuert habe.57 Moshe Gammer fasst die Geschichte der Tschetschenen als einen fortwährenden Widerstand gegen Russlands Herrschaft zusammen: Das russische Imperium sei zwar nicht zu besiegen. Doch die freiheitsliebenden Tschetschenen vermögen es, der Allmacht des Imperiums zu trotzen.58 Von Francis Fukuyamas Thesen vom »Ende der Geschichte« inspiriert, geht der britische Politologe Anatol Lieven noch einen Schritt weiter. Er betrachtet Tschetschenien als einen Ort, an dem der imperiale Habitus, das Erbe des postsowjetischen Russlands, zerbrach. Und tatsächlich schienen sich nach dem Ende des ersten Tschetschenienkrieges 1996 die Versprechen der liberalen Geschichtsschreibung zu erfüllen. Russlands Militärmacht hatte versagt, Tschetscheniens Rebellen hatten gesiegt. Ihre Geschichte schien den Geschichten anderer antikolonialer Bewegungen zu entsprechen, die nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges mit den Metropolen Europas gebrochen hatten.59
Es gibt gute Gründe, die Geschichte Tschetscheniens als eine Geschichte der brutalen Unterdrückung auf der einen und des Freiheitskampfes auf der anderen Seite zu erzählen. Atagi wäre gewiss kein schlechter Ort, um dieses Narrativ zu entfalten. Denn als Graf Pawel Potemkin (ein Verwandter des berühmten Favoriten Katharinas der Großen) 1782 ein Expeditionskorps ins Land der Tschetschenen schickte, waren es die Einwohner von Atagi, die eine freiwillige Unterwerfung verweigerten. Während die übrigen Aule einlenkten und als Zeichen des guten Willens »Geiseln« (amanaty) stellten, blieb Atagi stur, weshalb ein Jahr darauf ein »Detachement« losgeschickt wurde, um den Widerspenstigen eine Lektion zu erteilen.60 1783 wurde Atagi gleich zweimal niedergebrannt, einmal im März und erneut im September; die Einwohner der umliegenden Dörfer eilten jedes Mal zu Hilfe.61 Aus einem jener Dörfer, Aldy, dem späteren Vorort von Grosny, stammte auch der Anführer eines Aufstandes, Scheich Mansur, der 1785 die Stämme der Tschetschenen um sich scharte und sie im Namen des Heiligen Krieges vereinte. Aus jener Region zwischen dem Argun und der Sunscha breitete sich der Aufstand auf das gesamte Flachland aus. Er griff auf die Stämme der Kumyken und Kabardiner über, entwickelte sich zu einem ausgewachsenen »Bauernkrieg«, dessen Zorn sich sowohl gegen die eigenen Feudalherren als auch gegen die Zarenmacht richtete. Mit einem Heer von 12 000 Mann soll Scheich Mansur Kisljar, neben Mosdok die wichtigste Festung am Terek (vgl. Abb. 1.1), angegriffen haben.62
Für die Stämme der Bergvölker bedeutete der Kampf gegen das stehende Heer einen Kraftakt, der nicht lange aufrechtzuerhalten war. Doch auch nachdem Scheich Mansur 1791 sich der russischen Armee ergeben hatte, waren die Bergstämme nicht bereit, die Unterwerfung zu akzeptieren. Wiederholt wurden Expeditionskorps in die Ebene der Tschetschenen entsandt, die stets auf Gegenwehr stießen. Und so wurde Atagi 1807 einmal mehr niedergebrannt. Den Männern aus den Bergen gelang es zwar, den von General Bulgakow befehligten Verband in der Schlucht von Chankala zu stellen und ihm schwere Verluste zuzufügen. Doch auch sie zahlten einen hohen Blutzoll. Daher gaben die Stammesältesten letztlich klein bei: Die »übrig gebliebenen Einwohner des Großen Tschetschenischen Atagi«, hieß es in einem Militärbericht, hätten sich darauf geeinigt, »Russlands Schutz anzunehmen, Geiseln zu stellen und einen Treueeid zu schwören«. Die anderen niedergebrannten Dörfer in der Umgebung seien ebenfalls dazu bereit, signalisierte ein Parlamentär. Monate später leisteten die Gemeindeältesten einen Eid, schickten drei Geiseln aus den »besten Familien« nach Wladikawkas und strichen Geldgeschenke ein, mit denen die russische Armee die »Asiaten« gefügig zu machen hoffte.63
Der Widerstand ebbte aber nicht ab. Nicht nur General Jermolow gelang es nicht, die Gewalt zu beenden. Nach ihm kamen andere Statthalter, die mal auf die friedliche Strategie der zivilisatorischen Integration, mal auf eine Politik des Schreckens setzten, um Russlands Macht in der Region zu verankern. Dass die Politik der Härte schließlich die Überhand gewann, lag an der Haltung des Monarchen Nikolaus I., der 1825 den Dekabristen-Aufstand der Gardeoffiziere in St. Petersburg und 1831 den Novemberaufstand in Polen brutal niederschlagen ließ. Der berüchtigte »Gendarm Europas« duldete keinen Widerspruch. Daher befahl er dem Oberbefehlshaber im Kaukasus, die »Bergvölker für immer zu zähmen, anderenfalls die Widerspenstigen zu vernichten«. Und zwar nicht in einem langen, zermürbenden Kampf, sondern mit einem überraschenden und gewaltigen Schlag.64
Der Zar sah sich offenbar herausgefordert von der Widerstandsbewegung, die in Dagestan nicht zuletzt vom muslimischen Sufi-Orden der Naqschbandia gestützt wurde. Was die Bewegung gefährlich machte, war ihr zunehmend populistischer Charakter. Sie baute nicht primär auf die inneren Prinzipien des ursprünglich aus Zentralasien stammenden mystischen Ordens. Es ging nicht so sehr um die reine Lehre von den vier Stufen auf dem »Weg zum wahren Gott«. Vielmehr war es die der Bruderschaft innewohnende Forderung nach einer spirituellen Erneuerung des muslimischen Glaubens, die eine breite Bevölkerung anzusprechen begann. In der spezifischen Situation des Nordkaukasus der zwanziger Jahre des 19. Jahrhunderts gewann die Forderung nach einer ›Reformation‹, der Rückbesinnung auf das Eigentliche und Wesentliche des Islam, an Plausibilität.65
Eine Erzählung von den russischen Eindringlingen und den freiheitsliebenden Völkern des Kaukasus kann die daraus entstandene Dynamik der Gewalt nicht angemessen fassen. Schon marxistische Historiker haben darauf hingewiesen, dass diese Erneuerungsbewegung, ähnlich der Reformation in Europa, eine soziale Dimension besaß. Sie wandte sich nicht allein gegen die russische Fremdherrschaft, sondern ebenso gegen die Elite der Region, aus der sich die bisherigen geistlichen Führer rekrutierten und die sich gegen den Heiligen Krieg aussprach, weil der höhere Adel in Dagestan mit dem russischen Imperium kooperierte. Seit der Eroberung des muslimischen Khanats Kasan an der Wolga im 16. Jahrhundert kooptierte das Moskauer Reich auch die nichtchristlichen Eliten, was diesen wiederum den Fortbestand sicherte und die Möglichkeit gab, in der Metropole Karriere zu machen. Weil aber die Eliten des Nordkaukasus die Herrschaft des christlichen Imperiums akzeptierten, war es Predigern wie Gasi Muhammad, dem Vorgänger des berühmten Imams Schamil, ein Leichtes, die Bevölkerung gegen sie aufzubringen. Es half den Wortführern des erneuerten Islam, sich auf das Primat der Scharia zu berufen, während die Eliten an dem lokalen Gewohnheitsrecht des Nordkaukasus festhielten, das ihnen ihre Vormachtstellung sicherte. Und so verwandelte sich die Erneuerungsbewegung in eine Freiheitsbewegung, die der Fremdherrschaft den Islam und den traditionellen Eliten die moral community der Gläubigen entgegenstellte. Die Freiheit lag aber nicht auf der Straße. Sie zu erlangen, bedeutete Kampf, den Heiligen Krieg, den der Imam Gasi Muhammad 1829 ausrief.66
Um das Übergreifen des Aufstandes von Dagestan auf die tschetschenischen Stämme zu verhindern, zog General Weljaminow im Winter 1830/31 ins Land der Tschetschenen. Die Strategie Jermolows fortführend, setzte er eine ganze Reihe von Dörfern präventiv in Brand, darunter auch das Kleine Atagi auf der rechten Seite des Flusses Argun. Dies führte dazu, dass Gasi Muhammad dort ein umso leichteres Spiel hatte, nachdem die russischen Truppen sich zurückgezogen hatten. Die Armeeführung lernte aber nicht dazu. Im Sommer 1832 marschierte Weljaminow wieder in Tschetschenien ein. Diesmal mit einem noch größeren Heer von bis zu 20 000 Soldaten.67 Der Angriff mobilisierte an die 3 000 tschetschenische Männer und etwa 800 Lesginer aus Dagestan, die Germentschuk, einen Nachbarort im Osten von Atagi, in eine Festung verwandelten. Doch vergebens. So erbittert die Rebellen sich auch verteidigten, Weljaminows Truppen durchbrachen ihre Linien und richteten ein Blutbad an.68
Die Erfolge der Zarenarmee brachen der Rebellion indessen nicht das Genick. Auch wenn viele Mullahs und Vertreter der lokalen Eliten eingesehen hatten, dass die offene Konfrontation keine Aussicht auf Erfolg hatte, vermochten sie es doch nicht, sich gegen die Fürsprecher des Dschihad durchzusetzen. Die Stunde gehörte denjenigen, die zur Entschlossenheit aufriefen und auf das Einheit stiftende Moment des Krieges setzten. Daher wurde in Germentschuk bei der Dorfversammlung ein Muride, ein Gefolgsmann des Imams Gasi Muhammad überstimmt, der die Menge daran erinnert haben soll, dass der Heilige Krieg bisher nichts als »Verderben und Zerstörung« gebracht hatte. Oberhand gewann stattdessen Taschu Chadschi, dem es 1835 gelang, weite Teile der Bevölkerung der tschetschenischen Ebene, darunter auch Atagi, auf seine Seite zu ziehen. Taschu Chadschi stellte ein Heer auf und provozierte das Imperium mit regelmäßigen Überfällen. Er brauchte Erfolge, um seine Gefolgschaft zusammenzuhalten. Im Winter und im Spätherbst, sobald der Laubwald seine Blätter verlor, brachen russische Verbände ins Land ein, nahmen Geiseln, plünderten, zerstörten. Im Frühjahr und im Sommer gehörte die Ebene jedoch wieder den Tschetschenen. Manchmal waren die Bewohner des Argun-Tals so dreist, dass sie Pferde der Grosny-Garnison entführten, die vor den Bastionen der Festung weideten, was die umliegenden Dörfer jedoch teuer zu stehen kam.69
Wie die vorherigen Rebellenführer wusste Taschu Chadschi, dass er nur bestehen konnte, wenn er sich mit den Aufständischen in Dagestan verband, wo der Imam Schamil die Nachfolge des inzwischen gefallenen Imams Gasi Muhammad angetreten hatte. 1840 zog Schamil mit einem Heer durch die Ebene, brachte die noch hadernden Aule dazu, sich der Bewegung anzuschließen, darunter auch das Große Atagi, wo Teile der Bevölkerung offenbar gezögert hatten.70 Dem Triumphzug wohnte zugleich ein Moment der Unterwerfung inne. Bereits aus der Ferne hatte Schamil die Unwilligen wissen lassen, dass er diejenigen »mit Allahs Hilfe« bestrafen werde, die den Glauben missachteten und sich der Scharia verweigerten.71
Wie sein Vorgänger Gasi Muhammad wollte Schamil nicht nur Anführer einer Rebellion sein. Vielmehr strebte er an, im Nordkaukasus einen islamischen Staat zu errichten. Über den islamischen Staat haben muslimische Gelehrte in Dagestan bereits seit dem 15. Jahrhundert diskutiert, wie Michael Kemper gezeigt hat. Die Sufis und Rechtsgelehrten hatten dort eine eigene Tradition eines fundamentalistischen Islam etabliert. Seit dem 18. Jahrhundert gewann diese Bewegung an Kraft, was nicht zuletzt mit dem Vorgehen des Persischen Reiches in der Region zusammenhing. Doch es war Russlands Kolonialkrieg des 19. Jahrhunderts, der ihr zum Durchbruch verhalf. Denn nun gab es einen Grund, die lokalen Traditionen über Bord zu werfen.72
Seinen islamischen Staat baute Schamil hierarchisch auf. Er ernannte Statthalter. Taschu Chadschi wurde einer von ihnen. Er stellte ein stehendes Heer auf oder zumindest unternahm er den Versuch. Und er trieb Steuern ein, was ihm besser gelang. Schamil vertraute auf eine elementare Verwaltung und richtete ein Postwesen ein, das die Übermittlung von Nachrichten sicherstellte. Er regierte wie ein absolutistischer Herrscher – erteilte Anordnungen, erließ Gesetze, die die Scharia ergänzten. Mit anderen Worten, er baute eine Organisationsstruktur auf, die nicht zuletzt dank des universalen Prinzips des Islam die Fragmentierung des Nordkaukasus zu überwinden strebte. Für die tschetschenischen Gemeinden bedeutete dies vor allem eine Islamisierung, die tief in den Alltag eingriff, denn im Unterschied zu den Küstenregionen von Dagestan hatten die Gemeinden in der Ebene den Islam erst im 16. Jahrhundert anzunehmen begonnen. Dies galt vor allem für den östlichen Teil der Region. Die tschetschenischen Bergdörfer erreichte der Islam erst im 18. Jahrhundert, die weiter im Westen gelegenen Bergtäler der Inguschen im 19. Jahrhundert. Der Islam war aber selbst in der früher islamisierten Ebene nur oberflächlich in die lokale Gesellschaftsordnung eingedrungen. In Tschetschenien, so berichtete ein Zeitgenosse aus Dagestan, habe Schamil »die Tür zu allerlei Unanständigem geschlossen«. Was der Chronist damit meinte, war »das Trinken (von berauschenden Getränken), das Tabakrauchen, das Rezitieren von heidnischen Versen, den Liedgesang, (allerlei) Geselligkeiten und andere Gewohnheiten, die dem Koran und den Suren des Propheten widersprachen, wie etwa Mord, mit Ausnahme von Rache«, und ebenso »Diebstahl« und »Raubüberfall«.73
Aber die Islamisierung brachte den Gemeinden auch eine Rechtsreform, die Institutionalisierung des Richteramtes, die Einrichtung von Koranschulen an den Moscheen und so etwas wie eine Schulpflicht. Jeder zehnte männliche Einwohner besuchte die Koranschule. Der theokratische Staat nahm konkrete Gestalt an. Das erzeugte zweifelsohne Konflikte. Unter anderem, weil er Traditionen so grundsätzlich infrage stellte und, mehr noch, eine neue Elite hervorbrachte, die mit außerordentlichen Machtbefugnissen ausgestattet war. Gerade damit konnten die auf Egalität bedachten Gemeinden der Tschetschenen sich nur schwer abfinden. Auch die enorme Steuerlast rief Unmut und Widerstand hervor. Nun sahen sich die Menschen im Kaukasus nicht nur mit der Gewalt des Imperiums, sondern darüber hinaus mit dem Diktat der Imame konfrontiert. Doch davon abgesehen war es sicherlich dieser neuen Organisationsstruktur zu verdanken, dass diese Region sich so lange gegen die russische Streitmacht wehren konnte. Denn sie stellte eine »kohärente politische und militärische Struktur zur Verfügung« und lieferte darüber hinaus eine »ideologische Legitimation« für den verlustreichen Kampf. Es ist interessant, dass auch zeitgenössische europäische Beobachter Schamil etwas abgewinnen konnten, sofern sie die Scharia ausblendeten und stattdessen die Prozesse der Staats- und Nationsbildung in den Vordergrund rückten, die Schamil ihrer Meinung nach in Gang zu setzen versuchte.74
Der Kaukasuskrieg dauerte indes an und war für alle Seiten grausam. Die Krieger des islamischen Staates behandelten ihre Gegner nicht weniger zimperlich als die Soldaten des Imperiums. Eine Ahnung davon vermittelt ein Bericht des Statthalters des Argun-Distrikts an den Imam Schamil aus dem Jahr 1854. In knappen Worten schildert der Statthalter den Hergang eines Gefechts, das unweit von Atagi stattgefunden haben muss. Auf der Suche nach Kriegsglück hatte er sich mit seinem Verband aus den Bergen in die Ebene begeben, wo er prompt auf eine russische Patrouille stieß. Das Kräfteverhältnis scheint zunächst ausgewogen gewesen zu sein. Bald





























