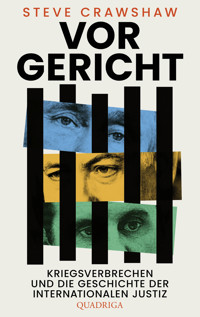
24,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Quadriga
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
»In diesem eindrucksvollen Buch setzt sich Steve Crawshaw, der seine Karriere dem Streben nach internationaler Gerechtigkeit gewidmet hat, eloquent mit einem Dilemma auseinander: Wie können Kriegsverbrecher zur Rechenschaft gezogen werden?« Anne Applebaum
Werden wir Wladimir Putin jemals auf der Anklagebank sehen? Oder Benjamin Netanjahu? Einst schien es unvorstellbar, Präsidenten vor Gericht zu stellen, doch die Möglichkeiten der Justiz haben sich in den letzten Jahrzehnten fundamental geändert.
Vom Beschluss der ersten Genfer Konvention über die Nürnberger Prozesse bis zu den aktuellen Anklagen des Internationalen Strafgerichtshofs gegen zwei der mächtigsten Staatsoberhäupter der Welt: Mit scharfem Blick und erzählerischer Kraft zeigt Steve Crawshaw, wie fragil Gerechtigkeit sein kann und warum es heutzutage wichtiger denn je ist, für sie einzutreten.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 645
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Inhalt
Cover
Inhalt
Über dieses Buch
Über den Autor
Titel
Impressum
Widmung
Vorwort zur deutschen Ausgabe
Einleitung
KAPITEL 1: »Das passt doch alles nicht zusammen«
KAPITEL 2: »Wir müssen im Stillen sündigen«
KAPITEL 3: »Es läuft alles nach Plan«
KAPITEL 4: »Eine Idee, deren Zeit gekommen ist«
KAPITEL 5: »Die Spielregeln ändern sich«
KAPITEL 6: »Ich lasse mich gern täuschen«
KAPITEL 7: »Wenn nicht jetzt, wann dann?«
KAPITEL 8: »Erinnert euch, was Amalek euch angetan hat«
KAPITEL 9: »Ich rieche den Duft der Gerechtigkeit«
KAPITEL 10: Die Augenbinde der Justitia
Erweitertes Nachwortfür die deutsche Ausgabe
Anmerkungen
Dank
Seitenliste
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
Navigationspunkte
Cover
Inhaltsverzeichnis
Titelseite
Hauptteil
Über dieses Buch
»In diesem eindrucksvollen Buch setzt sich Steve Crawshaw, der seine Karriere dem Streben nach internationaler Gerechtigkeit gewidmet hat, eloquent mit einem Dilemma auseinander: Wie können Kriegsverbrecher zur Rechenschaft gezogen werden?« Anne Applebaum.
Werden wir Wladimir Putin jemals auf der Anklagebank sehen? Oder Benjamin Netanjahu? Einst schien es unvorstellbar, Präsidenten vor Gericht zu stellen, doch die Möglichkeiten der Justiz haben sich in den letzten Jahrzehnten fundamental geändert.
Vom Beschluss der ersten Genfer Konvention über die Nürnberger Prozesse bis zu den aktuellen Anklagen des Internationalen Strafgerichtshofs gegen zwei der mächtigsten Staatsoberhäupter der Welt: Mit scharfem Blick und erzählerischer Kraft zeigt Steve Crawshaw, wie fragil Gerechtigkeit sein kann und warum es heutzutage wichtiger denn je ist, für sie einzutreten.
Über den Autor
Steve Crawshaw wurde 2021 Vorsitzender des Kuratoriums von RAID. Bis 2022 war er Direktor für Politik und Interessenvertretung bei Freedom from Torture. Davor war er International Advocacy Director bei Amnesty International, London Director und UN Advocacy Director bei Human Rights Watch und Journalist bei The Independent in Großbritannien, wo er als außenpolitischer Redakteur über die osteuropäischen Revolutionen, den sowjetischen Putsch und die Balkankriege berichtete. Für sein vorheriges Buch Street Spirit: The Power of Protest and Mischief verfasste Ai Weiwei das Vorwort.
Jürgen Neubauer arbeitete als Buchhändler in London, Dozent in Pennsylvania und Sachbuchlektor in Frankfurt, ehe er nach Mexiko auswanderte. Neubauer ist Autor und freiberuflicher Literaturübersetzer und übersetzt u.a. Bücher von Anne Applebaum und Yuval Noah Harari.
S T E V E C R A W S H A W
VORGERICHT
KRIEGSVERBRECHENUND DIE GESCHICHTE DERINTERNATIONALEN JUSTIZ
Übersetzung aus dem Englischen von Jürgen Neubauer
Vollständige E-Book-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Quadriga Verlag
Titel der englischen Originalausgabe:»Prosecuting the Powerful«
Für die Originalausgabe:Copyright © 2025 by The Bridge Street Press
Für die deutschsprachige Ausgabe:Copyright © 2025 byBastei Lübbe AG, Schanzenstraße 6 – 20, 51063 Köln, Deutschland
Vervielfältigungen dieses Werkes für das Text- und Data-Mining bleiben vorbehalten.Die Verwendung des Werkes oder Teilen davon zum Training künstlicher Intelligenz-Technologien oder -Systeme ist untersagt.
Textredaktion: Matthias Auer, Bodman-Ludwigshafen
Umschlaggestaltung: Kristin Pang nach einem Design von Jonathan Pelham
Umschlagmotiv: © Alamy Stock Photos | Allstar Picture Library Ltd | Mauritius-Bilder | Enrique Shore | Russische Regierung
eBook-Produktion: hanseatenSatz-bremen, Bremen
ISBN 978-3-7517-8481-8
quadriga-verlag.de
Für Eva und Ania,in Liebe
Vorwort zur deutschen Ausgabe
Als der Internationale Strafgerichtshof vor mehr als einem Vierteljahrhundert gegründet wurde, begrüßte man ihn in Deutschland als »eine Idee, deren Zeit gekommen ist«. Seit Jahren bewundere ich als Journalist, Autor und Menschenrechtsaktivist die Vorreiterrolle Deutschlands beim Einsatz für das Völkerrecht, und ich freue mich, wenn die Veröffentlichung der deutschen Ausgabe dieses Buches ein Hinweis darauf ist, dass es sich bei diesem Thema in Deutschland nach wie vor um ein wichtiges Anliegen handelt.
Wir stehen am Scheideweg. Die Überlebenden von massenhaften Gräueltaten in aller Welt verlangen nach Recht und Gerechtigkeit. Gleichzeitig klammern sich viele Regierungen an etwas, das der deutsche Philosoph Immanuel Kant im 18. Jahrhundert als ihre »gesetzlose Freiheit« bezeichnet hat. Deutschland steht vor der Wahl: Es kann diese gesetzlose Freiheit anfechten, indem es Rechenschaft für diese Verbrechen einfordert, unabhängig davon, wer sie begangen hat – oder es kann sich diejenigen Verbrechen herauspicken, die es ahnden möchte, je nachdem, ob es sich bei den Tätern um politische »Freunde« Deutschlands handelt oder nicht.
Ich hoffe, die Argumente in diesem Buch und die Geschichten der Menschen, die im zurückliegenden Jahrhundert und heute das Völkerrecht entwickelt und damit zu einer stabileren Welt beigetragen haben, sind ein Denkanstoß. In schwierigen Zeiten wie den heutigen könnte kaum mehr auf dem Spiel stehen.
Steve Crawshaw
London, August 2025
Einleitung
Schreckensorte sind natürlich nicht unbedingt als solche erkennbar. Es gibt keinen typischen Schauplatz für Massenmorde. Keine unheilvolle Beleuchtung oder Hintergrundmusik deutet auf das hin, was sich hier abgespielt haben könnte. Auch wenn rundum furchtbare Gräueltaten begangen wurden, machen sie den Besucher nicht auf sich aufmerksam, sobald die Leichen beseitigt, die Blutlachen aufgewischt und die zerbrochenen Fensterscheiben ausgetauscht sind. Trotzdem kann ich mich einfach nicht daran gewöhnen, dass Orte, an denen sich schrecklichste Verbrechen abgespielt haben – eine idyllische Wiese, auf der einst ein nationalsozialistisches Konzentrationslager stand, oder die freundlichen Hügel um Srebrenica in Bosnien, in deren Wäldern der Ruf des Kuckucks schallt –, derart normal aussehen und klingen können.
Dieses verstörende Gefühl hatte ich auch bei meinem ersten Besuch in Butscha im April 2023. Noch ein Jahr zuvor war dieser Pendlervorort nordwestlich von Kiew vor allem für die Pilze bekannt, die in den Wäldern der Umgebung in großen Mengen wachsen. Jeden Herbst kamen die Menschen in Scharen aus der Hauptstadt hierher, um Schwammerln zu suchen. Heute verbinden wir den Namen Butscha mit Dingen, die sich die Bewohner in ihren schlimmsten Albträumen nicht ausgemalt hätten.
Ich besuchte den Ort ein Jahr nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine. Als ich in Kiew ankam, waren die schlimmsten Raketenangriffe auf die ukrainische Hauptstadt vorüber, zumindest für den Moment. Dennoch ertönten häufig die Luftschutzsirenen. Jeder hatte eine App auf dem Handy installiert, die ihn warnte, wann er Schutz zu suchen hatte. Die Gefahren waren real: Zahlreiche Menschen waren ums Leben gekommen, überall im Stadtgebiet befanden sich beschädigte oder zerstörte Gebäude, und vier Monate vor meinem Besuch war ganz in der Nähe meines Hotels eine russische Rakete auf einem Kinderspielplatz eingeschlagen. Aber viele Ukrainer ignorierten die Sirenen inzwischen und nahmen die Gefahr in Kauf. Der Alltag ging irgendwie weiter. Abends besuchte ich eine Ballettvorstellung, die mit stehendem Applaus gefeiert wurde. Das Lesya-Ukrainka-Theater gab Brian Friels Sprachstörungen, das im von den Briten kolonisierten Irland spielt und von der Unterdrückung der Landessprache durch die Kolonialherren handelt; sämtliche Vorstellungen waren ausverkauft, auch wenn sie aufgrund des Raketenalarms oft später anfingen. Die Restaurants und Cafés der Stadt waren gut besucht, obwohl sie früh schlossen, damit die Gäste und Mitarbeiter vor der Sperrstunde nach Hause kamen. Es herrschte eine unnormale Form der Normalität.
Zu Beginn der Invasion waren sich die russischen Streitkräfte sicher, dass sie die ukrainische Hauptstadt binnen weniger Tage einnehmen würden. »Wir erobern Kiew! Kiew ist unser!«, riefen die Soldaten, als ihre Panzer über die Grenze rollten. Sie waren angewiesen worden, Paradeuniformen einzupacken für den Triumphzug auf dem breiten Chreschtschatyk-Boulevard und dem Maidan, wo acht Jahre zuvor die demokratischen Demonstrationen stattgefunden hatten. Präsident Wladimir Putin gab sich zuversichtlich, dass der »militärische Sondereinsatz« – von Krieg durfte man in Russland nicht sprechen – rasch beendet wäre. Trotz heftiger Kämpfe am Flughafen Hostomel gelang es den russischen Streitkräften jedoch nicht, Kiew einzunehmen. Sie erreichten lediglich Ortschaften auf dem Weg nach Kiew. Eine davon war Butscha.
Meine Fahrt nach Butscha verläuft ereignislos. Zwischen blühenden Aprikosenbäumen sehe ich einige verlassene militärische Kontrollpunkte, auf dem Grünstreifen stapeln sich die Panzersperren, die nicht mehr gebraucht werden. Auf einem Rastplatz türmen sich Fahrzeuge, deren Insassen beschossen oder getötet wurden – eine Mischung aus Schrottplatz und Gedenkstätte. Einige der Autos wurden mit leuchtenden Sonnenblumen bemalt und tragen Botschaften wie #BlumenDerHoffnung.
In Butscha selbst sind einige der Gebäude stark beschädigt, andere wurden unlängst restauriert. Doch vieles erinnert an einen normalen Pendlervorort: Wohnblocks, Einkaufszentren, Plakatwerbung für Fitnessstudios. In Wirklichkeit ist jedoch gar nichts normal hier, und das wird es auch auf Jahre hinaus nicht sein. An der Jablonska-Straße (»Straße der Apfelbäume«) stehen Einfamilienhäuser zum Verkauf – taunhausi, wie sie im Maklerjargon des Landes heißen. Ein Plakat verspricht die »Annehmlichkeiten des Vorstadtlebens« – Terrassen für den Sommer, ein schöner Ausblick auf die Landschaft. Und gegenüber der taunhausi befindet sich eine unauffällige Kreuzung, die inzwischen in aller Welt berüchtigt ist.
Im Februar 2022 meldete sich die 52-jährige Irina Filkina zu einem Schminkkurs an und sagte zu ihrer Freundin und Kollegin Anastasia Subatschewa: »Ich hab endlich kapiert, was das Wichtigste ist. Du musst dich selbst lieben und selbstständig sein.« Wenige Wochen später war sie tot. Als sie am 5. März 2022 mit dem Fahrrad nach Hause fuhr, wurde sie auf dieser Kreuzung von einem russischen Panzerfahrzeug getötet; an diesem Tag hatte sie erfolglos versucht, den Ort zu verlassen. Weil es zu gefährlich war, ihren Leichnam zu bergen, lag dieser dort bis Ende März, als es den ukrainischen Streitkräften schließlich gelang, Butscha zu befreien. Ein Foto, das die Reuters-Fotografin Zohra Bensemra von ihrer Hand mit der besonderen Valentinstag-Maniküre machte – vier rote Nägel und der fünfte mit einem schwarzen Herz auf rosa Grund –, reichte aus, um sie zu identifizieren. Subatschewa erkannte die Hand sofort: »Mir ist die Luft weggeblieben.«
Irina Filkina war eine von mehr als vierhundert Zivilisten, die in Butscha ermordet wurden. Allein auf der Straße der Apfelbäume wurden mehrere Dutzend Menschen getötet. In einem viergeschossigen Bürogebäude mit der Nummer 144, das den russischen Streitkräften als Hauptquartier diente, sind die zerbrochenen Fensterscheiben ausgetauscht. An einer Wand hängen die Fotos von acht Männern, die hier per Kopfschuss ermordet wurden. Auf dem Boden liegen Blumen. Die Männer wurden im Rahmen von »Säuberungsaktionen« aufgegriffen und hingerichtet; die Russen verwendeten dafür das Wort zachistki, genau wie während Putins Tschetschenienkrieg zwanzig Jahre zuvor.
In der Nähe der Kreuzung, auf der Filkina starb, wird ein Haus wiederaufgebaut. Natascha, die Besitzerin, die auf der Flucht während der ersten Tage der Invasion mehrfach beschossen wurde, erzählt mir: »Die Nachbarn sind fort. Man hat sie nicht ausfindig gemacht, weder tot noch lebendig. Die Russen müssen erfahren, was hier passiert ist. Sie müssen die Tränen der Menschen hier sehen.«
In Butscha und an vielen anderen Orten wurden grauenvolle Verbrechen begangen. Aber werden die Täter – und ihre Vorgesetzten, und die Vorgesetzten ihrer Vorgesetzten – jemals zur Rechenschaft gezogen werden? Früher wäre die Antwort ein eindeutiges Nein gewesen. Doch in den vergangenen Jahrzehnten hat die Justiz ganz neue Möglichkeiten erhalten.
Als ich den damaligen serbischen Präsidenten Slobodan Milošević 1992 fragte, ob er nicht fürchte, dass er eines Tages wegen Kriegsverbrechen vor Gericht gestellt werden könnte, schien ihn dieser Gedanke zu amüsieren. Neun Jahre später saß er auf der Anklagebank in Den Haag und war des Völkermordes und Verbrechens gegen die Menschlichkeit angeklagt. Auf die Einrichtung der Internationalen »Ad-hoc«-Strafgerichtshöfe für das ehemalige Jugoslawien und für Ruanda Mitte der 1990er Jahre folgte schon bald die Einigung auf einen ständigen Internationalen Strafgerichtshof – ein Projekt, für das sich einige wenige Entschlossene zwar seit langem eingesetzt hatten, das jedoch jahrzehntelang undurchführbar erschienen war. Dass auch die Straffreiheit lateinamerikanischer Diktatoren nicht mehr garantiert war, wurde klar, als der ehemalige chilenische Diktator General Augusto Pinochet während eines Besuchs in London verhaftet wurde, wo er sich zu einer Rückenoperation aufhielt. Politiker, die für schwerste Verbrechen verantwortlich waren, hatten mehr Grund zur Sorge denn je.
Jahrzehntelang schien es so, als seien die Nürnberger Prozesse gegen die deutschen Hauptkriegsverbrecher des Zweiten Weltkriegs und die wenig später stattfindenden Tokioter Prozesse eine einmalige Angelegenheit gewesen. Viele der Staaten, die nach 1945 die nationalsozialistischen Verbrecher strafrechtlich verfolgt hatten, begingen in der Folge ihre eigenen Gräueltaten, weil sie sich in der Sicherheit wiegen konnten, dass man sie niemals zur Rechenschaft ziehen würde. Sie verschlossen die Augen sogar vor Völkermord – ein Wort, das Raphael Lemkin, Rechtsanwalt aus der heutigen Ukraine, im Jahr 1944 geprägt hatte. Inzwischen stehen die Chancen allerdings deutlich besser, die Täter zur Rechenschaft zu ziehen.
Das Thema Gerechtigkeit beschäftigt mich seit vielen Jahren – einerseits die Schwierigkeit, die Verantwortlichen vor Gericht zu bringen, andererseits aber auch die Menschen, die gegen ganz erhebliche Widerstände dafür gekämpft haben. Ich bin in einer Zeit aufgewachsen, in der sich in Lateinamerika folternde Militärregierungen wie ein Virus ausbreiteten und in der Sowjetunion und dem gesamten Ostblock Andersdenkende inhaftiert oder in Arbeitslager deportiert wurden. Mein Denken wurde geprägt durch das Bedürfnis, etwas gegen diesen Wahnsinn zu unternehmen, und die schiere Unmöglichkeit dieses Unterfangens. Ich interessierte mich auch für den langen Schatten der Geschichte: Um Russisch und Deutsch zu lernen, lebte ich eine Zeitlang in St. Petersburg (damals Leningrad) und Berlin und lernte auf diese Weise zwei Länder kennen, die sich vierzig Jahre nach Stalins Säuberungen und dreißig Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs auf sehr unterschiedliche Weise mit ihrer jeweiligen Vergangenheit auseinandersetzten.
Ich wurde auch Zeuge historischer Momente der Hoffnung, zum Beispiel als ich 1980 in Polen miterlebte, wie Millionen Menschen dem kommunistischen Regime bis dahin unvorstellbare Zugeständnisse abrangen, während im Kreml noch Leonid Breschnew saß, der Panzer in die Tschechoslowakei und nach Afghanistan geschickt hatte. Diese beispiellosen Erfolge – die trotz aller Verhaftungen und Ermordungen nie ganz zurückgenommen werden konnten – beeinflussten mein Denken in den folgenden Jahren. Sie zeigten mir, dass sich mit Mut und Entschlossenheit außergewöhnliche Dinge erreichen lassen, selbst in scheinbar aussichtslosen Situationen und allen Unkenrufen zum Trotz.
Dank meiner Erfahrungen in Polen und Mitteleuropa sowie einer Fernsehdokumentation über Lügen, Wahrheit und den Zweiten Weltkrieg in Weißrussland, an der ich mitgewirkt hatte, bekam ich meinen Traumjob als Auslandsberichterstatter des Independent, als die Zeitung 1986 gegründet wurde. Drei Jahre später berichtete ich über den »Untergang eines Imperiums« (so die Überschrift eines meiner Artikel aus dem April 1989). Die Revolutionen in Osteuropa und der Fall der Berliner Mauer waren der vorläufige Schlusspunkt einer Reihe von außergewöhnlichen Ereignissen, deren Zeuge ich neun Jahre zuvor in Polen geworden war; den Weg bereitete nicht erst der sowjetische Reformer Michail Gorbatschow. Es war ein Privileg, in diesen hoffnungsvollen Tagen aus Warschau, Leipzig, Prag und Budapest berichten zu dürfen. Auch in Russland sah ich den Funken des Optimismus nach der Niederschlagung des Putschversuchs der Hardliner im August 1991, der das Ende der Sowjetunion selbst besiegelte.
Westliche Politiker sahen nicht, was da kam und wie viel sich verändert hatte. Wie ich in einem Buchexposé schrieb, das ich vier Monate vor dem Putschversuch an einen Verlag schickte, war der bevorstehende Untergang der Sowjetunion vielleicht die größte Story des ausgehenden 20. Jahrhunderts. Jeder Versuch, die Veränderungen mit Gewalt aufhalten zu wollen, könne nicht mehr sein als »eine äußerst kurzfristige Lösung«. Trotzdem war die Politik nicht bereit oder imstande, sich den gewaltigen Umwälzungen zu stellen, die da bereits im Gange waren. Ich zitierte den russischen Schriftsteller Jurij Karjakin, der geschrieben hatte: »In den letzten sechs Jahren wurden Hunderttausende Flaschen geöffnet, und ihre Geister lassen sich nicht wieder einsperren. Wie sollte das möglich sein?« Oder wie die Überschrift eines meiner Artikel aus dem Februar 1991 lautete: »Der Kreml kriegt den Deckel nicht mehr zu«. Als der befürchtete Gegenschlag kam, war er nach drei chaotischen Tagen im August zu Ende. Einen kurzen Moment lang schien es nicht abwegig, Hoffnung zu hegen. »Es war der glücklichste Tag meines Lebens«, sagte mir ein Freund in Moskau nach dem Scheitern des Putsches. »Glücklicher noch als der Tag, an dem mein Kind zur Welt gekommen ist.« Heitere Worte wie diese schienen jedoch schon bald wieder undenkbar.
Auf die guten Nachrichten folgten rasch schlechte. Jugoslawien hatte ich 1976 kennengelernt, als ich nach dem Ende meines Studienjahrs in der Sowjetunion mit dem Nachtzug ans Schwarze Meer nach Odessa fuhr (oder Odesa, um die ukrainische Schreibweise zu verwenden, die nur wenige Ukrainer benutzten, bis der russische Überfall die Sprachpolitik wieder aktuell machte), um von dort mit einem Touristendampfer die Donau hinauf nach Budapest zu fahren. Unterwegs machten wir in Belgrad halt. Ich war begeistert von der entspannten Atmosphäre dieser dem Namen nach Sozialistischen Föderativen Republik, die sich so sehr vom erstickenden Druck der Sowjetunion unterschied. Dort waren meine russischen Freunde (die sich schon verdächtig machten, wenn sie auch nur mit mir und anderen Ausländern sprachen) und ich uns stets der Allgegenwart des Komitees für Staatssicherheit, sprich KGB, bewusst. Als ich 1982 nach Jugoslawien zurückkehrte – zwei Jahre nach dem Tod von Marschall Tito, des Weltkriegshelden, der fast vierzig Jahre lang an der Spitze des Landes gestanden hatte –, war der Vielvölkerstaat immer noch offener als seine mittel- und osteuropäischen Nachbarn mit ihren Polizeiregimes. Ab 1989 sahen jedoch viele politische Führer, die sich von der neuen Parteiendemokratie in der Region bedroht fühlten, im Nationalismus ein probates Mittel, um sich an der Macht zu halten.
In den jugoslawischen Republiken Kroatien und Bosnien begann der Bürgerkrieg 1991 und 1992. Wie andere Balkankorrespondenten der Zeit erinnere ich mich besonders daran, dass es unmöglich schien, die Politik auf den Schrecken aufmerksam zu machen, der da seinen Lauf nahm. Es war doch »die Stunde Europas«, wie der luxemburgische Außenminister und EU-Ratspräsident Jacques Poos im Juni 1991 verkündete, offenbar in der Hoffnung, dass sich das Problem rasch von selbst erledigen werde. Zwei Wochen später besuchte ich in Osijek im Osten Kroatiens ein älteres Ehepaar, das mich zu einem Sliwowitz eingeladen hatte, als draußen ein Schusswechsel begann. Stundenlang tobte das Feuergefecht, und wir standen Todesangst aus. Tränenüberströmt sagte meine Gastgeberin: »Eines Tages werden sie uns alle umbringen. Ich habe solche Angst.« Der Arzt, der an diesem Tag die Totenscheine ausstellte, sagte mir: »Es ist entsetzlich. Und es wird immer schlimmer. Ich habe jede Hoffnung aufgegeben.«
Es war der Beginn von vier langen Kriegsjahren in der kollabierenden jugoslawischen Föderation. Es schien, als würden viele der vor allem von kroatischen und serbischen Streitkräften begangenen Verbrechen niemals gesühnt werden. Doch allmählich eröffneten sich neue juristische Möglichkeiten, insbesondere, als 1993 erstmals seit den Nürnberger Prozessen wieder ein Kriegsverbrechertribunal eingerichtet wurde. Im Jahr 2001 begleitete ich die Massenproteste, die den serbischen Präsidenten Milošević nach einem blutigen Jahrzehnt zum Rücktritt zwangen. Danach verbrachte ich einige Zeit am Internationalen Strafgerichtshof für das ehemalige Jugoslawien und sprach mit Menschen, die ihn seiner gerechten Strafe zuführen wollten; dazu veröffentlichte ich einen Zeitschriftenartikel mit dem Untertitel »Hinter den Kulissen des neuen Nürnberg«. Wenig später lieferte die neugewählte Regierung in Belgrad Milošević nach Den Haag aus.
Gleichzeitig war ein neuer permanenter Internationaler Strafgerichtshof ohne geografische Einschränkungen in Vorbereitung. Dabei spielten Menschenrechtsorganisationen eine entscheidende Rolle. Im Jahr 2002, kurz vor der Gründung des Internationalen Strafgerichtshofs, wurde ich Leiter des britischen Büros der international agierenden Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch. Zuvor hatte ich als Journalist über Menschenrechte und andere Themen geschrieben und geschildert, was ich gesehen und gehört hatte. In gewisser Weise blieb ich Berichterstatter und verbreitete Informationen über Menschenrechtsverletzungen, in der Hoffnung, damit Veränderungen zu bewirken. Doch meine Hauptaufgabe bestand nun darin, gemeinsam mit Aktivisten in aller Welt einen Beitrag dazu zu leisten, dem Recht zu seiner Durchsetzung zu verhelfen. Die Erfahrungen, die ich in meinen zwanzig Jahren bei Human Rights Watch, Amnesty International und Freedom from Torture gemacht habe, sowie die Menschen, denen ich dort begegnet bin, stehen im Mittelpunkt dieses Buches.
Im Jahr 2005 versuchte ich erstmals, meine Gedanken zum Internationalen Strafrecht zu Papier zu bringen. Wenn ich die Zeit gefunden hätte, »Crimes and Punishment« (so mein Arbeitstitel) zu schreiben, dann wäre es ein ganz anderes und viel zu optimistisches Buch geworden. Damals schien die Welt deutlich einfacher zu sein. In den zwei Jahrzehnten, die seither vergangen sind, gab es viele neue Gründe zur Verzweiflung. Es gab allerdings auch neuen Grund zur Hoffnung. Das Auf und Ab zwischen Verzweiflung und Hoffnung spiegelt sich auch in Vor Gericht wider.
Dieses Buch berichtet aus der im Umbruch befindlichen Landschaft des Völkerrechts, es schildert, wie diese Veränderungen zustande kommen und welche Hindernisse nach wie vor bestehen bleiben. Mächtige wurden verfolgt und inhaftiert, obwohl dies früher undenkbar schien. Überlebende von Konflikten konnten sich auf nie dagewesene Weise Gehör verschaffen. Viele Jahre lang schien es so, als werde das Recht nie für alle gelten. Das Muster aus der Zeit des Kalten Krieges wiederholte sich: Menschen, die mit großem Eifer die Verbrechen anderer verfolgten, beanspruchten für sich und ihre Freunde einen Freifahrtschein.
Dieses Gefühl der Straflosigkeit hat jedoch einen Knacks bekommen, auch während der Arbeit an diesem Buch. Im März 2023 erließ der Internationale Strafgerichtshof einen Haftbefehl gegen Wladimir Putin – eine außergewöhnliche Maßnahme gegen den Präsidenten eines Staats mit ständigem Sitz im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen. Noch bemerkenswerter waren jedoch die Haftbefehle, die 2024 gegen den Ministerpräsidenten und den Verteidigungsminister eines der engsten Verbündeten der Vereinigten Staaten ausgesprochen wurden, einer Regierung, die davon ausging, dass sie über jede Strafverfolgung erhaben war, egal was sie tat. Als der Strafgerichtshof die Ermittlungen gegen Benjamin Netanjahu und Joaw Galant aufnahm, bezeichnete US-Präsident Joe Biden dies als »empörend« und der britische Premierminister Rishi Sunak als »wenig hilfreich«.
Als ich wenige Tage nach Verkündung der Haftbefehle den Chefankläger Karim Khan in seinem Büro in Den Haag aufsuchte, war dieser nicht in der Stimmung, von seiner Anklage abzurücken. Im Gegenteil, er betonte, genau dies sei seine Aufgabe. »Wenn wir das Gesetz in einigen Fällen streng zur Anwendung bringen und in anderen nicht, dann bringen wir es in Verruf. Das sagt schon Shakespeare.« Khan schloss die Augen, um kurz nachzudenken, dann zitierte er König Lear:
Zerlumptes Kleid bringt kleinen Fehl ans Licht,
Talar und Pelz birgt alles. Hüll’ in Gold die Sünde, –
Der starke Speer des Rechts bricht harmlos ab; –
In Lumpen, – des Pygmäen Halm durchbohrt sie.
Nach Ansicht von Khan ist diese Beschreibung der Ungleichbehandlung durch das Gesetz bis heute gültig. Oder wie er es ausdrückte: »Wenn du arm und schwach bist, dann bekommst du die volle Härte des Gesetzes zu spüren. Aber wenn du im Goldmäntelchen daherkommst, darfst du dir alles erlauben.« Das zu ändern sah er als seine Aufgabe an.
Seinerzeit warnte ihn ein »hochrangiger Politiker« davor, Anklage gegen israelische Politiker zu erheben, mit der Begründung, das Gericht sei schließlich »für Afrika und für Gangster wie Putin« eingerichtet worden. Khan machte keinen Hehl daraus, was er von solchen Ansichten hielt: »An diesem rassistischen und kolonialistischen Denken kranken leider noch viele.«
Politiker, die Khans Haftantrag kritisierten, nahmen nicht einmal Anstoß an den Anklagepunkten. Khan hatte sich mit einem sechsköpfigen Gremium von angesehenen Juristen beraten, darunter ein ehemaliger Botschafter und Vorsitzender des jugoslawischen Kriegsverbrechertribunals sowie ein früherer Richter des Internationalen Strafgerichtshofs. Die Juristen unterstützten Khans Antrag auf Haftbefehl einstimmig. Washington und andere hielten jedoch dagegen, es sei grundsätzlich falsch, demokratisch gewählte Politiker wegen schwerster Verbrechen anzuklagen. Doch selbst den begriffsstutzigsten Politikern sollte einleuchten, dass sie damit die Dinge auf den Kopf stellen. Wir hoffen natürlich, dass sich demokratisch gewählte Politiker keiner schweren Straftaten schuldig machen. Wenn sie es dennoch tun – vor allem, wenn sie der Ansicht sind, dass sie aufgrund der Umstände (das Verhalten des Feindes eingeschlossen) das Recht dazu haben –, dann darf man davor nicht die Augen verschließen, sondern muss dem entschlossen entgegentreten. Alles andere wäre unaufrichtig und gefährlich.
Khans Anklage richtete sich nicht nur gegen die israelische Führung, sondern auch gegen die »unerhörten« Verbrechen der Hamas, wie er sie nannte. Ein Jahr nach meiner Fahrt nach Butscha besuchte ich die Stätte des Supernova-Festivals in der Nähe des Kibbuz Re’im im Süden Israels. Das Musikfestival beschrieb sich selbst als »Feier von Freunden, Liebe und grenzenloser Freiheit«. Videos zeigen, wie die Besucher am 7. Oktober 2023 in den Sonnenaufgang tanzten. Dann, kurz vor halb sieben, nimmt der Schrecken seinen Lauf: Entführungen, Vergewaltigungen und Morde. 1200 Männer, Frauen und Kinder, darunter achthundert Zivilisten, wurden getötet, als die Angehörigen der Hamas und anderer Gruppen in der Nähe von Re’im und anderer Kibbuze die Zäune des Gazastreifens mit Motorrädern, Gleitschirmen und Kleinlastwagen überwanden. 240 Menschen wurden als Geiseln verschleppt, darunter Soldaten, Zivilisten, thailändische Landarbeiter, dreißig Kinder und ein neun Monate alter Säugling.
Keine fünf Kilometer von Re’im entfernt befindet sich ein weiterer Schreckensort. Israelische Fernsehzuschauer sehen bestenfalls geschönte Darstellungen der Katastrophe, die israelische Soldaten auf der anderen Seite der Zäune anrichteten, hinter denen zwei Millionen Palästinenser eingesperrt sind; ausländische Journalisten haben trotz der Proteste internationaler Medienorganisationen keinen Zutritt. Der einst beliebte Aussichtspunkt nahe der südisraelischen Stadt Sderot, wo israelische Ausflügler während früherer Angriffe auf den Gazastreifen Picknick machten – der »Hügel der Schande«, wie er deshalb genannt wird –, ist während meines Besuchs mit Stacheldraht gesperrt. Die Region entlang der Grenze ist abgeriegelt. Doch wer es wissen möchte, für den ist das Leid der im Gazastreifen gefangenen, hungrigen, verwaisten, verwundeten oder getöteten Menschen kein Geheimnis.
Im Jahr 2022 verurteilte die Staatengemeinschaft nahezu einhellig den Angriff auf Zivilisten, Wohngebiete und Infrastruktur durch Russland in der Ukraine. Als die israelische Regierung zwanzig Monate später ähnlich vorging, reagierten einige derjenigen, die Putins Verbrechen verurteilt hatten, ganz anders. Justitia legte ihre Waagschale und Augenbinde beiseite. Wer beging die Verbrechen? (Sind das unsere Freunde oder Gegner?) Diese Frage wurde für einige Politiker genauso wichtig wie die, um welche Verbrechen es sich handelte.
Die Hintergründe für Putins Überfall auf die Ukraine und Israels Besetzung des Gazastreifens sind jeweils ganz andere. Putins Vorwände für den Einmarsch – man müsse die Ukraine vom »Faschismus« befreien und den »Völkermord« an der russisch sprechenden Bevölkerung verhindern – sind absurde Lügen. Das wahre Verbrechen der Ukraine bestand aus Sicht des Kreml darin, dass die Menschen ihre eigenen Entscheidungen treffen und nicht mehr unter der Knute Moskaus leben wollten. Der Auslöser für den israelischen Einmarsch im Gazastreifen war dagegen ein gesetzloser und brutaler Terrorangriff. In dieser Hinsicht könnten die beiden Fälle kaum unterschiedlicher sein.
In der Kriegsführung sind jedoch Parallelen erkennbar, auch wenn israelische Politiker solche Vergleiche erbost zurückweisen.
In Den Haag gibt es zwei Gerichte, die sich mit Kriegsverbrechen beschäftigen. Der Internationale Strafgerichtshof verfolgt Einzelpersonen, darunter auch Staatsoberhäupter und Regierungschefs. Der Internationale Gerichtshof, das Hauptrechtsprechungsorgan der Vereinten Nationen, spielt eine andere und ebenso wichtige Rolle: Er klagt die Verbrechen von Staaten an. Vier Monate vor dem Antrag auf Haftbefehl gegen Netanjahu und Galant vor dem Internationalen Strafgerichtshof saß ich im Friedenspalast von Den Haag, während der Vorsitzende des Internationalen Gerichtshofs das nahezu einstimmige Urteil der Richter verkündete, demzufolge eine »reale und dringliche Gefahr« eines Verstoßes gegen das Recht der Palästinenser zum Schutz vor Völkermord bestehe. Das Gericht warnte auch vor der Anstiftung zum Völkermord – ein wesentlicher Bestandteil der Konvention über die Verhütung und Bestrafung des Völkermordes.
Wie später vor dem Internationalen Strafgerichtshof schienen schon jetzt einige Regierungen die Lust zu verspüren, den Überbringer der schlechten Nachricht zu liquidieren. Der Internationale Gerichtshof wurde zusammen mit den Vereinten Nationen 1945 als »Weltgerichtshof« gegründet und genießt seither weltweit großes Ansehen. Putins Russland mag diesem Gericht mit Verachtung begegnen, doch demokratische Regierungen tun dies in der Regel nicht – 2024 änderte sich das. Westliche Regierungen kritisierten Südafrika, weil es Israel wegen Verstoßes gegen die Völkermordkonvention zur Anklage gebracht hatte, und warfen den Richtern (darunter der damaligen renommierten amerikanischen Vorsitzenden) ohne jeden Beweis Befangenheit vor.
Niemandem entging die grausame Ironie, dass das Land, dessen politische Führung nun einen Prozess wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit fürchten musste und das vom Internationalen Gerichtshof vor Völkermord gewarnt wurde, acht Jahrzehnte zuvor nicht zuletzt wegen des Mordes am eigenen Volk im Zuge der Schoah gegründet worden war. Diese Verbrechen ebneten über das Vorbild der Nürnberger Prozesse den Weg zur Gründung des Internationalen Strafgerichtshofs selbst. Die Führung Israels verhielt sich allerdings bisweilen so, als bedeuteten die Verbrechen des Holocaust, dass die Armee des Landes nie Gegenstand einer Strafverfolgung werden könne. Netanjahu sprach von »Blutverleumdung« bzw. »Ritualmordlegende«. Dem Strafverfolger Karim Khan warf er vor, »leichtfertig Öl ins Feuer des Antisemitismus zu gießen«, und verglich ihn mit den »infamen deutschen Richtern«, die sich mit ihren Entscheidungen zu Komplizen des Holocaust gemacht hatten. Khan sah dies anders und erklärte beim Antrag auf Haftbefehl: »Wenn wir nicht unsere Entschlossenheit unter Beweis stellen, gleiches Recht für alle zur Anwendung zu bringen, wenn wir das Recht selektiv anwenden, dann schaffen wir die Voraussetzung für sein Scheitern.«
Die Anklagen gegen Putin und Netanjahu – zwei Männer, die noch wenige Jahre zuvor eine Männerfreundschaft verband – sind Teil eines umfassenderen Wandels. Während weiter Teile des 20. Jahrhunderts blieben Kriegsverbrechen ungesühnt. Die Prozesse in Nürnberg und Tokio waren die Ausnahmen. Heute vernimmt man in aller Welt den Ruf »Schickt sie nach Den Haag!« von denjenigen, die überzeugt sind, dass auch die Mächtigen zur Rechenschaft gezogen werden müssen. In den letzten Jahren wurde aus dem Traum ein reales Ziel, und die Zahl der Verfahren nahm zu. Heute stehen nicht nur politische Führer vor Gericht, sondern auch Unternehmen sollen wegen ihrer Mittäterschaft bei menschenverachtenden Verbrechen zur Rechenschaft gezogen werden.
Im Jahr 1985 schrieb der Literaturnobelpreisträger Czesław Miłosz ein Vorwort zur Veröffentlichung der Briefe, die der polnische Oppositionelle Adam Michnik aus dem Gefängnis geschrieben hatte. Darin kritisierte Miłosz unsere Neigung, das Mögliche in die Vergangenheit zu verlegen, und diejenigen zu übersehen, die in der Gegenwart handeln, »der scheinbar unveränderlichen Ordnung trotzen« und »Dinge erreichen, die auf den ersten Blick unmöglich und undurchführbar erschienen«. Vier Jahre, nachdem Miłosz diese Worte geschrieben hatte, fiel die Berliner Mauer, und zwar auch deshalb, weil Menschen wie Michnik »der scheinbar unveränderlichen Ordnung« getrotzt hatten.
Auch Raphael Lemkin gehörte zu denen, die sich solchen vermeintlich unverrückbaren Ordnungen widersetzten. Er gab dem bis dahin namenlosen Verbrechen des Völkermordes gegen erheblichen Widerstand einen Namen und forderte eine internationale Konvention, die den Völkermord verhindern und bestrafen sollte. Als er 1959 starb, musste er annehmen, dass seine Arbeit vergeblich gewesen war. Doch im letzten Vierteljahrhundert haben nationale und internationale Gerichte zahlreiche Urteile gesprochen, sei es zu den Völkermorden von Ruanda und Bosnien oder zur Vergewaltigung und Ermordung Tausender irakischer und syrischer Jesiden durch den Islamischen Staat. Weitere Prozesse sind in Vorbereitung, nicht zuletzt dank der Entschlossenheit der Überlebenden dieser Verbrechen.
Trotz der Haftbefehle durch den Internationalen Strafgerichtshof ist nicht absehbar, dass Putin oder Netanjahu demnächst in Handschellen vorgeführt werden, aber immerhin sind ihre Reisemöglichkeiten eingeschränkt. Die Haftbefehle, die von Richtern drei Wochen beziehungsweise sechs Monate später bestätigt wurden, sind allerdings ein starkes Signal: Das Recht gilt für alle. Shakespeares Speer des Rechts muss nicht abbrechen, selbst nicht an der in Gold gehüllten Sünde. Dank der Errungenschaften der vergangenen Jahrzehnte haben wir heute Instrumente an der Hand, mit denen wir »nicht Rache üben, sondern [die] gefangenen Feinde freiwillig dem Richtspruch des Gesetzes übergeben«, wie Robert Jackson, der amerikanische Chefankläger des Nürnberger Prozesses gegen die Hauptkriegsverbrecher, es ausdrückte, um die Welt damit weniger gefährlich zu machen. Diese Werkzeuge dürfen wir nicht aus der Hand geben.
KAPITEL 1
»Das passt doch alles nicht zusammen«
Genf, Lwiw, Nürnberg, Paris (1863 – 1948)
Als Henry Dunant am Abend des 24. Juni 1859 im fünfzig Kilometer westlich von Verona gelegenen Castiglione eintraf, hatte er nicht die Absicht, die Welt zu verändern. Er wollte lediglich Napoleon III. um eine Audienz ersuchen. Dunant, ein 31-jähriger Geschäftsmann aus der Schweiz, war der Besitzer einiger Mühlen im französisch besetzten Algerien, die er aufgrund fehlender Wasserrechte nicht betreiben konnte. Da die Behörden in Paris jegliche Kooperation verweigerten, hatte Dunant beschlossen, ganz oben vorstellig zu werden.
Dunant war auf den Namen Henri getauft worden, hatte jedoch das i gegen ein y eingetauscht, um seinem Namen einen englischen Klang zu verleihen. Er hoffte, den französischen Kaiser in der Lombardei zu treffen, wo ein Bündnis aus französischen, piemontesischen und sardischen Streitkräften seit zwei Monaten gegen die Österreicher kämpfte. Als Türöffner hatte Dunant – der stets einen weißen Anzug trug und in Castiglione nur »der Herr in Weiß« genannt wurde – eine im Selbstverlag veröffentlichte Lobeshymne auf den Kaiser mit dem Titel L’Empire de Charlemagne rétabli dabei. Doch es kam alles ganz anders, als Dunant es sich erhofft hatte.
Am Tag seiner Ankunft trafen in der Schlacht von Solferino wenige Kilometer von Castiglione entfernt 300.000 Soldaten aufeinander. Nun lagen 30.000 Tote und Verwundete zwischen den Maulbeersträuchern. Dunant stolperte in das Nachspiel des Blutvergießens und war entsetzt. »In der Stille der Nacht hörte man Klagen, Angst- und Schmerzensschreie, herzzerreißende Hilferufe«, erinnerte er sich in Eine Erinnerung an Solferino. »Überall war das Schlachtfeld mit Menschen- und Pferdeleichen bedeckt; auf den Straßen, in den Gräben, Bächen, Gebüschen, auf den Wiesen, überall lagen Tote umher.« Der Gestank der Leichen erschütterte ihn genauso wie das Leid der Überlebenden. »Ihr Antlitz war von Mücken bedeckt, welche an ihren Wunden saugten; ihre Blicke schweiften nach allen Seiten umher, ohne eine Antwort zu erhalten; Mantel, Hemd, Fleisch und Blut bildeten bei ihnen eine schaudereregende Mischung, in welcher sich die Würmer eingefressen hatten.« Dunant sammelte eine Schar von Freiwilligen um sich, um die Verwundeten zu versorgen – unter seinen Helfern waren englische Touristen, ein französischer Journalist und der Schweizer Schokoladenfabrikant Philippe Suchard. Gemeinsam verbanden sie Wunden und schrieben Abschiedsbriefe der Sterbenden.
Zu der Audienz mit Napoleon III. kam es nicht; der Kaiser lehnte Dunants Wunsch ab, ihm sein Buch widmen zu dürfen; die Mühlen in Algerien gingen bankrott. Doch Dunant fand eine Lebensaufgabe und trug dazu bei, dass die Regeln aufgestellt wurden, die bis heute die Kriegsführung bestimmen und das Leben von Zivilisten in bewaffneten Konflikten schützen sollen. Dunant stellte eine Reihe internationaler Grundsätze auf und schlug die Gründung nationaler Hilfsorganisationen für die Versorgung der Verwundeten vor. Kaiser und Könige lobten ihn, und die Brüder Edmond und Jules de Goncourt hielten seine Beschreibung der Schlachtfelder von Solferino für »tausendmal besser als Homer«.
Im Jahr 1863 kamen Abgesandte aus sechzehn Nationen in Genf zu einer Konferenz zusammen, die unter anderem von Dunant und einem Schweizer Juristen namens Gustave Moynier einberufen worden war. Dort beschlossen sie die Gründung eines neutralen medizinischen Corps zur Versorgung von Verwundeten. Das Emblem, das Angehörige des Corps und ihre Ausrüstung auf dem Schlachtfeld kenntlich machen sollte, war eine umgekehrte Schweizer Flagge: statt eines weißen Kreuzes auf rotem Grund ein rotes Kreuz auf weißem Grund. Damit war die Organisation gegründet, die als Internationales Komitee vom Roten Kreuz bekannt werden sollte. Die erste Genfer Konvention wurde 1864 beschlossen. Im Jahr 1901 erhielt Dunant (sehr zu Moyniers Verdruss) als Erster den von Alfred Nobel gestifteten Friedenspreis. »Genfer Konvention« ist bis heute der weltweit anerkannte Begriff für die Bestimmungen zum Schutz von Verwundeten und Zivilisten im Krieg – weil Genf die Geburtsstadt jenes entschlossenen Unternehmers war, der durch das Leid in einer blutigen Schlacht zum Handeln veranlasst wurde, »wo jede menschliche Eigenliebe, wo jede menschliche Ehrfurcht geschwunden war«.
Der Gedanke, dass selbst in den blutigsten aller Konflikte gewisse Grundregeln eingehalten werden sollten, war allerdings nicht neu. Schon im antiken Griechenland gab es erste Überlegungen dazu, vor allem nach dem berüchtigten Massaker, das die Athener während des Peloponnesischen Krieges unter den männlichen Bewohnern der Insel Melos angerichtet hatten. Abu Bakr, der erste Kalif des Islam, forderte im siebten Jahrhundert die Befehlshaber seines Heeres auf: »Tötet weder ein Kind noch eine Frau noch einen alten Mann … Tötet nicht die Herden des Feindes, es sei denn zum eigenen Verzehr.« Christine de Pizan, Tochter eines Astrologen und Arztes aus Bologna, veröffentlichte 1410 ein Buch mit dem Titel Das Buch vom Fechten und von der Ritterschaft, mit Anweisungen zum Umgang mit Kriegsgefangenen und dem Schutz der Zivilbevölkerung: »Die am Gefecht Beteiligten können verwundet werden, doch die Geringen und Friedlichen sollen von ihrer Gewalt verschont bleiben.« Vor der Schlacht von Agincourt im Jahr 1415 verbot der englische König Heinrich V. seinen Soldaten, »ohne Anweisung des Königs Gebäude niederzubrennen« oder »Frauen und ihre Kinder zu gefährden«. Er verteilte schriftliche Anweisungen an seine Heerführer, damit diese »über klares Wissen verfügen und ihre Männer von genannten Anweisungen in Kenntnis setzen können«, damit »kein Untergebener Unwissenheit vorschützen kann«. Auf das, was dann wirklich in der Schlacht passierte, traf Shakespeares Beschreibung in Heinrich V. vom »Gewissen höllenweit« und »jähem Morde, Raub und Büberei« vermutlich besser zu. Dennoch gab es schon früh Versuche, die Verantwortlichen von Kriegsverbrechen zur Rechenschaft zu ziehen. So wurde zum Beispiel in einem Fall aus dem Jahr 1474, der später in den Nürnberger Prozessen zitiert werden sollte, in Breisach westlich von Freiburg ein gewisser Peter von Hagenbach von 28 Richtern verurteilt, weil er »das Recht Gottes und der Menschen mit Füßen getreten« habe. Von Hagenbach wurde zahlreicher Vergewaltigungen und Morde angeklagt, die seine Untergebenen begangen hatten; nach Ansicht der Richter wäre es seine Pflicht gewesen, diese Verbrechen zu verhindern.
Allmählich wurden die Gesetze schriftlich fixiert. Im Jahr 1625 veröffentlichte der niederländische Jurist Hugo Grotius, der als Vater des klassischen Völkerrechts bekannt werden sollte, ein Traktat mit dem Titel De Jure Belli ac Pacis (Über das Recht des Krieges und des Friedens), in dem er schrieb: »Sobald man zu den Waffen greift, sind menschliches und göttliches Gebot vergessen; es ist, als ob auf allgemeine Anweisung hin die Raserei entfesselt wurde, um alle Arten von Verbrechen zu begehen.« Das wollte Grotius ändern, und er stellte Regeln auf, die Plünderungen einschränken und die Behandlung von Kriegsgefangenen regeln sollten.
Auf dem Marktplatz seiner Geburtsstadt Delft steht heute ein Denkmal von Grotius. Zu Lebzeiten war der freidenkende Jurist den Behörden allerdings ein Dorn im Auge: Sie verurteilten ihn zu Hausarrest in einem Schloss, von wo er nur mithilfe seiner Frau und einer Hausangestellten und versteckt in einer Bücherkiste entkam. Sein Traktat wurde jedoch schnell bekannt. Während des Dreißigjährigen Krieges, der viele Millionen Todesopfer forderte, soll der schwedische König Gustav II. Adolph das Buch unter seinem Kopfkissen verwahrt haben; nach seinem Tod wurde in seinem Zelt ein Exemplar gefunden. Das war kein Theater: In einem für seine Grausamkeiten berüchtigten Krieg hielt der schwedische König seine Soldaten an, auf unnötige Gewalt zu verzichten. Auch lange nach Grotius’ Tod blieb sein Buch beliebt: Im Jahr 1715 wurde eine elegante, in Leder gebundene englische Übersetzung veröffentlicht (die ich kürzlich in einem Antiquariat zum bescheidenen Preis von 1000 Pfund gesehen habe), gewidmet »Seiner Königlichen Hoheit dem Prinzen von Wales«, dem künftigen König George II., der im Vorjahr gemeinsam mit seinem Vater aus Hannover nach England gekommen war. Doch trotz des Interesses an Grotius und seinem Werk sollten nach seinem Tod mehr als zwei Jahrhunderte vergehen, ehe man seine Forderung nach einem Kriegsrecht wirklich ernst nahm.
Im Jahr 1863, dem Jahr, in dem in Genf das Rote Kreuz ins Leben gerufen wurde, bat der amerikanische Präsident Abraham Lincoln den in Berlin geborenen Juraprofessor Francis Lieber, für den bereits heftig wütenden Amerikanischen Bürgerkrieg ein Regelwerk für die Truppen der Nordstaaten aufzustellen. Für Lieber war dies keineswegs eine theoretische Angelegenheit. Im Alter von sechzehn Jahren war er in der Schlacht von Waterloo schwer verwundet und als vermeintlich tot zurückgelassen worden. Sein Sohn Oscar, der aufseiten der Südstaaten kämpfte, war 1862 in der Schlacht von Williamsburg gefallen, und sein jüngerer Sohn Hamilton, der in der Armee der Nordstaaten diente, hatte einen Arm verloren. Liebers Instructions for the Government of Armies of the United States, in the Field, General Orders No. 100 oder Lieber Code, wie er nur genannt wurde, gewann schnell an Einfluss. In den Worten seines Verfassers war er »kurz und prägnant und gewichtig, wie eine kräftige deutsche Frau, die mit Zwillingen schwanger geht«. Er wurde in mehrere Sprachen übersetzt und unter anderem von Frankreich, Preußen und Großbritannien übernommen.
Dass Regeln der Kriegsführung nötig waren, erkannte man auch auf höchster Ebene. Im Jahr 1898 schlug der russische Zar Nikolaus II. eine Konferenz »im besten Interesse der Menschheit« vor, die den Einsatz gefährlicher neuer Waffen (»furchtbare Vernichtungsmaschinen«) regeln oder verbieten und die »Gesetze und Gebräuche des Landkrieges« festschreiben sollte. Der Zar sah in einer solchen Konferenz »ein glückliches Vorzeichen für das anbrechende neue Jahrhundert« und schlug vor, sie nicht in Sankt Petersburg, Berlin, Paris oder London abzuhalten, sondern in einer neutraleren Umgebung in den Niederlanden. So versammelten sich die befrackten Delegierten 1899 im Schloss Huis ten Bosch, der Sommerresidenz der niederländischen Königsfamilie in Den Haag. Am 4. Juli legte der amerikanische Botschafter Andrew White am Grab von Hugo Grotius im nahe gelegenen Delft einen Silberkranz nieder und äußerte den Wunsch, »den Frieden zu stärken und den Krieg menschlicher zu machen«. Der Kranz liegt bis heute in der Nieuwe Kerk von Delft. Der Botschafter pries die Rolle des Vordenkers: »Auf dem Gebiet des Völkerrechts sagte Grotius: ›Es werde Licht‹ – und es ward Licht.« Die Friedenskonferenz von Den Haag, ein Erbe Grotius’, sollte der Welt nach der Hoffnung des Botschafters »zumindest den Anfang eines wirkungsvollen und praktischen Schlichtungssystems« bringen.
Seitdem ist Den Haag ein Zentrum des Völkerrechts und bezeichnet sich selbst als »Stadt des Friedens und der Gerechtigkeit«. Auf Anregung des russischen Abgesandten der ersten Konferenz überzeugte White den amerikanischen Stahlmagnaten und Philanthropen Andrew Carnegie, einen Friedenstempel zu stiften, der 1913 als Sitz des Ständigen Schiedshofs eingeweiht wurde. Der Friedenspalast am Carnegieplein ist heute auch Sitz des Internationalen Gerichtshofs, der in den vergangenen Jahren unter anderem Urteile zum Krieg in der Ukraine und dem Gazastreifen gesprochen hat.
Von Anfang an gab es Versuche, die Vereinbarungen verbindlich zu machen. Schon 1872 schlug Gustave Moynier, inzwischen Präsident des Roten Kreuzes, eine Institution vor, die Verstöße gegen die acht Jahre zuvor unterzeichnete Genfer Konvention »verhindern und bestrafen« sollte. In der Folge des Deutsch-Französischen Krieges kam Moynier zu dem Schluss, »rein moralische Sanktionen« seien nicht ausreichend, um die »ungezügelten Leidenschaften des Schlachtfelds in Zaum zu halten«. Doch sein Vorschlag eines unabhängigen Gerichtshofs verlief im Sande. Damals wie heute waren Regierungen nur zu gern bereit, Abkommen zu unterzeichnen, doch bei ihrer Umsetzung waren sie weniger eifrig. Die Haager Landkriegsordnungen von 1899 und 1907 verboten unter anderem den Giftgaseinsatz sowie den Angriff auf zivile Gebäude. Doch die »wirkungsvolle und praktische« Durchsetzung, auf die US-Botschafter White gehofft hatte, blieb aus. Das wurde im Ersten Weltkrieg deutlich, der nur elf Monate nach der Einweihung des Friedenspalastes begann.
Nach 1918 wurden mehrere Versuche unternommen, die Lücke zwischen den hehren Idealen und der düsteren Wirklichkeit zu schließen, zu der auch der Einsatz von Giftgas während des Ersten Weltkriegs zählt. Wie von den Bestimmungen des Friedensvertrags von Versailles vorgesehen, fand in Leipzig ein Kriegsverbrecherprozess gegen deutsche Soldaten statt. Dieser Prozess zeichnete sich jedoch vor allem durch die verschwindend geringe Zahl der Verurteilungen aus: Von 1700 Angeklagten wurden lediglich einige wenige schuldig gesprochen.
Es gab auch Versuche, Kaiser Wilhelm II. zur Rechenschaft zu ziehen. Der Friedensvertrag warf ihm eine »schwere Verletzung des internationalen Sittengesetzes und der Heiligkeit der Verträge« vor und verlangte die Einrichtung eines Gerichtshofs mit Richtern aus den Vereinigten Staaten von Amerika, Großbritannien, Frankreich, Italien und Japan. Frankreich warf dem Kaiser vor, er habe »alle Grausamkeit, alles Unrecht und alle Schrecknisse … geduldet und in keiner Weise verhindert« – ein Prinzip, das als »Befehlshaberverantwortlichkeit« bezeichnet wurde und heute »Vorgesetztenverantwortlichkeit« heißt. In Großbritannien wurde der Ruf »Hang the Kaiser!« laut, und Premierminister David Lloyd George kündigte einen Prozess in London an. König George V. war erbost, dass sein Cousin, der älteste Enkel von Queen Victoria, der die Königin noch am Sterbebett besucht hatte, in der Nähe des Buckingham Palace vor Gericht gestellt werden könnte. Doch aus diesen Vorschlägen wurde ohnehin nichts. Eine andere Cousine des Kaisers, die niederländische Königin Wilhelmina, bot Wilhelm II. widerstrebend Asyl an, nachdem er zwölf Stunden lang auf dem Bahnsteig von Eijsden an der niederländisch-belgischen Grenze ausgeharrt hatte, während die Niederländer mit ihrer Entscheidung rangen. »Aber Sie erkennen mich doch bestimmt! Ich bin der deutsche Kaiser!«, soll er zum Grenzbeamten gesagt haben. Worauf dieser erwidert haben soll: »Ich sehe, dass Sie der Kaiser sind. Aber ich habe Anweisung, niemanden durchzulassen.«
Frankreich und seine Verbündeten verlangten die Auslieferung des Kaisers und führten »unanfechtbare Gründe« an, doch ohne Erfolg. Auch ein bizarrer Entführungsversuch schlug fehl. »Ich habe mir überlegt, nach Holland zu fahren und den Kaiser zu entführen«, sagte Luke Lea, Zeitungsherausgeber und ehemaliger US-Senator, an Weihnachten 1918 zu einem Freund. Doch die niederländische Polizei setzte dem Abenteuer ein Ende, und das Einzige, was die amerikanischen Besucher mitnahmen, war ein kaiserlicher Aschenbecher. Kaiser Wilhelm verbrachte seinen Lebensabend im Schlösschen Huis Doorn, dem Landhaus, in dem die adelige Mutter der Hollywoodschauspielerin Audrey Hepburn einen großen Teil ihrer Kindheit verbrachte. Er starb 1941, ein Jahr nach dem Einmarsch der Deutschen in den Niederlanden (Königin Wilhelmina war nach London geflüchtet). Ein Musikkorps der Wehrmacht spielte zur Beisetzung, und Hitler schickte einen riesigen Kranz. Wie der australische Jurist Geoffrey Robertson in seiner kontrafaktischen Geschichte The Trial of Vladimir Putin schreibt: »Es bleibt eine der spannendsten Fragen der Geschichte, ob sich Hitler hätte aufhalten lassen, wenn dem Kaiser der Prozess gemacht worden wäre.«
Auch andere Versuche, Kriegsverbrecher vor Gericht zu stellen, scheiterten. Westliche Zeitungen berichteten ausführlich über die Massaker, die Türken während des Ersten Weltkriegs unter Armeniern anrichteten. Im Jahr 1915 sprach die New York Times von Hunderttausenden Opfern und verlieh der Vermutung Ausdruck, die Behörden des Osmanischen Reichs betrieben »nicht weniger als die Auslöschung eines ganzen Volkes« – ein Vorwurf, der in den kommenden Jahren immer lauter werden sollte. US-Botschafter Henry Morgenthau legte beim türkischen Großwesir Mehmet Talât Protest ein. Talât erwiderte: »Warum interessieren Sie sich denn überhaupt so für die Armenier? Sie sind Jude, diese Leute sind Christen … Warum lassen Sie uns mit diesen Christen nicht so verfahren, wie wir es für richtig halten?«
Großbritannien, Frankreich und Russland verurteilten die Morde. Im Entwurf einer Protestnote warfen sie den Osmanischen Streitkräften »Verbrechen gegen die Christenheit und die Zivilisation« vor. Nach einigen Diskussionen wurden aus »Verbrechen gegen die Christenheit« schließlich »Verbrechen gegen die Menschlichkeit«, und damit war ein juristischer Tatbestand geboren. Im Jahr 1919 fanden in Konstantinopel eine Reihe von Militärprozessen wegen »Verbrechen gewaltigen Ausmaßes« statt, darunter Deportationen und Massaker. Doch auch diese Prozesse endeten in einer Farce, wie Diplomaten schrieben. Keiner der Verantwortlichen für die Massenmorde an den Armeniern wurde verurteilt. Die Prozesse von Konstantinopel waren »ein gescheitertes Nürnberg«, so der Historiker Gary Bass.
Die Lektion aus diesen fehlgeschlagenen Versuchen war klar: Trotz aller Konventionen und Regeln, die im zurückliegenden halben Jahrhundert unterzeichnet worden waren, blieb die Straflosigkeit Teil des Systems.
Das wusste auch Hitler. Vor dem Überfall auf Polen am 1. September 1939 forderte er die Generäle in einer Geheimrede auf, alle Regeln zu ignorieren, weil dies keine Konsequenzen haben werde. »Wer spricht heute noch von der Vernichtung der Armenier?«, soll er gefragt haben. Unaussprechliche Verbrechen waren nach 1918 schnell in Vergessenheit geraten. Dieses Muster ließ sich offenbar wiederholen. Hitlers kaltblütige Logik – Wenn die damit durchgekommen sind, warum dann nicht auch ich? – ist bis heute von überheblichen Kriegsverbrechern in Konfliktgebieten in aller Welt zu hören.
Doch was immer Hitler geglaubt haben mochte, das Schicksal der Armenier war nicht ganz vergessen. Ein polnischer Rechtsanwalt aus Lwów beschäftigte sich viele Jahre lang mit der Frage, warum diese Morde nicht gesühnt worden waren und wie man Verbrechen dieser Art der Bestrafung zuführen könnte. Mit seiner hartnäckigen Entschlossenheit zeigte Raphael Lemkin neue Möglichkeiten der Bestrafung auf, die jedoch erst lange nach seinem Tod verwirklicht werden sollten.
Lemkins Interesse an dem, was mit den Armeniern geschah, aber vor allem sein Interesse an dem, was nicht mit denjenigen geschah, die für die Planung und Durchführung des Massenmordes verantwortlich waren, ging auf das Jahr 1921 zurück. In der Zeitung las er Berichte über den Prozess gegen Soghomon Tehlirian, der Mehmet Talât, auch bekannt als Talât Pascha, in der Nähe seiner Wohnung im Berliner Stadtteil Charlottenburg erschossen hatte. Der Mord war die Vergeltung für Talâts Rolle als Drahtzieher des Massakers an den Armeniern. Tehlirian hatte Dutzende Angehörige verloren. »Ich habe nur dafür gelebt, den Tod nicht nur meiner Mutter und meines Vaters zu rächen, sondern auch die Verfolgung und das Blutvergießen des armenischen Volkes«, wie er dem Gericht sagte. Die Geschworenen sprachen den Angeklagten wegen »zeitweiliger Unzurechnungsfähigkeit« frei und schlossen sich damit seiner Verteidigung an: »Ich habe einen Mann getötet. Aber ich bin kein Mörder.«
Lemkin, der damals in Lwów studierte, stolperte über den scheinbaren Widerspruch: Wieso war es ein Verbrechen, einen einzelnen Menschen zu töten, »nicht aber für seinen Unterdrücker, mehr als eine Million Menschen zu töten«? Oder wie es Kurt Tucholsky in seinem Artikel »Französischer Witz« auf den Punkt brachte: »Der Tod eines Menschen: das ist eine Katastrophe. Hunderttausend Tote: das ist eine Statistik!« Ein Juraprofessor erklärte Lemkin, aufgrund der staatlichen Souveränität – des Westfälischen Systems, wie es nach dem Friedensschluss des Dreißigjährigen Krieges genannt wurde – könnten Machthaber innerhalb ihrer Landesgrenzen nach Gutdünken schalten und walten. Der Professor verglich das Schicksal der Armenier mit Hühnern, die von einem Bauern geschlachtet werden: »Er tötet sie. Warum nicht? Das geht Sie nichts an. Wenn Sie sich einmischen, begehen Sie Hausfriedensbruch.« Für Lemkin war diese Unterscheidung zwischen einer strafbaren Einzeltat und einem nicht zu bestrafenden Massenmord vollkommen inakzeptabel. Oder, wie er es ausdrückte: »Das passt doch alles nicht zusammen.« Souveränität sei schließlich »nicht gleichzusetzen mit dem Recht, Millionen unschuldiger Menschen zu töten«.
Dieses Gefühl der Widersprüchlichkeit war für Lemkin in den kommenden Jahren ein wichtiger Antrieb. Der Aufstieg des Faschismus in Europa machte sein Anliegen umso dringlicher. Neun Monate nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten im Jahr 1933 bereitete Lemkin, inzwischen stellvertretender Staatsanwalt an einem Bezirksgericht in Warschau, Vorschläge für eine Völkerrechtskonferenz in Madrid vor, die zwei neue internationale Straftatbestände vorsahen: den Akt der Barbarei und den Akt des Vandalismus. Unter einem Akt der Barbarei verstand Lemkin die »Ausrottung ethnischer, nationaler, konfessioneller, sozialer Menschheitsgruppen« und unter dem Akt des Vandalismus »die planmäßige Zerstörung von Werken, in denen sich die geistige Leistungsfähigkeit der Gemeinschaft auf dem Gebiete der Wissenschaft, Kunst oder Literatur offenbart«.
In Moskau stießen Lemkins Gedanken nicht auf Gegenliebe. Stalins späterer Generalstaatsanwalt Andrei Wyschinski beschrieb Lemkin als kriminellen Interventionisten und Vertreter der »konterrevolutionären Bourgeoisie«, weil er verlangte, die Welt dürfe nicht tatenlos zusehen, wenn ein Land Verbrechen an seinen Bürgern begehe. Angesichts seiner eigenen Vergehen musste der Kreml Lemkins Denken natürlich ablehnen: In demselben Jahr, in dem die Konferenz in Madrid stattfand, starben Millionen Ukrainer in einer vom Staat herbeigeführten Hungersnot, die als Holodomor bekannt wurde – »Tod durch Hunger«. Als der Schriftsteller Michail Scholochow seine Sorge über den massenhaften Hungertod ausdrückte, schrieb ihm Stalin: »Diese Menschen haben gezielt versucht, den Sowjetstaat zu sabotieren. Es ist ein Kampf auf Leben und Tod!« In ihrem Buch Roter Hunger zitiert die Historikerin Anne Applebaum die Beschreibung eines Überlebenden der Zeit: »In jenem Frühjahr roch die Luft überall nach verwesenden Leichen. Der Wind trug diesen Geruch über die ganze Ukraine.« In einer Rede zum 20. Jahrestag des Holodomor beschrieb Lemkin das Vorgehen Moskaus gegen die Ukraine als »vielleicht das klassische Beispiel des sowjetischen Völkermords … die Zerstörung der ukrainischen Nation«.
Doch 1933 galt Lemkins größte Sorge dem Aufkommen des Faschismus in Europa. Wie er später schrieb: »Hitler hatte den Vernichtungsplan verkündet … Die Welt verhielt sich so, als werde sie sein Vorhaben stillschweigend billigen.« Sechs Jahre nach der Konferenz von Madrid setzte Hitler seine tödlichen Pläne in die Tat um. Als die Wehrmacht Polen überfiel, floh Lemkin aus Warschau. Auf dem Weg zum Bahnhof brannten die Häuser »wie Fackeln«. In einer Beschreibung, die wir von den Nachrichten aus Lwiw und anderen ukrainischen Städten acht Jahrzehnte später wiedererkennen würden, traf er am Bahnhof auf »ein Meer von menschlichen Köpfen – es war unmöglich, die Leiber zu sehen, so eng drängten sie sich aneinander«. Lemkin wurde schließlich »von der Menge fortgetragen« und »fiel wie ein Sack mitten zwischen die anderen Fahrgäste«. Auf der Fahrt wurde der Zug bombardiert. Einige Wochen später kam er bei seiner Familie im Osten Polens an. Seine Eltern drängten ihn, weiterzufliehen, während sie zurückblieben. »Es war, als würde ich ihrem Begräbnis beiwohnen, während sie noch am Leben waren«, schrieb er.
Lemkin flüchtete nach Litauen und von dort aus weiter nach Schweden. Als er 1941 eine Einladung der Duke University in North Carolina erhielt, reiste er mit Bahn und Schiff über Moskau, Wladiwostok, Yokohama und Vancouver in die Vereinigten Staaten. Seine Mutter schrieb ihm: »Wir sind alle gesund und haben, was wir zum Leben brauchen. Mach dir keine Sorgen um uns!« Kurz darauf brannten die Deutschen das Haus seiner Familie nieder, beide Eltern wurden im Vernichtungslager Treblinka ermordet.
Auch wenn Lemkin noch nichts vom Schicksal seiner Eltern ahnte, wusste er besser als kaum jemand sonst vom Ausmaß der bevorstehenden Apokalypse. Während seiner Zeit in Stockholm hatte er Dekrete aus dem von den Nationalsozialisten besetzten Europa gesammelt und sie in die Vereinigten Staaten mitgebracht. Für diejenigen, die sich dafür interessierten, gab es keinen Mangel an Information. Im Jahr 1942 setzte der polnische Diplomat Jan Karski sein Leben aufs Spiel, als er sich in das Warschauer Ghetto und in ein Durchgangslager in der Nähe des Vernichtungslagers Bełżec hinein- und wieder hinausschmuggeln ließ (»Es war, als würde ich mir einen Weg durch eine Masse des Todes und der Verwesung bahnen«), um den Politikern in London und Washington aus erster Hand Beweise des Holocaust vorlegen zu können. Aber niemand schenkte ihm Beachtung. »Vielleicht haben sie mir nicht geglaubt«, mutmaßte er später. »Vielleicht haben sie gedacht, dass ich übertreibe.« Auch Lemkin fiel es schwer, Menschen zu finden, die sich für die Verbrechen der Nationalsozialisten interessierten. Das Thema »schien zu theoretisch und sogar fantastisch«, meinte er später. »Das Schweigen begann Ende 1942, als die ersten Berichte von Massenhinrichtungen aus Warschau nach London gelangten [also nach Karskis gefährlicher Mission]. Es endete erst im Dezember 1944, nach fast zwei Jahren.«
Rein theoretisch waren sich die Politiker einig, dass die Verbrechen ohne jedes Beispiel waren. Angesichts des »systematischen, erbarmungslosen Schlachtens« kam Winston Churchill schon 1941 zu dem Schluss: »Wir sehen uns einem namenlosen Verbrechen gegenüber.« (In der Praxis hatten die Alliierten allerdings andere Prioritäten. Obwohl US-Flugzeuge schon 1944 Industrieanlagen in der Nähe von Auschwitz bombardierten, weigerten sie sich trotz der dringlichen Bitten jüdischer und anderer Organisationen, die Bahnlinie nach Auschwitz oder die Gaskammern des Vernichtungslagers zu zerstören, weil sie sich auf »entscheidende Operationen an anderen Orten« konzentrieren müssten.)
Lemkin gab dem unvorstellbaren Verbrechen einen Namen. 1944 veröffentlichte die Stiftung Carnegie Endowment for International Peace die vielen hundert Dekrete der Nationalsozialisten und die übrigen Dokumente, die er gesammelt hatte, zusammen mit seiner Auswertung und seinen Empfehlungen, unter dem Titel Axis Rule in Occupied Europe. Lemkin tat alles, um dem Buch zur Verbreitung zu verhelfen: Das Exemplar, das ich mir aus der London Library ausgeliehen habe, gehörte ursprünglich der US-Botschaft am Grosvenor Square und trägt die Inschrift »Mit Empfehlungen des Autors«.
Das Herzstück des 670-seitigen Buches ist das neunte Kapitel, das den Begriff des Völkermords einführt und definiert. Lemkin hielt fest, dass es bereits Begriffe wie Tyrannenmord oder Kindesmord gebe, und schlug das neue Wort Völkermord vor. Ausgehend von seinen Vorschlägen für die inzwischen elf Jahre zurückliegende Konferenz in Madrid definierte er den Völkermord als »koordinierten Plan aus verschiedenen Aktionen, die auf die Zerstörung wesentlicher Lebensgrundlagen nationaler Gruppen abzielen, mit dem Ziel, diese Gruppen zu vernichten«.





























