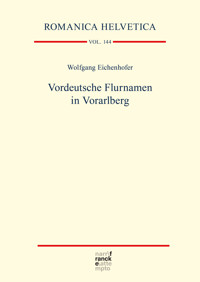
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Narr Francke Attempto Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Romanica Helvetica
- Sprache: Deutsch
Die vorliegende Publikation handelt die vordeutschen Flurnamen Vorarlbergs ab. Der erste Teil des Namenbuchs ist nach Etyma geordnet und dokumentiert ca. 3.200 etymologisch geklärte, der zweite ca. 270 alphabetisch geordnete, etymologisch fragliche Namen. Walserwörter romanischen Ursprungs sind ebenso berücksichtigt wie Ortsnamen oft vorromanischer Herkunft. Das Werk soll zur Kenntnis von Lautung und Lexikon des erloschenen Vorarlberger Romanischen beitragen und eine weitere Aufarbeitung der internen Sprachgeschichte des modernen Bündnerromanischen erleichtern.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 397
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
ROMANICA HELVETICA
EDITA AUSPICIIS COLLEGII ROMANICI HELVETIORUMA CURATORIBUS «VOCIS ROMANICAE»
VOL. 144
Wolfgang Eichenhofer
Vordeutsche Flurnamen in Vorarlberg
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar.
Publiziert mit Unterstützung des Vorarlberger Landesmuseumsvereins, Bregenz
DOI: https://doi.org/10.24053/9783381112425
© 2023 · Narr Francke Attempto Verlag GmbH + Co. KG
Dischingerweg 5 · D-72070 Tübingen
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Alle Informationen in diesem Buch wurden mit großer Sorgfalt erstellt. Fehler können dennoch nicht völlig ausgeschlossen werden. Weder Verlag noch Autor:innen oder Herausgeber:innen übernehmen deshalb eine Gewährleistung für die Korrektheit des Inhaltes und haften nicht für fehlerhafte Angaben und deren Folgen. Diese Publikation enthält gegebenenfalls Links zu externen Inhalten Dritter, auf die weder Verlag noch Autor:innen oder Herausgeber:innen Einfluss haben. Für die Inhalte der verlinkten Seiten sind stets die jeweiligen Anbieter oder Betreibenden der Seiten verantwortlich.
Internet: www.narr.de
eMail: [email protected]
Satz: Eichenhofer, Berlin
ISSN 0080-3871
ISBN 978-3-381-11241-8 (Print)
ISBN 978-3-381-11242-5 (ePDF)
ISBN 978-3-381-11243-2 (ePub)
Inhalt
Vorwort
Struktur des Namenbuchs
Abkürzungen
Lautzeichen
Bibliographie
Grundsätzliches zur Namenforschung
Namenbuch
I.Etymologisch geklärte Namen
II.Etymologisch fragliche Namen
III. Lauthistorischer Abriss
Indizes
IV. Index der Namen (Teil I., II.)
V. Index der Etyma in Teil II
VI. Inverser Index der Etyma (Teil I., II.)
Im Material angeführte Gemeinden Vorarlbergs
Die Lagen der Gemeinden Vorarlbergs auf dem Plan
Plan Vorarlbergs
Vorwort
Das heutige Bundesland Vorarlberg kann auf eine interessante Sprachgeschichte zurückblicken. Als Teil der Raetia Prima, die sich ab Ende des 3. Jhs. in einem Gebiet erstreckte, welches das heutige Graubünden, die linksrheinische Gegend zwischen Walen- und Bodensee, das rechtsrheinische Liechtenstein und Vorarlberg umfasst, weist die Region außer vorrömischen Formen auch Wortgut der regionalen Variante des ehemaligen Volkslateins auf, die wir heute „Rätoromanisch” nennen. Dieses Idiom war ab dem 6. Jh. in Vorarlberg Gebrauchssprache (VNB 1/5, 7) und erlosch in Etappen zwischen dem 14. und 17. Jh. (op. cit. 1/5, 8f und op. cit. 1/2, 27). Es hielt sich am längsten im Walgau und im Montafon.
Zeugen dieser sprachlichen Situation sind bis heute geläufige Orts- und Flurnamen, die uns Auskunft geben können über lautliche, morphologische, semantische und syntaktische Verhältnisse des damaligen Romanischen in Vorarlberg. Eine Beschreibung dessen lautlicher Gestalt im Besonderen trägt bei zur Kenntnis der Geschichte des modernen Rätoromanischen in Graubünden.
Die rätoromanische Sprachwissenschaft erkundet nach wie vor eine Entwicklungsstufe, die gemeinhin „Alträtoromanisch” genannt wird und uns bis heute Rätsel aufgibt. Dieses Idiom mag ungefähr zwischen dem 6. und dem 14. Jh. in Gebrauch gewesen sein, eine Epoche, in der es für das Rätoromanische so gut wie keine literarischen Belege gibt. Auch Vorarlberg ist dabei eine der zu untersuchenden Regionen, deren romanische Namen zur Kenntnis dieses alten Idioms beitragen können. Weitere Regionen sind die Kantone Uri, Schwyz, Glarus, der südöstliche Teil des Kantons St. Gallen, selbstverständlich die germanisierten Regionen Graubündens und Liechtenstein, außerdem besonders der Westen Tirols und der Vintschgau. Der Autor dieser Zeilen hat in einem Artikel aus dem Jahre 2019 („Romania submersa zwischen Schwyz und Zams” in VRom. 78, 89-124) versucht, gewisse lautliche Charakteristika des „Alträtoromanischen” aufzuzeigen.
Vorarlberg ist aber auch geprägt von germanischem Namengut, das gebietsweise die romanischen Namen überdeckte und auslöschte. Seit dem 3. oder 4. Jh. dringen Alemannen besonders ins Unterland vor. Ab ca. 1300 gelangen nach Vorarlberg die Walser, ein aus dem Oberwallis eingewanderter Volkstamm, dessen Idiom man „Höchstalemannisch” nennt (VNB 1/6, 10). Sie siedelten vor allem in höheren Lagen, auch an eher schattigen Orten, während die Romanen lichte und baumlose Zonen kultivierten (VNB 1/8, 12); zum Teil aus dem Frankoprovenzalischen stammende Wörter und phonetische Eigenheiten des Walserdeutschen bereichern das Lexikon des Alemannischen in Vorarlberg; sie erweitern auch die Kenntnisse über die Migration dieses Volksstammes. Der Namenschatz des Landes Vorarlberg setzt sich also aus (vor)romanischen, alemannischen und walserdeutschen Komponenten zusammen.
Interessant zu beobachten ist, dass die Alemannen gewisse romanische Namen sehr früh übernommen haben: So ist der Name Montikel als Siedlungsplatz der ab dem 3. Jh. eingewanderten Alemannen nachgewiesen (VNB 1/3, 17), was die Lautgestalt des Namens erklärt: Zu jener Zeit war lateinisch MONTĪCULU„kleiner Berg” noch nicht bei der romanischen Stufe *[mun'tiʎ] angelangt, eine Stufe, die aber Formen wie Muntiel oder Mundiel in St. Gallenkirch erklärt. Auch Formen wie Khobel in Warth oder Kobel in Götzis, die auf lat. *CŬBULU „Lagerstätte des Viehs” beruhen, sind aus dem lat. Wort übernommen worden, bevor aus lat. [k-] durch die ahdt. Lautverschiebung dt. [x-] entstand und bevor *CŬBULU auf Romanisch ['kʊvɐl] lautete. Dieses ['kʊvɐl] aber wurde später ins Alem. übernommen und lautet Gufel.
In verschiedenen Bänden des VNB 1 wurde das Postulat formuliert, die dort publizierten Namen lexikalisch zu ordnen, um daraus auch ein Bild des erloschenen Rätoromanischen in Vorarlberg zu entwerfen (VNB 1/1, 9 und 18, op. cit. 1/4, 6, op. cit. 1/7, 6).
Die vorliegende Arbeit kann sich nur auf die Darstellung des (vor)romanischen Materials der Vorarlberger Namenlandschaft beschränken. Das neunbändige VNB 1 weist total über 38.000 moderne Nameneinträge auf, dazu kommen ca. 45.000 historische Belege (VNB 1/6, 7), wovon die meisten germanischer oder alemannischer Herkunft sind.
Hier werden ca. 3.200 etymologisch geklärte und 270 etymologisch fragliche Namen abgehandelt; in Teil IV., dem Register mit den Orts- und Flurnamen und den Verweisen auf deren Etyma sind weitere 70 nicht zu klärende Namenformen vermerkt.
Die etymologisch geklärten Namen (Teil I.) werden in gut 540 Artikeln mit (vor)romanischem Lemma abgehandelt; bei jedem Lemma stehen im Durchschnitt 1,6 Zusammensetzungen damit oder Ableitungen davon.
Teil II. des Namenbuchs mit etymologisch fraglichen Fällen enthält weitere 100 etymologische Vorschläge.
Teil VI., der inverse Index der Etyma zu den Teilen I. und II. umfasst daher gut 1.500 Einträge. Er gibt Antwort auf die Frage, welche Grundwörter vor einem Bestimmungswort wie zum Beispiel BĔLLU stehen:
bĕllu
*freš- bĕllu
plānu bĕllu
cămpu bĕllu
prātu bĕllu
…
An dieser Stelle sei verschiedenen Personen und Institutionen gedankt:
Herr Prof. em. Dr. Guntram A. Plangg in Rum bei Innsbruck sandte mir verschiedene seiner neuesten Monographien oder Separata von Artikeln über Vorarlberger Namen zu, die in Deutschland nur schwer zu bekommen sind: Darunter seine Abhandlungen über Namenprobleme zwischen Dawenna und Arlberg, Augmentativa im alemannisch-rätischen Raum, Alte Montafoner Flurnamen (3) sowie Beiträge, welche zusammen mit Werner Vogt entstanden: Deutungen von Flurnamen im Walgau und Flurnamen von Innerbraz im Klostertal (Teil 1). Es handelt sich um Werke, die dieser Monographie eine wertvolle Stütze sind.
Die Präsidentin des Vorarlberger Landesmuseumsvereins in Bregenz, Frau Dr. Brigitte Truschnegg unterbreitete den vorliegenden Text einer Expertenkommission, die sich nach Prüfung desselben für die finanzielle Unterstützung der Publikation dieser Arbeit aussprach.
Frau Kathrin Heyng vom A. Francke Verlag in Tübingen vermittelte die Aufnahme dieser Abhandlung in die Reihe „Romanica Helvetica”.
Auch deren Kuratorium unter dem Vorsitz von Frau Prof. Dr. Rita Franceschini, welches Expertisen der Materialien unternahm, sei an dieser Stelle gedankt.
Schließlich bedanke ich mich beim Francke Verlag, der meine nunmehr dritte dort erschienene Monographie mit der gewohnten Sorgfalt produzierte, bewarb und nun der Öffentlichkeit darbietet.
Berlin-Charlottenburg, im Juli 2023
Wolfgang Eichenhofer
Struktur des Namenbuchs
Allgemeines:
Angaben zu Jahrhunderten stehen generell als αVIII (= 8. Jh.), Angaben zu Jahrgängen als α1423 (= anno 1423). Graphien in Besprechungen sind mittels <> markiert.
Phonetische Formen werden mit dem Internationalen Phonetischen Alphabet (IPA) wiedergegeben und in eckigen [Klammern] dargestellt. Das IPA ist die moderne und für das Dt., Alem. wie Rätorom. verbindliche und einheitliche phonetische Umschrift. Von verwirrenden Mischungen wie dt. rǫʃs „Ross” vs. rom. rǫsɐ „Hanfröste” in WNB 7, 470f, die sich einerseits nach dem Sprachatlas der deutschen Schweiz, anderseits nach dem DRG oder HWR richten, wurde abgesehen: Die genannten Formen gibt man im IPA durch [rɔs] bzw. ['rɔsɐ] wieder.
Vor der Silbe mit dem Hauptakzent steht ein „ ' ”. Angaben wie ['--ɐrɐ], ['--ɐnɐ] meinen daktylische Hebung-Senkung-Senkung in Formen wie Fénkera, Hánfera, alem. Kríessera für den ON Kriessern, Frátterna, Krénana usf. Phonetische Angaben bei einzelnen modernen Flurnamen sollen die erwogene Etymologie stützen: Cf. aquāle (…) + -āceu: (…) Valatschisa ['-la-] in Bartholomäberg, eine Form, die als Valátschisa, nicht als *Valatschísa gelesen werden soll.
Teil I.:
Das Namenmaterial in diesem Teil ist grundsätzlich nach dem Bestimmungswort (Determinans) geordnet: Lat. prātu + bĕllu hat als Grundwort (Determinatum) PRĀTU und als Bestimmungswort BĔLLU. Dessen Reflexe werden bei BĔLLU abgehandelt, weil der Hauptakzent in dieser lat. Kombination aufBĔLLU liegt, cf. Barbíel; fehlt ein Bestimmungswort, wird das Material unter dem Grundwort abgehandelt: Cf. *freš- (vorrom.) „steile Grashalde” mit Freschi, Fresch als Reflexen.
Es sei vermerkt, dass dem lat. PRĀTU BĔLLU das dt. Schön-Wies entspricht: Im Dt. steht – anders als im Romanischen – das Bestimmungswort an erster, das Grundwort an zweiter Stelle.
Die Etymologien der Namen werden alphabetisch nach den (vor)lat. Lemmata geordnet. Bei den lat. Etyma, welche die jeweiligen Artikel einleiten, wird die Länge oder Kürze des Tonvokals angegeben, cf. aquāle, bĕllu, hĕrba; Diphthonge stehen ohne solche Angabe (*alausa); komponierte Suffixe wie -ētĕllu haben zwei Längenangaben, denn sie sind als -ĒTU + -ĔLLU zu lesen; in unbetonten Suffixen wie -ulu oder -ere werden keine Angaben zu Quantitäten gemacht. Die lateinischen Etyma stehen im Obliquus (Akkusativ), wobei dessen klass.-lat. auslautendes -M weggelassen wird; man findet also plānu, nicht PLĀNUM. Bei vorrom. Etyma wird normalerweise deren Idiom angegeben, cf. *albanti (kelt.). Alle auf vorrom. Formen zurückgehende Orts- und Gewässernamen in unserem Gebiet sind soweit möglich nach Anreiter 2009 und 2012 etymologisiert.
Die Liste der Lemmata in Teil I. ist als (vor)lateinisch-deutsches Wörterbuch anzusehen. An anderen Stellen des Texts wird in der Regel nicht auf Bedeutungen der Lemmata eingegangen:
– hĕrba „Gras” (surs., surm. jarva, erva) ălbu.
– Aber: ălbu „weiß” mit der Zus.: hĕrba ~a:Mirfalva (…) Gasch.
Lat. Präpositionen stehen nie als Bestimmungswörter; sie sind daher mit Verweisen auf die Lemmata, bei denen sie auftreten, alphabetisch in die Liste der Etyma integriert:
– ĭnter „zwischen” (cf. surs. denter, engad. tanter) vĭa.
– trāns „durch” (surs., surm. tras) ăqua.
Personen- oder Familiennamen sind hier nur dann berücksichtigt, wenn sie eine Verbindung mit einem rom. Lexem eingegangen sind; in diesem Fall tritt der Name auch als Lemma auf:
– Nigg FamN (…) – Zus.: (…) prātu ~:Barnigga Nenz.
Aufbau der Wortartikel:
– Nach dem Etymon steht normalerweise dessen Bedeutung: *albanti (kelt.) „Weißenbach”, aquāle „Wassergraben”.
– Es folgen die Reflexe aus den Simplizia, allenfalls Zusammensetzungen mit bzw. Ableitungen von dem Lemma und deren Reflexe:
aquāle „Wassergraben”
Gweil α1423 gwayl St. Gall. (…)
Zus.: ĭntu + ĭnter ~s: αXV Tanterwals, Nr. 609 Frast. (…)
Abl.: ~ + -āceu:Awalatsch Gasch. (…)
– Zuweilen stehen Verweise auf Formen, in Verbindung mit denen das Lemma ebenfalls auftritt. Diese Verweise geben Antwort auf die Frage, vor welchen Bestimmungswörtern in unserem Material das Lemma als Grundwort vorkommt:
Zu aquāle cf. flĕxu, frĭgidu, …
– Sporadisch werden Reflexe mittels „a)” und „b)” gruppiert: Bei a) stehen dabei die aus dem Romanischen übernommenen Formen, bei b) Namen, die zwar ebenfalls aus dem (Vor)romanischen stammen, jedoch meist vor dem 12. Jh., also noch in ahdt. Zeit übernommen wurden und daher den rom. Akzent auf die Anfangssilbe verlegt haben oder andere lautliche Eigenheiten aufweisen; cf. *brigántion > Brégenz, cŭbulu > *cúbul > Khóbel, drausa > *drosa > Drúosa, jedoch rom. *briánz, cúvel, dros mit alem. Briénz, Gúfel, Tros als Reflexen.
– Zu 920 Etymologien, knapp zwei Drittel der Fälle, folgen Verweise auf parallele Formen in RN oder LNB, gegebenenfalls auf rom. Appellative in HWR oder DRG:
aquāle „Wassergraben” – Gweil (…) – RN 2, 20 Ual Rueun (…)
*brĕnta „Bodennebel” – Brenta (…) Schl. – HWR 121f brenta (Appell.).
– Formen aus dem RN 2 usf. stehen in Klammern, wenn sie nicht genaue Entsprechung des Voralberger Namens sind, aber als Vergleich dienen können:
bŏnu „gut” (…) alp- ~a:Valbona (…) Bürs. – (RN 2, 46 Val beuna Bon.).
– Die Abfolge der zitierten Vorarlberger Gemeindenamen richtet sich nach dem Prinzip „Süd vor Nord, Ost vor West”, weil das Bundesland mit Ausnahme der Gemeinden des Lech- und des Kleinwalsertals hydrologisch zum Einzugsgebiet des Rheins gehört, d. h. alles Wasser fließt gen Westen ab; aus diesem Grund wird das Montafon vor der Gegend um Bludenz/Klösterle, dieses vor dem Lechtal, dieses vor dem Walgau, dieser vor Großwalsertal, Hinterem und Vorderem Bregenzerwald, diese vor dem Südteil und dem Nordteil des Unterlands behandelt:
drausa (…) Drosa Gasch., Drös, Drosa, Drosas St. Gall., Trostberg Silb., Drosa, I da Drosa Vand., Trös(böda) Dal., Drös Bürserbg., Nenz., Trös Blons, Drossa Sonn., Drös Schopp., Bezau, Drös Au, Mellau, Bizau (…)
Teil II.:
– In diesem Teil nach „” stehende Etyma sind in Teil I. zu finden: Cf. s.v. Frausatobel: „(…) zur Entwicklung von lat. -STJ- cf. Formen wie Bischa bei BĔSTIA”.
– Auch hier sind die einzelnen Namenformen nach dem Prinzip der Lage der Gemeinde („Süd vor Nord, Ost vor West”) geordnet und durch „ , ” voneinander abgesetzt; nach „ ” folgt deren Besprechung. Die alphabetisch geordneten Lemmata sind halbfett gesetzt:
Verbrüel „Wiese” α1450 fabrüll, (BLK) Verbrüel IBraz., α1497 Wiß in Gurtschabrül, Nr. 107 Schl., α1514 Daflatabrül, Nr. 51 Blons Verbrüel fällt relativ steil (…).
– Auf die anderen hier erwähnten Namen wird in einem integrierten Apparat verwiesen:
Gurtschabrül Daflatabrül
Verbrüel Daflatabrül
Abkürzungen
* vor erschlossener Form
Lautzeichen
– Lateinisch:
– ā, Ā, ē, Ī, ō und ū sind lange, ă, Ă, ĕ, ĭ, ŏ und ŭ kurze Vokale; sie bezeichnen hier auch die Tonstelle, cf. prātu, PRĀTU, bĕllu usf. Bei Diphthongen oder unbetonten Vokalen entfallen diese Angaben, cf. *alausa, *ALAUSA, FŬNDU + -ULU.
– Alemannisch, Deutsch oder Romanisch:
– „ : ” bezeichnet die Länge eines Vokals, cf. alem. ['fa:rɐ] „fahren”.
– „ ' ” steht für die Betonung der anschließenden Silbe, cf. ['fa:rɐ].
– „ '-- ” steht vor einer nachtonigen Silbe, cf. ['--ɐrɐ] in Chálcheren.
Vokale:
– [e], [i], [o] und [u] stehen für geschlossenes <e> usw., cf. dt. [ve:g] „Weg”, [zi:] „sie”, [ro:t] „rot” und [blu:t] „Blut”.
– [ɛ], [ɪ], [ɔ] und [ʊ] stehen für offenes <e> usw., cf. dt. [rɛst] „Rest”, [bɪst] „bist”, [ɔrt] „Ort” und [mʊst] „musst”.
– [a] entspricht <a>, cf. Tat, matt usf.
– [ø] und [y] sind gerundete Vokale, cf. dt. [ʃø:n] „schön”, [zy:s] „süß”.
– [œ], [æ] und [ɑ] sind überoffene [ø], [ɛ] und [a], cf. fr. [sœ:r] „Schwester”, wals. [gæ:s] „Geiß, Ziege”, tir. [kxɑʃtn] „Schrank”.
– [ᾶ], [ɛ̃], [ĩ] und [õ] sind Nasalvokale, cf. fr. [grᾶ:] „groß”, [bjɛ̃:] „gut”, alem. [rĩ:] „Rhein”, fr. [sõ:] „Ton”.
– [ɐ] ist reduziertes [a], cf. alem. ['saxɐ] „Sachen”.
Halbvokale:
– [j], [w] und [ɥ] stehen in Verbindung mit Tonvokalen, cf. dt. [hajs] „heiß”, [blaw] „blau”, alem. [nøɥ] „neu”.
– Zu den steigenden und fallenden Diphthongen sowie Triphthongen im Bündnerromanischen cf. die Tabelle in Eichenhofer 2008, 2792.
Konsonanten:
– [p], [t] und [k] sind stimmlose, [b], [d] und [g] stimmhafte Verschlusslaute, cf. dt. [papl] „Pappel”, [ta:fl] „Tafel”, [kalt] „kalt”, [balt] „bald”, [datl] „Dattel”, [gants] „ganz”.
– [pf], [ts], [c] und [tʃ] sind Kombinationen von stimmlosen Verschlusslauten und Reibelauten, cf. alem. ['pfarɐr] „Pfarrer”, ['tsa:lɐ] „zahlen”, rom. ['ca:zɐ] „Haus”, alem. ['tʃo:pɐ] „Jacke”. Zu [c] besteht in unserem Material die stimmhafte Variante [ɟ], cf. rom. ['teɟɐ] „Hütte”. [c] wird ähnlich wie die dt. Kombination aus [t] und dem „ich-Laut” [ç] artikuliert, cf. ['kɪstçɐn] „Kistchen”.
– [β], [f], [s], [ʃ], [x] und [h] sind stimmlose, [v], [z] und [ʒ] stimmhafte Reibelaute, cf. tir. [βɑsr] „Wasser”, alem. ['fa:rɐ] „fahren”, ['sa:gɐ] „sagen”, dt. [ʃø:n] „schön”, alem. [xatz] „Katze”, ['haltɐ] „halten”, ['valtɐr] „Walter”, norddt. [ze:] „See”, [ʒe'le:] „Gelee”.
– [l], [r] und [ʎ] sind Liquide, cf. dt. [last] „Last”, [rɛst] „Rest”, rom. [teʎ] „Linde”.
– [m], [n], [ɲ] und [ŋ] sind Nasallaute, cf. dt. [mʊst] „musst”, [nʊs] „Nuss”, rom. [bɔɲ] „Bad”, alem. ['siŋɐ] „singen”.
NB. Das Rätoromanische Graubündens weist graphische Besonderheiten auf, die hier zu erwähnen sind, weil in den Materialien vielfach auf parallele rom. Namenbeispiele verwiesen wird, cf. fĭlice „Farn” (…) + -āria:Valischera in Vandans mit RN 2, 140 Filtgera SMart.
Grundsätzlich ist zu unterscheiden zwischen Graphien des Surselvischen im Bündner Oberland bzw. Mittelbünden einerseits sowie dem Engadinischen andererseits.
– Im Engadin existieren die Vokale <ö> und <ü>, die Surselva und Mittelbünden kennen hierfür nur <e> und <i>, cf. engad. fö, jedoch surm. fi „Feuer”.
– Für [c] ist in Surselva und Mittelbünden die Graphie <tg> gebräuchlich, cf. surm. tger „lieb”, phonetisch [ce:r]. Das Engadinische benutzt hierfür <ch>, cf. char „lieb”, phonetisch [ca:r]. Aus diesem Grund ist das Engadinische gezwungen, für die rom. Kombination aus [ʃ] und [c] <s-ch> zu schreiben, cf. RN 2, 57 Foppas dal Bös-chin in Puntr., engad. s-chür, phonetisch [ʃcy:r] „dunkel”, wofür im Surm. stgeir, im Surs. stgir steht.
– <ch> vor <e>, <i> steht in Surselva und Mittelbünden für [k], cf. surs. pachet „Paket”. Im Engadinischen steht <k>, zuweilen <qu>, cf. paket, paquet. (<c> vor <a>, <o>, <u> wird überall als [k] gesprochen, cf. canera „Lärm”, co, cu „wie”.)
– <gh> vor <e>, <i> steht allegemein für [g], cf. ghegna, ghigna „Grimasse”.
– <ge>, <gi> wird überall als [ɟe], [ɟi] ausgesprochen; im Unterengadin steht hierfür oft [j] und man schreibt <j>, cf. juven, sonst allg. giuven „jung”. (<g> vor <a>, <o>, <u> wird generell als [g] gesprochen, cf. garantir „garantieren”, guot(t)a, gotta „Nagel”.)
– Im Engadin spricht man <gö> und <gü> als [ɟø] und [ɟy], im Unterengadin oft als [jø], [jy], cf. jö, jürar, sonst engad. gö „Spiel”, gürar, -er „schwören”.
– <s> vor stimmlosen Konsonanten lautet [ʃ], vor stimmhaften [ʒ], cf. surs. [ʃci:r] „dunkel”, aber ['ʒba:bɐ] „Geifer”.
– <sch> kann in Surselva und Mittelbünden stimmhaft sein; hierfür steht im Engadinischen <dsch>, cf. schelar vs. dschelar „frieren”. Für stimmloses dt. <sch> steht überall <sch>, cf. schirar „erlahmen”.
– Rom. <tsch> entspricht dem dt. <tsch>, cf. tschien, tschient „hundert”.
Bibliographie
Anreiter, Peter (2012a): Früh bezeugte vorrömische Namen in Vorarlberg. In: JbLMV, 161-175
Anreiter, Peter (2012b): Vordeutsche Hydronyme in Vorarlberg. In Montfort 64, 141-148
Anreiter, Peter/Chapman, Christian/Rampl, Gerhard (2009): Die Gemeindenamen Tirols, Herkunft und Bedeutung, Innsbruck
AnSR: Annalas da la Società Retorumantscha, Cuoira 1886ff
Berchtold, Simone Maria (1996): Die Flur- und Siedlungsnamen der Stadtgemeinde Feldkirch, Wien
Berchtold, Simone Maria (2001): Gewässerbezeichnungen in Südvorarlberg. Eine Analyse. In: Österreichische Namenforschung 29, 47-63
Berchtold, Simone Maria (2008): Namenbuch des Großen Walsertales, Graz/Feldkirch
BLK Bayrischer Landeskataster, cf. VNB 1/1, 21
Bludenzer Geschichtsblätter, Bludenz 1987ff
BM: Bündnerisches Monatsblatt, Chur 1850-71, 1881, 1896-1904, 1914ff
Bohnenberger, Karl (1913): Die Mundart der deutschen Walliser im Heimattal und in den Außenorten, Frauenfeld
BUB: Bündner Urkundenbuch, Chur 1946ff
Decurtins, Alexi (2001): Niev vocabulari romontsch-sursilvan - tudestg, Chur 2001
DRG: Dicziunari Rumantsch Grischun, Cuoira 1938ff
DTA: Dizionario toponomastico atesino, Roma/Bolzano 1936ff
Egli, Jakob (1995): Zur Etymologie der Alpennamen Suvretta und Silvretta. Ein sprachwissenschaftlicher Deutungsversuch. In: BM, 277-318
Eichenhofer, Wolfgang (2002): Pledari sutsilvan-tudestg, Wörterbuch Deutsch-Sutsilvan, Chur 2002
Eichenhofer, Wolfgang (2004): Bemerkungen zu diversen Etymologien im NVRST (Niev vocabulari romontsch-sursilvan - tudestg). In: Ladinia 28, 103-114
Eichenhofer, Wolfgang (2007): Profilo del retoromancio intorno alla Schesaplana. In: RLiR 71, 119-202
Eichenhofer, Wolfgang (2008): Interne Sprachgeschichte des Bündnerromanischen (1) (Laut- und Schriftsystem). In: Ernst, Gerhard/Gleßgen, Martin-Dietrich/Schmitt, Christian/Schweikard, Wolfgang (Hg.), Romanische Sprachgeschichte. Ein internationales Handbuch zur Geschichte der romanischen Sprachen, Teilband 3, Berlin/New York, 2790-2797
Eichenhofer, Wolfgang (2017): Hans Stricker, Werdenberger Namenbuch, Zürich 2017. In: VRom. 76, 369-373
Eichenhofer, Wolfgang (2018): Glarner Namengut (vor)romanischer Herkunft. In: VRom. 77, 73-128
Eichenhofer, Wolfgang (2019): Romania submersa zwischen Schwyz und Zams. In: VRom. 78, 89-124
Eichenhofer, Wolfgang (2020): Etymologisches im LRC (i). In: Ladinia 44, 163-240
Eichenhofer, Wolfgang (2021a): Anmerkungen zum Werdenberger Namenbuch. In: Montfort 73, 109-124
Eichenhofer, Wolfgang (2021b): Etymologisches im LRC (ii). In: Ladinia 45, 161-220
FEW: Wartburg, Walther von: Französisches etymologisches Wörterbuch, Bonn/Leipzig 1922-2002, 25 Bde.
Finsterwalder, Karl (1955): Namen und Siedlung in der Silvretta. In: Jahrbuch des österreichischen Alpenvereins 80, 29-41
Finsterwalder, Karl (1975): Alpicula für „kleine Alp”. Zur Sprach- und Sachentwicklung des Wortes im Raume von Salzburg bis Vorarlberg und Graubünden. In: Carlen, Louis et al., Festschrift für Nikolaus Gross, Band 2, Innsbruck, 19-29
Finsterwalder, Karl (1990, 1995) cf. TOK 2, 3.
Furer, Jean-Jaques (s. a.): Dictionnaire romanche sursilvan - français, s. l.
Georges, Karl Ernst (1972): Ausführliches lateinisch-deutsches Handwörterbuch, Hannover, 2 Bde.
Hagen, Werner (1968): Die Flurnamen des Laternsertales, Wien
HLB: Eichenhofer, Wolfgang (1999): Historische Lautlehre des Bündnerromanischen, Tübingen/Basel
Hubschmid, Johannes (1950): Schesaplana. In: BM, 5-9
HWR: Bernardi, Rut et al. (1994): Handwörterbuch des Rätoromanischen, Zürich, 3 Bde.
ID: Schweizerisches Idiotikon, Wörterbuch der schweizerdeutschen Sprache, Frauenfeld 1881ff
Jahrbuch des österreichischen Alpenvereins, Innsbruck 1949-1969
Jahresbericht der Montafoner Museen, Schruns 2002-2011
JbLMV: Jahrbuch des Vorarlberger Landesmuseumsvereins, Bregenz 1928ff
Kispert, Eva (1959): Die rätoromanischen Flurnamen der Gemeinden Schnifis, Schlins, Röns, Düns, Dünserberg (Jagdberggemeinden). Ein Beitrag zu Vorarlbergs Rätoromania, Innsbruck
Kluge, Friedrich (1975, 21. Aufl.): Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache, Berlin/New York
Kübler, August (1894): Die suffixhaltigen Flurnamen Graubündens. I. Teil: Liquiden-Suffixe, Erlangen
Kübler, August (1898): Die suffixhaltigen Flurnamen Graubündens. II. Teil: Die übrigen Suffixe, Leipzig
Kuhn, Julia (2002): Die romanischen Orts- und Flurnamen von Walenstadt und Quarten/St. Gallen/Schweiz, Innsbruck
Ladinia: Revista scientifica dl Institut Ladin Micurá de Rü, S. Martin de Tor 1977ff
Landolt, Elias (1984, 5. Aufl.): Unsere Alpenflora, s. l.
Lexer, Matthias (1992, 38. Aufl.): Mittelhochdeutsches Taschenwörterbuch, Stuttgart
LNB: Stricker, Hans/Banzer, Toni/Hilbe, Herbert (1999): Liechtensteiner Namenbuch, Vaduz, 6 Bde.
LRC: Decurtins, Alexi (2012): Lexicon romontsch cumparativ sursilvan - tudestg, Cuera
Mätzler, Maria Clarina (1968): Romanisches Wortgut in den Mundarten Vorarlbergs, Innsbruck
Montfort, Innsbruck 1946ff
Nemecek, Brigitte (1968): Die rätoromanische Namengebung im Gemeindegebiet von Tschagguns. Ein Beitrag zur rätoromanischen Toponomastik des Montafon, Innsbruck
Niemeyer, Manfred (2012): Deutsches Ortsnamenbuch, Berlin/Boston
Österreichische Namenforschung, Wien 1973ff
Oswald, Doris (1967): Rätoromanische Flurnamen im Montafon: St. Gallenkirch (Innerfratte), Innsbruck
Plangg, Guntram (1962): Die rätoromanischen Flurnamen des Brandnertals, Innsbruck
Plangg, Guntram (1992): Flurnamen in St. Gallenkirch (Montafon). In: BM, 19-26
Plangg, Guntram (1997): Einige Ortsnamen im Bezirk Bludenz um 1600. In: Montfort 49, 72-76
Plangg, Guntram (1999): Romanische Flurnamen in Innerbraz (Klostertal). In: Anreiter, Peter/Jerem, Erzsébet (Hg.), Festschrift für Wolfgang Meid, Budapest, 325-330
Plangg, Guntram (2000): Namenschichten in Vandans (Montafon). In: AnSR 113, 69-84
Plangg, Guntram (2003): Der Montafoner Ortsname Schlupiert als Rechtsbegriff. In: Montfort 55, 288-292
Plangg, Guntram (2007a): Alte Flurnamen in Bludenz. In: Bludenzer Geschichtsblätter 86, 3-18
Plangg, Guntram (2007b): Auf den Spuren alter Namen in Gaschurn. In: Jahresbericht der Montafoner Museen, 130-138
Plangg, Guntram (2007c): Die Flurnamen von Bludenz in der Forschung. In: Montfort 59, 11-24
Plangg, Guntram (2007d): Silbertaler Namen aus alter Zeit. In: Jahresbericht der Montafoner Museen, 138-147
Plangg, Guntram (2008): Tal- und Bachnamen im Walgau. In: Montfort 60, 16-22
Plangg, Guntram (2009a): Frühe Alpnamen in Gaschurn. In: Jahresbericht der Montafoner Museen, 81-85
Plangg, Guntram (2009b): Romanische Namen aus dem Montafon. In: Anreiter, Peter (Hg.), Innbrucker Beiträge zur Onomastik Band 7, Wien, 89-102
Plangg, Guntram (2010): St. Anton, Lorüns, Stallehr: Flurnamen. In: Jahresbericht der Montafoner Museen, 48-54
Plangg, Guntram (2012a): Alte Namen im Lechquellengebirge. In: Thöny, Christof (Hg.), Von schroffen Bergen eingeschlossen. Das Lechquellengebirge und seine Erschließung, Wald a. A., 35-57
Plangg, Guntram (2012b): Romanische Namen vor 1200 in Vorarlberg. In: JbLMV, 150-160
Plangg, Guntram (2013): Namenprobleme zwischen Dawenna und Arlberg. In: JbLMV, Bregenz, 137-150
Plangg, Guntram (2014a): Alte Montafoner Flurnamen 1, Schruns
Plangg, Guntram (2014b): Bergnamen um Bludenz als sprachliche Zeugen. In: Bludenzer Geschichtsblätter 108, 41-54
Plangg, Guntram (2015a): Alte Namen in Röns. In: JbLMV, 164-201
Plangg, Guntram (2015b): Augmentativa im alemannisch-rätischen Raum. In: Anreiter, Peter/Mairhofer, Elisabeth/Posch, Claudia, Argumenta. Festschrift für Manfred Kienpointner zum 60. Geburtstag, Wien, 443-450
Plangg, Guntram (2018): Alte Namen am Dünserberg (Vorarlberg). In: JbLMV, 180-194
Plangg, Guntram (2019): Alte Montafoner Flurnamen 2, Schruns
Plangg, Guntram (2022): Alte Montafoner Flurnamen 3, Schruns
Plangg, Guntram/Vogt, Werner (2021): Flurnamen Walgau. Deutungen, Bregenz/Nenzing
REW: Meyer-Lübke, Wilhelm (1935, 3. Aufl.): Romanisches Etymologisches Wörterbuch, Heidelberg
RLiR: Revue de Linguistique romane, Paris 1925ff
RN 2: Schorta, Andrea (1985, 2. Aufl.): Rätisches Namenbuch, Band 2, Etymologien, Bern
RN 3: Huber Konrad (1986): Rätisches Namenbuch, Band 3, Personennamen, Bern
Rohlfs, Gerhard (1972, 2. Aufl.): Historische Grammatik der italienischen Sprache und ihrer Mundarten, Bern
Salvini-Plawen, Luitfried von (1980): Zum Namen Obervinschgauer Geschlechter (II): Plawen(na). Eine Analyse. In: Der Schlern 54, 261-276
Schlern: Monatszeitschrift für Südtiroler Landeskunde, Bozen 1920-38, 1946ff
Schmid, Heinrich (1956): Über Randgebiete und Sprachgrenzen. In: VRom. 15, 19-80
Schöpf, Johann Baptist (1866): Tirolisches Idiotikon, Innsbruck
Schorta, Andrea (1949): Elemente der christlichen Kultur in den Ortsnamen Graubündens. In: BM, 265-279
Signorell, Faust (1999): Vocabulari surmiran-tudestg, Wörterbuch Deutsch-Surmiran, Chur
Sonderegger, Stefan (1979): Grundzüge deutscher Sprachgeschichte. Diachronie des Sprachsystems. Band 1: Einführung - Genealogie -Konstanten, Berlin/New York
Srbik, Robert von (1929): Überblick des Bergbaues von Tirol und Vorarlberg. Innsbruck
Stadler, Hans: Maderanertal. In: Historisches Lexikon der Schweiz, Version vom 08.10.2007 (www: https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/015979/2007-10-08)
Steiner, Thaddäus (2007): Allgäuer Bergnamen, Lindenberg
Stricker, Hans (1976): Zur Geschichte von lat. presbyter im Rätoromanischen. Aus der Werkstatt des St. Galler Namenbuchs. In: VRom. 35, 48-60
Szadrowsky, Manfred (1925): Walserdeutsch. In: BM, 161-198
Tiefenthaler, Eberhard (1968): Die rätoromanischen Flurnamen der Gemeinden Frastanz und Nenzing, Innsbruck
TOK 2: Finsterwalder, Karl 1990: Tiroler Ortsnamenkunde. Gesammelte Aufsätze und Arbeiten: Einzelne Landesteile betreffende Arbeiten – Inntal und Zillertal. Ölberg, Hermann M./Grass, Nikolaus (Hg.), Schlern-Schriften 286, Innsbruck
TOK 3: Finsterwalder, Karl 1995: Tiroler Ortsnamenkunde. Gesammelte Aufsätze und Arbeiten: Einzelne Landesteile. Ölberg, Hermann M./ Grass, Nikolaus (Hg.), Schlern-Schriften 287, Innsbruck
Tscharner, Gion (2000): Dicziunari puter-Deutsch, Wörterbuch Deutsch-puter, Chur
Tscharner, Gion (2009, 4. Aufl.): Dicziunari vallader-tudais-ch, Wörterbuch deutsch-vallader, Chur
Videsott, Paul (2001): La palatalizzazione di ca e ga nell’arco alpino orientale. In: VRom. 60, 25-50
Vincenz, Valentin (1993): Die romanischen Orts- und Flurnamen von Vilters und Wangs, Mels
Vogt, Werner (1970-1993): Vorarlberger Flurnamenbuch. 1. Teil: Flurnamensammlungen, Band 1) Bludenz und Klostertal, Band 2) Montafon, Band 3) Walgau, Band 4) Großwalsertal und Damüls, Band 5) Vorderland, Band 6) Unterland, Band 7) Vorder-Bregenzerwald, Band 8) Hinter-Bregenzerwald, Band 9) Hochtannberg und Klein-walsertal, jeweils mit Karten-Beilagen, Bregenz (zitiert als VNB 1/1, 1/2 usf.)
Vogt, Werner (1982a): Fraxern und seine Flurnamen. Das Bild einer Bergbauerngemeinde. In: Montfort 34, 175-180
Vogt, Werner (1982b): Von alten Wegen im rätischen Südvorarlberg. In: Montfort 34, 425-434
Vogt, Werner/Plangg, Guntram (2016): Die Flurnamen von Bürserberg. In: Gamon, Thomas (Hg.), Walgau in Einzeldarstellungen 1, Nenzing, 1-62
Vogt, Werner/Plangg, Guntram (2018): Die Flurnamen von Innerbraz (Klostertal), Teil 1. In: Bludenzer Geschichtsblätter 118, 65-83
VRom.: Vox Romanica, Zürich 1936ff
Wahrig, Gerhard (2002, 7. Aufl.): Deutsches Wörterbuch, Gütersloh/München
Waltenberger, Anton (1875): Allgäu, Vorarlberg, Westtirol nebst den angrenzenden Gebieten der Schweiz. Innsbruck
WNB: Stricker, Hans (2017): Werdenberger Namenbuch, Zürich, 8 Bde.
www.ortsnamen.ch
Zehrer, Josef (1949): Vorrömische Ortsnamen in Vorarlberg, Innsbruck
Zehrer, Josef (1960): Die Ortsnamen von Vorarlberg (2. Teil). In: JbLMV 103, 107-211
Zehrer, Josef (1965): Zu den vordeutschen Alp-, Berg- und Flussnamen in den hinteren Lagen des Bregenzerwaldes. In: JbLMV, 14-41
Zehrer, Josef (1967): Die Ortsnamen von Vorarlberg (2. Nachtrag). In: JbLMV 110, 9-48
Zösmair, Josef (1888): Die Ortsnamen des Gerichtsbezirkes Bludenz in Vorarlberg, s.l.
Zösmair, Josef (1923): Die Bergnamen Vorarlbergs, möglichst auf urkundlicher Grundlage, Dornbirn
Grundsätzliches zur Namenforschung
Die Namenforschung sollte sich grundsätzlich nach folgenden sechs Prinzipien richten:
a) Der Name sollte anhand lautlicher, eventuell auch graphischer Kriterien plausibel erklärt werden: Jupident in Schlins kann wegen dem alten Beleg Mumpidend nicht auf JŬGU + -ĬTTU + DĒ + ĬNTU zurückgeführt werden, cf. Teil I. des Namenbuchs s.v. *PITÍNO.
b) Dessen Grundlage sollte gleichfalls morphologisch mit dem Rom. vereinbar sein: DĒ + ĬNTU, das zu einem rom. *dent geführt hätte, ist nicht nachzuweisen; cf. jedoch DĒ-ĂD + ĬNTU mit dem Reflex dadens „innere(r, -s)” und s.v. ĬNTU den Eintrag Alp dadens aus dem bündnerischen Vuorz.
c) Die Syntax der Etymologie sollte derjenigen des Rom. entsprechen: Eine Komposition aus *CALA und TŬRNU mit der Bedeutung „Wegbiegung” ist syntaktisch im Rom. nicht möglich, weil dem dt. Wort umgekehrt ein lat. TŬRNU + *CALA entspricht, das auf Rom. tuorn + *cala lautete und in unserem Gebiet zu *durn-gala oder *dura-gala geführt hätte; cf. hierzu Teil II. s.v. Galtornes.
d) Auch die semantische Komponente sollte Berücksichtigung finden: Jupident mit dem Etymon JŬGU „Joch” zu verbinden ist angesichts des unter a) erwähnten alten Belegs, der zu rom. munt < MŎNTE „Berg” gehört, nicht plausibel.
e) Weiters ist den geographischen Zusammenhängen Rechnung zu tragen: In Kompositionen tritt rom. chau „Kopf” nach Ausweis des RN 2, 78 in Romanisch Bünden nicht als Bestimmungs-, sondern als Grundwort auf wie bei CĂPU DĒ PŎNTE > Gapunt in Tschagguns, und lenn „Holz” gemäß op. cit. 188 nicht als Grundwort, sondern als Bestimmungswort, cf. CĀSA LĬGNU > Gasslain, ebenfalls in Tschagguns. Damit ist eine Komposition wie lenn + chau (anstatt ein vielleicht mögliches rom. *chau + lenn in der Bedeutung „Holz-Kopf”) aus geographischen Gründen anzunehmen nicht stichhaltig, cf. hierzu den Namen Latschau < LĂRICE + -ŌNE.
f) Die großartigen von Werner Vogt gezeichneten Karten zu jeder Gemeinde Vorarlbergs als Beilagen zum VNB 1 sind die unentbehrliche Hilfe, mit der Etymologien auf sachliche Gegebenheiten gegründet werden können: Namen wie Battlina, Batlinis usf., die laut der Karten Vogts ausnahmslos ebene Fluren benennen, können also aus den genannten Gründen schwerlich auf ein vorrom. *MŬTT- + -ĔLLĪNU der Bedeutung „kleiner Hügel” zurückgeführt werden. In Teil I. wurde für Battlina daher eine Herleitung aus PAITA „Gewand” + -ĪLĪNU erwogen.
Es wurde in dieser Arbeit soweit möglich versucht, obige sechs Prinzipien bei der Etymologisierung der Namen im Auge zu behalten. Daher finden sich in unserem Material nicht wenige Vorschläge von Lösungen, die von denjenigen in früherer Literatur differieren.
NAMENBUCH
I. – Etymologisch geklärte Namen
abănte „vor, vorde(r, -s)”
– Zus.: *cantu dĕ ~:Gafant Vand., St. Ger.
dē ~:Vand α1486 in Dafannt Gasch. – (RN 2, 1 Davont Esch Flem).
frŭstu dē ~:Frastafant Nenz.
prātu dē ~: α1457 Pradafent, Nr. 36 St. Ant., Bradafant Nenz. – RN loc. cit. Pradafant Mfeld.; LNB 5, 37 † Pradafant Balz.
Zu abănte cf. cāsa + -ĕlla.
ăccola „Anwohner”
Nagla Barthbg. – RN 2, 2 acla „Gadenstatt”, „Maiensäß” (Appell.).
– Anm.: Bei N. ist lat. ĬN agglutiniert.
acĕreu „Ahorn”
Laschier α1516 Aschier Bomgärtle Bürs.
– Anm.: Anl. [l-] stammt aus lat. ĬN, dessen [-n-] zu [-l-] denasaliert wurde.
– Zus.: wald ~:Valsersirsch α1644 Waldaschierer Egg St. Gall., Waldeschier Thürbg., Woldeschierkopf Ragg., Woldeschier Sonn.
– Abl.: ~ + -īna „Ahornwald”: Rescharina St. Gall., Nescherina α1430 in Ascharin Silb., Schrina Silb., Barthbg., Schrines Ebnit. – RN 2, 4 Ascharina St.Ant.-A.
– Anm.: Rescharina und Nescherina haben agglutiniertes lat. ĬN, wobei in Rescharina [-n-] zu [-r-] denasaliert ist.
– Zus.: mŏnte ~ + -īna:Manschrinas „Bergweide mit einzelnen Ahornbäumen” Nenz.
wald ~ + -īna:Valscherina Nenz. – LNB 5, 30 † Faltscherina Mauren.
– Anm.: Bei Eichenhofer 2007, § 25 ist Faltscherina fälschlicherweise aus VĂLLE statt WALD + ACERĪNA hergeleitet.
– Abl.: ~ + -ōne „Ahornwald”: Schruns (Ort) α1397 ze Schiruns Schr.
– Zus.: wald ~ + -ōne:Falscheronna α1551 α1639 Follscheronen, Nr. 264 Nenz.
– Anm.: Falscheronna kann aus lautl. Gründen nicht, wie in WNB 7, 545 s.v. serein behauptet, auf AQUĀLE + SERĒNU „heiter” beruhen.
acūtu „spitz”
– Zus.: *motta ~a:Mottaguda Barthbg. – RN 2, 5 Motta gida Sour.
*pits ~:Pizagut St. Gall., Silb. – RN loc. cit. α1389 Spitzagud Mfeld.; LNB 5, 15 † Spitzagud Balz.
Adolf PN (cf. RN 2, 550 Dolf)
Dolfa Gasch.
– Zus.: prātu ~: α1478 wiß Proßendolf, Nr. 171 Schl.
– Anm.: Proß- entspricht dem lat. Plural PRĀTOS, <n> ist parasitär.
ăgru „Acker”
– Zus.: ĭntu + ĭnter ~:Tantelier ['-iɐr] Bürs. – (RN 2, 9 Plan tanter Ers Guarda).
– Kommentar: Die Flur liegt relativ eben auf 700 m Richtung NO über einer Schlucht im W; ein „Geschiebe” ist auf der Karte nicht auszumachen, weshalb der Vorschlag tanter + g(a)lera „zwischen dem Kies” (Plangg 1962, 68) nicht einleuchtet; [-l-] in Tantelier beruht auf Liquidw. in altem *[tantɐr'er].
– Abl.: ~ + -ōne:Lorüns (Ort) α896 Airumne α1403 Aruns Lor. – RN 2, 10 α1492 Irruns Flerd.
– Anm.: Das [-y-] der Form Lorüns beruht auf umgelauteten [-u-], welches dem lat. -ŌNE entstammt, cf. Plangg 2007a, 18.
Zu ăgru cf. Albĕrtu, cărdine, cŏsta, *cŭmbu, lŏngu, Magnoc, mărcidu, Martīnu, nĭgru, Paulu, plānu [1], rotŭndu, vĕtere.
*alausa „Traubenkirsche”
– Zus.: ăd ~:Dalaas (Ort) α1303 Talaus α1386 Talas α1394 Thalass Dal.
– (RN 2, 10 α1439 in Alaus Vrin).
– Kommentar: Der Name wird von Zösmaier 1888 zu Recht „mit alosér in Verbindung gebracht” (zitiert nach Kübler 1894, 122); die Annahme von Zehrer 1949, 84 und id. 1960, 139f, wonach TABULĀTOS anzusetzen sei, ist aus lautl. Gründen nicht haltbar, weil sekundäres lat. -B’L- von TABULĀTU in unserem Gebiet ausnahmslos [-fl-] ergab; das anlautende [d-] des Namens findet sich in ONN wie Domat (GR) < ĂD ĂMBITU, Danuder (T, rom. zu Nauders) < ĂD INÓUTRION (Finsterwalder 1990, 886).
Ob hierzu in RN 2, 670 erwähntes Dalaus, α1268 Tellaus (Mas.) – nach Schorta fraglicher Herkunft – etymologisch gehört, ist unklar. Dass Dalaas ursprünglich einen Wald bezeichnet haben mag, legen folgende Formen nahe:
plānu dē ~: α1535 alle Walder von Plandalaus α1611 Wald auf Plendalaus, Nr. 37 Stall.
– Kommentar: Nach Plangg 2014b, 48 sei PLĀNU + TAEDULĒTU anzusetzen, was aber aus lautlichen Gründen nicht stichhaltig ist: -ĒTU in TAEDA + -ULĒTU lautet in unserem Gebiet [-øɥ] bzw. [-iɐb-].
*alb- + -ănna (vorrom.) „Anhöhe”
Albo α1610 Albonakopf Gasch., Albona α1475 Albb Albona Klöst., Albon Egg. – RN 2, 10 Albanas Zuoz; LNB 5, 560 Malbun Triesbg.
*albanti (kelt.) „Weißenbach“?
Alfenz α1355 alvenze Bludz.
– Kommentar: Cf. Anreiter 2012b, 142, wonach der Name alteurop. Herkunft und stammverwandt ist mit lat. ĂLBUS „weiß”; ~ wäre demnach ähnlich wie Albula in Mittelbünden als „Weißenbach” zu interpretieren, cf. hierzu RN 2, 613.
ălbaru „Weißpappel”
– Abl.: ~ + -ēta „Weißpappelwald”: Lavareda α1650 Lafariede Barthbg., Lavareda St. Ant. – RN 2, 10f α1585 Albareda Vic., Albareida Stam.; cf. LNB 5, 17 Mundelbris in Planken als Zus. mit mŏnte.
– Anm.: Anl. [l-] stammt aus altem lat. ĬN, dessen [-n] zu [-l-] denasaliert wurde.
Albĕrtu PN
– Zus.: ăgru ~:Rapiert α1512 Rapiert Thürbg., Rapiert α1459 Rappiert Ragg. – (RN 2, 531 Chaunt d'Albert S-cha.).
– Anm.: Anl. [r-] entsteht in altem *[ɛrɐl'biɐrt] durch Deglutination des vermeintlichen alem. in.
cămpu ~:Gampabiat α1636 Gamperbiet Üsax.
– Anm.: Im alten Beleg liegt Liquidw. vor: *[gampɐl'biɐrt] > [gampɛr'biɐrt].
cāsa ~:Salbiat α1499 Galbier Barthbg., α1400 α1512 gut galbier, Nr. 54 St. Ger. – RN loc. cit. α1481 Galbiert Sevg.
– Anm.: In Salbiat dürfte vermeintliches anlautendes alem. gen durch das ersetzt worden sein.
ălbu „weiß”
– Zus.: hĕrba ~a:Mirfalva „[mirválva]” Gasch. – (RN 2, 11 Müsc-chel alb Sent).
– Anm.: In M. ist alem. im agglutiniert.
plătta ~a:Plattalva Gasch. – RN loc. cit. Platt'alva Siat.
ălneu „Erle”
– Abl.: ~ + -ētu „Erlenwald”: Daneu α1406 gut agněw Barthbg., α1480 In Agnuw marien, Nr. 217 Vand., Daneu α1544 Allmain in Thanew Bludz., Nüz., αXIV in tanuws, Nr. 281 Lud., Jnanib α1363 in Anuͦw α1431 in Anngyw Düns, α1503 Jngnuͦw, Nr. 46 Röns. – RN 2, 12 Igniu Dis.
– Anm.: [d-] dürfte agglutiniertes alem. de(r) sein, [in-] ist agglutiniertes lat. ĬN; <Jnanib> in Düns entspricht dem surs. und mbündn. Typ, cf. HWR 397 s.v. igniu „Erlenwald”: Lat. -ĒTU ergab in diesen Gebieten ['-ɪw] bzw. ['-iɐ], cf. HLB § 72a mit Tabelle 13.
– Zus.: mŏnte ~ + -ētu:Muntaneu α1575 montanouw, montanew Barthbg., Muntineu α1670 Munthinau Vand. – (RN 2, 210 Munt dad Ognas Guarda).
Zu ălneu cf. pič.
alp- (vorrom.) „Alp”
– Abl.: ~ + -ĕlla „kleine Alpe”: α1713 alphella, Nr. 6 Silb. – RN 2, 14 Arpella Guarda.
– Anm.: Sollte alphella als *<alpilla> zu lesen sein, liegt ALP- + -ĪCULA zugrunde; aus lautl. Gründen wäre auch die Annahme von ALP- BĔLLA möglich.
~ + -īcĕlla „kleine Alpe”: Alpisella [-i'sɛ-] Gasch., Alpasella [-ɐ'sɛ-] St. Gall., Alpaschella St. Ger., Alpschellen α1392 Alpe Schella α1471 alpp schellen Sonn. – RN loc. cit. Alperschelli Saf., Arpschella Zern.
– Anm.: Zur Graphie <-sella> cf. Vadusis mit altem <vaduschis> (Lor.), Vaduss (Dal.) aus AQUAEDŬCTU.
~ + -īcula „kleine Alpe”: Alpila Gasch., St. Gall., Alpilla Tschagg., Alpilich ['-pil-] Silb., Alpila Barthbg., Alppila Vand., Alpieli Brand, Alpila Nenz., Alpila α1363 alb Abeilen Thürbg., Äußere Alpila Schn., Alpila Sonn., α1324 Alpigl α1394 Alpyla α1415 Alpiglen α1443 Alpigel, Nr. 4 Frax., α1415 Alpiglen α1521 Alpillen, Nr. 3 Götz. – RN loc. cit. Arpiglia Zuoz; LNB 5, 21 Alpila Schaan.
– Kommentar: Alpilich, Alpig(e)l und Alpiglen sind nach Finsterwalder 1975, 24 Walserformen, die auf *alpílga < *alpílja < ALP- + -ĪCULA zurückgehen; als Parallele führt Finsterwalder loc. cit. die romanische Form Bregaglia an, die im Wals. Bregalga laute; wenn demnach inlautendes alem. <-lg-> eine rom. Vorstufe *<-lj-> voraussetzt, kann es sich bei Alpigl usf. kaum um eine „Regressionsform” aus ALP- + -ĪCULA handeln, was in WNB 7, 9f s.v. alp supponiert wird.
Zu alp- cf. apĕrtu, bĕllu, bŏnu, bŏve + -āria, fani, majōre, nŏvu.
altāre „Altar”
Latar ['-ar] α1761 Latar α1798 im Laddar Nenz. – Cf. RN 2, 14f, wonach das lat. Wort in der Bedeutung „auf hohe Bergrücken bezogen” auftritt: Davos gl'Altà Dis.
– Anm.: Anl. [lɐt-] entsteht durch Metathese in altem *[ɐlt-], cf. hierzu HWR 50 s.v. altar mit [ɐl'tar] in Sav.
*altiōne „Heidelbeere”
– Abl.: ~ + -ētu:Zerneu [ts-] Tschagg., Vand. – RN 2, 355 s.v. uzun Zaniu Tuj., Zaneu Lags.
– Anm.: <r> ist parasitär; zu *ALTIŌNE cf. HLB § 261b.
ăltu „hoch”
– Zus.: capritūra ~a: α1483 Gaferduralta, Nr. 131 Klöst.
mŏnte ~: α1400 Munald, Nr. 448 Barthbg. – RN 2, 209 *Munt ot SMur.
*motta ~a:Matalda Gasch., Matalda α1420 motalta Barthbg. – (RN 2, 15 Muot aut Ardez).
rīpa ~a:Rifisatta α1654 Rifensalten Gasch., Rafalten Bludz., Nüz., Barfalta α1512 Rafalten Nenz., Rafalt Schn., α1466 rafolten α1497 Rafallten, Nr. 91 Düns. – RN 2, 283 Realta Cazas.
– Anm.: <n> in <Rifensalten> ist parasitär, dessen <s> reflektiert pluralisches RĪPAS; <Barfalta> hat wohl alem. bi agglutiniert.
ămbitu „freier Raum zwischen zwei Häusern” (cf. Anreiter 2012a, 166f) Hohenems [ts ɛms] (Ort) α1170 de Amides α1210 de Amedes α1255 de Emz α1310 Aemtz Hoh. – Cf. RN 2, 16, op. cit. 676 Domat (Ort) und HWR 288 endi (VMü.) „Umschwung”, das wegen dessen Tonvokal [e] etymologisch nicht ganz klar ist.
apĕrtu „offen”
– Abl.: ~as:Laferdis α1518 Berg gen. afertis Vand. – RN 2, 17 aviert, avert (Appell.).
– Anm.: Anl. [l-] stammt aus altem lat. ĬN, dessen [-n] zu [-l-] denasaliert wurde.
– Zus.: alp ~a: α1443 Alpaferta, Nr. 4 Bürs.
ăqua „Wasser”
– Zus.: cŏsta ~:Gastauer α1654 Gastaur, Garstaur St. Gall.
– Anm.: <-r> stammt wohl von alem. ['-ɐrɐ], cf. *KRAPP- > Grappera in Zwisch.
ĕcce + ĭlla ~:Tschaleua α1650 Tschaluna (Gut) Barthbg. – HWR 948 engad. tschilover „Einer vom anderen Wasser, d. h. Einwohner im Einzugsgebiet des Rheins” (Appell.).
– Anm.: <Tschaluna> ist gemäß Plangg 2014a, 144 <Tschalüua> zu lesen.
ĭntu + ĭnter ~s:Trantrauas α1514 tantharawas Gasch. – RN 2, 19 Trantráwis Saas.
prātu ĭn ~: α1491 Pratanawe, Nr. 377 Vand. – (RN loc. cit. Jert da l'Eva Beiva).
sŭper ~:Serauas Tschagg., α1435 an Sarawengassen, Nr. 438 Feldk. – RN loc. cit. Surava Sal.
trāns ~:Zersauen, Trasáura α1417 Trasawer α1423 Trusawa, Trasawn, Intrasawen α1477 Traß-awea, Traßauen Nüz.
trāns + sŭper ~s: α1747 Trazeraues, Nr. 51 Stall., Trasseraus α1414 Tres Sorores, dres Sorores αXV aker in Trösorauß, ze tresorauß, ack Ze treßerauß Lud.
– Kommentar: Nach Plangg 2010, 53f verzeichnen ältere Quellen für <Trazeraues> in Stall. α1752 Prazeraus, weshalb man als Herleitung PRĀTU + SŬPER + ĂQUA annehmen könne; <Tres Sorores> „drei Schwestern” ist latinisiertes Traseraus; es handelt sich bei dieser Flur um eben liegende Äcker im NNW des Mühlbachs, weshalb wohl eine Annahme von TRĀNS + SERRĀTOS (Plangg/Vogt 2021, 243) mit der Bedeutung „über den Verschlossenen” (?) nicht nötig ist; auch in RN 2, 310f s.v. *serrare fehlt eine solche Abl.
Zu ăqua cf. bŏnu, grănde, grŏssu, *grull-, lātu, mărcidu, nĭgru, rāru.
aquaedŭctu „Wasserleitung”
Vaduschis α~1400 faescha de faduzis α1443 Gut vaduschis α1503 Vadutschas, Vadusches Vand., Vadusis α1443 vaduschis, -es α1503 Vadutschas, Vadusches Lor., αXV Vaduss, Nr. 378 Dal. – RN 2, 19 Uadotg Lohn; LNB 5, 33 Vaduz.
aquāle „Wassergraben”
Gweil α1423 gwayl St. Gall., Falls α1387 untz an den Val αXV berg im fals Frast., Valles α1260 Walese, Walex Thür., Wals(bächle) α1432 ennent walß α1497 auf Awals Röns. – RN 2, 20 Ual Rueun; LNB 5, 34 † Falls Eschen.
– Anm.: Walsbächle ist Tautol.
– Zus.: ĭntu + ĭnter ~s: αXV Tanterwals, Nr. 609 Frast. – RN loc. cit. Tranter Uals Vaz; LNB 5, 535 † Tantermals Tries.
– Abl.: ~ + -āceu:Awalatsch Gasch., Nalatsch Barthbg., Valatsch, Valatschisa ['-la-] Barthbg., Aualatschbach Vand., Awalatsch Thür. – RN 2, 21 Ualatsch Pignia.
– Anm.: <Nalatsch> hat lat. ĬN agglutiniert, Aualatschbach ist Tautol.; zu Valatschisa, wohl abgeleitet auf alem. ['--isɐr], cf. Tschenglisa, -iserkopf in Barthbg. s.v. CĬNGULU.
Zu aquāle cf. flĕxu, frĭgidu, gemĕlla, grŏssu, magĭstru + -ĕllu, nĭtidu, pāla + -āria, plānu [1], sĭccu, tŏrtu.
ărca „Kasten”
Arken α1302 Archen Zwisch., Arka α1531 Arckhentobel Frax. – RN 2, 22 α1467 Arkass Chur; LNB 5, 27 Arg Tries.
– Zus.: *ganda dē ~: α1417 Gandadarka, Nr. 84 Schl.
ārea „Fläche”
α1400 gut aͤra, Nr. 1 Silb. – RN 2, 23 era (Appell.).
– Zus.: tabulātu dē + ăd ~: α1383 Dafla dedaͤra α1412 daffla dedära, Nr. 81 Silb. – (RN loc. cit. (b) αXIV Anntrayras Mon, α1557 Surllera Ferr., op. cit. 24 (b) Via d’Eras Camuns).





























