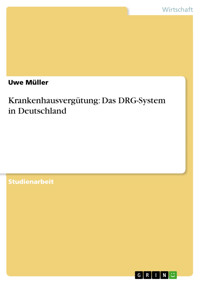9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Die DDR ist vor zwanzig Jahren untergegangen. Und doch will sie nicht verschwinden – das Gedankengut und die Ideale des sozialistischen Staates leben im vereinten Deutschland in beängstigender Weise fort. Uwe Müller und Grit Hartmann zeigen, wie die mangelnde Aufarbeitung der SED-Diktatur dazu beigetragen hat: Der Rechtsstaat war unfähig, die Staatsverbrechen der DDR zu ahnden, nur vierzig Täter wurden zu Gefängnisstrafen verurteilt. Die politischen Häftlinge hingegen haben nie eine angemessene Entschädigung erhalten. Gleichzeitig nehmen ehemalige SED-Funktionäre, CDU-Blockflöten und Stasi-Spitzel wieder Schlüsselpositionen in Politik, Wirtschaft, Kultur, Sport und Medien ein. Der friedlichen Revolution ist eine stille Restauration gefolgt. Der Westen weigert sich standhaft, seine Komplizenschaft mit dem SED-Staat aufzuklären. Weil man peinliche Enthüllungen fürchtet, lehnt es die Politik ab, die Verstrickungen früherer Bonner Abgeordneter mit dem DDR-Geheimdienst untersuchen zu lassen. So wirkt das Erbe der SED-Herrschaft auf fatale Weise fort: Die Linke, die als Nachfolgerin der Diktaturpartei erneut Gleichheitsideale propagiert, feiert Wahlerfolge im ganzen Land – und der Westen droht zu verosten. Eine schockierende Bilanz nach zwanzig Jahren Einheit.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 462
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Uwe Müller
Grit Hartmann
Vorwärts und vergessen!
Kader, Spitzel und Komplizen: das gefährliche Erbe der SED-Diktatur
Inhaltsverzeichnis
VORWORT
TEIL I EIN STAAT GEHT UNTER, DAS UNRECHT BLEIBT
Das Archiv des Verbrechens
Ein Nürnberger Prozess gegen Kommunisten?
Das zweite Versagen der Justiz
Doppelter Diktaturrabatt für die Täter
Einmal Opfer, immer Opfer
TEIL II PARTEIEN OHNE VOLK
Ehrenpensionen für Stasi-Minister
Die retrograde Amnesie der Unionsfreunde
Sozialdemokraten auf Geisterfahrt
Neue Linke auf alten Pfaden
TEIL III DAS ÜBERLEBEN DER ELITEN
Das Kreuz mit dem Bundesverdienstkreuz
Das Schweigen der Journalisten
Durchmarsch der Staatsdiener
Die vereinte Doping-Republik
TEIL IV KOMBINAT ERINNERUNGSWESEN
Die Diktatur als Bagatelle
Behörde mit Geburtsfehler
Vom Umgang mit den Akten
Die Aufarbeitung geht stiften
NACHWORT
Anmerkungen
Ausgewählte Literatur
Personenregister
VORWORT
Am Abend des 18.März 1990 klagte der Schriftsteller Stefan Heym bitter: «Es wird keine DDR mehr geben. Sie wird nichts sein als eine Fußnote der Weltgeschichte.» Soeben hatte die PDS die ersten freien Volkskammerwahlen verloren, die Befürworter einer schnellen Wiedervereinigung trugen den Sieg davon. Keine acht Monate später war die DDR von der politischen Landkarte verschwunden. Dennoch irrte Heym damals gründlich. Denn wider Erwarten landete der sozialistische Staat nicht einfach auf dem Müllhaufen der Geschichte: Sein Gedankengut und seine Ideale leben im vereinten Deutschland auf irritierende Weise fort. Davon handelt das vorliegende Buch.
Die DDR will nicht verschwinden. Sie besteht sogar in ihren alten Grenzen weiter – als gigantische Wirtschaftssonderzone. Nirgendwo sonst auf der Welt muss eine vergleichbar große Region innerhalb eines Staates vom stärkeren Landesteil so umfassend alimentiert werden. Ein Ende der Abhängigkeit ist nicht in Sicht. Gewiss haben die vergangenen zwanzig Jahre Fortschritte gebracht. Die Infrastruktur ist so modern wie kaum anderswo, einst zerfallene Städte und verwüstete Landschaften sind saniert. Nicht zuletzt hat das Wohlstandsniveau der Bürger erheblich zugenommen. Doch eines hat sich nicht verändert: Auf sich allein gestellt wäre Ostdeutschland heute ebenso wenig lebensfähig, wie es die DDR in ihrer Endphase war.
Ein solcher Fehlschlag war im Einheitsfahrplan des Jahres 1990 nicht vorgesehen. Begleitet wird er vom Schock der Bevölkerungsentwicklung: Die ostdeutsche Gesellschaft schrumpft und altert in einem Tempo, das in der europäischen Geschichte einzigartig ist. Bis zum Jahr 2020 werden die neuen Länder im Vergleich zum Zeitpunkt der Wiedervereinigung fast ein Fünftel ihrer Bevölkerung verloren haben. Ganze Regionen entleeren sich, halbe Städte sind schon abgerissen. Die als unwirtlich empfundene Realität nährt die Flucht ins Vergangene. Viele Ostdeutsche haben sich innerlich wieder in der Welt der DDR eingerichtet: Sie mystifizieren den Staat, den sie einst zu Fall gebracht haben, und verschanzen sich im antiwestlichen Protest, wie ihn einst die Propaganda predigte. Die sich abzeichnenden Verwerfungen im Gefolge der Weltwirtschaftskrise machen wenig Hoffnung, dass sich daran etwas ändert.
Ostdeutschland ist auch ohne Mauer und Stacheldraht eine «andere Republik» geblieben. Schon 1990 prophezeite Ralf Dahrendorf, es werde sechzig Jahre dauern, bis sich erneut eine bürgerliche Zivilgesellschaft herausgebildet habe. Sein Zeitmaß war die doppelte Diktaturerfahrung der Ostdeutschen. Zwar unterschied sich die SED-Diktatur von der NS-Diktatur durch die zweifellos geringere Dimension ihrer Verbrechen. Aber sie wirkte nachhaltiger, nicht nur, weil sie länger andauerte und drei Generationen prägte. Sondern auch, weil sie eine Weltanschauungsdiktatur war, die ihren repressiven Kern mit den Parolen von Antifaschismus, Frieden oder Gerechtigkeit drapierte. Zudem vertrieb sie das Bürgertum und zerstörte zielgerichtet religiöse Milieus – nicht zuletzt darin liegt die geistige Heimatlosigkeit vieler Ostdeutscher begründet.
Aber auch im Westen rumoren die Mythen des SED-Staates weiter. Viele Westdeutsche, die dank der Gnade des Geburtsortes in Freiheit aufgewachsen sind, wollten den wahren Charakter des Ost-Berliner Regimes nie wahrhaben. Für Günter Grass war die DDR, die Tausende Menschenleben gewaltsam ausgelöscht und mehr als 200000Bürger aus politischen Gründen inhaftiert hatte, selbst im Rückblick eine «kommode Diktatur». Manche betrauerten, dass mit dem Ende des kommunistischen Experiments ein Korrektiv zur kapitalistischen Ordnung verloren ging.
Die Folgen für die Gegenwart sind erschreckend:
Wenn die Linkspartei als Nachfolgerin der ostdeutschen Diktaturpartei einen westdeutschen Landtag nach dem anderen erobert – ist die DDR damit im Westen angekommen? Wenn sich ausgerechnet in Sachsen, dem Kernland des Aufbruchs im Herbst 1989, die CDU-Regierungspolitiker zur Hälfte aus früheren Mitgliedern und Funktionären einer SED-hörigen Blockpartei rekrutieren – ist damit die demokratische Erneuerung im Osten gescheitert? Wenn Bundespräsident Horst Köhler einem namhaften Künstler das Bundesverdienstkreuz verleiht, im Wissen darum, dass der Geehrte nach den Kriterien der Stasi-Unterlagenbehörde ein Spitzel des DDR-Geheimdienstes war – lässt dann selbst der höchste Repräsentant der Bundesrepublik die nötige Distanz zu den Stützen der Diktatur vermissen?
Nach dem Zusammenbruch der DDR wollten es die Deutschen besser machen als fünfundvierzig Jahre zuvor. Heute steht fest: Die Aufarbeitung der zweiten Diktatur auf deutschem Boden ist gründlich gescheitert. Dieses Buch liefert die längst überfällige Bilanz des folgenschweren Versagens in vier entscheidenden Bereichen.
1.Der Umgang mit dem DDR-Unrecht: Die juristische Ahndung der Staatsverbrechen ist fehlgeschlagen. Obwohl es eine der Hauptforderungen der DDR-Bürgerrechtler und der frei gewählten Volkskammer war, die Systemkriminalität zu sühnen, wurden die Täter vom bundesdeutschen Rechtsstaat in empörender Weise verschont. Zudem hat die Politik – anders als im Fall der NS-Aufarbeitung – zum Ausgang dieses Kapitels bis heute keine Rechenschaft abgelegt. Für jahrzehntelanges Diktaturunrecht büßten gerade einmal vierzig Täter hinter Gittern. Ihre Namen werden in diesem Buch zum ersten Mal aufgelistet, viele ihrer Taten dargestellt. Selbst im Auftrag des Regimes begangene Morde behandelten die Richter mit außergewöhnlicher Nachsicht. Für die Opfer war nicht nur dies ein Schlag ins Gesicht. Sie wurden nie angemessen entschädigt.
2.Die Entwicklung der Parteien: Im Westen bleiben die sogenannten Volksparteien CDU und SPD trotz schwindender Mitgliederzahlen politische Interessengruppen, die in der Gesellschaft verankert sind. Im Osten dagegen schrumpft die ohnehin schmale Mitgliederbasis in rasantem Tempo. Ein neuer Typus von Partei hat sich herausgebildet: Vereine, in denen wenigen Funktionsträgern eine nahezu entsprechende Anzahl von Mandaten und Ämtern gegenübersteht. Das heißt: Beinahe jedes aktive Parteimitglied hat auch einen Posten inne. In Niedersachsen und Hessen sind zusammen mehr als doppelt so viele Christdemokraten organisiert wie in allen fünf neuen Ländern. Es macht die ostdeutsche CDU nicht attraktiver, dass etliche einflussreiche Politiker ihre Vergangenheit als Blockflöten verschleiern. Bei den Sozialdemokraten sieht es zahlenmäßig noch trauriger aus, die Partei hat im Osten gerade einmal so viele Mitglieder wie der Landesverband Saar. Die Linkspartei hat sich in einer Lüge eingerichtet. Unverdrossen behaupten ihre Funktionäre, sie hätten mit dem Stalinismus gebrochen – in Wirklichkeit setzen die Parteichefs Oskar Lafontaine und Lothar Bisky auf Kooperation mit Vereinen ehemaliger Systemträger, die bis heute die DDR als besseren deutschen Staat loben.
3.Die Eliten in den Medien, im Öffentlichen Dienst und im Sport: Nach dem Ende der DDR waren die meisten Ostdeutschen gezwungen, sich beruflich neu zu orientieren. In wichtigen Bereichen fällt die Bilanz anders aus, es herrscht verblüffende Kontinuität. In den Regionalzeitungen, die in Ostdeutschland eine monopolartige Stellung innehaben, waren beispielsweise zehn Jahre nach dem Systemwechsel noch immer sechzig Prozent der Journalisten beschäftigt, die sich vor 1989 als Propagandisten der SED verstanden. Wie kaum ein anderer Berufsstand ist die Medienbranche mit ehemaligen MfS-Mitarbeitern durchsetzt. Ihre Vergangenheit sorgt noch immer für Schlagzeilen, weil eine systematische Überprüfung unterblieben ist. Selbst in Bundesministerien arbeiten noch heute Agenten der DDR-Auslandsspionage. Die DDR war dank krimineller Funktionäre, Trainer und Ärzte mit 572 olympischen Medaillen die erfolgreichste Sportnation der Welt – mit diesem Potenzial ist das vereinte Deutschland bis heute auf Medaillenjagd.
4.Die staatlich geförderte Aufarbeitung: Für das richtige Gedenken an die zweite deutsche Diktatur stehen Jahr für Jahr weit über hundert Millionen Euro bereit. Die Deutschen lassen sich ihren Ruf als «Weltmeister der Aufarbeitung» etwas kosten. Wissenschaftler und Publizisten haben 53000Publikationen über die DDR und den Transformationsprozess hervorgebracht – dennoch strahlt das Bild der DDR umso heller, je weiter sie zurückliegt. Selbst bei denen, die sie nicht aus eigenem Erleben kennen. Daran sind die Institutionen der Aufarbeitung selbst nicht ohne Schuld. Die vom Bund eingerichtete Aufarbeitungs-Stiftung kooperiert wie selbstverständlich mit der Rosa-Luxemburg-Stiftung, die MfS-Generälen ein Podium bietet. Die hochgelobte Stasi-Unterlagenbehörde wiederum krankte schon an einem Geburtsfehler – die Stasi schrieb am Gründungskonzept mit und nistete sich sogleich dort ein. Rund siebzig hauptamtliche MfS-Mitarbeiter wirkten in Deutschlands größtem Aktenimperium, was unter den beiden Bundesbeauftragten Joachim Gauck und Marianne Birthler verheimlicht wurde.
«Vorwärts und vergessen» ist kein Buch über den Osten. Das Scheitern der DDR hat auch westdeutsche Gewissheiten und Weltbilder erschüttert. Seit der Regierungszeit von Willy Brandt arrangierte sich die Bundesrepublik im Status quo der Teilung, der antitotalitäre Konsens schwand. Die politische Klasse in Bonn, Zeitgeschichtler und Intellektuelle betrachteten die DDR zunehmend als eine gleichberechtigte Alternative mit gewissen sozialen Errungenschaften. In diesem Koordinatensystem gerieten die wichtigsten Normen aus dem Blick: die Menschenrechte und die Demokratie. Es war erst die ostdeutsche Bürgerrechtsbewegung, die im Herbst 1989 den Westdeutschen einen Begriff in Erinnerung rief, den sie längst mit einem Tabu belegt hatten – den der Diktatur. Auch die Politik der Kollaboration hätte einer Klärung bedurft, doch das Eigeninteresse des Westens verhinderte dies. Die Chance eines gemeinsamen Neuanfangs war damit vertan.
Der Historiker Hans-Ulrich Wehler hat kürzlich Stefan Heyms Formel von der DDR als «Fußnote der Weltgeschichte» wiederaufgegriffen. Das östliche Gesellschaftsmodell habe in jeder Hinsicht in eine Sackgasse geführt – deshalb habe die Bundesrepublik mit dem «Recht des historisch Überlegenen» die kollabierte DDR aufgenommen. Nach dem Vorbild des westdeutschen Modells müssten nun alle falschen Weichenstellungen, die in der DDR vorgenommen worden seien, korrigiert werden.
Schön, wenn es so einfach wäre.
TEIL I
EIN STAAT GEHT UNTER, DAS UNRECHT BLEIBT
Das Archiv des Verbrechens
Einem Fernschreiben von Willy Brandt verdankt die Nachwelt ein einzigartiges Archiv. Der Regierende Bürgermeister von Berlin richtete es am 5.September 1961, drei Wochen nach dem Mauerbau, an die westdeutschen Ministerpräsidenten. Zu diesem Zeitpunkt waren am «antifaschistischen Schutzwall» bereits zwei Männer von Grenzsoldaten erschossen worden. Brandt wollte dies nicht tatenlos hinnehmen. Er bat seine Kollegen, gemeinsam für die «umfassende Strafverfolgung der Untaten der Gewalthaber der SED»1 zu sorgen. So entstand die «Zentrale Erfassungsstelle der Landesjustizverwaltungen» mit Sitz in Salzgitter. Drei Jahrzehnte lang wurden hier alle verfügbaren Informationen über Verbrechen gegen die Menschlichkeit in der DDR festgehalten.
Bis zur Wiedervereinigung hatte die kleine Behörde, in der normalerweise zwei Staatsanwälte, zwei Sachbearbeiter und drei Schreibkräfte arbeiteten, 32Kubikmeter Akten angesammelt. In der großen Zentralkartei waren die Namen von 70000Opfern und 10000Beschuldigten erfasst. Zudem hatte man in 42000Fällen Beweise für staatliche Willkürhandlungen gesichert, darunter unzählige Aussagen von Zeugen. In den Unterlagen ist das ganze Ausmaß des Unrechts dokumentiert: Terrorurteile einer willfährigen Justiz, Misshandlungen von Strafgefangenen und Tötungsdelikte an der innerdeutschen Grenze.
Nie zuvor in der Geschichte sind die Verbrechen einer Diktatur so akribisch registriert worden. Die Deutschen hätten auf die Datensammlung stolz sein können. Doch Mitte der neunziger Jahre verschwanden die Akten still und leise im Keller des Braunschweiger Oberlandesgerichts, wo sie allmählich verstaubten. Das Erbe von Salzgitter wurde kalt entsorgt, weil der Anspruch, mit dem es einst verbunden war, im Westteil des nun vereinten Landes immer weniger zählte.
Brandt hatte in seinem Fernschreiben betont, er wolle «allen Anhängern und Dienern des Pankower Regimes» vor Augen führen, «dass ihre Taten registriert und sie einer gerechten Strafe zugeführt werden». Ursprünglich hatte er eine schon bestehende Einrichtung mit dieser Aufgabe betrauen wollen – sie war 1958 im württembergischen Ludwigsburg gegründet worden, um nationalsozialistische Straftäter zu verfolgen. Brandt hielt genau diese Institution für «besonders geeignet», wegen der «nahezu völligen Identität der jetzt vom SED-Regime in der Zone und in Ost-Berlin angewandten Methoden mit denen des Nationalsozialismus». Schließlich verständigte man sich darauf, die SED-Straftaten getrennt aufzuklären – in Niedersachsen, dem Bundesland mit der längsten Grenze zur DDR.
Als die Erfassungsstelle Salzgitter am 24.November 1961 ihre Tätigkeit aufnahm, gelobte der niedersächsische Justizminister Arvid von Nottbeck (FDP) feierlich: «Wir werden nichts vergessen, und es wird nichts verjähren.» Diesem Auftrag fühlten sich alle Bundestagsparteien verpflichtet – wenigstens für einige Jahre. Doch im Gefolge der Entspannungspolitik wurde die «Buchhaltung des Verbrechens». («Weltwoche») als Hindernis für gute Beziehungen zu Ost-Berlin empfunden – die Dokumentation der SED-Untaten galt als Anmaßung. Nur die Union hielt geschlossen daran fest. Doch am Ende hat auch sie den Geist von Salzgitter verraten. Im September 1991 redete Bundesinnenminister Wolfgang Schäuble (CDU) die Funktion der Unrechtskartei klein: «Unser Ziel war nicht in erster Linie, eines Tages die Verantwortlichen vor Gericht zu stellen.»2 Diese Falschbehauptung sollte politisches Kalkül verschleiern: Die Bundesregierung war in Wahrheit schon nicht mehr an einer Bestrafung der SED-Täter interessiert.
Viel früher hatte sich die SPD von Salzgitter verabschiedet. Niedersachsens Justizminister Horst Schäfer wollte die Erfassungsstelle schon 1970 auflösen. Im September 1984 forderte der Ostpolitiker Egon Bahr, der das Nachdenken über das Verfassungsgebot der Wiedervereinigung als «politische Umweltverschmutzung» bezeichnete, die Abwicklung der Behörde. Kurz darauf erklärte die SPD-Bundestagsfraktion unter Hans-Jochen Vogel, die Zentrale Erfassungsstelle Salzgitter sei «gemessen an der ihr gestellten Aufgabe wirkungslos und überflüssig».
Im selben Jahr dokumentierte die Behörde 2175Hinweise auf Unrechtstaten – trotz rückläufiger Tötungsdelikte so viele wie nie zuvor. Dieser traurige Rekord wurde 1985 mit 2660Fällen noch einmal übertroffen. SPD-Größen wie die Ministerpräsidenten Johannes Rau und Oskar Lafontaine sowie die Oppositionsführer Björn Engholm und Gerhard Schröder ignorierten diese Tatsachen. «Ich finde die Frage, wie man die Elbe sauber kriegt, viel wichtiger», erklärte Schröder im Dezember 1985 vor einem Treffen mit Erich Honecker in Gera.3 Seinem Duz-Freund («Mein lieber Erich») verhalf der spätere Kanzler im August 1988 zu einem spektakulären Propagandaerfolg: Hinter den Kulissen sorgte er dafür, dass eine knappe Ratsmehrheit der Stadt Salzgitter für die Abschaffung der Erfassungsstelle plädierte. Honecker gewährte der niedersächsischen Kommune zum Dank eine Städtepartnerschaft mit dem thüringischen Gotha.
Zuständig für Salzgitter war allerdings der Bundesrat. Weil die SPD dort keine Mehrheit besaß, versuchte sie auf anderem Weg, die Behörde auszuhebeln. Ab 1988 stoppten die SPD-Länder Bremen, Hamburg, Nordrhein-Westfalen und das Saarland die Finanzierung, ein Jahr später auch Schleswig-Holstein. Um Salzgitter zu retten, musste der Bund seine Zuwendungen verdoppeln. Dann kündigte auch Berlin den Rückzug an, was SPD-Bürgermeister Walter Momper im Mai 1989 so begründete: «Die Stelle ist so überflüssig wie ein Kropf. Sie bringt nichts, sie schadet nichts, aber sie kostet nur Geld. Und das Geld dafür haben wir nicht.»4 Ein schräges Argument: Berlin musste 1989 nach dem Finanzierungsschlüssel gerade einmal 6373D-Mark überweisen, insgesamt kostete Salzgitter nur 256000D-Mark.5
Das Geld war gut angelegt. Es bremste im anderen Teil Deutschlands den Eifer von Grenzsoldaten oder Gefängniswärtern, die sich die Möglichkeit, später als Rentner unbeschwert in die Bundesrepublik reisen zu können, nicht nehmen wollten. Dass dort Unrechtstaten bestraft wurden, war bekannt und wirkte auf potenzielle Täter abschreckend. Doch SPD-Fraktionsvize Jürgen Schmude hatte noch im März 1984 diese «institutionalisierte Drohung gegenüber Bürgern der DDR» in scharfer Form kritisiert. Grenzübertritte mit Waffengewalt zu verhindern sei für DDR-Soldaten eine Amtspflicht, die nicht durch eine westdeutsche Institution in Unrecht verwandelt werden dürfe.6 Die Partei von August Bebel rechtfertigte damit indirekt das Töten wehrloser Menschen, obwohl die DDR gleichermaßen gegen ihre eigene Verfassung als auch gegen völkerrechtliche Verpflichtungen verstieß.7 Die SED-Machthaber konnten zufrieden sein.
Schon Walter Ulbricht hatte nichts unversucht gelassen, um die Arbeit in Salzgitter zu sabotieren. Ein Gesetz bedrohte DDR-Bürger, die Informationen dorthin meldeten, mit bis zu fünf Jahren Haft. Die westdeutschen Mitarbeiter der Erfassungsstelle wurden sogar wegen der «völkerrechtswidrigen Verfolgung» von DDR-Bürgern auf die Fahndungsliste gesetzt. Honecker hielt diese Sanktionen aufrecht. Die Auflösung der Behörde war eine der vier «Geraer Forderungen», mit denen er im Oktober 1980 die Zweistaatlichkeit zementieren wollte. Im «Neuen Deutschland» ließ er Salzgitter als «Einrichtung des Revanchismus» schmähen, dort seien die «alten und neuen Nazis» am Werk. An der Stasi-Hochschule in Potsdam-Eiche entstand eine Dissertation über «Probleme der politischoperativen Bekämpfung dieser Feindzentrale».8 Noch am 17.Dezember 1989 forderte Gregor Gysi auf dem letzten Parteitag der SED vor ihrer Umbenennung in PDS: «Die Erfassungsstelle Salzgitter gehört als Relikt des Kalten Krieges abgeschafft!»9
Ganz im SED-Jargon hatte FDP-Vize Wolfgang Gerhardt schon im Januar 1986 von einem «Relikt aus der Zeit des Kalten Krieges» gesprochen.10 Zwei Jahre zuvor hatte Helmut Kohls Kanzleramtschef Philipp Jenninger (CDU) wegen der rückläufigen Zahl von Todesfällen an der Grenze angekündigt: «Wenn keine Erkenntnisse mehr vorliegen, löst sich diese Stelle in der Tat auf.»11 Auch die CDU wollte nicht länger als deutschlandpolitischer «Eisenbeißer». (Klaus Bölling) verspottet werden. Anfang 1988 debattierte sie über die «Modernisierung» ihrer Deutschlandpolitik – dieser Neuorientierung, die Kohl im letzten Moment stoppte, wäre wohl eines Tages auch Salzgitter geopfert worden. Die ansonsten bei Menschenrechtsverletzungen hellwache «Tageszeitung» empfahl sogleich eine «Umwidmung» der Behörde: «Erfasst lieber die Umwelttäter!»12
Dann fiel die Mauer, und zur Verblüffung des Westens baten die Ostdeutschen fast inständig darum, die Aufzeichnungen in Salzgitter unter keinen Umständen zu vernichten. Zuerst meldeten sich Leipziger Kirchenkreise zu Wort. In der Erfurter SED-Zeitung «Das Volk» sprach sich sogar ein offenbar schwer erschütterter Ex-Stasi-Offizier dafür aus, die Akten in die DDR zu holen, «in denen die Übergriffe der Staatsmacht gegen DDR-Bürger aufgezeichnet sein sollen». Im Januar 1990 druckte die «Magdeburger Volksstimme», ebenfalls ein SED-Blatt, eine große Salzgitter-Reportage und urteilte: «Nicht die Erfassungsstelle war unser Problem, sondern unsere eigenen politischen Zustände.» Man habe versucht, «der Hässlichkeit zu entrinnen, indem man den Spiegel zerschlägt».13 Der DDR-Ministerpräsident Lothar de Maizière (CDU) beteuerte, die Bürger seines Landes hätten die Einrichtung nie als Grundlage für Rache und Vergeltung verstanden, sondern als Möglichkeit, «um eines fernen Tages Gerechtigkeit üben zu können».14 Die Ost-Berliner Untersuchungskommission gegen Amtsmissbrauch und Korruption wollte die Salzgitter-Dossiers für ihre Arbeit nutzen. Das DDR-Justizministerium forderte sie an, um Richter und Staatsanwälte auf ihre Vergangenheit zu überprüfen. Politisch Verfolgte wollten sie für ihre Rehabilitierung einsehen.
Das enorme Interesse der Ostdeutschen an den Unterlagen düpierte alle Westdeutschen, die Salzgitter um des lieben Friedens willen hatten opfern wollen. Dennoch wurde die Erfassungsstelle 1992 überhastet und gegen den Rat von Experten geschlossen. Bald darauf verschwanden die Akten im Gerichtskeller. Erst fünfzehn Jahre später wurde das Bundesarchiv beauftragt, sie für die zeitgeschichtliche Forschung aufzubereiten, um der zunehmenden Verharmlosung und Glorifizierung der DDR zu begegnen. Der Anstoß dazu kam von FDP-Politikern, die es künftigen Generationen ermöglichen wollten, die Unrechtsmechanismen im untergegangenen Staat besser zu begreifen.
Doch trotz dieser späten Einsicht steht Salzgitter vor allem für dramatisches Versagen. Im Gründungsbeschluss der Erfassungsstelle heißt es, die Verbrechen des SED-Regimes sollten dokumentiert werden, um «dafür Sorge zu tragen, dass sie zu gegebener Zeit gesühnt» werden. Diesen Auftrag hat das vereinte Deutschland schlicht ignoriert.
Ein Nürnberger Prozess gegen Kommunisten?
Nach dem Untergang der DDR wollten es die Deutschen besser machen als fünfundvierzig Jahre zuvor. Die Vergangenheit sollte nicht gnädigem Vergessen anheimfallen, sondern rückhaltlos aufgeklärt werden. Dieses Mal wollte man die Täter zur Rechenschaft ziehen und den Opfern Gerechtigkeit widerfahren lassen – so weit die guten Vorsätze. Die Praxis sah anders aus: Der Rechtsstaat war unfähig, die Staatsverbrechen der zweiten deutschen Diktatur angemessen zu ahnden. Statt Unrecht kenntlich zu machen, verwischte man es. Im Namen des Volkes wurden die Opfer ein zweites Mal mit Füßen getreten. So wirkt das Erbe der SED-Herrschaft auf fatale Weise fort – und wir müssen uns nicht wundern, wenn die DDR im Nachhinein zum besseren Deutschland verklärt wird. Der Prozess gegen Erich Honecker und andere höchste Repräsentanten der SED zeigt exemplarisch, dass die Deutschen aus der Aufarbeitung der NS-Vergangenheit wenig gelernt haben. Er geriet zum Trauerspiel – und zu einem Lehrstück über die Mitschuld des Westens.
Es war ein Prozess ohne Beispiel in der deutschen Geschichte. Ab dem 12.November 1992 musste sich Erich Honecker vor dem Berliner Landgericht wegen der Todesschüsse an der innerdeutschen Grenze verantworten: Totschlag in zwölf Fällen wurde ihm zur Last gelegt. Sein erstes Opfer, der 20-jährige Peter Müller, war im Juni 1964 im Harz von einer Mine zerfetzt worden. Als letzter Flüchtling wurde der ebenfalls 20-jährige Chris Gueffroy im Februar 1989 an der Berliner Mauer erschossen. Zunächst hatte die Staatsanwaltschaft dem Beschuldigten sogar 68 solcher Totschlagdelikte vorgeworfen. Doch dem Gericht war an einem schnellen Prozess gelegen. Die besondere Bedeutung des Verfahrens lag darin, dass ein ehemaliges Staatsoberhaupt angeklagt war – noch nie seit der Entstehung des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation war ein deutscher Herrscher vor Gericht gestellt worden, weil er fundamentale Rechte seiner Untertanen verletzt hatte.15
Der Honecker-Prozess war auch aus einem zweiten Grund ein Novum. Die Deutschen wollten erstmals in ihrer Geschichte in Eigenregie eine totalitäre Vergangenheit mit den Mitteln des Rechts aufarbeiten. Nach dem Ende des Dritten Reichs hatten ihnen die alliierten Siegermächte einen Gutteil dieser Arbeit abgenommen. Nach dem Untergang des SED-Regimes galt es nun, ein eigenes Drehbuch zu schreiben. Ob es etwas taugte, musste sich im Verfahren gegen den Mann erweisen, der als Staatsratsvorsitzender und SED-Generalsekretär über beinahe unbeschränkte Macht verfügt hatte. Mit dem 80-jährigen Honecker waren zudem weitere hohe Repräsentanten des ostdeutschen Staates angeklagt: Willi Stoph (Vorsitzender des Ministerrates, 78Jahre), Erich Mielke (Minister für Staatssicherheit, 84Jahre), Heinz Keßler (Minister für Nationale Verteidigung, 72Jahre), Fritz Streletz (Stellvertretender Verteidigungsminister, 66Jahre) und Hans Albrecht (SED-Bezirkschef von Suhl, 72Jahre). Honecker, Stoph und Mielke, die drei ältesten Angeklagten, hatten dem allmächtigen Politbüro zusammen mehr als hundert Jahre angehört. Sie hatten die DDR geprägt wie sonst nur Walter Ulbricht.
Eine ganze Epoche musste juristisch aufgearbeitet werden, und entsprechend groß war das Interesse des Publikums. Seine Geduld wurde jedoch auf eine harte Probe gestellt. Der Rechtsstreit war erst nach acht Jahren endgültig abgeschlossen. Sechs Gerichte waren beteiligt.16
Das Verfahren gegen Honecker & Co. war ein Testfall für das Gelingen der inneren Einheit. Die meisten Zeitgenossen waren sich dessen bewusst, deshalb war bald von einem «Jahrhundertprozess»17 die Rede. Man wies auf Parallelen zum Nürnberger Prozess hin, ohne den ein demokratischer Neuanfang in den westlichen Besatzungszonen undenkbar gewesen wäre. Diese Analogie führte aber auch in die Irre: Zur Aburteilung der Hauptverantwortlichen des NS-Regimes hatten die Alliierten ein international besetztes Sondergericht geschaffen und es mit Sonderrecht ausgestattet. Für den Staatsführer Honecker und seine Gefolgsleute hingegen war eine herkömmliche Strafkammer zuständig, vor der sich sonst normale Kriminelle verantworten mussten. Es gab ein erprobtes Strafrecht und eine bewährte Strafprozessordnung. Andererseits ging es sowohl in Nürnberg als auch in Berlin darum, unter den Augen der Weltöffentlichkeit das Unrecht einer totalitären Ära kenntlich zu machen. Keiner sah das so deutlich wie Honecker – er hat den Begriff vom «Nürnberger Prozess gegen Kommunisten»18 geprägt.
Waren Berlin und Nürnberg also doch wesensverwandt? Honecker, obgleich er selbst den historischen Bogen geschlagen hatte, sträubte sich entschieden dagegen: «In der DDR gab es keine Konzentrationslager, keine Gaskammern, keine politischen Todesurteile, keinen Volksgerichtshof, keine Gestapo, keine SS», legte er vor Gericht dar. «Die DDR hat keine Kriege geführt und keine Kriegs- und Menschlichkeitsverbrechen begangen.»19
Richtig ist: Erich Honecker war nicht Adolf Hitler und die DDR nicht das Dritte Reich. Gemessen an der Schreckensbilanz der nationalsozialistischen Herrschaft, die den Völkermord an den Juden begangen und einen Weltkrieg angezettelt hatte, verblassen die Untaten des realsozialistischen Experiments auf deutschem Boden. Der Holocaust-Staat und die Hammer-und-Zirkel-Republik könnten nicht gleichgesetzt werden, meinte auch der Schriftsteller Ralph Giordano. Der Sohn einer deutsch-jüdischen Klavierlehrerin, der als Jugendlicher von der Gestapo misshandelt worden war und untertauchen musste, hat gleichwohl früh darauf hingewiesen, dass es aus der Sicht der Opfer kein «schlimm» und «weniger schlimm» gibt.20 Er fragte: «Wird ein so scheußliches System, wie das des real existierenden Sozialismus, etwa weniger scheußlich dadurch, dass es ein noch scheußlicheres gab?» Aus dieser Perspektive ist die Behauptung, wonach das NS-Reich Berge von Leichen und die SED-Diktatur nur Berge von Akten hinterlassen habe, nur zynisch. SPD-Vordenker Erhard Eppler griff die Redewendung 1995 dennoch auf, um eine Normalisierung im Verhältnis seiner Partei zur PDS zu rechtfertigen.21
Die DDR war in die zweite «universelle Scheußlichkeit». (Giordano) des 20.Jahrhunderts eingebettet – den Stalinismus. Ihm fielen nicht zuletzt viele Sozialdemokraten zum Opfer. Dieses Gewaltsystem hatte kommunistische Funktionäre wie Honecker, Stoph und Mielke geprägt, schon bevor die Nationalsozialisten an der Macht waren. Die Blutspur der sowjetischen Bajonette irritierte sie nicht im Geringsten.
Nach 1945 unterstützten und beförderten sie vorbehaltlos den Terror der sowjetischen Besatzungsmacht in Ostdeutschland, die «Säuberung» der Gesellschaft von «feindlichen Elementen». Allein in den zehn Speziallagern der SBZ, die auf Befehl des Volkskommissariats für Innere Angelegenheiten der UdSSR (NKWD) zwischen 1945 und 1950 betrieben wurden, starb mehr als jeder Dritte: knapp 43000 der 122671 inhaftierten Menschen22. Die Toten wurden in anonymen Massengräbern verscharrt, die SED bereicherte sich an ihrem Vermögen.
Die Internierungspraxis, an der die ostdeutsche Volkspolizei beteiligt wurde, sprach rechtsstaatlichen Grundsätzen hohn. Sieht man von einfachen Mitläufern ab, waren Nationalsozialisten unter den Eingesperrten in der Minderheit. Unterschiedslos wurden Kommunisten und Sozialdemokraten, Konservative und Liberale, Adlige und Großbauern, Fabrikanten und Großhändler, Frauen und Jugendliche festgesetzt. Über 19000Insassen (24Prozent der Überlebenden) wurden in die Sowjetunion zur Zwangsarbeit deportiert. Nach Auflösung der Lager brachte man etwa 14000Personen (18Prozent) in DDR-Gefängnisse. Bezeichnend ist, dass die übrigen rund 45000Lagerinsassen (57Prozent) in die Freiheit entlassen und nicht weiter behelligt wurden. Allerdings durften sie über ihr erlittenes Martyrium – brutale nächtliche Verhöre, Geständniserpressung, Scheinhinrichtungen, Schläge und Schlafentzug – nicht öffentlich reden. Das Thema wurde in der DDR totgeschwiegen, solange sie existierte.
Der Etablierung der zweiten deutschen Diktatur dienten auch die sowjetischen Militärtribunale. Sie erledigten für die SED die «politische Schmutzarbeit», wie der Historiker Karl Wilhelm Fricke es ausdrückte. Zwischen 1945 und 1955 verurteilten die Tribunale 2943 deutsche Zivilisten zum Tode, in 2223Fällen wurden die Strafen vollstreckt. 927Deutsche wurden zur Hinrichtung eigens nach Moskau gebracht. Einige von ihnen waren zuvor von der Stasi gewaltsam aus West-Berlin und der Bundesrepublik verschleppt worden. Selbst nach sowjetischer Klassifizierung waren Kriegsverbrecher unter den Exekutierten in der Minderheit. Die meisten Todesurteile wurden mit den Vorwürfen der «Spionage» und der Mitgliedschaft in «konterrevolutionären Organisationen» begründet, danach folgten «Banditentum» sowie «Kriegs- und Gewaltverbrechen». Letztere spielten von 1950 bis 1955, also nach Gründung der DDR, praktisch keine Rolle mehr.23 Die SED hielt sich bei den «Säuberungen» zurück, um ihre ohnehin schwache Akzeptanz nicht völlig auszuhöhlen. Der kommunistischen Kaderpartei «neuen Typs» fehlte zudem jede demokratische Legitimation. Bei den freien Gesamtberliner Wahlen im Oktober 1946 kam sie auf dürftige 19,8Prozent der Stimmen. Damit landete sie hinter der CDU (22,2Prozent) und weit abgeschlagen hinter der SPD (48,7Prozent), obwohl deren Kandidaten im Ostteil der Stadt nicht antreten durften. Bei den parallel abgehaltenen Wahlen in den ostdeutschen Ländern konnte die SED nirgends die absolute Mehrheit erringen, obwohl sie sich kurz zuvor die SPD zwangsweise einverleibt hatte.
Eine Blutspur haben auch Ulbricht und sein Nachfolger Honecker hinterlassen. Schon vor Gründung der DDR verhängten deutsche Gerichte auf dem Gebiet der SBZ mindestens 142Todesurteile, von denen 48 vollstreckt wurden. Bis 1981 folgten nochmals 235Todesurteile, die zu 164Hinrichtungen führten.24 Auch ohne Gerichtsurteile wurden Menschen getötet. Nie aufgeklärt werden konnten rätselhafte Todesfälle im Umfeld der in der Bundesrepublik tätigen SED-Firmen und ausländischer Holdinggesellschaften, die 1989 einen Umsatz in Milliardenhöhe erzielten. Vermutlich sind mindestens 30Verantwortliche liquidiert worden, weil Ost-Berlin den Verrat von Geschäftspraktiken befürchtete. Die meisten von ihnen wurden in die DDR gelockt, begingen dort angeblich Selbstmord, starben angeblich an Herzversagen oder kamen angeblich bei einem Sturz ums Leben. Die Urnen mit der Asche der Toten wurden der Bundesrepublik übergeben.25 In den Gefängnissen der DDR starben vermutlich 2500Häftlinge eines unnatürlichen Todes.26 Laut Gefangenenkartei waren zwischen 1950 bis 1989 rund 700000Menschen27 inhaftiert, davon mehr als 20000028 aus politischen Gründen. In manchen Jahren wurden allein wegen tatsächlich versuchter oder nur geplanter «Republikflucht» bis zu 10000Bürger eingesperrt. Bezogen auf die Einwohnerzahl verbüßten in der DDR etwa dreimal so viele Menschen wie in der Bundesrepublik Freiheitsstrafen, die zudem unverhältnismäßig lang waren.29 Der Justizapparat war von Beginn an ein Instrument der SED und verstand sich auch so.
Die neuerrichtete Diktatur war keine Abkehr, sondern die Fortsetzung der NS-Diktatur, stellte der Jurist Rudolf Wassermann Anfang der neunziger Jahre fest. Trotz aller Unterschiede bestünden zwischen beiden totalitären Systemen «bestürzende Parallelen».30 Deshalb ist der Vergleich zwischen dem Nürnberger Prozess und dem Verfahren gegen Honecker in Berlin keinesfalls abwegig. Die Herausforderungen waren ganz ähnlich.
Die Ergebnisse könnten jedoch kaum unterschiedlicher sein. Nürnberg hat sich tief in das kollektive Gedächtnis eingeprägt. Der Prozess enthüllte das «düstere Panorama des Dritten Reiches», wie es der stellvertretende US-Hauptankläger Robert Kempner ausdrückte. Nürnberg hat darüber hinaus Rechtsgeschichte geschrieben und die Weiterentwicklung des Völkerrechts beeinflusst.
Berlin ist in dieser Hinsicht folgenlos geblieben. Von vornherein verzichtete man darauf, das gesamte Panorama des SED-Regimes auszuleuchten. Es fiel nur ein kleines, aber immerhin grelles Schlaglicht – auf die Todesfälle an der innerdeutschen Grenze. Der Prozess konnte die mit ihm verbundenen Erwartungen nicht erfüllen. Schon bevor er beendet war, charakterisierten Medien ihn als «Provinzposse», «Groteske» und «Farce». Denn er zeigte, dass es den Deutschen nicht gelungen war, das Unrecht einer Diktatur in eigener Verantwortung juristisch angemessen aufzuarbeiten.
Der Misserfolg der deutschen Premiere hat viele Väter: die Politik, die Richter und die Strafverfolgungsbehörden. Letztere trifft die geringste Schuld: Staatsanwälte aus beiden Teilen Deutschlands bemühten sich drei Jahre lang um den Erfolg. Bereits am 8.November 1989, am Vortag des Mauerfalls, hatte die Generalstaatsanwaltschaft der DDR gegen Honecker ein Ermittlungsverfahren wegen Amtsmissbrauchs und Korruption eingeleitet. Der Schritt war dem Druck der Straße geschuldet und entbehrte nicht einer gewissen Absurdität. Dieselben Justiz-Funktionäre, die Wochen zuvor noch das Recht im Auftrag der SED verbogen hatten, verfolgten plötzlich Rechtsverletzungen durch SED-Obere. Dem Eifer der frischgewendeten Fahnder setzten jedoch die Ärzte bald Schranken: Sie bescheinigten dem entmachteten Partei- und Staatschef am 6.Dezember 1989, dass er nur stark eingeschränkt vernehmungsfähig und nicht haftfähig sei.
Es war ein Mann von außen, der Jenaer Hochschullehrer und Strafrechtsprofessor Lothar Reuther, der frischen Wind in die Ermittlungen brachte. Im Januar 1990, kurz nach seiner Ernennung zum Leiter einer Untersuchungsgruppe zur «Aufklärung von Straftaten der ehemaligen Staats- und Parteiführung» sowie zum Stellvertretenden Generalstaatsanwalt, erwirkte er gegen Honecker einen neuen Haftbefehl und ließ ihn ins Untersuchungsgefängnis Berlin-Rummelsburg bringen. Reuther warf dem gestürzten DDR-Herrscher ein Verbrechen vor, das äußerst selten vor Gericht verhandelt wird: Hochverrat. Diese Strafvorschrift hatte in der deutschen obrigkeitsstaatlichen Tradition stets dem Schutz der Machthaber gedient. Wegen Hochverrats wurde Karl Liebknecht 1907 aufgrund «antimilitaristischer Agitation» vor das Reichsgericht gestellt, und die Männer des 20.Juli 1944 wurden nach dem gescheiterten Attentat auf Hitler vom Volksgerichtshof dieses Verbrechens angeklagt. Jetzt wollte Reuther erstmals einen ehemaligen Staatsführer auf diese Weise zur Verantwortung ziehen. Das war kühn und beeindruckte Juristen im Westen. Dabei hatte ihr ostdeutscher Kollege lediglich die DDR-Verfassung zum Maßstab gemacht – und damit den Generalschlüssel gefunden, um die DDR-Systemkriminalität wirksam verfolgen zu können.
Ganz in der Tradition westlicher Demokratien waren in der DDR-Verfassung viele bürgerliche Grundrechte verbrieft. Dazu zählten das Recht auf freie Meinungsäußerung (Artikel 27) und Versammlungsfreiheit (Artikel 28) sowie die Unverletzlichkeit des Post- und Fernmeldegeheimnisses (Artikel 31). Diese Garantien waren wenig wert, zumal es keine Verfassungs- oder Verwaltungsgerichte gab, die über ihre Einhaltung gewacht hätten. Sie bildeten die schöne Fassade vor einer hässlichen Rechtswirklichkeit. So hatte das Ministerium für Staatssicherheit (MfS) nahezu industrielle Methoden zur systematischen Überwachung des Telefonverkehrs und der Postsendungen entwickelt. Allein die Abteilung M (Postkontrolle) mit zuletzt 2368 hauptamtlichen Mitarbeitern31 öffnete täglich etwa 90000Briefe und 60000Pakete, aus denen im Laufe der Jahre rund 30Millionen D-Mark geraubt wurden. Wegen solcher eklatanten Verfassungsbrüche prüfte Reuther, Honecker zusätzlich nach Paragraph 107 des Strafgesetzbuches der DDR wegen Unterstützung oder Bildung einer kriminellen Vereinigung («verfassungsfeindlicher Zusammenschluss») anzuklagen. Schwerer wog der Vorwurf des Hochverrats. Dieser Straftat machte sich nach Paragraph 96StGB-DDR jeder schuldig, der versuchte, die sozialistische Staats- oder Gesellschaftsordnung «durch planmäßige Untergrabung» zu beseitigen. Das vorgesehene Strafmaß: «lebenslänglich», mindestens aber zehn Jahre Freiheitsentzug.
Im Untersuchungsgefängnis wurde Honecker am 29.Januar 1990 von Reuther eine knappe Stunde verhört. Das schriftliche Protokoll32 zeigt einen Beschuldigten voller Selbstmitleid. Honecker beklagte seine Inhaftierung, die Vorverurteilung durch die Medien und steigenden Blutdruck. Selbst unbestreitbare Fakten leugnete er hartnäckig. Die Volkswirtschaft in einem desolaten Zustand? Zur Krise sei es erst nach seiner Abberufung gekommen: «Bis zu diesem Zeitpunkt kann ich einschätzen, dass die Volkswirtschaft leistungsstark war und sogar Zuwachsraten von bis zu zwei Prozent existierten. Von solchen Zuwachsraten haben andere Länder nur geträumt.» Die rechtswidrigen Verhaftungen friedlicher Demonstranten am 7.Oktober 1989 zum 40.Jahrestag der DDR-Gründung? «Dass es zu Zuführungen gekommen ist und eine angespannte Situation herrschte, habe ich erst am 9.Oktober erfahren.» Die Fälschung der Kommunalwahl im Mai, bei der angeblich 98,85Prozent für die Kandidaten der Nationalen Front stimmten? «Dass es zu Manipulationen gekommen ist, ist mir nicht bekannt.» Selten hat ein deutscher Staatsmann so offensichtlich gelogen.
Honeckers Verhaftung durch den Vize-Generalstaatsanwalt Reuther rief im Westen sogleich den SPD-Politiker Egon Bahr auf den Plan. Per Pressemitteilung und Ferndiagnose stellte er fest, dass sein ehemaliger Gesprächspartner «schwerkrank» sei, und belehrte die ostdeutsche Justiz: In einem «Rechtsstaat wie der Bundesrepublik oder in den USA» würde es zu Haftverschonung kommen. Weder Flucht- noch Verdunkelungsgefahr seien erkennbar.33 Bei keiner Verhaftung eines DDR-Dissidenten hatte Bahr jemals in vergleichbarer Weise interveniert.
Das Ost-Berliner Stadtgericht ordnete prompt die Freilassung des prominenten Häftlings an. Honecker war wenige Wochen zuvor ein Tumor an der rechten Niere entfernt worden, angeblich litt er an «lebensbedrohlichen Herzkomplikationen». So stand es jedenfalls im Attest des Obermedizinalrates Peter Janata, der einst als Gefängnisarzt unter dem Decknamen «Pit» an die Stasi berichtet hatte – laut Verpflichtungserklärung auch über Angelegenheiten, «die der ärztlichen Schweigepflicht unterliegen».
Honecker zog sich erst in die evangelische Sozialanstalt Lobetal und dann ins sowjetische Militärspital Beelitz zurück. Dort kam er offenbar rasch zu Kräften. Der haftunfähige Polit-Pensionär gab mehrmals in der Woche stundenlange Interviews. Gemeinsam mit Ehefrau Margot erläuterte er einem Liedermacher und einem Philosophen seine Sicht auf die DDR. Die Gespräche über Personenkult und Staatssicherheit, Ausreiseprobleme und Antisemitismus sowie Ulbrichts Ablösung und Stalins 70.Geburtstag füllten über zwanzig Tonbänder – aus dem Material wurde das gut 450Seiten dicke Buch «Der Sturz. Erich Honecker im Kreuzverhör» komponiert. Ein Kreuzverhör hätten die Strafverfolger auch gern geführt.
Ende Februar 1990 signalisierte DDR-Justizminister Kurt Wünsche der Generalstaatsanwaltschaft, dass eine Anklage wegen Hochverrats kaum eine Chance haben werde. Er begründete dies mit einer angeblich bevorstehenden Neuregelung des politischen Strafrechts, die es verbiete, den Tatbestand rückwirkend anzuwenden.34 Wünsche hatte schon Ulbricht in gleicher Funktion gedient. Ende März 1990 kapitulierten die Ermittler, sie ließen den Hochverratsvorwurf fallen.35 Zwar waren sie nach wie vor überzeugt, dass die Verfassung permanent verletzt worden war. Das aber lasteten sie plötzlich nicht mehr einzelnen SED-Funktionären wie Honecker an, diese hätten vielmehr «subjektiv» aus einem falschen Rechtsverständnis heraus gehandelt. Reuther erklärte: «Objektiv gesehen sind die Verfassungsbrüche einer deformierten stalinistisch geprägten Haltung von der führenden Rolle der Partei geschuldet und dem gesamten System zuzuordnen.»36 Das «System als Ganzes» ist juristisch eine heikle Konstruktion – sie kennt keine individuelle Verantwortung, sondern nur kollektive Schuld.
Die gerade abgeschüttelte Diktatur wurde mit einer Naturkatastrophe gleichgesetzt, die über das Volk gekommen war.
Der furios gestartete Reuther legte im Frühjahr 1990 alle Ämter nieder. Später trat der Aufklärer als Anwalt der SED-Täter auf. Er verteidigte in Sachsen eine DDR-Richterin, die wegen Rechtsbeugung und Freiheitsberaubung angeklagt war. Um seiner Mandantin das Gefängnis zu ersparen, zog Reuther bis vor das Bundesverfassungsgericht, allerdings ohne Erfolg.
Am 8.August 1990 unternahm die Generalstaatsanwaltschaft der DDR in der Sache Honecker einen allerletzten Anlauf. Sie eröffnete gegen ihn ein Verfahren wegen des Grenzregimes: «Durch die Anwendung von Schusswaffen, durch Explosion von Minen und die Auslösung von Selbstschussanlagen wurde eine erhebliche Anzahl von Personen getötet oder verletzt. Der Beschuldigte steht daher im Verdacht, sich der Anstiftung zum mehrfachen Mord und zur vorsätzlichen Körperverletzung schuldig gemacht zu haben.» Wichtig für den Fortgang der Ereignisse war, dass der Vorwurf auf Mord und nicht auf Totschlag lautete. Mord gilt in allen Rechtsordnungen als schwerste Straftat gegen das Leben eines Menschen und wird härter bestraft als Totschlag. An einen Abschluss des Verfahrens glaubte in Ost-Berlin indes keiner mehr. Denn die Tage der DDR waren gezählt, längst beschäftigten sich die Anklagebehörden im Westen mit dem DDR-Unrecht. Die Todesfälle an der Grenze sollten dabei im Zentrum stehen.
Reuthers Idee war schnell in Vergessenheit geraten. Dabei wäre es auch nach der Wiedervereinigung möglich gewesen, die SED-Machthaber wegen Hochverrats anzuklagen.37 Eine solche Anklage hätte eine hinreichend hohe Strafe erwarten lassen und die Verfolgung der Staatsverbrechen erheblich erleichtern können. Doch über die fortgesetzten Verfassungsbrüche sahen die Strafverfolger einfach hinweg. Dass es auch anders geht, zeigt ein Blick nach Polen: Staatschef Wojciech Jaruzelski hatte 1981 das Kriegsrecht verhängt und wurde deshalb im September 2008 wegen Bildung und Leitung einer «kriminellen Vereinigung bewaffneter Art» angeklagt. Die Staatsanwälte erklärten, er habe gegen die geltende Verfassung verstoßen und das Parlament umgangen.38
Der Fixierung auf Gewalttaten an der innerdeutschen Grenze bei der strafrechtlichen Verfolgung der SED-Spitzenfunktionäre haftet etwas Willkürliches an. Warum sind sie nicht wegen der Verbrechen der Staatssicherheit belangt worden? Warum nicht dafür, dass sie «Urteilsvorschläge» der Justiz verschärften und Freiheitsstrafen willkürlich in Todesstrafen umwandelten?
In der Bilanz der Verbrechen des SED-Staates ist die Jagd auf Menschen, die nicht mehr in ihrem Staat leben wollten, lediglich einer von vielen Posten. Gleichwohl wiegt er schwer. Bis zu 1000Menschen39 sind im deutschen Abschnitt des «Eisernen Vorhangs», wie Winston Churchill die Europa trennende Demarkationslinie genannt hatte, gewaltsam ums Leben gekommen. Allein an der 156Kilometer langen Berliner Mauer, an der an einem normalen Tag rund 2300Soldaten eingesetzt waren, sind mindestens 136Menschen getötet worden.
Mit Beginn der siebziger Jahre wurden unter Honeckers Regie etwa 60000Selbstschussanlagen des Typs SM-70 als «das gegenwärtig wirksamste Element des technischen Ausbaues der Staatsgrenze» aufgestellt. Erprobungsversuche an Reh-, Schwarz- und Federwild hatten zuvor gezeigt, dass der Beschuss mit den «richtungsgebundenen Splitterminen» in drei von vier Fällen tödlich endete. Ein Vermerk hielt fest: «Die Splitterwirkung der durch Wild ausgelösten Minen bestätigt die Aussage, dass Personen, die versuchen, die Sperre zu durchbrechen, tödliche bzw. so schwere Schädigungen erhalten, dass sie nicht mehr in der Lage sind, die Staatsgrenze zu verletzen.» Als die Erkenntnisse im Dezember 1971 im Verteidigungsministerium diskutiert wurden, schlug ein Teilnehmer vor, die Schusstrichter anstelle der Stahlsplitter mit Hartgummikugeln zu füllen. Da es sich um eine Frage von grundsätzlicher politischer Bedeutung handelte, wurde der SED-Chef eingeschaltet. Honecker traf die Entscheidung allein – er votierte für die tödliche Variante mit Stahlsplittern.40
Jahrelang bestritt die DDR die Existenz der martialischen Todesautomaten. Im März und April 1976 aber drang Michael Gartenschläger, der wegen «staatsgefährdender Propaganda» zehn Jahre Haft erlitten hatte und von der Bundesrepublik freigekauft worden war, von westlicher Seite aus in den Todesstreifen ein. Er montierte zwei Selbstschussanlagen ab und präsentierte sie der Öffentlichkeit. Im Mai 1976 wurde Gartenschläger beim Versuch, eine dritte Anlage zu entwenden, in einen Hinterhalt gelockt und erschossen. Im Zusammenhang mit dem von Franz Josef Strauß vermittelten Milliardenkredit entfernte die DDR ab 1983 sämtliche Selbstschussanlagen, was der Westen als «humanitäre Geste» feierte. Doch die Todesautomaten waren veraltet und oft nicht mehr funktionsfähig. Sie waren dank der Perfektionierung des Grenzregimes auch verzichtbar. Jede Grenzkompanie hatte rückwirkend für die letzten zehn Jahre eine «Analysekarte der Grenzverletzerbewegung» zu führen. Die «wissenschaftliche Auswertung von Fluchtversuchen» führte in den achtziger Jahren dazu, dass neun von zehn «Grenzverletzern» weit vor dem letzten Sperrzaun festgenommen wurden. Heikel blieb die Lage in Ost-Berlin, wo die enge Bebauung nicht wie üblich eine fünf Kilometer breite Sperrzone zuließ.
Honecker wollte den «antifaschistischen Schutzwall» bis zum Jahr 2000 endgültig unüberwindbar machen – mit Mikrowellenschranken, Funkmess-Aufklärungsgeräten, Meldungsgebern und Grenzsignalanlagen im Wert von 256,75Millionen Mark. Für die Grenztruppen waren 2,21Milliarden Mark im Staatshaushalt eingestellt.41 Weil das eine enorme Belastung für die hochverschuldete DDR war, sollte die Personalstärke mittelfristig um 17Prozent verringert werden. An der Wacht für «Frieden und Sozialismus» waren 1989 rund 47000Grenzsoldaten beteiligt. Gerade einmal 600 von ihnen wurden für die Grenzen zu Polen und der ČSSR benötigt.42
Grenzsicherung war immer Chefsache – die Todesschüsse eingeschlossen. Das zeigten auch die von der Anklage zusammengetragenen Beweismittel. Das wichtigste Dokument war ein von Erich Honecker unterzeichnetes zwanzigseitiges Wortlautprotokoll der 45.Sitzung des Nationalen Verteidigungsrates vom 3.Mai 1974.Diesem Spitzengremium, von dem die Öffentlichkeit kaum etwas wusste und das eine Art Notstandsregierung für den Kriegs- und Krisenfall war, hatten alle sechs Angeklagten angehört. Deshalb wurde auch vom «Prozess gegen Mitglieder des Nationalen Verteidigungsrates» gesprochen. Das Wortlautprotokoll, die «Geheime Kommandosache» GKdos-Nr.19/74, war von West-Berliner Staatsanwälten in einem Archivkeller des Verteidigungsministeriums in Strausberg bei Berlin entdeckt worden. Es handelte sich um einen Sensationsfund, weil von anderen Sitzungen dieses Gremiums nur knappe Ergebnisprotokolle überliefert sind. Laut Niederschrift hatte Honecker unter Tagesordnungspunkt 4 («Bericht über die Lage an der Staatsgrenze») angeordnet: «Man muss alle Mittel und Methoden nutzen, um keinen Grenzdurchbruch zuzulassen. (…) Nach wie vor muss bei Grenzdurchbruchsversuchen von der Schusswaffe rücksichtslos Gebrauch gemacht werden, und es sind die Genossen, die die Schusswaffe erfolgreich angewandt haben, zu belobigen. An den jetzigen Bestimmungen wird sich diesbezüglich weder heute noch in Zukunft etwas ändern.» Das war der faktische Beweis, dass Honecker einen Schießbefehl verfügt hatte. Stoph, Mielke, Keßler, Streletz und Albrecht nickten ihn ab: «Dem Bericht und den mündlichen Ausführungen wurde unter Berücksichtigung der Ausführungen des Genossen Erich Honecker die volle Zustimmung gegeben.»
Das Amtsgericht Berlin-Tiergarten erließ am 30.November 1990Haftbefehl gegen Honecker. Der jedoch wähnte sich im Beelitzer Spital bei den Westgruppen der Sowjetarmee in Sicherheit. Als Politiker seine Überstellung forderten, entzog sich der einstige Staats- und Parteichef dem Zugriff der Justiz durch Flucht. Am 13.März 1991 ließ er sich nach Moskau ausfliegen. In der «Heimat aller Werktätigen» wurde Honecker Zeuge des Untergangs der UdSSR. Das epochale Ereignis hatte für ihn unangenehme Folgen: Anders als sein zeitweiliger Weggefährte Michail Gorbatschow nahm der neue russische Präsident Boris Jelzin keine Rücksicht auf den Regenten des einstigen Satellitenstaates, zumal der Fall zu ernsten Verstimmungen mit Bonn geführt hatte. Am 16.November 1991 wurde die Ausweisung verfügt. Honecker rettete sich noch als sozusagen letzter deutscher Botschaftsflüchtling in die Moskauer Vertretung der Republik Chile, bis er auch dort nicht mehr erwünscht war. Am 29.Juli 1992 landete er in einer Aeroflot-Maschine auf dem Flughafen Berlin-Tegel und wurde von dort direkt in das Untersuchungsgefängnis der Haftanstalt in Moabit gebracht. Mit seiner Rückkehr hatte in Deutschland kaum jemand gerechnet. Ohnehin war das öffentliche Interesse an Honecker erloschen. Das änderte sich nun schlagartig.
Plötzlich wurde mit erbitterter Schärfe darüber gestritten, ob es überhaupt legitim sei, den abgedankten Diktator vor Gericht zu stellen. Umfragen zeigten, dass in Ost und West eine Mehrheit die Bestrafung der Verantwortlichen des SED-Regimes befürwortete. Im Osten war dieser Wunsch vor dem Hintergrund eigener Erfahrungen ausgeprägter als im Westen. Den Diskurs prägten aber andere – eine kleine Gruppe von Pfarrern, Historikern, Politikern, Rechtsanwälten und Publizisten. Im Dezember 1991 warnte der Wittenberger Pfarrer Friedrich Schorlemmer vor «massiv zutage tretender Rachementalität». Er fürchtete ernsthaft, dass «Volksterror dem Staatsterror» folgen könne. Bestand die Gefahr, dass der Mob die SED-Bonzen an den Laternen aufknüpfte?
Der West-Berliner Grünen-Politiker Wolfgang Wieland hielt «eine sogenannte Aufarbeitung der DDR-Vergangenheit durch Strafverfahren weder für geboten noch für möglich». Schließlich drohe keine Wiederholungsgefahr. Honecker und Mielke seien nicht mehr in der Lage, Menschenrechtsverletzungen zu begehen.43 Mit der gleichen Begründung hätte man nach 1945 auch den Reichsmarschall Hermann Göring oder den NS-Architekten und Rüstungsminister Albert Speer laufenlassen können. Die Forderung des später in Berlin zum Justizsenator ernannten Wieland44 bedeutete einen Rückfall in das Rechtsverständnis vor den Nürnberger Prozessen – seither galt in der westlichen Welt die Auffassung, dass es für einen Kernbestand an Verbrechen in einer Diktatur keine Immunität geben dürfe. Die «Zeit»-Herausgeberin Marion Dönhoff konnte sich ebenfalls nicht mit einer Aufarbeitung des Diktaturunrechts durch die Justiz anfreunden. In dem von ihr herausgegebenen Manifest «Weil das Land Versöhnung braucht» bezeichnete sie die Nürnberger Prozesse als «abschreckendes Beispiel», weil diese «in vielen Schritten nur neues Unrecht geschaffen» hätten. Günter Gaus, einst erster Leiter der Ständigen Vertretung der Bundesrepublik in der DDR, sprach dem wiedervereinten Deutschland vollends die Berechtigung ab, Honecker & Co. den Prozess zu machen. Dafür fehle jede rechtliche Grundlage. Das Grenzregime, so hart es gewesen sei, gehöre zu den staatlichen Souveränitätsrechten.45
Als Modell für den Umgang mit dem SED-Unrecht galt vielen der Westfälische Frieden, mit dem 1648 in Osnabrück der Dreißigjährige Krieg beendet worden war. In Artikel 2 des Friedensvertrags hatten die verfeindeten Seiten «einander immerwährendes Vergessen» versprochen. Taugte dieses Modell, stimmten seine Prämissen? Hatten West und Ost im «Kalten Krieg» miteinander im Krieg gelegen? Die Bürger, die in Umfragen für eine Strafverfolgung plädierten, wussten, dass der Krieg der Machthaber zuerst gegen die Menschen in der DDR gerichtet war.
Nicht der Gegensatz zwischen West und Ost, sondern das Verhältnis zwischen Oben und Unten im Osten beschäftigte viele Bürgerrechtler. Aber auch sie waren unsicher, wie mit den hohen SED-Funktionären zu verfahren sei. In einem selbstkritischen Essay befragte sich Jens Reich, ob es so etwas wie «einen Strafanspruch des Volkes gegenüber Honecker & Co.» geben könne. Seine Antwort: «Leider nein.» Denn: «Jeder Strafanspruch ist gegenstandslos, weil wir beteiligt waren. Wir haben zugesehen. Wir haben weggesehen. Wir haben geschwiegen. Wir haben die Augen gen Himmel geschlagen. Wir haben alles besser gewusst. Viele haben mitgetan. Nur ein ärmliches Häuflein von Menschen hat versucht, den Prozess aufzuhalten.» Doch letztlich war dem Molekularbiologen Reich, der für das Neue Forum in der Volkskammer gesessen hatte und 1994 von den Grünen zur Wahl für das Amt des Bundespräsidenten vorgeschlagen wurde, der Gedanke an Straffreiheit suspekt. Eine Aburteilung der alten Führungsriege, relativierte er, werde dem Volk keine Genugtuung verschaffen. Zugleich stellte er klar: «Wir können Totschlag, Körperverletzung, Folterung und Rechtsbeugung in schweren Fällen sühnen, und ich habe wenig Verständnis (…) für pseudo-rechtsstaatliche formale Rabulistik zum Schutz von Schreibtischtätern.»46
Was Rudolf Augstein im «Spiegel» schrieb, muss man, bei allem Respekt vor diesem großen Journalisten, wohl rabulistisch nennen. In gleich drei Kommentaren geißelte der Magazin-Herausgeber die «Justiz-Farce» gegen Honecker.47 Bonn habe mit dem Ost-Berliner Regime in voller Kenntnis seines Charakters gekungelt. «Geradezu schäbig» sei es, jene Politiker zur Rechenschaft ziehen zu wollen, denen man ihr «doch gar nicht nachweisbares Unrechtsbewusstsein mittels roter Teppiche und großzügiger Kredite sanktioniert hat». Für Augstein war Honecker kein Diktator, sondern eine «Marionette von Moskaus Gnaden». In seiner Logik war es bereits Unrecht, dass Honecker in U-Haft saß. Nicht Honecker und seine Gesinnungsgenossen hätten den recht- und gesetzlosen Stalinismus nach Deutschland hineingeprügelt: «Die Mehrheit des um Hitler gescharten Volkes war es.» Nun wolle man stellvertretend an dem SED-Generalsekretär dafür Rache nehmen.
Die meist wortgewaltigen Aufarbeitungsgegner ließen keinerlei Empathie für die Opfer erkennen. Zugleich hatten sie eine Winzigkeit übersehen – den Einigungsvertrag. Nach dem Willen zweier demokratisch gewählter Parlamente sollten sogenannte «DDR-Alttaten» – also das SED-Unrecht – im neuen Deutschland verfolgt und geahndet werden. Richter und Staatsanwälte waren dazu verpflichtet, sie hätten sich ansonsten der Strafvereitelung im Amt schuldig gemacht. Zur Verfolgung der «Alttaten» war eigens das Einführungsgesetz zum Strafgesetzbuch in Artikel 315 neu gefasst worden, worauf der Einigungsvertrag in Artikel 8 hinweist.
Diese Regelung hat die konservativ-liberale Regierung in Bonn nicht unbedingt gewollt. Ost-Berlin wollte sie sehr wohl. Und weil man der westdeutschen Seite misstraute, forderte die Volkskammer vor ihrer Auflösung den künftigen gesamtdeutschen Gesetzgeber ausdrücklich noch einmal dazu auf, die strafrechtliche Verfolgung des SED-Unrechts sicherzustellen. Auch vor diesem Hintergrund ist es nichts als eine wohlüberlegte Verdummungsstrategie, wenn Vertreter von Stasi-Vereinen oder Politiker der Linkspartei bis heute von westdeutscher «Rache»-, «Sieger»- oder «Kolonial»-Justiz sprechen. Richtig ist: Unter den ostdeutschen Volksvertretern war die Bereitschaft, Lehren aus der Diktatur-Vergangenheit zu ziehen, viel stärker ausgeprägt als bei ihren westdeutschen Kollegen. Das gereicht ihnen bis heute zur Ehre.
So viel zur traurigen Rolle der Politik.
Bleiben die Gerichte. Am 12.November 1992 um 8Uhr 45 öffneten die Wachleute im Moabiter Justizpalast die Türen des Schwurgerichtssaals 700. 65Zuschauer und 70Journalisten bekamen Deutschlands prominentesten Untersuchungshäftling live zu sehen. Ein Pressefoto der Agentur Reuters, längst ein Bilddokument der Zeitgeschichte, zeigt einen in Schriftsätze vertieften Honecker. Die linke Hand liegt über dem Kinn und verdeckt den Mund, die rechte Hand hält ein Blatt Papier. Der Blick hinter der großen Hornbrille ist hellwach. Honecker macht auf dem Foto einen entschlossenen und vitalen Eindruck. Das verblüffte damals auch die Gerichtsreporter. Im Vorfeld des Verfahrens war ausführlich über eine schwere Erkrankung berichtet worden. «Der Prozess ist geplatzt, bevor er begonnen hat», hatte der «Spiegel» prophezeit und aus vertraulichen Gutachten zitiert.48 Der erste Auftritt des Angeklagten passte nicht zu diesen Befunden.
Wegen einer Erkrankung war Willi Stoph dem Gerichtstermin ferngeblieben. Ein daraufhin eingeschalteter Amtsarzt bestätigte eine «stark depressiv geprägte Angststimmung». Damit war der Prozess für den ehemaligen Ministerpräsidenten erledigt. Er hatte am 17.Oktober 1989 im Politbüro den Antrag gestellt, Honecker als SED-Generalsekretär abzulösen: «Erich, es geht nicht mehr, du musst gehen.» Dass die Meuterer Stoph vorgeschickt hatten, empfand Honecker als gezielte Demütigung.49 Schon seit den fünfziger Jahren waren die beiden Führungskader einander in herzlicher Abneigung verbunden gewesen. 1960 hatte Honecker den fast gleichaltrigen Gegenspieler vorübergehend kaltgestellt. Er teilte ihm im Auftrag von Ulbricht mit, dass er nicht Verteidigungsminister bleiben könne. Vorausgegangen war eine Enthüllung des West-Berliner Boulevardblatts «BZ». Es hatte einen Zeitungsartikel aus Stophs Zeit als Unteroffizier der Wehrmacht ausgegraben. Darin pries der Soldat die «wahre Volksgemeinschaft» und schilderte mit warmen Worten eine Begegnung: «Ein Erlebnis von bleibendem Wert war die Geburtstagsparade vor dem Führer. Da wurde geputzt und gearbeitet, denn jede Gruppe hatte den Ehrgeiz, angenehm aufzufallen.» Ost-Berlin war blamiert. Im «Handbuch der Volkskammer» stand über «Stoph, Willi» für die Jahre von 1933 bis 1945: «Illegale antifaschistische Tätigkeit.» Ende der sechziger Jahre war die Episode vergessen, und Stoph galt als aussichtsreicher Anwärter für die Ulbricht-Nachfolge. Weil er Honecker unterlag, galt er lange als «zweiter Mann» der DDR. Mitte der achtziger Jahre soll Stoph versucht haben, den Kreml für die Ablösung Honeckers zu gewinnen.50
Stoph gehörte stets zum innersten Machtzirkel der SED. Sein größter politischer Erfolg waren die deutsch-deutschen Gipfeltreffen im März und Mai 1970 in Erfurt und Kassel mit Willy Brandt. Der Arbeitersohn und gelernte Maurer, wegen seiner soldatischen Pflichtauffassung und asketischen Lebensweise «roter Preuße» genannt, zählte zu den Architekten des Repressionsstaates DDR. Stoph war an der Gründung des Staatssicherheitsapparates und am Ausbau der Kasernierten Volkspolizei beteiligt. Als Innenminister trug er Verantwortung für die Niederschlagung des Volksaufstandes im Jahr 1953.In diesem Schicksalsjahr stieg er ins Politbüro auf. Von 1964 bis 1973 und, nach einer zwischenzeitlichen Entmachtung durch Honecker, von 1976 bis 1989 war er Ministerpräsident. Nachdem er aus dem Prozess ausgeschieden war, lebte Stoph noch gut sechs Jahre unbehelligt von der Justiz. Er starb am 13.April 1999 in Berlin.
Am dritten Verhandlungstag fehlte ein weiterer Angeklagter– Ex-Stasi-Minister Erich Mielke. Gegen ihn wurde schon seit Februar 1992 wegen der «Mordsache Bülowplatz» vor einer anderen Strafkammer des Berliner Landgerichts verhandelt. Diesem Verfahren räumte die Berliner Justiz Vorrang ein, weil man Mielke zwei Prozesse gleichzeitig nicht zumuten wollte. Für die Entscheidung gab es gute Gründe. Der Mordfall war gut dokumentiert und ließ eine rasche Verurteilung erwarten. Andererseits lag die Tat sechs Jahrzehnte und drei Staatsformen zurück – mit Mielkes Rolle in der DDR hatte sie rein gar nichts zu tun.
Die «Mordsache Bülowplatz» ereignete sich zum Ende der Weimarer Republik. Da war Mielke bereits KPD-Mitglied, schrieb als Lokalreporter für die «Rote Fahne» und machte beim paramilitärischen «Parteiselbstschutz» mit. Diese Untergrundgruppe wollte den Tod eines Sympathisanten rächen, der am 8.August 1931 nahe der Berliner KPD-Zentrale (sie beherbergt heute die Linkspartei) am Bülowplatz (nun Rosa-Luxemburg-Platz) nach einem tätlichen Angriff von einem Polizisten erschossen worden war. Am Tag darauf starben zwei Polizeioffiziere durch gezielte Schüsse aus dem Hinterhalt, ein weiterer überlebte schwer verletzt. Nachdem die Nazis an der Macht waren, konnte die Bluttat laut einem Polizeibericht vom 25.September 1933 «restlos» aufgeklärt werden. Der mutmaßliche Mörder Mielke und sein Mittäter Erich Ziemer hatten sich nach der Tat in die Sowjetunion abgesetzt.
In Moskau absolvierte Mielke die militärpolitische Schule der Komintern und arbeitete auch für sowjetische Geheimdienste. Zwischen September 1937 bis Mai 1945 diente er seiner Partei in der «Westemigration». Im Spanienkrieg spürte er «anarchistische» und «trotzkistische» Abweichler in den eigenen Reihen auf. Von Belgien aus organisierte er den Widerstand im Rheinland. In Südfrankreich, wo die Wehrmacht im November 1942 einmarschierte, arbeitete Mielke getarnt als lettischer Staatsangehöriger im Arbeitsdienst des Vichy-Regimes und als «Bausoldat Hitlers» in der Organisation Todt. Er beantragte vergeblich politisches Asyl in Mexiko und nahm Spendengelder einer amerikanischen Hilfsorganisation an. Das gereichte einem Antifaschisten in der späteren DDR nicht zur Ehre und konnte sogar tödliche Folgen haben.
Dem nach Ost-Berlin zurückgekehrten Mielke wurde im Juni 1945 zunächst die Leitung der Polizeiinspektion im Bezirk Lichtenberg übertragen – der Polizistenmörder machte Karriere als Polizeichef. Wegen der «Mordsache Bülowplatz» stellte jedoch das Amtsgericht Berlin-Mitte im Februar 1947 einen Haftbefehl aus, dessen Vollstreckung die sowjetische Kommandantur verhinderte.
Mielke bekam 45Jahre Schonfrist, bevor er vor Gericht gestellt wurde. Nach 86Verhandlungstagen wurde er am 26.Oktober 1993 wegen gemeinschaftlich begangenen Mordes in zwei Fällen und des versuchten Mordes in einem Fall zu einer Freiheitsstrafe von sechs Jahren verurteilt. Auf Mord steht «lebenslang». Das gesetzliche Strafmaß empfand das Gericht aber «als unerträglich»: Die Tat liege 62Jahre zurück, der Täter sei 85Jahre alt. Der Bundesgerichtshof wollte keinen neuen Prozess riskieren und wies Revisionen von Staatsanwaltschaft und Verurteiltem zurück. Im August 1995 wurde Mielke nach fünf Jahren Haft aus dem Gefängnis entlassen. Im Dezember 1997 machte ihm der Rechtsstaat ein schönes Geschenk zum 90.Geburtstag: Seine Eintragung im Strafregister wurde gelöscht. Damit war er im rechtlichen Sinne ein unbescholtener Bürger. Mielke starb am 21.Mai 2000 in einem Berliner Pflegeheim. Auf eigenen Wunsch fand er seine letzte Ruhestätte in einem anonymen Urnengrab auf dem «Sozialistenfriedhof» in Friedrichsfelde, wo auch Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg, Ernst Thälmann und Franz Mehring sowie Walter Ulbricht und Wilhelm Pieck begraben sind.
Mielke war der erste SED-Funktionär, der nach der Wiedervereinigung wegen der Ermordung von Menschen verurteilt wurde. Die Tochter des erschossenen Polizeihauptmanns Paul Anlauf empfand das Urteil als Genugtuung. Sie war mit elf Jahren Vollwaise geworden und trat im Prozess als Nebenklägerin auf. Zehntausende Ostdeutsche hingegen nahmen ungläubig zur Kenntnis, dass die Machenschaften von Mielkes Terrorapparat im Verfahren keine Rolle spielten. Dieses Manko war dem Vorsitzenden Richter Theodor Seidel bewusst – in seiner Urteilsbegründung erklärte er, über dieses Kapitel müsse «die Geschichte» ihr Urteil fällen. Schon jetzt stehe fest, dass der Angeklagte «als einer der gefährlichsten Diktatoren und Polizeiminister in das ‹Buch der Geschichte› eingehen» werde. Ins Geschichtsbuch ist tatsächlich der Mielke-Prozess eingegangen – als Bankrotterklärung der Justiz im Umgang mit der deutschen Vergangenheit.
Die Justiz eines funktionierenden Rechtsstaats darf sich nicht damit begnügen, einen Angeklagten auf möglichst bequeme Weise abzuurteilen. Es ist ihre Aufgabe, individuelle Schuld in angemessenem Umfang aufzuklären und damit einen Beitrag zur allgemeinen Wahrheitsfindung zu leisten – diese Verpflichtung besteht gegenüber dem Beschuldigten selbst, seinen Opfern und der Gesellschaft insgesamt. Mielke hatte sich eines Doppelmordes schuldig gemacht, doch im Register seiner Verbrechen war das gewiss nicht der größte Posten. Ihm ist der falsche Prozess gemacht worden, seine Rolle in der Diktatur haben die Gerichte ignoriert. Dabei hatten Staatsanwälte insgesamt dreißig Ermittlungsverfahren gegen Mielke eingeleitet. Ihre Akten hat der Berliner Historiker Klaus Bästlein in dem Buch «Der Fall Mielke» ausgewertet. Die Dokumentation zeigt eindrucksvoll, welchen wertvollen Beitrag die Strafverfolgungsbehörden zur Aufklärung totalitärer Vergangenheit leisten können. Der Autor hat die einzelnen Ermittlungskomplexe folgendermaßen zusammengefasst: stalinistische Verfolgungen von KPD-Politikern, stalinistische Verfolgungen von SED- bzw. DDR-Politikern, stalinistische Verfolgungen von Verurteilten sowjetischer Militärtribunale, Entführungen aus West-Berlin, Verfolgung von «Verrätern», Einflussnahmen auf die Justiz, Korruption und «Sonderversorgung» sowie Sonstiges.
Mielke ist einmal als «Trivialausgabe»51